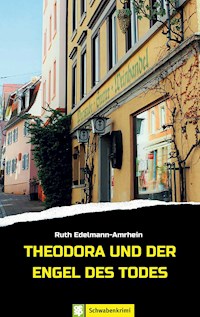Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel + Spörer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Geheimnisse eines toten Richters, ein altes Tagebuch und ein unaufgeklärter Mord vor mehr als 40 Jahren beschäftigen Theodora Klein und ihren Assistenten Georg Eisele in ihrem zweiten gemeinsamen Mordfall. Dieser führt sie über die Grenzen der Landeshauptstadt Stuttgart hinaus auf die Schwäbische Alb ins geheimnisvoll schöne Lautertal. Während ein tragisches Ereignis Theodora Klein aus den Ermittlungen reißt, verschwindet Georg Eisele spurlos. Zurück bleibt sein verbranntes Auto und eine verkohlte Leiche. Doch wo ist Georg Eisele und wer ist dieser Tote?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autorin
Nachdem sie schon immer viel gelesen hatte, fand die gelernte Bankkauffrau erst in ihrer zweiten Lebenshälfte Zeit und Muße, selbst zu schreiben. Im Jahr 2017 schloss sie sich den Mörderischen Schwestern e. V. an. Nach der Publikation diverser Kurzkrimis wurde im Jahr 2021 ihr erster Roman mit dem ungleichen Ermittlerteam Theodora Klein und Georg Eisele veröffentlicht. Es erfüllt sie, mit ihren Geschichten Menschen zu unterhalten und zu berühren, ganz besonders bei Lesungen, im direkten Kontakt mit dem Publikum.Zusammen mit ihrem Mann lebt die Mutter zweier erwachsener Söhne in Württembergs Mitte, im schönen Aichtal.
Ruth Edelmann-Amrhein
Theodora und der Tod des Richters
Krimi
Oertel+Spörer
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel + Spörer Verlags-GmbH + Co. KG 2023
Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen
Alle Rechte vorbehaltenTitelbild: © dreamstimeGestaltung: PMP Agentur für Kommunikation, Reutlingen
Lektorat: Bernd Weiler
Korrektorat: Sabine Tochtermann
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-96555-155-8
Besuchen Sie unsere Homepage und informierenSie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:www.oertel-spoerer.de
Für meinen MannWerner Amrhein
1948
Erschöpft ließ sie sich in die Kissen sinken. Die nassen Haare klebten an ihrer Stirn und sie lechzte nach einem kühlen Schluck Wasser. Neun Monate hatte der Wurm in ihr gewohnt, hatte ihre Figur ruiniert, ihre Taille zur Geschichte werden lassen. Dieses Geschöpf, empfangen nach einer gewalttätigen Nacht, hatte es ihr unmöglich gemacht, weiterhin auf dem Rücken ihrer geliebten Pferde durch den Forst zu reiten. Seit Monaten vermisste sie den Geruch des feuchten Waldbodens nach einem lang ersehnten Regen. Wenn sich die Erde vollsog wie ein dürstender Schwamm. Sie liebte den Wald und all seine Geheimnisse, das Sonnenlicht zwischen den Zweigen, die geheimnisvollen Schatten. Sie seufzte bei dem Gedanken an den unverwechselbaren Geruch, wenn im Herbst die Pilze aus dem Unterholz sprossen. Das alles würde sie jetzt bald wieder erleben. Jetzt, wo das Balg endlich da war. Die Hebamme hatte das schreiende Bündel hinausgetragen. Zwölf Stunden hatte es ihr das Dasein zur Hölle gemacht. Zwölf Stunden, in denen sich der Schmerz bis zur Besinnungslosigkeit gesteigert hatte. Nun hörte sie es aus der Ferne schreien. Niemals würde sie es lieben können. Ebenso wenig wie sie seinen Vater jemals lieben würde. Wie hatte es passieren können, dass sie sich diesem Mann an den Hals geworfen hatte. Diese Frage hatte sie sich in den vergangenen Monaten immer und immer wieder gestellt. War es sein Geld gewesen, das sie so beeindruckt hatte? Er besaß ein großes Sägewerk auf der Schwäbischen Alb in der Nähe des Haupt- und Landgestüts Marbach. Dort, im Gestüt, hatten sie sich kennengelernt. Sie war auf der Suche nach einem Reitpferd. Er war auf der Suche nach einem Schwarzwälder Kaltblut, einem Arbeitspferd für die Waldarbeit gewesen. Sie hatte ihm ein paar Tipps gegeben, so waren sie miteinander ins Gespräch gekommen. Sie kannte sich aus in der Pferdezucht, war leidenschaftliche Reiterin. Er war ein leidenschaftlicher Jäger. Sie hatten sich lange unterhalten, schon am ersten Abend. Über die Pferde und über die Jagd. So hatte alles angefangen. Er hatte sie umworben, ihr eines dieser wunderbaren Trakehner Pferde in Aussicht gestellt, und sie, sie hatte sich an ihn verkauft. Damals war ihr noch nicht klar gewesen, dass es ihm bei der Jagd nur um eines gegangen war. Um das Töten! Schon bald nachdem sie geheiratet hatten, hatte er ihr sein wahres Gesicht offenbart. Nun hatte sie ihm ein Kind geboren. Seine Tochter. Nun würde sie gehen. Zurück zu ihren Eltern. Die Pferde würde sie mitnehmen. Er hatte seine Jagd. Seine Trophäen und jetzt auch seine Tochter …
FÜNFUNDSECHZIG JAHRE SPÄTER
Ein monotones Geräusch drang langsam in ihr Unterbewusstsein. Ein leises Brummen und Summen, dem schon bald ein helles Gluckern folgen würde. Sie hielt die Augen geschlossen. Sie brauchte keine Uhr, um zu wissen, dass es fünf Uhr in der Frühe war. Langsam setzte sich die Heizung in Gang. Vor halb acht würde es draußen nicht hell werden, nicht im November. Sie fror. Wie damals, als sie über die schneebedeckte Wiese zurück in ihr Zimmer geschlichen war und sich unter ihrem Deckbett verborgen gehalten hatte. Länger als sechzig Jahre war das her. Fast war es ihr gelungen,den Schleier des Vergessens endlich darüber auszubreiten. Doch dann war sie ihm begegnet und alles war wieder da. Er hatte sie angesehen mit seinen eisblauen Augen. Den Augen eines Huskys. Diese Augen hatte sie nie vergessen. Doch damals, im Gerichtssaal, vor mehr als vierzig Jahren, damals hatten diese Augen nicht sie im Visier gehabt. Zum Glück nicht. Diese Augen hatten in einem anderen den Täter gesehen und dafür gesorgt, dass dieser hinter Gitter gekommen war. Sein Irrtum war ihre Rettung gewesen. Und der Tod des Unschuldigen. Und nun? Er hatte sie erkannt, dessen war sie sich sicher. Sie drehte sich um, fand keine Ruhe mehr. Langsam wurde es warm in dem Raum. Sie stand auf und schlüpfte in ihre Hausschuhe. Trat ans Fenster und blickte hinaus in die Dunkelheit. Sie hatte gemordet. Damals. Und heute. Das Damals hatte sie verdrängt. Nie hatte sie sich auch nur im Geringsten schuldig gefühlt. Im Gegenteil. Sie hatte den Menschen getötet, der sie gequält hatte. Nach seinem Tod hatte sie sich unendlich stark gefühlt. Befreit, von den Schatten der Vergangenheit, die allmählich zu verblassen begannen. Durch seinen Tod hatte sie auch ihren inneren Peiniger zu Fall gebracht. Hätte sie es damals nicht getan, wer weiß, ob sie überlebt hätte. Als er sie das erste Mal mit der Peitsche geschlagen hatte, waren die Narben auf ihrem Rücken aufgeplatzt. Narben, die sie Jahre zuvor nach Schlägen davongetragen hatte, die nie verheilt waren. Verletzungen, die in ihrer Seele brannten. Damals hatte sie richtig gehandelt. Und das Heute zwang sie dazu, es wieder zu tun. Sie musste verhindern, dass sie jetzt, ein ganzes Leben später, dafür zu Rechenschaft gezogen wurde. Den ersten Schritt hatte sie bereits getan. Es war nur eine Frage der Zeit, bis zu seinem letzten Atemzug. Auch für den anderen hatte sie eine Lösung gefunden. Sie wusste, wie sie es anstellen würde. Der geeignete Moment würde kommen, dessen war sie sich sicher.
EINS – SONNTAG
Wo die nur alle wieder bleiben«, sagte Schwester Sandra und knallte die Kaffeetassen auf den Teewagen.
»Jeden Sonntag ist es das gleiche«, maulte sie weiter und schob den Wagen aus der Küche.
»Was heißt hier jeden Sonntag, es ist jeden Tag das gleiche«, antwortete Schwester Inge gelassen und schnitt in aller Ruhe gleichmäßige Stücke von einem Hefezopf, die sie anschließend auf den Tellern platzierte. Der Duft von frischem Kaffee und Kamillentee lag in der Luft.
»Hast du die Kerzen in die Teelichter gegeben?«, fragte sie Sandra, die lustlos die Tassen auf den Tischen verteilte. Der erste Advent war zwar erst in einer Woche, doch sie hatten bereits jetzt einige Tannenzweige in Vasen drapiert und diese mit kleinen Strohengeln geschmückt.
»Ja, klar doch«, antwortete Sandra gereizt und fuhr fort, nun die lieblos zusammengefalteten Papierservietten neben die jeweiligen Kuchenteller zu legen.
»Frau Maier braucht eine Schnabeltasse«, erinnerte sie Inge, doch Sandra hörte sie nicht. Sie hatte bereits wieder den Knopf in ihrem Ohr, aus dem Heavy Metall dröhnte. Inge schüttelte den Kopf. Dieses junge Ding. Was hatte sie sich dabei gedacht, als sie sich für diese Ausbildung entschieden hatte. Sandra war ganz und gar empathielos, ungeduldig mit den alten Leuten, unfreundlich und – was noch schlimmer war – unzuverlässig. Wie oft schon hatte sie Medikamente verwechselt, oder gar vergessen, sie den alten Herrschaften zu verabreichen. Zum Glück hatte Inge Schwester Sandra von Anfang an im Auge gehabt und dadurch bisher Schlimmeres verhindern können. Gegenüber Sandra war der junge Türke, der seit einigen Wochen hier nach einer Bewährungsstrafe seinen sozialen Dienst leistete, ein wahrer Lichtblick. Er war ein kräftiger Junge, der nach anfänglichen Schwierigkeiten, die vor allem seinem schlechten Deutsch geschuldet waren, schnell seine Scheu verloren hatte und inzwischen eine wirkliche Bereicherung im Stift Himmelruh darstellte. Nicht nur der alte Wichrowsky hatte einen Narren an ihm gefressen, auch Oberstudienrätin Kraushaar hatte ihn schnell in ihr Herz geschlossen und jede Gelegenheit genutzt, mit ihm an seiner Sprache zu feilen. Zunächst hatten sie alle gelacht, als er sich mit seinem Namen vorgestellt hatte. Murat Kächele. Inge erinnerte sich noch gut an das Gelächter der alten Leute. Murat war der Sohn eines Schwaben und einer türkischen Mutter, die den Fehler gemacht hatte, nach dem frühen Tod ihres Mannes mit Murat überwiegend in ihrer Muttersprache zu reden. Murat hatte vor einigen Monaten eine alte Frau in ihrer Wohnung überfallen und niedergeschlagen. Er hatte sich selbst gestellt, was sich strafmildernd ausgewirkt hatte, doch um die Sozialstunden war er nicht herumgekommen. Umso verwunderlicher war es, dass er gerade zu der alten Oberstudienrätin, die allgemein als Zicke galt, eine solche Zuneigung entwickelt hatte. Heute hatte er frei, was schade war, viel lieber hätte sie den Nachmittag mit ihm gestaltet als mit Sandra, dieser Kratzbürste.
»Könne Sie ned besser aufpassen?«, riss die brüchige Stimme Frau Gottliebs Inge aus ihren Gedanken.
»Sie sollen halt Ihre Füß auch auf dem Brett stehen lassen, wenn ich Sie mit dem Rollstuhl durch die Pampa schieb!«, giftete Sandra zurück. Inge schüttelte den Kopf. Gewiss war es schwer, mit all den Marotten der Heimbewohner umzugehen, doch keiner wusste, wie er selbst einmal im Alter werden würde.
»Des wär dem Murat ned passiert!«, konterte Frau Gottlieb. »Der passt besser auf, und noch was«, fuhr sie unbeirrt fort »ich will heut beim Herrn Wichrowsky sitzen.«
»A Altersheim isch koi Wunschkonzert. Sie hocket da, wo sie immer hocket. Neben dem Herrn Wichrowsky hockt die Frau Klösterle, des wissed Sie ganz genau.«
Frau Gottlieb nahm ihre Füße vom Brett und stampfte wütend auf. »Ich will aber neben dem Herrn Wichrowsky hocka!«
»Ach lecked Sie mich doch am Socka!«, schnaubte Sandra und ließ Frau Gottliebs Rollstuhl mitten im Raum stehen.
»Was soll ich macha?«, schrie Frau Gottlieb. Doch Sandra hob die Hand und zeigte ihr nur den Stinkefinger.
»Habed Sie was an der Hand? Habed Sie sich verletzt?«, wollte Frau Gottlieb wissen, doch in dem Moment kam Frau Balthasar den Flur entlang. Wie immer, wenn sie konsterniert war, hatte sie beide Augenbrauen so weit nach oben gezogen, dass sie beinahe unter ihrem akkurat geschnitten grauen Pony verschwanden. Offensichtlich hatte sie die letzten Worte noch mitbekommen.
»Warten Sie, Frau Gottlieb«, sagte sie betont rücksichtsvoll, »ich nehme Sie mit an den Tisch.« Sie schob Frau Gottlieb an ihren gewohnten Platz, wand sich, ohne diese eines weiteren Blickes zu würdigen, ab, und ließ sich ihrerseits an ihrem Platz nieder. Inzwischen hatte sich der Saal gefüllt. Inge hatte das Licht gedimmt und die CD mit den Weihnachtsliedern in den CD-Player gelegt. Sie freute sich auf einen gemütlichen Nachmittag mit den alten Menschen, die ihr, bis auf wenige Ausnahmen, am Herzen lagen. Während es draußen stürmte, und Regen gegen die großen Scheiben des Speisesaals prasselten, verströmten die frischen Tannenzweige einen vorweihnachtlichen Duft. Wo nur Herr Wichrowsky blieb? Er hatte das Mittagessen vorzeitig verlassen. Es ginge ihm gut, hatte er gemeint, er wolle sich lediglich etwas früher hinlegen, um am Nachmittag frisch und ausgeruht zu sein. Dabei hatte er einen liebevollen Blick auf Frau Klösterle, den Neuzugang aus Zimmer Herbstzeitlose geworfen, die ihm am Tisch gegenübersaß.
»Wo bleibt denn der Herr Wichrowsky?«, klang es weinerlich von Frau Gottlieb.
Frau Balthasar räusperte sich herzhaft, zog die Augenbrauen noch weiter unter ihren Pony zurück und hob an, etwas zu sagen, doch ein anderer kam ihr zuvor:
»Habt Ihr denn alle ned gemerkt, dass die Klösterle au ned da ist? Ja was werded die jetzt wohl machen, ha? Ein Schäferstündle werded die abhalten, nix andres!«
Frau Gottlieb ließ klirrend die Kuchengabel fallen, dann wurde es still im Raum. Erst jetzt bemerkten es alle. Auch der Stuhl von Frau Klösterle war leer.
»Herr Klein!«, Schwester Inge sprang von ihrem Stuhl auf. »Was erlauben Sie sich!«
Dieser giftige alte Mann, der seit ein paar Wochen die ganze Station mit seinen Boshaftigkeiten aufmischte, hatte es gerade nötig, eine solche Äußerung zu tun. Keine der Schwestern mochte sich um ihn kümmern. Ständig prahlte er mit seiner Manneskraft, die sich offensichtlich nur noch in seinem Kopf abspielte, was ihn nicht davon abhielt, wann immer er die Möglichkeit dazu sah, den Schwestern an den Hintern zu fassen.
»Sie alter Luschtmolch«, ertönte da die Stimme Frau Gottliebs. »Der Herr Wichrowsky ist ein Tschentlemän. Der isch ned so ein alter Dackel wie Sie, der dene arme Schwestern dauernd uff den Hintern klopft.«
»Was haben die gsagt?«, fragte eine andere Dame, deren Hörgerät seit einigen Tagen beim Akustiker zur Reparatur lag.
»Nix«, schrie ihr Inge ins Ohr, »nur die Wahrheit!«
Sie griff zur Kaffeekanne, um den Herrschaften einzuschenken, als aus dem Zimmer von Herrn Wichrowsky ein spitzer Schrei erklang. Gleich darauf erschien Frau Klösterle auf dem Flur.
»Tot«, sagte sie tonlos. »Kommen Sie schnell! Ich glaube, der Rudolf ist tot!«
Haben Sie keinen Hunger?«
Theodora hielt die Augen geschlossen. Sich Totstellen schien ihr der einzige Ausweg zu sein, einer Unterhaltung mit der Frau, die kauend neben ihr saß, zu entgehen. Als sie vor einer Stunde in Nürnberg in diesen verdammten Zug eingestiegen war, hatte sich dieser wandelnde Futtertrog neben ihr niedergelassen. Sie hatte einen Korb zwischen sich und Theodora auf die Sitzbank gestellt und sofort damit begonnen, an ihr leibliches Wohl zu denken. Theodora hatte die Augen zugemacht, um einem Gespräch mit ihr aus dem Weg zu gehen. Zunächst hatte der Verschluss einer Dose geknallt, kurz darauf rann das Getränk, was auch immer es sein mochte, ihrer Sitznachbarin geräuschvoll durch die Kehle. Diesen Vorgang begleitete diese mit wohligem Grunzen und schloss ihn mit einem kleinen, aber unüberhörbaren Rülpser, ab. Einen Herzschlag später begann sie in ihrem Korb zu kramen und beförderte – dem Geruch nach – ein mit Leberwurst bestrichenes Brot zutage. Bereits jetzt formierten sich Fluchtgedanken in Theodoras Kopf, doch zunächst stellte sie sich weiterhin schlafend. Irgendwann einmal musste jeder Mensch satt sein, vielleicht sogar ihre Sitznachbarin.
Dabei hatte sich die Rückfahrt von der Ostsee zunächst so gut angelassen. Bis Rostock hatte sie vollkommen alleine im Abteil gesessen und es genossen, in aller Ruhe die vergangenen vier Wochen vor ihrem inneren Auge Revue passieren zu lassen. So vieles war geschehen, in dieser Zeit, so vieles, was sie noch nicht einsortieren konnte. Nach der Sache mit Gabriele Engel hatte nicht nur Kriminaloberrat Rüdiger Hummel darauf gedrängt, dass sie eine Auszeit nahm, auch der Polizeipsychologe hatte es für unerlässlich gehalten und so hatte sie sich kurz entschlossen für einen Aufenthalt an der Ostsee entschieden. Möglichst weit weg von allem, was zu ihrem Leben und ihrem Alltag gehörte. Ganz vorn rangierte in dieser Liste ihr Vater. Das Problem seiner weiteren Behandlung und der damit verbundenen Unterbringung in einem Heim war nur aufgeschoben. Dieses »Projekt« würde sie als Erstes angehen müssen. Wie sich das Verhältnis zu ihrem Kollegen Eisele entwickeln würde, musste die Zukunft zeigen. Immerhin hatte er versucht, ihr das Leben zu retten.
»Hallo, geht’s Ihnen nicht gut?«, jemand zupfte an Theodoras Ärmel. »Haben Sie denn gar keinen Hunger? Ich hätte da noch ein Käsebrötchen, das können Sie gerne haben!«
Theodora seufzte und öffnete die Augen. Die Frau biss gerade in ein frisch geschältes, hart gekochtes Ei, was den unangenehmen Geruch erklärte, den Theodora seit einigen Sekunden wahrgenommen hatte. Sie blickte in ein rundes Gesicht und in neugierige Augen, auf einen vollen Mund, in dessen Winkeln gelbe trockene Krümel hingen. Automatisch rückte Theodora ein Stück von ihr ab. Wenn sie jetzt noch ein Wort sagen würde, dann …
»Ach da sind Sie ja wieder. Sie haben also doch geschlafen?«
Sie hatte es gewusst! Es hatte gar nicht anders sein können! Eine Salve gelber Krümel landete auf Theodoras schwarzem Rollkragenpullover.
»Ja, ich habe tatsächlich geschlafen«, log Theodora, »und jetzt werden Sie verstehen, dass ich mir ein wenig die Füße vertrete.« Sie schälte sich aus dem Sitz, wuchtete ihren Koffer von der Ablage und verabschiedete sich. Die verbleibenden knapp zwei Stunden Fahrzeit würde sie überall verbringen, zur Not auf der Toilette. Keinesfalls wollte sie auch nur noch eine Sekunde länger neben dieser mampfenden Matrone sitzen. Theodoras Knie zitterten. Wie spät war es eigentlich? Sie blickte auf die Uhr und erschrak. Tatsächlich hatte sie seit dem Frühstück um halb fünf in der Frühe nichts mehr zu sich genommen. Vor 22 Uhr würde sie nicht in ihrer Wohnung sein und dort wurde sie lediglich von einem leeren Kühlschrank erwartet werden. Was also lag näher, als das Bordbistro aufzusuchen. Eine heiße Tasse Tee und ein warmes Gericht würden ihr jetzt guttun.
Außer einem jungen Paar, das sich ganz nach hinten im Wagen verdrückt hatte, war das Bistro leer. Theodora suchte sich einen Platz in der Nähe der Theke, behielt ihren Koffer im Auge und holte sich dann eine Kürbiscremesuppe mit Brot. Sie setzte sich und schaute gedankenverloren aus dem Fenster, während sie die lauwarme Suppe löffelte, die – mehr Brei als Suppe – etwas mehr Würze vertragen hätte. Lautlos glitt der Zug über die Schienen. Still war es auch im Bordbistro. Das junge Paar hatte eng umschlungen die Köpfe zusammengesteckt und beschäftigte sich mit einem Smartphone. Theodora legte den Löffel zurück in den Teller und schluckte den letzten Bissen des viel zu trockenen Brotes hinunter. Sie schaute aus dem Fenster. Bis vor wenigen Minuten noch war die Landschaft an ihr vorbeigeflogen, nun war die Dunkelheit hereingebrochen. Sie nahm das Teeglas von dem kleinen altmodischen Teller mit dem runden Untersetzer aus Papier. Unglaublich, dass in einem modernen Zug noch immer dieses altbackene Geschirr verwendet wurde. Oder war das inzwischen wieder modern? Der Tee war noch immer sehr heiß. Vorsichtig trank sie in kleinen Schlucken. Interessiert hielt sie dabei den Blick auf das Fenster ihr gegenüber gerichtet. In der Scheibe spiegelte sich eine Frau in schwarzem Rollkragenpullover. Um den Hals geschlungen hatte sie einen grünen flauschigen Schal, die roten Locken fielen ihr locker über die Schultern. In den Ohren trug sie große silberne Scheiben, in deren Mitte ein tiefvioletter Amethyst thronte. Theodora stellte das inzwischen leere Glas zurück auf den Unterteller und schloss die Augen. Sie dachte zurück an den Moment, der ihr ganzes bisheriges Leben veränderte. Es war in der ersten Woche ihres Aufenthaltes gewesen. Schon vor dem Frühstück hatte sie sich aufgemacht, um die Gegend rund um das Hotel zu erkunden. Der kühle Seewind trug einen süßlichen Duft nach Weihrauch und Patschuli zu ihr herüber. Sie war diesem Duft gefolgt und nahm bereits nach wenigen Schritten in der Ferne einen bunten Jahrmarktswagen wahr. Auf einem Ständer wehten bunte Tücher im Wind.
»Darf es noch etwas sein?«
Die Stimme des Servicemitarbeiters riss Theodora aus ihren Gedanken.
»Nein, vielen Dank«, erwiderte sie, doch der junge Mann hatte sich bereits abgewandt. Beim Gedanken an die mampfende Matrone entschied sich Theodora, den Rest der Fahrt einfach im Bistro sitzen zu bleiben. Noch immer waren das junge Paar, das zwischendurch leise gekichert hatte, und sie, die einzigen Gäste im Bistro. Erneut betrachtete sie ihr Spiegelbild im Fenster des durch die Dunkelheit gleitenden Zuges. Sie sah eine Frau, die sich in einer weichen Bewegung eine Strähne aus dem Gesicht strich. Aus einem Gesicht, das bis vor wenigen Wochen noch kantig gewesen war. Nun war es voller geworden. Sie lächelte. Nie hätte sie damit gerechnet, dass ausgerechnet ihr so etwas passieren würde, doch es war geschehen. Sie hatte sich verliebt. Theodora lehnte sich im Sitz zurück. Das Schaukeln des Zuges versetzte sie in einen meditativen Zustand. Mechanisch griff sie zu ihrem Ohr, fühlte das kühle Metall. Damit hatte alles begonnen, mit diesen Ohrringen.
»Nimm sie! Sie stehen dir ganz ausgezeichnet«, hatte sie eine Stimme hinter sich vernommen, als sie sich am Stand des Inders in einem Handspiegel betrachtete. Sie hatte sich umgedreht und in ein paar eisblaue Augen geblickt. Diese Augen, um die sich kleine, wettergegerbte Lachfalten abzeichneten, waren voller Wärme gewesen.
»Also ich würde da nicht lang zögern. Wirklich, nimm sie, sie haben nur auf dich gewartet«, war er fortgefahren und es hatte sie nicht im Geringsten gestört, dass er sie vertraulich geduzt hatte. Spontan drückte sie dem Händler 80 Euro in die Hand und behielt die Ohrringe gleich an.
»Der Amethyst ist ein ganz besonderer Heilstein«, hatte er begonnen zu erklären und ihr damit ein Lachen entlockt. »Warum lachst du?«, hatte er irritiert gefragt, um gleich darauf fortzufahren: »Der Amethyst vertreibt die schlechten Gedanken«, weiter war er nicht gekommen.
»Der Name des Edelsteins ist aus dem Griechischen abgeleitet«, war sie ihm ins Wort gefallen. »Amethyst bedeutet, dem Rausch entgegenwirkend.«
Nun war er es, der lachte. »Du willst also damit andeuten, dass sich die Wirkung von Alkohol für die Träger eines Amethysten reduziert?«, die kleinen Fältchen um seine Augen wurden tiefer und Theodora überkam ein Gefühl in der Magengrube, das sie seit ihrem sechzehnten Lebensjahr nicht mehr gespürt hatte.
»Genauso ist es«, hatte sie ihm zugestimmt. »Außerdem wird dem Amethyst eine vielseitige Heilwirkung nachgesagt. Ich bin eine große Anhängerin der Schriften Hildegard von Bingens, falls du weißt, wen ich meine?«
»Oh ja, ich weiß, wer Hildegard von Bingen war. Aber du weißt auch, dass es keine Zufälle gibt?«, hatte er mit ruhiger Stimme gesagt und die Lachfältchen um seine Augen hatten sich geglättet. »Gleich hinter dem Hotel ist eine kleine griechische Taverne, das Poseidon. Sagen wir um halb acht?«
Sie hatte nur genickt und die Schmetterlinge in ihrem Inneren still gebeten, sie nicht zu verraten. Theodora Klein in einem solchen Zustand war etwas, was nicht sein durfte. Dennoch war dies der Anfang von vier wunderbar erfüllten Wochen gewesen, denn ab diesem Abend war ihr Amadeus nicht mehr von der Seite gewichen, bis zum Ende ihres Aufenthaltes.
In ihrer letzten Nacht hatte sie sich aus dem Bett geschlichen. Immer wieder hatte sie Amadeus Atemzügen gelauscht, doch er hatte tief und fest geschlafen, fast wie ein Kind. Sie hatte sich ein Blatt Papier genommen und begonnen zu schreiben. Zunächst musste sie den Stift immer wieder absetzen, zu viel wollte aus ihr heraus, zu vieles, was sie zuerst für sich selbst ordnen und sortieren musste, doch dann, als der Morgen dämmerte, hatte sie es zu Papier gebracht. Alles, was sie bewegte. Amadeus hatte die Kälte in ihren Inneren verscheucht. Was niemand je gelungen war, hatte er geschafft. Durch seine Liebe war es ihr endlich gelungen, sich selbst anzunehmen, ja sogar sich selbst zu mögen. Dafür dankte sie ihm. Sie schrieb ihm, wie sehr sie sich auf die Zukunft freute, vielleicht sogar auf eine gemeinsame Zukunft mit ihm. Sie schloss mit den Worten in Liebe Theodora und schüttelte dabei lächelnd mit dem Kopf. So ganz geheuer war ihr die neue Theodora doch noch nicht, doch sie gefiel ihr. Dann hatte sie den Brief zusammengefaltet und ihn heimlich in die Seitentasche des Anoraks gesteckt, der am Garderobenhaken hing. Sie hoffte, Amadeus würde ihn erst finden, wenn sie im Zug säße.
Ein Geräusch riss Theodora aus ihren Gedanken. Es war der Ton, den ihr Handy verursachte, wenn sie eine WhatsApp erhielt. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Sie warf einen letzten Blick auf ihr Spiegelbild, bevor sie in ihre Umhängetasche griff und nach ihrem Handy fischte. Ein lila Punkt hüpfte über die Oberfläche. Tatsächlich. Eine WhatsApp-Nachricht. Das konnte nur Amadeus sein. Sicher hatte er soeben den Brief entdeckt. Voller Freude öffnete sie das Dialogfeld und las:
»Hallo Theo, wann kommst du an? Muss dringend mit dir reden. Bitte melde dich. Komm einfach hoch. Habe gekocht. Gruß Aylin.«
Enttäuscht ließ Theodora die Hände in den Schoß sinken. Wie schade. Nur Aylin. Was sie wohl wieder mit ihr bequatschen wollte? Ganz sicher hatte Murat wieder irgendetwas ausgefressen. Sie seufzte. Noch einmal versuchte sie, sich zurück zu träumen, in die Zeit, die sie mit Amadeus, dem Klangschalentherapeuten, verbracht hatte. Zu den Abenden, an denen sie ihm die Tarotkarten gelegt hatte, und an die Nacht, in der sie, nach dem Genuss eines starken Joints, in seinem Bett gelandet war. Dies war die erste, aber nicht die letzte Nacht gewesen. Sie, die enthaltsame Kriminalkommissarin Theodora Klein, hatte vollkommen den Verstand verloren.
»Haben Sie wirklich keinen Wunsch mehr? Ich würde sonst schließen?«, der Kellner des Bordbistros sah sie erneut fragend an. Theodora schüttelte stumm mit dem Kopf. Ob sie wollte oder nicht, sie musste zurück an ihren Platz im Abteil. Schon von Weitem hörte sie die Matrone schnarchen. Offenbar hielt sie einen Verdauungsschlaf.
Noch zwei Stunden Fahrzeit und die Realität hatte sie endgültig wieder.
Wie oft mussten Sie diese Kerze in diesem Jahr schon anzünden?« Dr. Schnabel warf seinen Mantel und seine Aktenmappe auf einen Stuhl. Wie immer, wenn ein Bewohner verstorben war, hatte Inge die Totenkerze auf dem Sideboard angezündet, die nun still in einem Windlichtglas vor sich hin flackerte. Sie und Dr. Schnabel waren inzwischen ein eingespieltes Team, wenn es darum ging, einen Totenschein auszustellen.
»Das wissen Sie doch, Dr. Schnabel. Herr Wichrowsky ist der zwölfte Tote in diesem Jahr. Jeden Monat haben wir einen Menschen hier verloren. Ich räum die Kerze gar nicht erst weg, ich leg sie inzwischen nur noch oben in die Schublade, damit sie jeder gleich findet, für den Fall, dass ich vielleicht ausnahmsweise mal gerade keinen Dienst haben sollte, wenn jemand stirbt.«
»Das klingt bitter, liebe Inge, aber es ist ein schönes Ritual …«
»Das klingt nicht nur bitter, das ist bitter! Und das ist nicht der einzige Wermutstropfen. Sie wissen so gut wie ich, dass wir hier im Heim chronisch unterbesetzt sind. Und mit Sandra – na ja, Sie wissen ja – der einzige Lichtblick in meinem Team ist, sie werden es nicht glauben, Murat, der junge Türke. Der hat das Herz am rechten Fleck, leider weiß er das bis jetzt selbst noch nicht. Ich musste Sandra heute Nachmittag nach Hause schicken. Stellen Sie sich vor, sie ist fast durchgedreht, als wir den toten Herrn Wichrowsky gefunden haben. Er war wohl der erste Tote, den sie gesehen hat. Aber er wird ganz sicher nicht der letzte bleiben. Wenn sie tatsächlich in diesem Beruf bleiben will, für den sie sich meiner Meinung nach überhaupt nicht eignet, dann …«
»Inge …«, unterbrach Dr. Schnabel ihren Redefluss und blickte demonstrativ auf seine Armbanduhr. »Meinen Sie, wir könnten uns jetzt ein bisschen beeilen? Die Sportsendungen heute … ich meine … die Ergebnisse der Fußballspiele vom Wochenende …«
»Ja, ja, wir gehen schon. Kommen Sie.«
»Herr Doktor!«, erklang es in dem Moment schrill aus einem Zimmer am Ende des Korridors.
»Frau Balthasar! Ich glaube, wir müssen vorher noch einen Umweg über Zimmer Heckenrose machen«, flüsterte Schwester Inge und verdrehte die Augen. Dr. Schnabel folgte ihr widerwillig.
»Herr Doktor«, klang es weinerlich aus dem Zimmer, dessen Tür nur angelehnt war. Dr. Schnabel klopfte und trat ein, Inge folgte ihm.
»Mein Herz! Es rast so! Herr Doktor, die Aufregung …«, Frau Balthasar hing in ihrem Ohrensessel wie ein schlaffer Pflanzenstängel, die Hände hielt sie auf ihr Herz gepresst.
»Bitte geben Sie mir etwas zur Beruhigung, ich kann keine Aufregungen mehr ertragen in meinem Alter«, schluchzte sie. »Der arme Mann, er war eine solche Bereicherung, hier, unter all den, na ja, Sie wissen schon.«
Weiter kam sie nicht. Dr. Schnabel hatte bereits seine Tasche abgestellt und eine Spritze hervorgezogen. Eine Leiche reichte am Sonntag um diese Uhrzeit. Immerhin war der alte Wichrowsky schon der zweite Tote in diesem Monat, der so kurz vor der Sportschau verstorben war, als ob es nicht auch noch andere Wochentage oder Tageszeiten zum Sterben gab. Beim Anblick der Spritze erschrak die alte Dame. Mit einem Ruck setzte sie sich gerade.
»Nein, du lieber Himmel, keine Spritze, damit machen Sie alles nur noch schlimmer. Ich verliere schon beim Anblick von diesen Dingern das Bewusstsein.«
Neugierig starrte sie in den geöffneten Koffer. »Haben Sie denn keine Tabletten dabei für solche Fälle?«, fuhr sie fort und zeigte auf eine Tablettenschachtel. Dr. Schnabel öffnete einen Moment den Mund, um ihn sofort darauf wieder zu schließen. Er hatte absolut keinen Nerv, sich mit dieser alten Schachtel auf eine Diskussion einzulassen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und dieser besonderen Umstände griff Dr. Schnabel gerne in seinen Arztkoffer und reichte Frau Balthasar ein Päckchen mit Tabletten.
»Nur eine heute Abend, und wenn es gar nicht anders geht, noch eine in der Nacht«, ermahnte er.
»Sie sind gut! Mehr als zwei Tabletten sind da sowieso nicht mehr drin«, bäffte ihm Frau Balthasar entrüstet nach.
»Jetzt isses aber gut«, schnaubte Inge und zog die Tür von Zimmer Heckenrose hinter sich ins Schloss.
Dr. Schnabel war bereits vorausgeeilt, jedoch vor dem Zimmer von Herrn Wichrowsky stehen geblieben. Behutsam, als könne sie noch jemanden erschrecken, öffnete Inge die Tür. Sie betrachtete den Verstorbenen, dessen Präsenz selbst im Tod noch immer gewaltig war, mit Respekt. Tatsächlich war Herr Wichrowsky ein besonderer Mensch gewesen. Höflich, klug und belesen, weit gereist, und auf eine gewisse Weise geheimnisumwittert. Eine Familie schien er nicht zu haben. Außer einem angeblichen Freund gab es niemanden in seinem Leben. Erst jetzt, am Ende seines Daseins, Frau Klösterle.
Friedlich lag er auf seinem Bett, ganz so, als ob er schliefe. Noch immer trug er das blau-weiß gestreifte Hemd und die rote Fliege mit Paisleymuster, die er bereits zum Mittagessen getragen hatte, dazu eine grüne Strickjacke und graue Flanellhosen. Seine mit Lammfell gefütterten Hausschuhe hatte er ordentlich auf seinem Bettvorleger abgestellt.
»Dann wollen wir mal«, sagte Dr. Schnabel und öffnete seinen Arztkoffer.
Vierzig Minuten später hatten Dr. Schnabel und Schwester Inge im Schwesternzimmer Platz genommen.
»Also, wie zu vermuten war«, Dr. Schnabel schraubte den Deckel seines Federhalters ab. »Der Mann ist an einer natürlichen Todesursache gestorben. Zum einen war er Diabetiker, zum anderen hat er bereits zwei Herzinfarkte überstanden. Ich gehe davon aus, dass er einen dritten, stummen Infarkt hatte. Dafür spricht auch die Tatsache, dass er am Nachmittag über leichte Übelkeit geklagt hat. Sie sagten doch so etwas?«
»Ja, ja, so was in der Art. Jedenfalls hat er sich früher als sonst hingelegt«, pflichtete Inge ihm rasch bei.
»Und seine Insulinspritze? Hat er die bekommen?«
»Ja, ganz sicher. Ich selbst habe die Medikamente bereitgestellt. Sandra hat sie dann verabreicht. Sie hat nichts Ungewöhnliches berichtet.«
»Na, dann hat ja alles seine Richtigkeit«, stellte Dr. Schnabel zufrieden fest und setzte seine Unterschrift auf den Totenschein. »Sie können jetzt den Bestatter informieren.«
»Das werde ich unverzüglich tun«, sagte Schwester Inge, während sie Dr. Schnabel, der nun noch rechtzeitig zu seinen Fußballergebnissen zu Hause sein würde, zur Tür begleitete.
Das vergilbte Blatt Papier, das der Luftzug unter das Bett des Verstorbenen geweht hatte, hatten sie beide übersehen.
Der Zug fuhr pünktlich um 22 Uhr auf dem, was vom Stuttgarter Hauptbahnhof übrig geblieben war, ein. Lustlos zog Theodora ihren Koffer hinter sich her zum Ausgang. Die jungen Leute, die vorhin noch so ruhig im Bordbistro gesessen hatten, drängelten sich an ihr vorbei und rempelten sie mit ihrem Rucksack an. Kopfschüttelnd ließ sie ihnen den Vortritt. Die heutige Jugend eben, kein Benehmen, ging es ihr durch den Sinn. Auch sie wollte nach dieser langen, ermüdenden Reise endlich zu Hause ankommen. Zunächst musste sie jedoch erst einmal einen endlosen Weg innerhalb des Bahnhofsgeländes zurücklegen. Wieder einmal fragte sie sich, wie es alten oder gehbehinderten Menschen gelang, solche unzumutbaren Entfernungen zu bewältigen. Die feuchte schwere Novemberluft kroch unaufhaltsam in ihre dicke lila Filzjacke. Kein Vergleich zu der guten, reinen Luft, mit der sie in den vergangenen Wochen ihre Lungen verwöhnen durfte. Der Mief der Großstadt hatte sie wieder. Endlich hatte sie den Ausgang erreicht. Von Weitem sah sie ein einsames Taxi am Taxistand. Der Fahrer ging vor dem Fahrzeug auf und ab und rauchte. Dann sah sie ihn winken. Er schnippte seine Zigarette auf den Boden, wo sie in einer Pfütze verglühte. Theodora beschleunigte ihre Schritte. Zu spät. Ein elegant gekleideter junger Mann kam angerannt und sprang sportlich in den Wagen, der Fahrer gab Gas. Theodora blieb nur der Blick auf die Rücklichter des Taxis. So ein Mist, zischte sie, doch die Hoffnung stirbt zuletzt, es wird doch wohl noch ein zweites Taxi geben in dieser verdammten Stadt …
Stimmt so«, sagte Theodora und drückte der jungen Frau zwei Scheine in die Hand. Tatsächlich war schon bald ein anderes Taxi erschienen und hatte sie sicher und schnell zu ihrer Wohnung in den Artusweg gebracht. Die junge Frau stieg aus und reichte ihr das Gepäck aus dem Kofferraum. Sie wünschte Theodora noch einen schönen Abend und fuhr davon. Theodora blieb einen Moment vor dem Haus stehen und blickte hinauf in den dritten Stock. Dort oben war noch Licht. Es war kurz vor 23 Uhr und sie wusste, Aylin wartete auf sie. Die Gartentür ließ ihr vertrautes Quietschen hören, als Theodora sie öffnete. Sie zog den Haustürschlüssel aus ihrer Manteltasche und schloss sachte auf. Der alte Vermieter, der im Erdgeschoss wohnte, hatte neuerdings einen leichten Schlaf. Seit der Geschichte mit Gabriele Engel war er zudem überaus misstrauisch und neugierig geworden. Ihm wollte sie auf keinen Fall begegnen. So leise wie möglich schlich sie auf Zehenspitzen nach oben in ihre Wohnung. Im Treppenhaus roch es vertraut nach Aylins türkischen Gewürzen und Theodora ahnte, was sie gekocht haben könnte. Sie stellte ihren Koffer ab und schloss die Wohnungstür auf. Abgestandene Luft schlug ihr entgegen. Sie verschloss die Tür hinter sich, zog ihre Jacke aus und warf sie auf den Garderobenständer. Dann knipste sie den Lichtschalter an und sah sich in ihrer Wohnung um. Alles sah genauso aus, wie sie es bei ihrer Abreise verlassen hatte, nur die Post lag, von Aylin fein säuberlich sortiert, auf dem afrikanischen Holztisch, dem Herzstück ihrer Wohnung. Theodora ging durch den Raum und öffnete das Fenster. Dabei fiel ihr Blick in die leere Ecke, in der früher Mephistos Käfig gestanden hatte. Wie hatte sie diese Ratte geliebt. Niemals würde sie für Ramses, die Schildkröte, die sie von Eisele geschenkt bekommen hatte, dieselbe Wärme empfinden können. Dieses harte Etwas, das seinen dürren Kopf sofort erschrocken einzog und unter seinem Panzer versteckte, wenn sie sich ihm nur näherte, war so ganz und gar kein Wesen nach ihrem Geschmack. Die kratzigen Geräusche, die die langen Krallen verursachten, wenn das Tier auf der Jagd nach einem Salatblatt über den gefliesten Küchenboden kroch, bescherten ihr ähnliches Unwohlsein, als wenn jemand Styropor zerriss. Sie mochte das Reptil nicht, weshalb sie es meist in ihrem Büro in der Dienststelle ließ. Eiseles Tierhaarallergie spielte bei einer Schildkröte keine Rolle, was auch der Grund war, dass er ihr ausgerechnet Ramses geschenkt hatte. Sie begann zu frösteln, schloss das Fenster und öffnete stattdessen den Kühlschrank. Wie zu befürchten war, gähnte sie Leere an. Einzig eine Bierdose lag unten im Gemüsefach. Noch nicht einmal an eine Flasche ihres geliebten Lembergers hatte sie gedacht. Ihr Magen knurrte. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und starrte auf das Display, in der Hoffnung, einen kleinen lila Punkt blinken zu sehen. Doch da war kein Punkt. Amadeus hatte ihr nicht geschrieben. Es half nichts, sie musste nach oben. Aylin wartete auf sie.
Kriminalassistent Georg Eisele nahm sich die Goldrandbrille von der Nase und legte sie auf einen Stapel Zeitschriften, die vor ihm auf dem Wohnzimmertisch lagen. Er saß im Halbdunkeln, unfähig, irgendetwas zu unternehmen. Er hatte Hunger. Er hatte Durst. Er fühlte sich allein. Chantal war nicht mehr da. Sie hatte den Roten Flamingo verlassen, um auf der Schwäbischen Alb auf dem Hof ihrer Eltern auszuhelfen. Ihre Mutter hatte ein künstliches Hüftgelenk bekommen und ihr Vater war bereits in einem Alter, in dem er schon länger darüber nachdachte, seinen Hof zu verkaufen. Abends und am Wochenende half sie zudem als Bedienung in einem Gasthaus aus. Eisele stand auf und ging zum Lichtschalter. Es hatte keinen Sinn, länger in der Dunkelheit zu sitzen und vergangenen Zeiten nachzutrauern. Chantal hatte die besten Kutteln gemacht, die er je gegessen hatte. Aber die Kutteln waren nicht das Einzige, was er vermisste. Außer Chantal hatte er keine Freunde, das war das eigentliche Drama. Er saß noch immer am Rosenbergplatz in der elterlichen Wohnung bei Mama und das, obwohl er sich geschworen hatte, sich endlich auf eigene Beine zu stellen mit seinen inzwischen 38 Lenzen. Er nahm wieder in dem Sessel Platz und blickte fassungslos auf die unzähligen Kleiderbügel, die seine Mutter entlang des Schranks gehängt hatte, und an deren Ende die absurdesten Stofffetzen baumelten. Es schien aussichtslos, zwar hatte sie sich nach dem Sturz während des Überfalls vor einigen Monaten von ihren Straußenfederpantoffeln verabschiedet, zu mehr Zugeständnissen war sie jedoch nicht fähig gewesen, erst recht nicht, nachdem sie eine für seine Meinung recht fragwürdige Eroberung gemacht hatte. Bei einem Konzert der Stuttgarter Philharmoniker in der Liederhalle war sie in der Pause im Foyer von einem Herrn angerempelt worden, der sie unverzüglich als Wiedergutmachung zu einem Glas Sekt eingeladen hatte. Eisele misstraute dem ältlichen Gigolo sofort, doch seine Mutter schwebte seitdem auf Wolke sieben. Wo sie nur wieder blieb. Eisele blickte auf seine Armbanduhr, stand auf und ging in die Küche. Tatsächlich herrschte im Kühlschrank die befürchtete Leere. In der Vorratskammer fand sich noch eine Dose Ravioli. Das Mindesthaltbarkeitsdatum war seit zwei Monaten abgelaufen, doch es hieß ja schließlich Mindesthaltbarkeitsdatum, also, warum sollte man da gleich eine Botulinum-Vergiftung befürchten. Wagemutig öffnete Eisele die Dose und schüttete den Inhalt in eine Keramikschüssel. Diese wiederum stellte er in den Mikrowellenherd. Zehn Minuten bei 800 Watt mussten reichen. Eisele schloss die Klappe des Gerätes und drückte den Startknopf. Dann ging er hinüber ins Badezimmer, um sich die Hände zu waschen, wie er es seit seiner Kindheit vor dem Essen zu tun pflegte. Er senkte den Kopf, während er die Flüssigseife zwischen seine Finger gleiten ließ. Diesen Anblick seines lichten Haars, andere nannten es bereits Glatze, konnte er jetzt nicht auch noch ertragen. Schon öfter hatte er darüber nachgedacht, sich ein Haartonikum zu kaufen und in die Kopfhaut einzumassieren in der Hoffnung, dadurch wenigstens noch ein paar Büschelchen hervorzubringen. Er griff zum Handtuch und trocknete sich ab. Als er sich umdrehte, fiel sein Blick auf einen Katalog, der auf der Waschmaschine lag. Eisele stockte der Atem. Das konnte nicht sein! Mutter! Er griff nach dem Katalog und ließ sich auf dem Rand der Badewanne nieder. Auf Seite 98 wurden diverse Liebesspielzeuge von lebensecht bis gefühlsecht in verschiedenen Farben und Größen für die selbstbewusste Frau sowie eine Venusmuschel für den liebebedürftigen Herren angeboten. Eisele war entsetzt. Angewidert warf er den Katalog zurück auf die Waschmaschine. Irgendetwas knallte. Er rannte in die Küche. Im Mikrowellenherd hatte es eine Explosion gegeben. Die Ravioli hingen überall, nur nicht mehr in der Schüssel. 800 Watt bei zehn Minuten waren wohl doch etwas zu viel gewesen. Eisele kratzte die wenigen essbaren Nudeln zusammen und ging mit dem Teller zurück ins Wohnzimmer. Morgen würde Theodora Klein ins Büro zurückkommen. Er hatte Bauchweh bei dem Gedanken an sie. Ihr Verhältnis hatte sich zwar in letzter Zeit etwas gebessert, erst recht, nachdem er ihr wenigstens beinahe das Leben gerettet hatte, doch er traute dem Frieden nicht. Schließlich war er Kriminalbeamter. Er nahm die Fernbedienung und schaltete das Erste ein. Florian Silbereisen sang gerade Versuch’s noch mal mit mir, als er sich an den heißen Ravioli den Mund verbrannte. Wütend knallte er den Teller auf den Tisch und machte den Fernseher aus. Er musste raus hier. So schnell wie möglich. Weshalb sollte er eigentlich nicht in den Roten Flamingo? Nur weil Chantal nicht mehr da war? Bei Rosi am Tresen gab es immer ein frisch gezapftes Pils für ihn und mit ihr würde er jetzt reden. Über Mutter! Er griff den Prospekt, steckte ihn in die Seitentasche seiner Jacke und verließ fluchtartig die Wohnung. Es war schon nach zehn und seine Mutter war noch immer nicht da!
Wie schön, dass du wieder da bist, komm rein!«
Aylin Kächeles Augen strahlten, als sie Theodora die Tür öffnete. Unaufgefordert zog Theodora ihre Schuhe aus und ging auf Strümpfen hinter Aylin ins Wohnzimmer.
»Hm, das riecht aber gut«, Theodora dachte an die Ebbe in ihrem Kühlschrank und freute sich auf das schmackhafte Essen, das sie bei Aylin erwartete. Mit einer Handbewegung wies ihr Aylin den Platz auf dem Sofa, den sie immer einnahm, wenn sie die Türkin besuchte.
»Ich habe uns eine Linsensuppe gekocht.« Aylin lachte. »Was magst du trinken?« Bevor Theodora antworten konnte, fuhr sie fort: »Ich dachte mir, da es heute so kalt ist und auch schon spät am Abend, mach ich uns heute mal etwas, was du bei mir noch nie bekommen hast.«
»Was soll das sein?«
»Ich mach uns einen Salep«, hörte sie Aylin aus der Küche rufen.
»Einen was? Einen Salep? Das habe ich ja noch nie gehört«, Theodora griff in ihre Jackentasche, holte ihr Handy hervor und legte es neben sich auf das Sofa. Ungeduldig fixierte sie das Display. »Also, was ist das, ein Salep?«, hakte sie nach.
»Das ist ein typisch türkisches Wintergetränk«, Aylin war zurück aus der Küche und stellte zwei Gläser auf den Tisch, in denen weiße, schaumige Flüssigkeit dampfte.
»Das sieht ja aus wie Latte macchiato.«
»Nur ganz knapp daneben. Mit der Milch hast du recht, aber probiere mal, da ist getrocknetes Orchideenpulver und Zimt drin. Das Rezept stammt ursprünglich aus der osmanischen Palastküche. Da wirst du später gut schlafen und träumen, du wärst im Himmel. Lass es dir schmecken!«
»Na, na, das Gesöff hat doch hoffentlich keine aphrodisierende Wirkung?«, Theodora grinste, während sie sich den Milchschaum von der Oberlippe leckte. Sie griff erneut zum Handy und starrte auf das Display.
»Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen, so viel Zimt ist dann auch wieder nicht drin! Aber sag mal, warum siehst du denn dauernd auf das Handy? Erwartest du eine Nachricht? Du kannst doch auf LAUT stellen, dann hörst du, wenn du eine Nachricht bekommst.«
»Was du nicht sagst.« Theodora seufzte. »Du hast ja recht, aber ich bin so, ich bin so …«
»Was bist du so?«
»Ach nichts, ich weiß auch nicht, ich bin …«
»Jetzt aber raus mit der Sprache. Wenn ich dich so ansehe …«
»Was ist, wenn du mich so ansiehst?«
»Wir haben ja heute Abend eine merkwürdige Art uns zu unterhalten, ehrlich. Also, wenn ich dich so ansehe, du siehst so anders aus. Fast so, als wärst du verliebt.«
Theodora schwieg.
»Jetzt sag schon. Bist du etwa verliebt?«
»Ja!«
»Was? Tatsächlich? Du bist verliebt? Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Entschuldige«, verhaspelte sich Aylin aufgeregt. »Aber das ist ja wunderbar! Das musst du mir erzählen.«
Theodora schluckte trocken. Sie konnte es Aylin nicht verdenken, schließlich hatte sie seit Jahren keinen Hehl daraus gemacht, dass ihr an einem Mannsbild nichts lag.
»Also, sein Name ist Amadeus und er ist Klangschalentherapeut …«, weiter kam Theodora nicht. Im Flur begann es zu poltern. Die Wohnungstür schlug zu. Elvis rannte unter dem Tisch hervor und begann zu bellen. Murat war nach Hause gekommen.
»Für heute hast du noch mal Glück gehabt. Aber du musst es mir unbedingt erzählen! Alles!«, flüsterte Aylin verschwörerisch, dann sprang sie auf und lief in den Flur, um ihren Sohn zu begrüßen. Nach einem kurzen Wortwechsel kam Murat ins Zimmer und setzte sich aufs Sofa.
»Wie geht es dir?«, brach Theodora das Schweigen.
»Gut«, antwortete Murat und starrte auf seine Füße.
»Magst du Theodora nicht erzählen, wie gut es dir in der Einrichtung gefällt, in der du gerade arbeitest?«
Aylin lächelte voller Stolz.
Murat zuckte mit den Schultern.
»Lass ihn doch«, beschwichtigte Theodora, »wenn er nicht will, kannst du ihn nicht dazu zwingen.«
Irgendwo begann etwas zu vibrieren. Murat vergrub seine Hand in der Tasche seiner Jeans und zog ein Handy hervor. »Hallo«, sagte er nur, dann weiteten sich seine Augen. Immer wieder schüttelte er mit dem Kopf, dann brüllte er »Fuck«, sprang auf und rannte nach draußen. Im Flur kickte er gegen den Schirmständer, der krachend umflog. Elvis, der Mops, rannte ins Wohnzimmer und verkroch sich unter dem Sofa.
»Fuck«, brüllte Murat noch einmal im Flur, dann fiel seine Zimmertür zu. Im selben Moment begann Heavy Metall aus seinem Zimmer zu dröhnen. Aylin hämmerte gegen Murats Zimmertür, doch er hatte sich eingeschlossen.
»Aylin, es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen, es ist schon spät.«
»Aber, aber, du hast doch noch gar nichts gegessen«, stammelte Aylin verwirrt und verzweifelt.
»Schon gut, die Milch hat mir gereicht, vielen Dank.«
Theodora schlüpfte in ihre Schuhe und eilte die Treppe hinab. Anscheinend war die Entwicklung, die Murat genommen hatte, weniger positiv, als Aylin es in den vergangenen Wochen geschildert hatte. Der Auftritt von heute Abend ließ nichts Gutes ahnen. Das Wabern der Bässe aus Murats Zimmer war bis ins Treppenhaus zu hören. Theodora schloss die Tür auf. Sie sah es sofort! Der Anrufbeantworter im Wohnzimmer blinkte. Mit zittrigen Händen drückte sie den Knopf. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie Amadeus geliebte Stimme hörte.
»Hallo mein wilder, roter Teufel, ich vermisse dich. Heute in einer Woche werde ich bei dir sein, gute Nacht und träume schön.«
Irritiert ging Theodora ins Badezimmer. Während sie ihre Zähne putzte, betrachtete sie ihr Spiegelbild. Gewiss, sie hatte rote Locken, doch mein wilder roter Teufel hatte Amadeus sie nie genannt.
»Wer weiß, was der heute Abend geraucht hat«, murmelte sie, während sie das Licht löschte. Verdammt, ich habe Ramses beiAylin vergessen, war das Letzte, an was sie dachte, bevor ihr die Augen zufielen.
Erschöpft betrat Eisele gegen 22.25 Uhr den Roten Flamingo. Seine Brille beschlug sofort, was seine schlechte Laune noch verstärkte. Den ganzen Weg über, den er zu Fuß und ohne Schirm zurückgelegt hatte, hatte es stark genieselt. Wie konnte er auch nur so blöd sein. Die erstaunlich vielen Menschen, die bei diesem Wetter noch unterwegs waren, hatten ihn irritiert und ihm seine Einsamkeit wieder einmal deutlich gemacht. Kaum einer war allein unterwegs gewesen.
Er lugte über den Rand seiner Brille und sah, dass die Bar bis auf einen Platz belegt war. Er wollte schon wieder gehen, als er Rosi seinen Namen rufen hörte.
»Georg, alter Junge, stattest du dem Roten Flamingo auch mal wieder einen Besuch ab? Na komm, dieser Hocker hat genau auf deinen Hintern gewartet.«
Rosi lachte ihr heiseres Lachen, und balancierte wie immer eine Zigarette im Mundwinkel. Noch immer halb blind tapste Georg in Richtung Tresen und kletterte umständlich auf den Barhocker.
»Ein schlankes Blondes, wie immer«, krächzte Uschi und reichte Eisele unaufgefordert das Bier. Eine dralle Brünette auf dem Hocker neben ihm musterte ihn aufdringlich. Er hatte sie hier noch nie gesehen und ihre Nähe war ihm unangenehm.
»Wie laankweilig, schalank und balond, wo du doch so was wie mich haben kannst«, raunte die Brünette in erstaunlich tiefer Stimmlage und rückte ein Stück näher an Eisele heran. Sie schlug ihre endlos langen Beine übereinander, die in schwindelerregend hohen roten Lackstiefeln steckten. Eisele schnürte es die Kehle zu. Es waren dieselben Stiefel, die Chantal immer getragen hatte. Sollten es etwa ihre Stiefel sein, die diese Person trug? Bis eben hatte er noch gefroren, nun wurde ihm erstaunlich warm.
»Wie kommt die dazu …?«, stammelte er und starrte auf das erotische Schuhwerk.
»Olga, Kundschaft«, zischte Uschi und blickte die Brünette scharf an.
»Ich habe verstanden«, maulte diese und schwang sich vom Hocker.
»Schätzchen, machste mir einen Whiskey, doppelt ohne Eis«, dröhnte es neben Eisele und eh er sich versah, hatte ein Herr mittleren Alters in stahlgrauem Seidenanzug neben ihm Platz genommen.
»Wat machstn du fürn Jesicht, Junge?«, fragte er und schlug Eisele auf die Schulter. »Uschi, gib dem Jungen ooch eenen, so wie der kiekt, kann der eenen jebrauchen.«
Uschi warf Eisele einen sorgenvollen Blick zu. »Der ist heute so neben der Spur, da kommts auf einen Whiskey auch nicht mehr an«, murmelte sie und füllte das Glas.
»Prost«, sagte der Seidenanzug und stieß mit Eisele an.