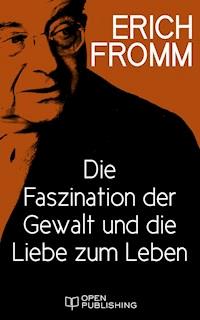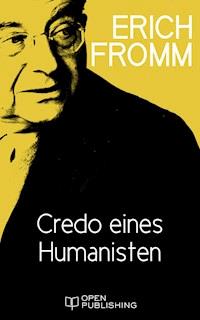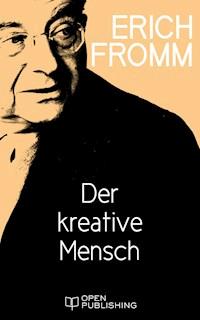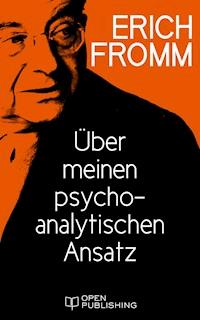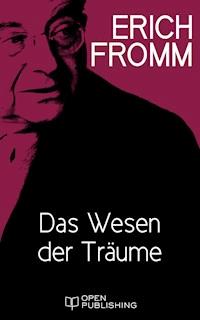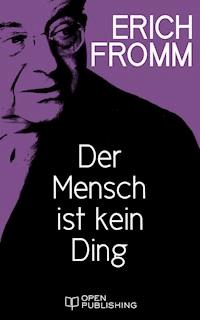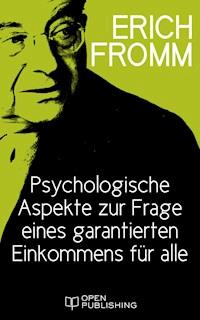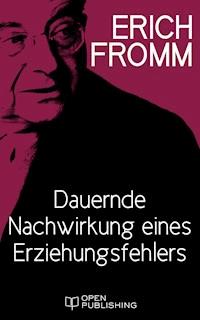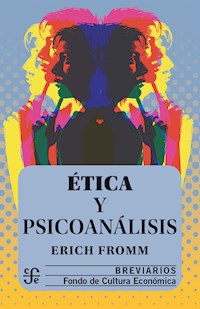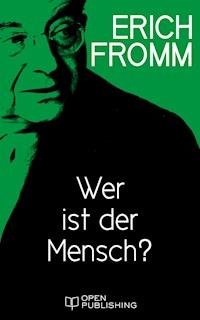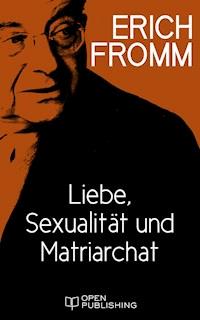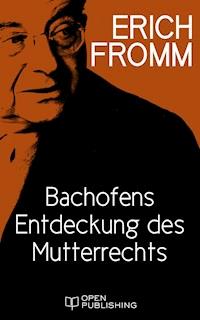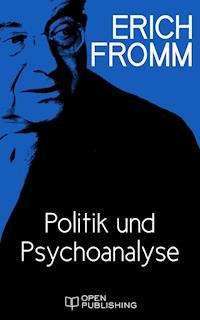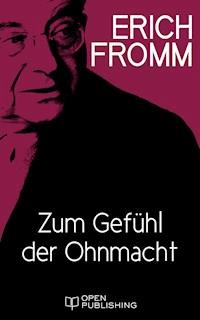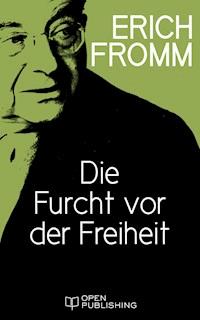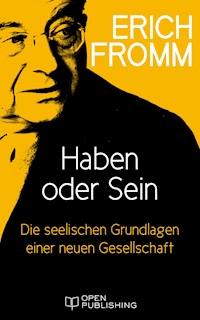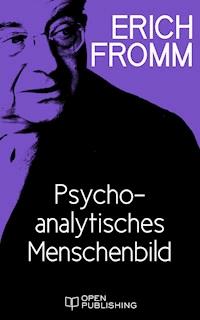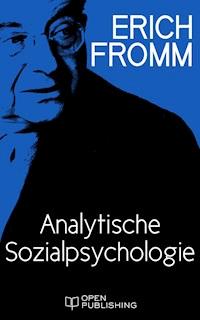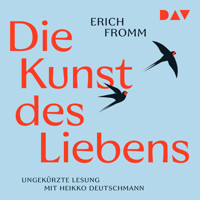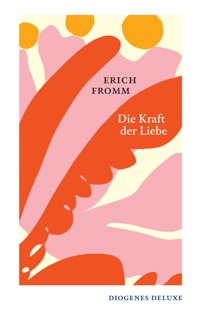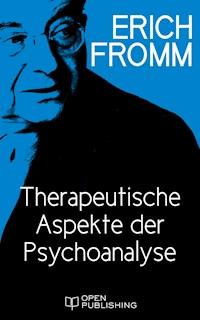
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Erich Fromm
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erich Fromm hat kaum etwas zur sogenannten therapeutischen „Technik“ publiziert. Umso wertvoller ist der nachgelassene Band ‚Von der Kunst des Zuhörens‘, der – aus dem Mitschnitt eines Vortrags und eines Seminars entstanden – zahlreiche Fragen der psychotherapeutischen Praxis erörtert. Die Beiträge dieses Buches geben nicht nur unmittelbar Auskunft über den praktizierenden Psychoanalytiker Fromm (wozu vor allem seine detaillierten Bemerkungen zu einem Fallbericht beitragen), sondern auch über die modernen Charakterneurosen und die speziellen Erfordernisse bei ihrer Behandlung. Für Fromm ist die Kunst des Therapierens eine Kunst des Zuhörens und eine Frage des Bezogenseins. Eine solche therapeutische „Technik“ lässt sich nicht mit Hilfe von störungsspezifischen Behandlungsmanualen erlernen; vielmehr ist sie das Ergebnis eines sehr direkten, urteilsfreien Bezogenseins auf einen anderen Menschen und auf sich selbst. Patienten werden von Fromm nicht als ein fremdes, „gestörtes“ Gegenüber gesehen; vielmehr ist die Beziehung von einer tief reichenden Solidarität bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Analytiker und die Analytikerin mit sich selbst umzugehen gelernt haben und noch immer – durch tägliche Selbstanalyse – zu lernen bereit sind. Aus dem Inhalt • Wirkfaktoren der psychoanalytischen Behandlung • Voraussetzungen der psychoanalytischen Therapie • Die prägende Kraft von Gesellschaft und Kultur • Die therapeutische Beziehung im psychoanalytischen Prozess • Die Bearbeitung des Widerstands • Übertragung, Gegenübertragung und reale Beziehung • Besondere Methoden bei der Therapie der modernen Charakterneurosen • Sich selbst analysieren • Psychoanalytische „Technik“ oder die Kunst des Zuhörens
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse
(Therapeutic Aspects of Psychoanalysis)
Erich Fromm(1991d [1974])
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer FunkAus dem Amerikanischen von Rainer Funk.
Mitschnitt eines englischsprachigen Seminars zum Thema „Therapeutic Aspects of Psychoanalysis” mit amerikanischen Studenten im Sommer 1974 in Locarno. Deutsche Erstveröffentlichung unter dem Titel Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse, in: E. Fromm, Von der Kunst des Zuhörens (1991a), hg. von Rainer Funk (Schriften aus dem Nachlass, Band 5), Weinheim (Beltz Verlag) 1991; Reprint als Heyne Sachbuch 1995 beim Heyne Taschenbuchverlag in München. Überarbeitet fand der Beitrag 1999 Aufnahme in die Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag), Band XII, S. 259-367. – Die englische Originalfassung wurde 1994 veröffentlicht unter dem Titel Therapeutic Aspects of Psychoanalysis in: E. Fromm, The Art of Listening bei The Continuum Publishing Corporation in New York, S. 45-193.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an den von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassungen der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band XII, S. 259-367.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1991 by The Estate of Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Inhalt
Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse
1. Zum Selbstverständnis und zum Menschenbild der Psychoanalyse
a) Welches Ziel hat die Psychoanalyse?
b) Sigmund Freuds therapeutische Zielsetzung und ihre Kritik
c) Das Freudsche Bild vom Kind und seine Kritik
d) Der Stellenwert der Kindheitserfahrungen im therapeutischen Prozess
e) Die Rezeption der Psychoanalyse in der therapeutischen Praxis
f) Der Beitrag Harry Stack Sullivans zum Menschenbild der Psychoanalyse
g) Die Krankheit unserer Zeit als Herausforderung für die Psychoanalyse
2. Voraussetzungen der psychoanalytischen Therapie
a) Die Fähigkeit zu psychischem Wachstum
b) Die Verantwortung jedes Einzelnen für sein psychisches Wachstumspotenzial
c) Die Fähigkeit zur subjektiven Wirklichkeitswahrnehmung
d) Die prägende Kraft von Gesellschaft und Kultur
e) Die Dynamik psychischer Entwicklung und die Freiheit des Menschen
3. Die Wirkfaktoren der psychoanalytischen Therapie
4. Die therapeutische Beziehung im psychoanalytischen Prozess
a) Das Geschehen zwischen Psychoanalytiker und Analysand
b) Voraussetzungen beim Psychoanalytiker
c) Fragen des Umgangs mit dem Analysanden
5. Aufgaben und Methoden des psychoanalytischen Prozesses
a) Die Mobilisierung unbewusster Kräfte und das Aufzeigen von Alternativen
b) Sublimierung, Triebbefriedigung und Triebverzicht am Beispiel sexueller Perversionen
c) Die Bearbeitung des Widerstands
d) Übertragung, Gegenübertragung und reale Beziehung
e) Hinweise zur Arbeit mit Träumen
6. Christiane. Bemerkungen zur therapeutischen Methode und zum Traumverstehen anhand eines Fallberichts
a) Die ersten drei Stunden und der erste Traum
b) Der zweite Therapiemonat und der zweite Traum
c) Der weitere Verlauf der Therapie und der dritte Traum
d) Der vierte Traum und generelle Überlegungen zum Verlauf der Therapie
7. Besondere Methoden bei der Therapie der modernen Charakterneurosen
a) Das eigene Handeln ändern
b) Interesse an der Welt entwickeln
c) Kritisch denken lernen
d) Sich selbst erkennen und seines Unbewussten gewahr werden
e) Des eigenen Körpers gewahr werden
f) Sich konzentrieren und meditieren
g) Den eigenen Narzissmus entdecken
h) Sich selbst analysieren
8. Psychoanalytische „Technik“ oder die Kunst des Zuhörens
Literaturverzeichnis
Der Autor
Der Herausgeber
Impressum
1. Zum Selbstverständnis und zum Menschenbild der Psychoanalyse
a) Welches Ziel hat die Psychoanalyse?
Die Frage, mit der ich beginnen möchte[1], ist zugleich auch die Grundfrage für alles weitere: Welches Ziel hat die Psychoanalyse? Dies ist eine einfache Frage, und es gibt auch eine einfache Antwort: Die Psychoanalyse zielt darauf, sich selbst zu erkennen. Selbsterkenntnis ist ein sehr altes menschliches Bedürfnis. Von den Griechen über das Mittelalter bis zur Gegenwart lässt sich die Vorstellung nachweisen, dass die Selbsterkenntnis die Grundlage der Erkenntnis der Welt ist – oder um es mit einer drastischen Formulierung von Meister Eckhart auszudrücken: „Es gibt nur einen einzigen Weg, Gott zu erkennen: sich selbst zu erkennen.“ Selbsterkenntnis ist eine der ältesten Sehnsüchte der Menschen. Sie ist eine Sehnsucht oder eine Zielsetzung, die ihre Wurzeln sehr wohl in objektiven Gegebenheiten hat.
Wie kann jemand die Welt erkennen, wie vermag jemand zu leben und richtig zu reagieren, wenn uns das Instrument zum Handeln und zur Entscheidung nicht bekannt ist? Wir sind der Führer dieses „Ichs“, das es irgendwie fertigbringt, dass wir in der Welt leben, Entscheidungen fällen, Prioritäten setzen und uns zu Werten bekennen. Wenn dieses Ich, dieses Subjekt, das entscheidet und handelt, uns nicht genügend bekannt ist, bedeutet dies, dass all unsere Handlungen und Entscheidungen halbblind oder nur in einem halbwachen Zustand erfolgen. Es gilt, in Betracht zu ziehen, dass der Mensch im Unterschied zum Tier keine solchen Instinkte hat, die ihm sagen, wie er zu handeln hat, so dass das Tier auch gar nichts außer dem, was ihm die Instinkte sagen, wissen muss. Allerdings gilt diese Feststellung nur mit der Einschränkung, dass auch im Tierreich die Tiere etwas lernen müssen, und zwar selbst die auf niedrigem Evolutionsniveau. Instinkte funktionieren nicht ohne wenigstens ein Minimum an Lernen. Dieser Aspekt ändert aber nichts daran, dass die Tiere im Großen und Ganzen nicht viel „wissen“ müssen. Das Tier muss sehr wohl einige Erfahrungen gesammelt haben, die durch die Erinnerung vermittelt werden.
Der Mensch hingegen muss Erkenntnis haben, um entscheiden zu können. Seine Instinkte sagen ihm nicht, wie er sich entscheiden soll. Sie sagen ihm nur, dass er essen, trinken, sich verteidigen und schlafen muss, und nach Möglichkeit auch, dass er Kinder [XII-262] hervorbringen soll, wobei der Trick der Natur darin besteht, dass sie den Menschen mit einem bestimmten Vergnügen oder einer Lust auf sexuelle Befriedigung ausgestattet hat. Doch das sexuelle Verlangen ist bei weitem kein so starkes instinktives Verlangen wie die anderen Triebe und Impulse. Das Verlangen, sich selbst zu kennen, ist deshalb nicht nur unter einer spirituellen, religiösen, moralischen oder menschlichen Perspektive eine Bedingung des Menschen, sondern auch bei biologischer Betrachtungsweise.
Das Optimum an Lebensfähigkeit hängt vom Grad der Kenntnis über uns selbst ab. Diese Kenntnis ist das Instrument, mit dem wir uns in der Welt orientieren und unsere Entscheidungen treffen. Offensichtlich ist es so: Je besser wir uns selbst bekannt sind, desto richtiger sind unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und je weniger wir uns kennen, desto unklarer müssen unsere Entscheidungen ausfallen.
Die Psychoanalyse eignet sich nicht nur zur Therapie, sondern ist auch ein Instrument, sich selber zu verstehen, das heißt, sich selber zu befreien. Als Hilfsmittel bei der Kunst des Lebens hat die Psychoanalyse unter persönlichen und praktischen Gesichtspunkten meiner Meinung nach sogar die wichtigste Bedeutung.
Der Hauptwert der Psychoanalyse liegt darin, dass sie zu einer spirituellen Veränderung der Persönlichkeit verhelfen kann, und weniger darin, Symptome zu heilen. Solange es keine bessere und kürzere Methode gibt, Symptome zu heilen, hat die Psychoanalyse auch hier ihre Bedeutung; ihre tatsächliche historische Bedeutung liegt in Richtung jener Erkenntnis, die man auch im buddhistischen Denken findet: Es geht der Psychoanalyse um eine bestimmte Art des Gewahrwerdens seiner selbst, um „Achtsamkeit“, wie sie in der buddhistischen Praxis eine zentrale Rolle spielt, mit dem Ziel, einen besseren Zustand des Seins zu erreichen und sinnvoller leben zu können als der durchschnittliche Mensch.
Die Psychoanalyse behauptet, dass Selbsterkenntnis eine heilende Wirkung hat. Diesen Anspruch erhob bereits das Evangelium: „Die Wahrheit wird euch frei machen.“ [Jo 8,32] Warum soll die Kenntnis des eigenen Unbewussten, also eine umfassende Selbsterkenntnis, dazu verhelfen, einen Menschen von seinen Symptomen zu befreien, ja ihn sogar glücklich machen?
b) Sigmund Freuds therapeutische Zielsetzung und ihre Kritik
Ich möchte zuerst auf die therapeutische Zielsetzung der klassischen, der Freudschen Psychoanalyse, zu sprechen kommen. Freud sah das therapeutische Ziel darin, den Menschen arbeitsfähig und sexuell genussfähig zu machen, so dass er sich der Sexualität erfreuen kann und fähig ist, sexuell zu funktionieren. Um es mit anderen Worten zu sagen, das Ziel ist, zu arbeiten und sich fortzupflanzen. Dies sind zugleich die zwei großen Forderungen, die die Gesellschaft an jeden Einzelnen stellt. Die Gesellschaft muss den Menschen Gründe liefern und sie indoktrinieren, warum sie arbeiten und Kinder hervorbringen sollen. Wir tun dies schlecht und recht aus vielerlei Gründen. Der Staat tut im allgemeinen nichts besonderes, um die Menschen dazu anzuhalten; braucht der Staat aber mehr Kinder, als derzeit hervorgebracht werden, dann wird er alle möglichen Anstrengungen dazu unternehmen. [XII-263]
Freuds Definition von psychischer Gesundheit ist in Wirklichkeit eine gesellschaftliche Definition. Sie zielt auf eine Normalität im gesellschaftlichen Sinne ab. Es geht darum, dass der Mensch der gesellschaftlichen Norm gemäß funktioniert; dementsprechend ist auch die Definition des Symptoms eine gesellschaftliche: Ein Symptom liegt dann vor, wenn es für den Einzelnen schwierig ist, der gesellschaftlichen Norm gemäß zu funktionieren. Deshalb wird der Konsum von Drogen als schweres Symptom angesehen, das zwanghafte Rauchen dagegen nicht, obwohl es vom Psychologischen her das gleiche Phänomen ist. Gesellschaftlich gesehen gibt es einen großen Unterschied, denn wenn jemand bestimmte Drogen nimmt, dann hindern diese ihn in vielen Situationen daran, gesellschaftlich angemessen zu funktionieren. Jemand kann sich zu Tode rauchen – wen kümmert es? Stirbt er an Lungenkrebs, dann ist dies kein gesellschaftliches Problem. Die Menschen sterben so oder so. Und wenn jemand mit fünfzig Jahren an Lungenkrebs stirbt, dann ist er gesellschaftlich gesehen auch nicht mehr wichtig. Immerhin hat er die gewünschte Zahl von Kindern gehabt, hat seine Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und sein Bestes getan. Sein Rauchen und der Lungenkrebs sind uninteressant, weil sie die genannten gesellschaftlichen Funktionen nicht stören.
Wir erklären etwas zu einem Symptom, wenn es der gesellschaftlichen Funktion des Menschen abträglich ist. Weil dies so ist, gilt der Mensch als gesund, der unfähig ist, etwas von seinem eigenen Erleben zu spüren, und stattdessen alles immer nur ganz „realistisch“ sieht. In Wirklichkeit ist er genauso krank wie der Psychotiker, der unfähig ist, die äußere Wirklichkeit als etwas wahrzunehmen, mit dem er umgehen kann und das er gestalten kann, der stattdessen aber alles in sich wahrnimmt, was für den sogenannten normalen Menschen unzugänglich ist: Gefühle, selbst die äußerst feinen Gefühlsregungen, und das innere Erleben.
Freuds Definition von seelisch-geistiger Gesundheit ist im wesentlichen eine gesellschaftliche. Dies ist keine Kritik an Freud im engeren Sinne, denn Freud war so sehr ein Kind seiner Zeit, dass er seine Gesellschaft nie infragestellte. Die einzige Ausnahme betraf die Sexualität; hier war ihm das sexuelle Tabu zu streng, weshalb er es gemildert sehen wollte. Freud selbst war ein sehr prüder Mensch, und er wäre außerordentlich geschockt, wenn er sehen würde, zu welchem sexuellen Verhalten angeblich seine Lehren geführt haben. In Wirklichkeit hat Freud wenig mit dieser Entwicklung zu tun, denn das gegenwärtige Sexualverhalten ist Teil eines allgemeinen Konsumverhaltens.
Wie begründet Freud das beschriebene Ziel der Psychoanalyse? Die Freudsche Auffassung von dem, was in der Therapie geschieht, lässt sich im Kern von seiner Trauma-Theorie her so skizzieren: Freud nimmt ein traumatisches Ereignis in der frühen Kindheit an, das verdrängt wurde und, eben weil es verdrängt wurde, noch immer am Werk ist. Der sogenannte „Wiederholungszwang“ bindet den Menschen an dieses frühe Ereignis, und zwar nicht nur auf Grund seines Beharrungsvermögens und weil das traumatische Ereignis von damals noch immer seine Wirkung zeigt, sondern weil der Wiederholungszwang den Menschen dazu anhält, das gleiche Verhalten je neu zu wiederholen. Wird dieses Verhalten zu Bewusstsein und seine Energie in Erfahrung gebracht, und zwar nicht nur intellektuell, sondern, wie Freud bald erkannte, affektiv [XII-264] erlebt (was er „durcharbeiten“ nannte), dann hat dies die Wirkung, die Macht des Traumas zu brechen, so dass der Mensch von seinem verdrängten Einfluss befreit ist.
Ich habe schwerwiegende Zweifel an der Richtigkeit dieser Theorie. Als erstes möchte ich ein persönliches Erlebnis aus der Zeit mitteilen, als ich in Ausbildung am Psychoanalytischen Institut in Berlin war [1928 bis 1930].[2] Dort gab es einmal unter den Professoren eine lange Diskussion, an denen die Lehranalysanden gewöhnlich teilnahmen, wie oft es eigentlich vorkomme, dass ein Patient sich wirklich seiner frühen traumatischen Ereignisse erinnere. Die Mehrheit der Professoren sagte, dass dies äußerst selten geschehe. Ich war völlig überrascht, denn ich war ein guter und gutgläubiger Schüler und hatte an die Theorie geglaubt. Und plötzlich hörte ich, dass das, was als Grundlage für die Heilung galt, so selten vorkam. – (Die Professoren fanden natürlich einen Ausweg aus dem Dilemma, indem sie sagten, dass das Trauma aber in der Übertragung wiederkehre. Doch darauf möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen.)
Das Trauma ist in Wirklichkeit sehr selten und es ist tatsächlich ein einzelnes Erlebnis; es muss außerordentlich und wirklich traumatisch sein, um eine so starke Wirkung zu haben. Vieles, was für traumatisch gehalten wird – wenn etwa der Vater den dreijährigen Jungen im Zorn einmal verprügelt hat –, ist überhaupt kein traumatisches Ereignis, weil der Einfluss, den das Ereignis hat, nicht im einzelnen Ereignis begründet liegt, sondern in der gesamten und kontinuierlichen Eltern- und Familienatmosphäre. Auch wenn man heute bereits dann von traumatischen Situationen spricht, wenn man den Zug verpasst hat oder irgendwo einige unerfreuliche Erlebnisse hatte, so gilt doch, dass das wirkliche Trauma per definitionem ein Ereignis ist, das über die Belastbarkeit des menschlichen Nervensystems hinausgeht. Dies ist der Grund, warum es eine tiefe Störung verursacht und dann auch eine Wirkung zeitigt. Die meisten Ereignisse zeigen keine solche Wirkung und sind deshalb auch keine Traumata. Vielmehr ist das, was eine Wirkung zeigt, die beständige Atmosphäre.
Das Alter, in dem es zu einer Traumatisierung kommt, spielt nur bedingt eine Rolle. Einerseits kann es in jedem Alter zu einer Traumatisierung kommen, andererseits hat das gleiche traumatische Ereignis eine stärkere Wirkung, je früher es sich zuträgt. Gleichzeitig sind dann aber auch die Kräfte, mit denen sich der Mensch davon wieder erholen kann, noch stärker. Das Problem ist also sehr verwickelt, und ich möchte nur vor dem heute so häufig praktizierten ungenauen Gebrauch des Wortes Trauma warnen.
Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die sich im Laufe des psychoanalytischen Prozesses verändert haben. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sich dabei nicht verändert haben. Es ist aber eine Tatsache, dass es auch ohne Psychoanalyse zu tiefgreifenden Änderungen in einem Menschen kommt. Die Erfahrungen mit dem Vietnamkrieg sind hier ein gutes Beispiel. Da gab es viele, die in ihrer Einstellung bezüglich des Vietnamkriegs Falken waren; ich denke hier etwa an konservative Offiziere der Luftwaffe. Diese Leute waren in Vietnam und bekamen dort alles mit; sie sahen die Sinnlosigkeit, die Ungerechtigkeit, die Grausamkeit – und plötzlich kam es zu dem, was man in früheren Zeiten eine „Konversion“ genannt hat: Plötzlich sahen diese Menschen ihre Welt völlig anders und wandelten sich von Befürwortern des [XII-265] Krieges zu Menschen, die ihr Leben und ihre Freiheit riskierten, den Krieg zu beenden. Solche Menschen sind fast nicht wiederzuerkennen. Sie sind selbst andere Menschen geworden, und zwar nur auf Grund eines eindrucksvollen Erlebnisses und auf Grund der Tatsache, dass sie die Fähigkeit hatten, eigenständig zu reagieren. Diese Fähigkeit haben die meisten Menschen nicht, weil sie bereits zu unsensibel geworden sind. – Tiefgreifende Änderungen gibt es also innerhalb und außerhalb der Psychoanalyse, und für beide Möglichkeiten lassen sich hinreichend Beispiele finden.
c) Das Freudsche Bild vom Kind und seine Kritik
Wie jeder, der sich ein wenig mit Freud befasst hat, weiß, war Freud äußerst kritisch, wenn es um sein besonderes Thema ging: um die Beziehung des bewussten Denkens zur unbewussten Motivation. Man kann Freud sicherlich nicht vorwerfen, dass er kein radikaler Kritiker des bewussten Denkens war. Sobald es aber um die Gesellschaft, deren Regeln und Werte ging, in der Freud selbst lebte, war er von Grund auf ein Reformist. Er hatte die gleichen Einstellungen, wie sie die liberale Mittelklasse im allgemeinen vertrat, nämlich dass diese Welt die beste von allen sei, aber dass sie noch verbessert werden könne. Es könnte zum Beispiel noch längere Zeiten des Friedens geben, oder die Gefangenen könnten noch besser behandelt werden. Die Mittelklasse stellte aber nie radikale Fragen; sie fragte zum Beispiel nie – um bei der Kriminologie zu bleiben – nach dem Zusammenhang zwischen dem ganzen kriminologischen System des Strafens und seiner Verankerung in der Klassenstruktur. Ist der Kriminelle nicht deshalb kriminell, weil es für ihn keinen anderen Weg gibt, um zu einem Optimum an Befriedigung zu kommen? Ich will hier nicht das Stehlen und Rauben verteidigen. Dennoch ist unser ganzes strafrechtliches System in der Gesamtstruktur unserer Gesellschaft verankert, die es als selbstverständlich und gegeben ansieht, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen – wie man gebildet sagt – unterprivilegiert ist oder dass – wie man ehrlicher sagen müsste – die Minderheit überprivilegiert ist. Eine gleiche Linie verfolgte man mit dem nicht-radikalen Pazifismus: Man war für eine Reduktion der Armeen und schloss Verträge ab, die den Frieden sichern sollten. In ähnlicher Weise wurde auch die Psychoanalyse zu einer Bewegung, bei der man mit Hilfe einiger Reformen im Bewusstsein das Leben verbessern wollte, ohne radikal nach den Werten und der Struktur der bestehenden Gesellschaft zu fragen.
Freuds Sympathien waren auf Seiten der Regierenden, beim Establishment. Dies lässt sich vielfach belegen. So glaubte er während des Ersten Weltkriegs noch bis 1917, dass die Deutschen gewinnen würden. 1917 war allen, die ein wenig informiert waren und nachdachten, der Glaube an einen deutschen Sieg bereits abhanden gekommen. Freud aber schrieb zu diesem Zeitpunkt noch immer Briefe – ich denke zum Beispiel an einen aus Hamburg –, in denen er sich glücklich wähnte, in Hamburg zu sein, weil er in Deutschland von „unseren Soldaten“ und „unseren Siegen“ sprechen konnte. Dies klingt für uns heute geradezu beängstigend, wenn man den phantastischen Effekt und die Signalwirkung in Betracht zieht, die eine solche Äußerung auf das Gewissen gerade der besonders intelligenten und ehrbaren Menschen hatte. Die Bedeutung [XII-266] lässt sich nur richtig begreifen, wenn man die Situation damals mit den schlimmsten Zeiten in Vietnam vergleicht. Es gab zu der Zeit – und darin zeigt sich die ganze Tragik – so gut wie keine Opposition gegen den Ersten Weltkrieg. Die große Mehrheit der deutschen und der französischen Intellektuellen befürwortete den Krieg. Einstein war eine der wenigen Ausnahmen und weigerte sich, den Krieg zu billigen. Vor diesem Hintergrund ist Freuds Äußerung nicht so ungewöhnlich und schockierend, wie sie ohne Berücksichtigung der Umstände klingen würde; doch sie ist immer noch schlimm genug, wenn man in Betracht zieht, zu welcher Zeit sie gemacht wurde und dass sie von einem Menschen stammt, der sich 1925 in einem Briefwechsel mit Einstein einen „Pazifisten“ nannte.
Als Freud in Berichten von Patienten hörte, dass diese verführt wurden – die Mädchen von ihren Vätern, die Jungen von ihren Müttern –, glaubte er zunächst, dass diesen Berichten wirkliche Vorkommnisse entsprachen. Und nach allem, was ich weiß, war dies vermutlich auch so. Sándor Ferenczi kam am Ende seines Lebens zu der gleichen Überzeugung. Freud hingegen änderte schon bald seine Betrachtungsweise und behauptete, dass dies alles Phantasien seien: Die Eltern konnten so etwas nicht getan haben; die Berichte mussten unwahr sein. Kinder würden nur deshalb von diesen Vorkommnissen erzählen, weil sie über ihre eigenen Phantasien sprachen. Sie wünschten sich diese inzestuöse Phantasie, mit dem Vater oder mit der Mutter zu schlafen oder worum es auch ging. Freud sah in diesen Geschichten einen Beweis für die inzesthaften halb-kriminellen Phantasien des Kindes.
Bekanntermaßen ist diese Vorstellung ein Grundstein der psychoanalytischen Theorie: Das Kind, ja schon das Kleinkind, ist bereits mit dem gefüllt, was Freud polymorph-perverse Phantasien genannt hat. Freud sah also im Kind etwas ganz Schlechtes: Das Kind sei so gierig, dass es am liebsten darüber phantasiere, wie es den Vater oder die Mutter verführen könne, um mit ihnen zu schlafen. Dies gab der gesamten psychoanalytischen Betrachtungsweise eine schräge Richtung: Einerseits führte es zu der theoretischen Annahme, dass die inzestuösen Phantasien ein wesentlicher Teil der kindlichen Ausstattung seien. Andererseits führte es bei der Therapie zu der Annahme, dass alles, was ein Patient in dieser Hinsicht einbringt, seinen eigenen Phantasien zuzuschreiben ist und deshalb nicht ein reales Vorkommnis wiedergibt, sondern analysiert werden muss.
Freud war im Kern davon überzeugt, dass das Kind schuldig ist und – ich ergänze – nicht die Eltern. Dies kommt in Freuds eigenen Fallgeschichten deutlich zum Vorschein. Ich selbst habe diese Sicht Freuds zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen in der Fallgeschichte vom „Kleinen Hans“ aufgezeigt (Der Ödipuskomplex. Bemerkungen zum „Fall des kleinen Hans“, 1966k, GA VIII, S. 143-151); sie lässt sich bei allen Fallgeschichten nachweisen. Die Eltern werden bei Freud immer in Schutz genommen, auch wenn sie offensichtlich noch so selbstsüchtig, widerstreitend und feindselig sind. Die Schuld und die Last liegen immer auf Seiten des Kindes. Das Kind mit seinen inzesthaften Phantasien ist nicht nur inzestuös, es will auch den Vater umbringen und die Mutter vergewaltigen. Für Freud war das Kind ein kleiner Krimineller.
Diese Sicht des Kindes bei Freud muss man dynamisch als Folge seiner Verteidigung der Eltern und der Autorität verstehen. Betrachtet man das Leben der meisten Kinder [XII-267] näher, lässt sich erkennen, dass die „Elternliebe“ eine der größten Fiktionen ist, die jemals erfunden wurde. Gewöhnlich wird mit der Elternliebe, wie Ronald Laing ganz zutreffend gesagt hat, nur die Gewalt vertuscht, die die Eltern über das Kind ausüben möchten. Natürlich gibt es echte Ausnahmen, und ich kenne auch einige wirklich liebende Eltern. Wenn man aber aufs Ganze gesehen die Geschichte des Umgangs der Erwachsenen mit den Kindern durch die Jahrhunderte verfolgt und wenn man sich die Lebensgeschichte der Menschen von heute ansieht, dann haben zumindest ich und einige andere gesehen, dass das Hauptinteresse der meisten Eltern in Wirklichkeit das Ausüben von Herrschaft ist. Ihre Liebe ist ganz seltsamer Natur, eine Art sadistischer Liebe nach dem Motto: „Ich will ja nur dein Bestes!“ Sie lieben die Kinder in dem Maße, in dem diese sich nicht gegen die elterliche Bevormundung wenden.
Die Art, wie die Eltern ihre Kinder lieben, entspricht dem Verständnis der Liebe des Mannes zu seiner Frau in der patriarchalischen Gesellschaft: Kinder werden als Besitz angesehen. Sie waren seit der Römerzeit Besitz und sind es noch heute. Noch immer haben die Eltern das uneingeschränkte Recht, über ihr Kind zu verfügen. Es gibt inzwischen in einigen Ländern zaghafte Versuche, dies zu ändern und die Möglichkeit vorzusehen, dass Eltern von Gerichts wegen das Erziehungsrecht genommen wird, wenn ernste Gründe dafür sprechen, dass sie unfähig sind, ein Kind großzuziehen. Doch ist hier viel Augenwischerei dabei, denn es dauert lange, bis ein Gericht zu der Entscheidung kommt, dass Eltern unfähig sind; außerdem sind die meisten Richter selbst Eltern und, was die Erziehung betrifft, meist ebenso unfähig wie andere Eltern. Wie sollen sie also entscheiden können?
Sieht man einmal von der halb-instinktiven und etwas narzisstischen Liebe der Mütter zu ihren Säuglingen ab, dann kann man, wie auch Ronald Laing und andere es tun, sagen, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder die ersten Anzeichen eines eigenen Willens bekunden, die Tendenz dominiert, über die Kinder zu herrschen und sie zu besitzen. Für die meisten Menschen bedeutet das Kinderhaben, dass sie sich selbst mächtig erleben, Herrschaft ausüben können, sich wichtig vorkommen, etwas bewegen können, sich so fühlen, dass sie etwas zu sagen haben. Ich zeichne hier kein böswilliges Bild von den Eltern. Was ich sage, entspricht den Gegebenheiten. In der britischen Oberschicht gab es diesen Fluch über die Kinder im allgemeinen nicht. Die europäische Oberschicht hatte ihre Gouvernanten und Erzieherinnen, und den Müttern waren ihre Kinder völlig egal, denn sie hatten jede Menge anderer Befriedigungen im Leben. Sie hatten ihre Liebesaffären, feierten Partys, interessierten sich für Pferde usw.
Kinder werden wie ein Besitz betrachtet, solange der Wunsch zu haben die beherrschende Qualität der Charakterstruktur von Menschen ist. Es gibt auch Menschen, in denen dieser Wunsch zu haben nicht vorherrschend ist, doch sind sie heute in der Minderzahl. Auch die Kinder sind so sehr daran gewöhnt, der Besitz der Eltern zu sein, dass sie es als gegeben ansehen, zumal die ganze Gesellschaft dies als das Natürliche ansieht. Diesen Konsens gibt es schon seit den Tagen der Bibel. Die Bibel sagt bereits, dass der rebellierende Sohn gesteinigt und getötet werden muss. Wir tun dies zwar heute nicht mehr, doch noch im Neunzehntem Jahrhundert passierte mit einem rebellierenden Sohn Schlimmes. [XII-268]
Die elterliche Liebe ist etwas, für das man viel Sympathie und Mitgefühl, ja selbst Sorge und Mitleid haben kann. Und doch ist sie bei vielen Menschen im besten Fall eine gutartige Besitzhaltung, in der überwiegenden Zahl der Fälle aber ein malignes Besitzen, bei dem geschlagen und verletzt wird. Das Verletzen geschieht dabei auf vielerlei Weisen, ohne dass es als solches bewusst ist: Das Ehrgefühl des Kindes wird verletzt, die stolze Selbstachtung wird verletzt, das so sensible und zugleich so intelligente Kind lässt man spüren, dass es ein Einfaltspinsel und dumm sei und nichts verstehe. Selbst manche ganz wohlmeinenden Eltern stellen ihre Kinder zur Schau, wie wenn diese in Gegenwart anderer Menschen kleine Clowns wären. Alles Mögliche wird getan, um das Selbstvertrauen des Kindes zu drücken und sein Gespür für Würde und Freiheit zu unterdrücken.
Freuds Parteinahme für die, die dominieren, für die herrschende Klasse, sein Konformismus mit dem Establishment trug meiner Ansicht nach tatsächlich viel zur Entstellung seiner Theorie über Kinder und auch zur Entstellung seiner Therapie bei. Freud machte den Psychoanalytiker zum Verteidiger der Eltern. Der Analytiker sollte aber eine objektive Betrachtungsweise haben und deshalb die Eltern anklagen. Macht er sich aus dem Geist des Establishments blindlings zum Verteidiger der Eltern, dann tut er dem Patienten nichts Gutes. Um noch genauer zu sein, muss man noch einen Schritt weiter gehen: Man sollte nicht nur die Eltern und das Familiensystem im Auge haben, sondern das gesamte gesellschaftliche System, denn die Familie ist ja nur ein Ausschnitt, ein Beispiel davon.
Wenn ich Freud vorwerfe, dass er das Kind schuldig spricht, dann meine ich natürlich nicht, dass das Kind immer unschuldig ist und die Eltern immer schuldig sind. Selbstverständlich muss man in jedem Einzelfall die gesamte Konstellation im Auge behalten und sich auch fragen, welchen Anteil das Kind an den Reaktionen der Eltern hat. Es gibt Eltern, die gegen einen bestimmten Typ von Kind geradezu allergisch sind. Wenn zum Beispiel eine sehr sensible Mutter, die ein wenig zurückhaltend ist, einen Jungen zur Welt bringt, der aggressiv und etwas grob ist – und so etwas zeigt sich bereits, wenn ein Baby erst acht Wochen alt ist –, dann ist dies das Temperament des Jungen, das diese Mutter nie wird aushalten können, weder bei dem kleinen Kind noch später irgendwann. Dies ist ziemlich schlimm, und man kann weder sagen, dass der Junge dafür verantwortlich ist, denn er ist eben so geboren, noch kann man die Mutter dafür verantwortlich machen, weil sie einfach nicht anders kann.
Es gibt Kinder, die von Anfang an schwierig sind; andere sind von Anfang an sehr arrogant. Freud selbst zum Beispiel war schon als Kind sehr arrogant gegenüber seinem Vater. Er wettete mit seinem Vater um sein Bett und tröstete seinen Vater damit, dass er ihm das schönste Bett der ganzen Stadt kaufen werde, wenn er groß sei. Er kam gar nicht auf die Idee, dass es ihm leidtun und er sich entschuldigen könnte, wie dies die meisten Kinder tun würden, derart eingenommen war er von sich. Für manche Väter wäre dieses arrogante Verhalten ihres Jungen absolut unerträglich. Die Kinder tragen also sehr wohl auf Grund ihres Soseins einiges zu den Verhaltensreaktionen der Eltern gegenüber ihren Kindern bei. Die Annahme, das Kind müsste einem sympathisch sein, weil es ja das eigene Kind ist, ist schlichtweg eine Fiktion. Immer noch ist es das Lotteriespiel der Gene, die hier am Werk sind, und man ist nicht immer der Gewinner [XII-269] bei diesem Lotteriespiel. Davon aber abgesehen, kommt es zu vielen Entwicklungen im Laufe des Lebens eines Kindes, für die die Eltern sehr wohl verantwortlich zu machen sind.
d) Der Stellenwert der Kindheitserfahrungen im therapeutischen Prozess
Es ist meine Überzeugung, dass ein Großteil der Prägung in den ersten fünf Lebensjahren stattfindet und dass diese Jahre deshalb für die Entwicklung eines Menschen besonders wichtig sind, doch bin ich auch davon überzeugt, dass viele andere Dinge, die sich später ereignen, ebenso wichtig sind und den Menschen verändern können.[3]
Ich unterscheide mich hier von Freud und seiner Theorie des Wiederholungszwangs, derzufolge sich die wichtigsten Dinge in den ersten fünf Lebensjahren ereignen und alles, was danach passiert, reine Wiederholung des Früheren ist. Eine solche Vorstellung ist mir zu mechanistisch. Meiner Ansicht nach wiederholt sich im Leben gar nichts; nur mechanische Dinge können sich wiederholen. Alles, was sich ereignet, führt dazu, dass sich etwas ändert, wenngleich ich einschränkend den konstitutionellen Faktor unterstreichen möchte. Freud trug den konstitutionellen Faktoren theoretisch Rechnung, doch die meisten Psychoanalytiker und vor allem die Öffentlichkeit glauben, dass das, wozu ein Mensch wird, nur das Ergebnis dessen sei, was seine Eltern ihm antaten. Auf diese Weise kommt es dann zu so rührseligen Geschichten, wie man sie oft in Psychoanalysen finden kann: „Mein Vater liebte mich nicht, meine Mutter liebte mich nicht, meine Großmutter liebte mich nicht, und deshalb bin ich ein so schwieriger Mensch geworden.“ Die Schuld den Bezugspersonen zuzuschieben, ist natürlich die allereinfachste Lösung.
Es lässt sich immer zeigen, dass es für die Entwicklung eines Menschen bereits bestimmte Elemente in seiner Kindheit gibt, die den Grund für später legen; andererseits aber verstärken oder schwächen spätere Ereignisse diese Elemente. Man kann nicht sagen, dass spätere Ereignisse nicht ihren Beitrag leisten. Ich vertrete prinzipiell die Auffassung, dass frühere Ereignisse einen Menschen zwar nicht determinieren, aber ihn geneigt sein lassen: Nichts von dem, was früher passierte, hat meiner Meinung nach eine notwendig determinierende Kraft, aber es richtet ihn in eine bestimmte Richtung aus, und je länger jemand in diese Richtung geht, desto mehr ist er geneigt, eben dieser Richtung zu folgen, so dass es schließlich nur noch durch ein Wunder zu einer Änderung seiner Richtung kommen könnte.
Die Psychoanalyse zielt darauf ab, zu Einsichten in jene unbewussten Prozesse zu gelangen, die den Patienten aktuell zum Zeitpunkt der Psychoanalyse bestimmen. Als solche ist die Psychoanalyse keine historische Forschung. Es geht ihr vielmehr darum, wie bei einer Röntgenaufnahme zu erkennen, was jetzt im Patienten unbewusst, sozusagen hinter seinem Rücken, vor sich geht. Freilich kann der Patient selbst dies oft nur verstehen, wenn er einige Kindheitserlebnisse wieder-erfahren kann, denn sie sind es, die ihn im Moment beeinflussen oder sich in besonderer Weise auswirken, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Manchmal geschieht dies mit Hilfe der Übertragung, [XII-270] manchmal dadurch, dass sich jemand an etwas anderes aus der Kindheit erinnert, manchmal erinnert sich jemand der Kindheitserlebnisse auch direkt in der Analysestunde (wir haben viele solche Erinnerungen in uns), manchmal taucht ein Kindheitserlebnis im Traum auf.
Es kommt vor, dass in einem Traum etwas auftaucht, das sich schon 30 Jahre zuvor, als der Patient vielleicht 17 Jahre alt war, ereignete. Es geht nun aber in der Analyse nicht um eine historische Erforschung dessen, was damals war; vielmehr ist es das psychoanalytische Ziel, so deutlich wie nur möglich bewusst zu machen, was das Unbewusste jetzt ist. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man jedoch oft, vielleicht sogar in den meisten Fällen, Einblick gewinnen in das, was der Patient erlebte, als er noch ein Kind oder ein Jugendlicher war. Wenn ich mich selbst analysiere, und ich tue dies jeden Tag, versuche ich absichtlich dem nachzuspüren, wie ich mich in einer bestimmten Frage oder Situation wohl als Fünfjähriger oder Fünfzehnjähriger gefühlt habe. Auf diese Weise versuche ich herauszufinden, welche dieser Gefühle in mir sind. Ich versuche, meine eigene Verbindung zu meiner Kindheit dauerhaft offen und lebendig zu halten, weil ich auf diese Weise das besser erkennen und bewusst machen kann, was jetzt in mir vor sich geht und dessen ich mir nicht bewusst bin. Mir geht es nicht um eine historische Erforschung, sondern um das Jetzt.
Es war Freuds Idee, die wichtigsten pathogenen Erfahrungen aus der Kindheit zu Bewusstsein zu bringen, und zwar nicht nur verstandes- und wissensmäßig, sondern, wenn möglich, affektiv, um auf diese Weise die Symptome zum Verschwinden zu bringen. Was ist daraus geworden? In der Öffentlichkeit und in weiten Kreisen der Psychoanalyse [...] ist daraus das geworden, was man eine „genetische“ Erklärung nennt. Wenn man Analysierte fragt, was denn die Psychoanalyse gezeigt habe, kann man oft die Formel und Logik hören: „Ich bin dies und jenes“ oder „Ich habe dies und jenes, weil...“ – und dann folgt eine kausale Erklärung historisch-genetischer Natur. Diese aber hat als solche keinerlei heilenden Wert. Wenn man weiß, warum etwas geschah, dann ändert sich durch dieses Wissen allein noch gar nichts.
Auch wenn dies nicht ohne weiteres zu verstehen ist, so möchte ich doch die Aufmerksamkeit auf folgenden Unterschied lenken: Wenn ich in mir etwas erfahre, das verdrängt war und plötzlich auftaucht, so dass ich seiner gewahr werde, dann ist dies etwas völlig anderes, als historische Rekonstruktionen darüber anzustellen, wie dieses oder jenes sich ereignete. Weil aber diese ursprünglichen Erfahrungen so selten wiedergefunden werden, so dass sie im wahren Sinne des Wortes wieder in Erinnerung „gerufen“ sind, gibt man sich mit einer Konstruktion zufrieden: Es muss so etwas stattgefunden haben, es hat vermutlich stattgefunden – und weil es stattgefunden hat, bin ich so oder so geworden. In Wirklichkeit ist ein solcher Rekonstruktionsversuch völlig nutzlos. Wenn jemand am Ertrinken ist und die Gesetze der Schwerkraft kennt, dann ertrinkt er dennoch [...].
Die Kindheitserfahrung hat nur in dem Maße Bedeutung, als sie wieder-erfahren und zurückgerufen wird. Darüber hinaus verhilft die Kenntnis der Kindheit zu einem leichteren Verstehen dessen, was jetzt vor sich geht, weil man von der Theorie her zu einigen Annahmen über die Bedingungen in der Kindheit und zu dem kommen kann, was man auf Grund dieser Kindheit erwarten kann. [XII-271]