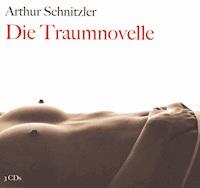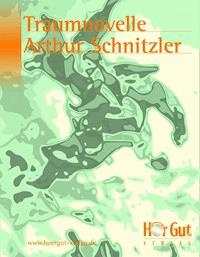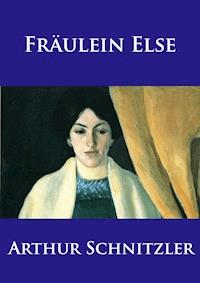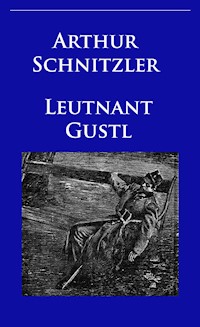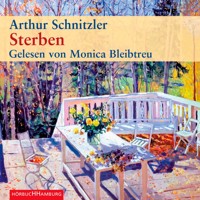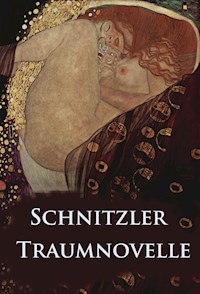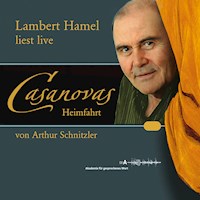0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Therese Fabiani flieht nach Wien. Flieht vor ihrem stumpfsinnigen Alltag in Salzburg, vor der ihr fremd gewordenen Mutter, vor dem Tod des Vaters in einer Nervenheilanstalt. Als Erzieherin in besseren Kreisen verspricht sie sich ein erfüllteres Leben. Aber bald schon merkt sie, dass sie nur geduldet und nicht geachtet ist, dass sie nur ausgenutzt und nicht anerkannt wird. Sie wechselt die Anstellungen wie die Liebschaften, immer wird sie enttäuscht. Als sie auch noch ein Kind erwartet, für das sie keine Liebe empfinden kann, droht der einstmalige Lebensmut in Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit zu kippen. Schnitzler, der Meister des inneren Monologs, führt uns das Schicksal der Heldin so klar vor Augen, dass wir nur mitleiden können. »Therese« ist ein Desillusionsroman, der Einblicke in die österreichische Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg gestattet und gleichzeitig ein Bild vom Untergang dieser Epoche zeichnet. Man wendet sich dem alten k. u. k. ab, aber hat dabei noch nicht den Weg in die Moderne gefunden. Ein literarisches Meisterwerk mit 20 vollendeten Zeichnungen der bekannten Illustratorin Christa Unzner. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Arthur Schnitzler
Therese - Illustrierte Fassung
Chronik eines Frauenlebens
Arthur Schnitzler
Therese - Illustrierte Fassung
Chronik eines Frauenlebens
Überarbeitung und Korrekturen: Null Papier VerlagIllustrationen: Christa Unzner Herausgeber: Jürgen Schulze Published by Null Papier Verlag, Deutschland Copyright © 2017 by Null Papier Verlag 1. Auflage, ISBN 978-3-954189-71-7
null-papier.de/449
Das hier veröffentlichte Werk ist eine kommentierte, überarbeitete und digitalisierte Fassung und unterliegt somit dem Urheberrecht. Verstöße werden juristisch verfolgt. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Genehmigung des Verlages ist ausdrücklich untersagt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Verlegers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Danke
Danke, dass Sie dieses E-Book aus meinem Verlag erworben haben.
Sollten Sie Fehler finden oder Anregungen haben, so melden Sie sich bitte bei mir.
Ihr Jürgen Schulze, Verleger, [email protected]
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort des Verlegers
Neben einer behutsamen Übertragung des Textes in die Neue Deutsche Rechtschreibung habe ich es mir aber erlaubt, einige der österreichischen Eigenheiten (bspw. das herzliche Verniedlichen von Namen und Substantiven mit der Endsilbe „erl“) zu belassen – es ist immer allzu charmant, um es anzupassen oder zu ändern. Und wer wäre ich schon, dem Autor zu widerschreiben?
Einige, der nur im Österreichischen bekannten Wörter, findet der Leser in Fußnoten erklärt. Oder wussten Sie, was ein Inquisitenspital ist?
Ich hoffe sehr, dass Sie auch die Bilder der bekannten Illustratorin Christ Unzner zu schätzen wissen.
Jürgen Schulze, 2017
1
Zu der Zeit, da der Oberstleutnant Hubert Fabiani nach erfolgter Pensionierung aus seinem letzten Standort Wien – nicht wie die meisten seiner Berufs- und Schicksalsgenossen nach Graz, sondern – nach Salzburg übersiedelte, war Therese eben sechzehn Jahre alt geworden. Es war im Frühling, die Fenster des Hauses, in dem die Familie Wohnung nahm, sahen über die Dächer weg den bayrischen Bergen zu; und Tag für Tag, beim Frühstück schon, pries es der Oberstleutnant vor Frau und Kindern als einen besonderen Glücksfall, dass es ihm in noch rüstigen Jahren, mit kaum sechzig, gegönnt war, erlöst von Dienstpflichten, dem Dunst und der Dumpfheit der Großstadt entronnen, sich nach Herzenslust dem seit Jugendtagen ersehnten Genuss der Natur hingeben zu dürfen. Therese und manchmal auch ihren um drei Jahre älteren Bruder Karl nahm er gern auf kleine Fußwanderungen mit; die Mutter blieb daheim, mehr noch als früher ins Lesen von Romanen verloren, um das Hauswesen wenig bekümmert, was schon in Komorn, Lemberg und Wien Anlass zu manchem Verdruss gegeben, und hatte bald wieder, man wusste nicht wie, zur Kaffeestunde zwei- oder dreimal die Woche einen Kreis von schwatzenden Weibern um sich versammelt, Frauen oder Witwen von Offizieren und Beamten, die ihr den Klatsch der kleinen Stadt über die Schwelle brachten. Der Oberstleutnant, wenn er zufällig daheim war, zog sich dann stets in sein Zimmer zurück, und beim Abendessen ließ er es an hämischen Bemerkungen über die Gesellschaften seiner Gattin nicht fehlen, die diese mit unklaren Anspielungen auf gewisse gesellige Vergnügungen des Gatten in früherer Zeit zu erwidern pflegte. Oft geschah es dann, dass der Oberstleutnant sich stumm erhob und die Wohnung verließ, um erst in später Nachtstunde mit dumpf über die Treppe hallenden Schritten zurückzukehren. Wenn er gegangen war, pflegte die Mutter zu den Kindern in dunkler Weise von den Enttäuschungen zu reden, die zwar keinem Menschen erspart blieben, insbesondere aber vom Dulderlos der Frauen; erzählte wohl auch, beispielsweise, mancherlei aus den Büchern, die sie eben gelesen; doch all das in so verworrener Art, dass man glauben konnte, sie menge den Inhalt verschiedener Romane durcheinander, – und Therese stand nicht an, eine solche Vermutung gelegentlich scherzhaft auszusprechen. Dann schalt die Mutter sie vorlaut, wandte sich gekränkt dem Sohne zu und streichelte ihm wie zur Belohnung für sein geduldig-gläubiges Zuhören Haar und Wangen, ohne zu bemerken, wie er verschlagen zu der in Ungnade gefallenen Schwester hinüberblinzelte. Therese aber nahm ihre Handarbeit wieder vor oder setzte sich an das immer verstimmte Pianino, um die Studien weiter zu treiben, die sie in Lemberg begonnen und in der Großstadt unter der Leitung einer billigen Klavierlehrerin fortgeführt hatte.
Die Spaziergänge mit dem Vater nahmen noch vor Einbruch des Herbstes ein nicht ganz unerwartetes Ende. Schon geraume Zeit hindurch hatte Therese gemerkt, dass der Vater die Wanderungen eigentlich nur fortsetzte, um sich und seine Sehnsucht nicht Lügen zu strafen. Stumm beinahe, jedenfalls ohne die Ausrufe des Entzückens, in die die Kinder früher hatten einstimmen müssen, wurde der vorgesetzte Weg zurückgelegt, und erst zu Hause, im Angesicht der Gattin, versuchte der Oberstleutnant wie in einem Frage- und Antwortspiel den Kindern die einzelnen Momente des eben erledigten Spaziergangs mit verspäteter Begeisterung zurückzurufen. Aber auch das nahm bald ein Ende; der Touristenanzug, den der Oberstleutnant seit seiner Pensionierung alltäglich getragen, wurde in den Schrank gehängt, und ein dunkler Straßenanzug trat an seine Stelle.
Eines Morgens aber erschien Fabiani zum Frühstück plötzlich wieder in Uniform, mit so strengem und abweisendem Blick, dass sogar die Mutter jede Bemerkung über diese plötzliche Veränderung lieber unterließ. Wenige Tage darauf langte aus Wien eine Büchersendung an die Adresse des Oberstleutnants, eine andere aus Leipzig folgte, ein Salzburger Antiquar sandte gleichfalls ein Paket; und von nun an verbrachte der alte Militär viele Stunden an seinem Schreibtisch, vorerst ohne irgendwen in die Natur seiner Arbeit einzuweihen; – bis er eines Tages mit geheimnisvoller Miene Therese in sein Zimmer rief und ihr aus einem sorgfältig geschriebenen, geradezu kalligraphierten Manuskript mit eintöniger, heller Kommandostimme eine vergleichende strategische Abhandlung über die bedeutendsten Schlachten der Neuzeit vorzulesen begann. Therese hatte Mühe, dem trockenen und ermüdenden Vortrag mit Aufmerksamkeit oder auch nur mit Verständnis zu folgen; doch da ihr der Vater seit einiger Zeit ein stetig wachsendes Mitleid erregte, versuchte sie, zuhörend, ihren schläfrigen Augen einen Schimmer der Teilnahme zu verleihen, und als der Vater endlich für heute unterbrach, küsste sie ihn wie mit gerührtem Dank auf die Stirn. Noch drei Abende in gleicher Art folgten, ehe der Oberstleutnant mit seiner Vorlesung zu Ende war; dann trug er persönlich das Manuskript auf die Post. Von nun an verbrachte er seine Zeit in verschiedenen Gast- und Kaffeehäusern. Er hatte in der Stadt mancherlei Bekanntschaften angeknüpft, meist mit Männern, die die Arbeit ihres Lebens hinter sich und ihren Beruf aufgegeben hatten: pensionierte Beamte, gewesene Advokaten, auch ein Schauspieler war darunter, der an dem Theater der Stadt alt geworden war und nun Deklamationsunterricht erteilte, wenn es ihm gelang, einen Schüler zu finden. Aus dem früher ziemlich verschlossenen Oberstleutnant Fabiani wurde in diesen Wochen ein gesprächiger, ja lärmender Tischgenosse, der über politische und soziale Zustände in einer Weise herzog, die man bei einem ehemaligen Offizier immerhin sonderbar finden durfte. Aber da er dann wieder einzulenken pflegte, als wäre eigentlich alles nur Spaß gewesen, und sogar ein höherer Polizeibeamter, der zuweilen an der Unterhaltung teilnahm, vergnügt mitlachte, ließ man ihn gewähren.
2
Am Weihnachtsabend, wie zum Angebinde, lag für den Oberstleutnant unter den andern, übrigens recht bescheidenen Gaben, mit denen die Familienmitglieder sich gegenseitig beschenkten, ein wohlverschnürtes Postpaket unter dem Baum. Es enthielt das Manuskript mit einem ablehnenden Schreiben der militärischen Zeitschrift, an die der Verfasser es einige Wochen vorher abgesandt hatte. Fabiani, zorngerötet bis an die Haarwurzeln, beschuldigte seine Gattin, dass sie eine offenbar schon vor einigen Tagen eingelangte Sendung gerade heute ihm wie zum Hohn unter den Baum gelegt, warf ihr die von ihr gespendete Zigarrentasche vor die Füße, schlug die Türe hinter sich zu und verbrachte die Nacht, wie man später erfuhr, in einem der verfallenen Häuser nahe dem Petersfriedhof bei einer der Frauenspersonen, die dort Knaben und Greisen ihren welken Leib feilboten. Nachdem er sich dann für Tage in sein Kabinett verschlossen, ohne an irgend jemanden das Wort zu richten, trat er eines Nachmittags ganz unerwartet in Paradeuniform in das Zimmer seiner zuerst erschrockenen Frau, bei der eben ihre Kaffeegesellschaft versammelt war. Doch er überraschte die anwesenden Damen durch die Liebenswürdigkeit und den Humor seiner Unterhaltung und hätte als vollendeter Weltmann wie in seiner besten Zeit erscheinen können, wenn er sich nicht beim Abschied, im halbdunklen Vorzimmer, gegen einige der Damen unbegreifliche Zudringlichkeiten herausgenommen hätte.
Er verbrachte von nun an noch mehr Zeit außer Hause, zeigte sich aber daheim umgänglich und harmlos; und man war daran, sich in sein so erfreulich aufgeheitertes Wesen aufatmend zu finden, als er eines Abends die Seinen mit der Frage überraschte, was sie wohl dazu meinen würden, wenn man die langweilige Kleinstadt wieder mit Wien vertauschte, worauf er weitere Andeutungen von einer bald zu erwartenden großartigen Umgestaltung ihrer Lebensverhältnisse vernehmen ließ. Theresen klopfte das Herz so heftig, dass sie jetzt erst erkannte, wie sehr sie sich nach der Stadt zurücksehnte, in der sie die letzten drei Jahre verlebt hatte; obzwar ihr von den Annehmlichkeiten, die das Dasein in einer Großstadt Begüterten bietet, nur wenig vergönnt gewesen war. Und sie wünschte sich nichts Besseres, als wieder einmal wie damals planlos in den Straßen umherzuspazieren und sich womöglich zu verirren, was ihr zwei- oder dreimal begegnet war und sie jedes Mal mit einem bebenden, aber köstlichen Schauer erfüllt hatte. Noch leuchteten ihre Augen in der Erinnerung, da sah sie plötzlich ihres Bruders Blick missbilligend von der Seite auf sich gerichtet; – ganz mit dem gleichen Ausdruck wie vor wenigen Tagen, da sie zu ihm ins Zimmer getreten war, als er eben mit seinem Schulkollegen Alfred Nüllheim die mathematischen Aufgaben durchnahm. Und nun erst ward es ihr bewusst, dass er immer so missbilligend dreinblickte, wenn sie selbst heiter schaute und in ihre Augen jenes freudige Leuchten kam, wie es jetzt eben wieder geschehen war. Ihr Herz zog sich zusammen. Früher einmal, als Kinder, ja vor einem Jahre noch, waren sie so vortrefflich zueinander gestanden, hatten zusammen gescherzt und gelacht; – warum war dies anders geworden? Was hatte sich denn ereignet, dass auch die Mutter, der sie freilich niemals besonders nahe gewesen, sich immer verdrossener, feindselig beinahe von ihr abwandte? Unwillkürlich richtete sie nun den Blick auf die Mutter hin, und der böse Ausdruck erschreckte sie, mit dem jene den Gatten anstarrte, der eben mit dröhnender Stimme erklärte, dass die Tage der Genugtuung nicht fern seien und dass ein Triumph ohnegleichen ihm binnen kurzem bevorstünde. Böser noch und hasserfüllter als sonst erschien Theresen heute der Mutter Blick, als hätte sie dem Gatten noch immer nicht verziehen, dass er vor der Zeit pensioniert worden war – als könnte sie es noch immer nicht vergessen, dass sie vor vielen Jahren auf dem elterlichen Gut in Slavonien als kleine Baronesse in einem urwalddichten eigenen Park auf feurigem Pony umhergesprengt war.
Plötzlich sah der Vater auf die Uhr, erhob sich vom Tisch, sprach von einer wichtigen Verabredung und eilte davon.
Er kam nicht wieder heim in dieser Nacht. Aus dem Wirtshaus, wo er teils unverständliche, teils unflätige Reden gegen das Kriegsministerium und das Kaiserhaus geführt hatte, wurde er auf die Wachstube und am Morgen, nach ärztlicher Untersuchung, in die Irrenanstalt gebracht. Später wurde bekannt, dass er kürzlich an das Ministerium ein Gesuch um Wiedereinstellung in den Dienst mit gleichzeitiger Ernennung zum General gerichtet hatte. Daraufhin war von Wien aus der Auftrag ergangen, ihn unauffällig beobachten zu lassen, und es hätte kaum mehr des peinlichen Auftrittes im Wirtshaus bedurft, um seine Einlieferung in eine Anstalt zu rechtfertigen.
3
Seine Gattin besuchte ihn dort vorerst alle acht Tage. Therese erhielt erst nach einigen Wochen die Erlaubnis, ihn zu sehen. In einem weitläufigen, von einer hohen Mauer umgebenen Garten, durch eine von hohen Kastanien beschattete Allee, in einem verwitterten Offiziersmantel, eine Militärmütze auf dem Kopf, kam ihr ein alter Mann entgegen mit fast weißem, kurzem Vollbart, am Arm eines käsebleichen, in einen schmutziggelben Leinenanzug gekleideten Wärters. »Vater«, rief sie tief bewegt und doch beglückt, ihn endlich wiederzusehen. Er ging an ihr vorbei, anscheinend ohne sie zu kennen, und murmelte unverständliche Worte vor sich hin. Therese blieb fassungslos stehen, dann merkte sie, dass der Wärter ihrem Vater irgend etwas klarzumachen versuchte, worauf dieser zuerst den Kopf schüttelte, dann aber sich umwandte, den Arm des Wärters losließ und auf seine Tochter zueilte. Er nahm sie in die Arme, hob sie vom Boden auf, als wäre sie noch ein kleines Kind, starrte sie an, begann bitterlich zu weinen, ließ sie wieder los; endlich, wie in brennender Scham, verbarg er das Gesicht in den Händen und eilte davon, dem düster-grauen Gebäude zu, das durch die Bäume herschimmerte. Der Wärter folgte ihm langsam. Die Mutter hatte dem ganzen Vorgang von einer Bank aus teilnahmslos zugesehen. Als Therese wieder auf sie zukam, erhob sie sich gelangweilt, wie wenn sie hier eben nur auf die Tochter gewartet hätte, und verließ mit ihr den Park.
Sie standen auf der breiten, weißen Landstraße im grellen Sonnenschein. Vor ihnen, an den Felsen mit der Feste Hohensalzburg gelehnt, in einer Viertelstunde zu erreichen und doch unendlich weit, lag die Stadt. Die Berge ragten in den Mittagsdunst, ein Leiterwagen mit schlafendem Kutscher knarrte vorbei, aus einem Bauernhof jenseits der Felder sandte ein Hund sein Gebell in die stumme Welt. Therese wimmerte: »Mein Vater.« Die Mutter sah sie böse an. »Was willst du? Er selbst ist schuld daran.« Und schweigend gingen sie die besonnte Straße weiter, der Stadt entgegen.
Bei Tisch bemerkte Karl: »Alfred Nüllheim sagt, dass solche Krankheiten viele Jahre dauern können. Acht, zehn, zwölf.« Therese riss entsetzt die Augen auf, Karl verzog die Lippen und sah von ihr fort an die Wand.
4
Seit dem Herbst besuchte Therese die vorletzte Lyzealklasse. Sie fasste rasch auf, Fleiß und Aufmerksamkeit ließen zu wünschen übrig. Die Oberlehrerin brachte ihr ein gewisses Misstrauen entgegen; obwohl sie in der Religionslehre nicht schlechter beschlagen war als ihre Mitschülerinnen und alle religiösen Übungen in Kirche und Schule nach Vorschrift mitmachte, stand sie im Verdacht, der wahren Frömmigkeit zu ermangeln. Und als sie eines Abends in Gesellschaft des jungen Nüllheim, dem sie zufällig begegnet war, von der Lehrerin gesehen wurde, benützte diese die Gelegenheit zu boshaften Anspielungen auf gewisse großstädtische Angewohnheiten und Sitten, die sich nun auch in der Provinz einzubürgern schienen, wobei sie einen nicht misszuverstehenden Blick auf Therese warf. Therese empfand dies um so ungerechter, als man von viel schlimmeren Dingen, die mancher Schulkameradin nachgesagt wurden, keinerlei Aufhebens machte.
Der junge Nüllheim kam indes öfter in das Haus Fabiani, als es für das gemeinsame Studium mit Karl notwendig gewesen wäre, ja, ein oder das andere Mal auch, wenn Karl nicht daheim war. Dann saß er bei Theresen im Zimmer und bewunderte ihre geschickten Hände, die farbige Blumen auf einen graulila Kanevas stickten, oder hörte ihr zu, wenn sie auf dem verstimmten Pianino schlecht und recht ein Chopinsches Nocturno spielte. Einmal fragte er sie, ob sie immer noch, wie sie gelegentlich geäußert, Lehrerin zu werden beabsichtige. Sie wusste nicht recht darauf zu antworten. Eines nur war gewiss, dass sie hier in diesen Räumen, in dieser Stadt keineswegs mehr lange wohnen würde; sobald als möglich wollte, vielmehr musste sie einen Beruf ergreifen; lieber anderswo als hier. Die häuslichen Umstände begannen sich zusehends zu verschlechtern, das konnte auch für Alfred kein Geheimnis sein; doch nach wie vor – davon sprach sie nicht – empfing die Mutter ihre Freundinnen oder die sie so nannte, ein oder das andere Mal fanden sich auch Herren ein, und zuweilen dehnten sich die Gesellschaften bis in den späten Abend aus. Therese kümmerte sich wohl wenig darum; doch entfremdete sie sich ihrer Mutter immer mehr. Der Bruder aber zog sich sowohl von ihr als auch von der Mutter völlig zurück; bei den Mahlzeiten wurden nur die unumgänglichsten Worte gewechselt, und manchmal war es Theresen, als würde sie, gerade sie, ohne dass sie sich einer Schuld bewusst gewesen wäre, in unfassbarer Weise für den Niedergang des Hauses verantwortlich gemacht.
5
Der nächste Besuch in der Anstalt, vor dem Therese sich beinahe gefürchtet hatte, ließ sich anfangs tröstlich, ja beruhigend für sie an. Der Vater plauderte mit ihr wie in früheren Zeiten, harmlos, beinahe heiter, führte sie in den weitläufigen Alleen des Anstaltsparkes hin und her wie einen willkommenen Gast; und erst beim Abschied machte er alle Hoffnungen Theresens wieder zunichte durch die Äußerung, dass er sie bei ihrem nächsten Besuch voraussichtlich schon in Generalsuniform werde empfangen dürfen.
Als sie tags darauf Alfred Nüllheim von ihrem Besuch in der Anstalt berichtete, erbot er sich, sie bei nächster Gelegenheit zu dem Kranken zu begleiten. Er beabsichtigte, was Theresen bekannt war, Medizin zu studieren und sich zum Nervenarzt und Psychiater auszubilden. So trafen sie einander ein paar Tage später, wie zu einem geheimen Stelldichein, außerhalb der Stadt und nahmen gemeinsam den Weg nach der Anstalt, wo der Oberstleutnant Alfred wie einen erwünschten, ja erwarteten Besuch begrüßte. Er erzählte heute von den Garnisonsorten seiner Jugendzeit, auch von dem kroatischen Gut, wo er seine Frau kennengelernt hatte, von dieser selbst aber in einer Art, als wenn sie längst nicht mehr am Leben wäre; und dass er einen Sohn hatte, schien ihm überhaupt völlig entfallen zu sein. Alfred wurde auch dem ordinierenden Arzte vorgestellt, der ihn sehr liebenswürdig, fast wie einen jungen Kollegen behandelte. Es berührte Therese sonderbar, fast schmerzlich, dass Alfred auf dem Heimweg von dem erledigten Besuch ohne jede Traurigkeit, eher in angenehm erregter Weise, wie von einem merkwürdigen, für ihn gewissermaßen bedeutungsvollen Erlebnis sprach und die Tränen nicht merkte, die ihr über die Wangen rannen.
6
In diesen Tagen fiel es Theresen auf, dass ihre Mitschülerinnen ihr gegenüber ein verändertes Benehmen zur Schau trugen. Man zischelte, man brach plötzlich ein Gespräch ab, wenn sie in die Nähe kam, und die Lehrerin richtete überhaupt kein Wort und keine Frage mehr an sie. Auf dem Nachhausewege von der Schule schloss sich keines der Mädchen ihr an, und in den Augen von Klara Traunfurt, der einzigen, der sie ein wenig nähergekommen war, glaubte sie etwas wie Mitleid schimmern zu sehen. Durch sie erfuhr Therese auch endlich von dem Gerücht, dass die Abendgesellschaften bei der Mutter in der letzten Zeit nicht mehr ganz harmloser Natur wären, ja, es wurde sogar behauptet, dass Frau Fabiani neulich zur Polizei vorgeladen und dort verwarnt worden sei, und nun fiel es Theresen auch auf, dass in der Tat seit zwei oder drei Wochen jene Abendgesellschaften zu Hause ein Ende genommen hatten.
Als sie heute nach Klaras Aufschlüssen mit Mutter und Bruder beim Essen saß, merkte sie, dass Karl sich kein einziges Mal mit einer Frage oder Antwort an die Mutter wandte; und nun ward ihr auch bewusst, dass es schon mindestens eine Woche her nicht anders war. Sie atmete erlöst auf, als Karl sich erhob und gleich darauf die Mutter sich in ihr Zimmer zurückzog, doch als sie nun plötzlich allein an dem noch nicht abgedeckten Tische saß, auf den durchs offene Fenster die Frühlingssonne fiel, saß sie eine Weile erstarrt wie in einem bösen Traum.
In derselben Nacht noch geschah es ihr, dass sie durch ein Geräusch im Vorzimmer plötzlich erwachte. Sie hörte, wie die Türe vorsichtig geöffnet und wieder verschlossen wurde; und nachher leise Schritte auf der Treppe. Sie erhob sich aus dem Bett, ging zum Fenster und sah hinab. Nach wenigen Minuten wurde das Haustor geöffnet, sie sah ein Paar heraustreten, einen Herrn in Uniform mit aufgestelltem Kragen und eine verhüllte Frauengestalt, die beide rasch um die Ecke verschwanden. Therese nahm sich vor, von ihrer Mutter Aufklärung zu verlangen. Aber als die Gelegenheit dazu erschien, fehlte ihr der Mut. Sie fühlte wieder, wie unzugänglich und fremd ihr die Mutter geworden war; ja, es schien in der letzten Zeit, als wenn die alternde Frau ihr schrullenhaftes Wesen wie mit Absicht ins Unheimliche steigerte; sie hatte sich einen sonderbar schlürfenden Gang angewöhnt, rumorte sinnlos in der Wohnung umher, murmelte unverständliche Worte und sperrte sich gleich nach dem Essen für Stunden in ihr Zimmer ein, wo sie auf große Bogen Papier mit kratzender Feder zu schreiben anfing. Therese nahm zuerst an, dass ihre Mutter mit dem Entwurf einer auf jene polizeiliche Vorladung bezüglichen Verteidigungs- oder Anklageschrift beschäftigt sei, dann dachte sie, ob die Mutter nicht vielleicht ihre Lebenserinnerungen aufzeichne, von welcher Absicht sie früher manchmal gesprochen hatte; doch bald stellte sich heraus – Frau Fabiani erwähnte es einmal bei Tische wie eine bekannte und eigentlich selbstverständliche Tatsache –, dass sie daran sei, einen Roman zu verfassen. Therese warf unwillkürlich einen verwunderten Blick zu ihrem Bruder hin; der sah an ihr vorbei auf die Sonnenkringel an der Wand.
7
Anfang Juli legten Karl Fabiani und Alfred Nüllheim ihre Maturitätsprüfung1 ab. Alfred bestand sie als Bester unter seinen Kollegen, Karl mit eben genügendem Erfolge. Tags darauf trat er eine Fußreise an, nachdem er von Mutter und Schwester so kühl und flüchtig Abschied genommen, als wenn er abends wieder zu Hause sein wollte. Alfred, der einem früheren Plan nach ihn auf der Wanderung hätte begleiten sollen, nahm eine leichte Erkrankung seiner Mutter zum Vorwand, um vorläufig in der Stadt zu bleiben. Er kam auch weiterhin fast täglich in das Haus Fabiani, zuerst um Bücher und Hefte abzuholen, ein nächstes Mal, um Erkundigungen über Karl einzuziehen; und es fügte sich, dass sich an diese Nachmittagsbesuche an den schönen Sommerabenden Spaziergänge mit Therese anschlossen, die sich immer länger ausdehnten.
Eines Abends auf einer Bank in den Anlagen des Mönchsbergs sprach er wieder einmal davon, dass er im Herbst die Wiener Universität beziehen werde, um Medizin zu studieren, was Theresen freilich wie das meiste, was er ihr sagte, nicht neu war, und gestand ihr, was sie auch nicht überraschte, dass er nur deshalb auf eine Ferialreise2 verzichtet habe, um diese paar letzten Monate in ihrer Nähe zu verbringen. Sie blieb ungerührt, ja wurde eher ärgerlich, denn ihr war nicht anders, als ob dieser junge Mensch, dieser Knabe in all seiner Bescheidenheit ihr eine Art von Schuldschein vorzuweisen sich unterfing, den einzulösen sie wenig Lust verspürte.
Zwei Offiziere gingen vorbei, der eine war Theresen vom Sehen längst bekannt, wie die meisten Herren von den hier garnisonierenden Regimentern; die Erscheinung des andern aber war ihr neu; es war ein glattrasierter, dunkelhaariger, schlanker Mensch, der, was ihr besonders auffiel, die Kappe in der Hand hielt.
Seine Augen streiften Therese ganz flüchtig, aber als Nüllheim und der andere Offizier einander grüßten, grüßte auch er, und zwar, da er barhaupt war, nur durch ein lebhaftes Neigen seines Kopfes, und richtete einen lebhaften, beinahe lachenden Blick auf Therese. Doch er wandte sich nicht nach ihr um, wie sie eigentlich erwartet hätte, und verschwand mit seinem Begleiter bald in einer Biegung der Allee. Die Unterhaltung zwischen Therese und Alfred wollte nicht wieder in Fluss geraten, beide erhoben sich und gingen langsam in der Dämmerung nach abwärts.
Reifeprüfung nach einer höheren Schulausbildung <<<
Ferienreise <<<
8
Karls Heimkehr wurde für Anfang August erwartet; statt seiner aber kam ein Brief, dass er nach Salzburg nicht mehr zurückzukehren gedenke und den ihm monatlich zugesicherten kleinen Betrag von jetzt an nach Wien zu senden bitte, wo es ihm bereits gelungen sei, sich durch ein Zeitungsinserat eine Lektion bei einem Mittelschüler zu verschaffen. Eine beiläufige Frage nach dem Befinden des Vaters und Grüße an Mutter und Schwester beschlossen den Brief, in dem nicht das leiseste Bedauern über eine doch wahrscheinlich endgültige Trennung mitzuzittern schien. Der Mutter machte Inhalt und Ton des Briefs keinen sonderlichen Eindruck; Therese aber, so kühl auch ihre Beziehungen zu dem Bruder sich allmählich gestaltet hatten, kam sich nun zu ihrer eigenen Verwunderung völlig verlassen vor. Sie nahm es Alfred übel, dass er nicht der Mensch war, ihr über dieses Gefühl des Alleinseins wegzuhelfen, und seine Schüchternheit begann ihr etwas lächerlich zu erscheinen. Als er aber einmal auf einem Spaziergang außerhalb der Stadt ihren Arm nahm und ihn leise drückte, machte sie sich mit übertriebener Heftigkeit von ihm los und verhielt sich noch beim Abschiednehmen am Haustor kalt und abweisend gegen ihn.
Eines Tages machte die Mutter ihr den Vorwurf, dass sie sich überhaupt nicht mehr um sie bekümmere und nur mehr für Herrn Alfred Nüllheim Zeit zu haben scheine. In derselben Stunde noch schloss sich Therese ihrer Mutter zu einem Spaziergang durch die Stadt an, bei welcher Gelegenheit sie merken konnte, dass Frau Fabiani von zwei Damen, die früher im Hause verkehrt hatten, nicht gegrüßt wurde. Eine Promenade tags darauf führte sie weiter hinaus bis außerhalb der Stadt; jenseits des Felsentors kam ihnen ein älterer Herr mit grauem Schnurrbart entgegen, der anscheinend an ihnen vorbeigehen wollte; plötzlich aber blieb er stehen und bemerkte in einer etwas affektiert klingenden Sprache: »Frau Oberstleutnant Fabiani, wenn ich nicht irre?« – Frau Fabiani sprach ihn als Graf an, stellte ihm ihre Tochter vor; er erkundigte sich nach dem Befinden des Herrn Oberstleutnants und erzählte ungefragt von seinen beiden Söhnen, die, nach dem kürzlich erfolgten Tod seiner Frau, in einem französischen Konvikt erzogen wurden. Als er sich verabschiedet hatte, bemerkte Frau Fabiani: »Graf Benkheim, der frühere Bezirkshauptmann.1 Hast du ihn denn nicht erkannt?« Therese wandte sich unwillkürlich nach ihm um. Seine Hagerkeit fiel ihr auf, der elegante, etwas zu helle Anzug, den er trug, sowie der jugendlich rasche, absichtlich federnde Schritt, mit dem er sich rascher entfernte, als er herangekommen war.
oberste Verwaltungsbeamte einer Bezirkshauptmannschaft <<<
9
Am Tag nach dieser Begegnung erwartete Therese daheim Alfred Nüllheim, der ihr Bücher bringen und sie zu einem Spaziergang abholen sollte. Es war ihr eigentlich lästig; lieber wäre sie allein spazieren gegangen, trotzdem sie in der letzten Zeit öfters von Herren verfolgt und etliche Male auch schon angesprochen worden war. Wie immer zu dieser Jahreszeit, gab es viele Fremde in der Stadt. Therese hatte seit jeher einen offenen, neugierigen Blick für alles, was nach Vornehmheit und Eleganz aussah; als Zwölfjährige schon in Lemberg hatte sie für einen hübschen jungen Erzherzog geschwärmt, der im Regiment des Vaters als Leutnant diente, und sie bedauerte manchmal, dass Alfred, der doch aus wohlhabendem Hause war, trotz seiner guten Figur und seines feinen Gesichts sich gar nicht nach der Mode, ja geradezu kleinstädtisch zu kleiden pflegte. Die Mutter trat ins Zimmer, äußerte ihre Verwunderung, dass Therese bei dem schönen Wetter noch zu Hause sei, und fing wie beiläufig vom Grafen Benkheim zu sprechen an, den sie heute zufällig wieder getroffen hatte. Er interessiere sich für die kriegswissenschaftliche Bibliothek des Vaters, die er gelegentlich besichtigen wolle, um sie vielleicht käuflich zu erwerben. »Das ist nicht wahr«, sagte Therese, und ohne Gruß verließ sie das Zimmer. Sie nahm Hut und Jacke, lief die Treppe hinab. Im Hausflur begegnete ihr Alfred. »Endlich«, rief sie. Er entschuldigte sich; er war zu Hause aufgehalten worden. Schon dämmerte es. Was ihr denn wäre, fragte Alfred, sie sehe so erregt aus. »Nichts«, erwiderte sie. Übrigens habe sie ihm einen komischen Einfall anzuvertrauen. Wie wär’s, wenn sie heute zusammen in einem der großen, schönen Hotelgärten zu Abend essen würden? Er und sie ganz allein unter lauter fremden Leuten? Er errötete. Oh, wie gern, wie gern; aber – leider – gerade heute sei es vollkommen unmöglich. Er habe nämlich kein Geld bei sich; jedenfalls zu wenig für ein gemeinsames Souper in einem der vornehmen Hotels, an die sie denke. Sie lächelte, sie sah ihn an. Er war noch tiefer errötet und rührte sie ein wenig. – »Das nächste Mal«, bemerkte er schüchtern. Sie nickte. Dann gingen sie weiter durch die Straßen, bald waren sie außerhalb der Stadt und nahmen ihren Lieblingsweg durch die Felder. Der Abend war schwül, die Stadt wich immer weiter hinter ihnen zurück, sternenlos hing über ihnen der dämmernde Himmel. Sie wandelten zwischen hochstehenden Ähren; Alfred hielt Theresens Hand gefasst und fragte nach Karl. Sie zuckte die Achseln. »Er schreibt beinahe nie«, erwiderte sie. »Ich habe überhaupt noch nichts von ihm gehört«, sagte Alfred, »seit er fort ist.« Dann kam er wieder auf seine eigene, bald bevorstehende Abreise zu reden. Therese schwieg und sah an ihm vorbei. Ob sie ihm wenigstens nach Wien schreiben werde?
»Was sollte ich Ihnen schreiben?«, erwiderte sie ungeduldig. »Was gibt es von hier zu erzählen? Ein Tag wird sein wie der andere.« – »Auch jetzt ist ein Tag wie der andere«, erwiderte er, »und man hat sich doch immer was zu erzählen. Aber ich will auch zufrieden sein, wenn Sie mir nur manchmal einen Gruß senden.«
Aus dem wogenden Feld waren sie wieder auf die Straße hinausgetreten. Die Pappeln ragten hoch; als dunkle Wand in scharf gezogenen Linien schloss der Nonnberg mit seinen düsteren Festungsmauern das Bild ab. »Sie werden Heimweh haben«, sagte Therese plötzlich mild. – »Nur nach dir«, antwortete er. Es war das erste Du, das er an sie richtete, und sie war ihm dankbar dafür. »Warum eigentlich bleibst du mit der Mutter in Salzburg? Was hält euch hier?« – »Was zieht uns anderswo hin?« – »Es wäre am Ende auch möglich, deinen Vater in eine andere Anstalt zu überführen – in der Nähe von Wien.« – »Nein, nein«, entgegnete sie heftig. – »Du hattest ja die Absicht – du sprachst von einem Beruf, einer Stellung –« – »Das geht nicht so rasch. Ich habe noch eine Lyzealklasse vor mir, auch müsste ich wohl eine Lehrerinnenprüfung machen.« Sie schüttelte heftig den Kopf, denn es war ihr, als sei sie an den Ort, an die Gegend geheimnisvoll gefesselt. Und ruhiger fügte sie hinzu: »Du bist doch zu Weihnachten jedenfalls wieder hier, schon wegen deiner Familie?« – »Bis dahin ist es lang, Therese.« – »Du wirst gar keine Zeit haben, an mich zu denken. Du hast ja zu studieren. Du wirst neue Menschen kennenlernen, auch Frauen, Mädchen.« Sie lächelte, sie fühlte keine Eifersucht, sie fühlte nichts.
Plötzlich sagte er: »In weniger als sechs Jahren bin ich Doktor. Willst du so lange auf mich warten?« – Sie sah ihn an. Sie verstand ihn anfangs nicht, dann aber musste sie wieder lächeln, diesmal gerührt. Um wie viel älter erschien sie sich doch als er. Sie wusste schon in diesem Augenblick, dass sie beide nur Kindereien redeten und dass aus der Sache niemals etwas werden könnte. Aber sie nahm seine Hand und streichelte sie zärtlich. Als sie später vor ihrem Haustor von ihm Abschied nahm, im Dunkel, erwiderte sie lange, leidenschaftlich beinahe, mit geschlossenen Augen seinen Kuss.
10
Abend für Abend wandelten sie nun draußen vor der Stadt auf wenig begangenen Feldwegen und plauderten von einer Zukunft, an die Therese nicht glaubte. Tagsüber daheim stickte sie, bildete sich weiter im Französischen aus, übte Klavier, las in dem und jenem Buch, die meisten Stunden aber verbrachte sie träg, beinahe gedankenlos, und sah zum Fenster hinaus. So sehnsüchtig sie den Abend und Alfreds Erscheinen erwartete: – meist schon nach der ersten Viertelstunde ihres Beisammenseins verspürte sie Regungen der Langeweile. Und als er wieder einmal auf einem Spaziergang von seiner immer näher heranrückenden Abreise sprach, merkte sie mit leisem Schreck, dass sie diesen Tag eher herbeiwünschte. Er fühlte, dass der Gedanke einer baldigen Trennung sie nicht besonders schmerzlich berührte, gab ihr seine Empfindung zu verstehen, sie erwiderte ausweichend, ungeduldig; der erste kleine Streit hob zwischen ihnen an, stumm schritten sie auf dem Heimweg nebeneinander her und schieden ohne Kuss.
In ihrem Zimmer war ihr öd und schwer ums Herz. Sie saß im Dunkel auf ihrem Bett und sah durchs offene Fenster in die schwüle, schwarze Nacht hinaus. Dort drüben, nicht weit, unter dem gleichen Himmel, wusste sie das traurige Gebäude, wo ihr wahnsinniger Vater seinem vielleicht noch fernen Ende entgegensiechte. Im Nebenzimmer, ihr fremder von Tag zu Tag, mit ruheloser Feder, auch einem Wahn anheimgefallen, wachte die Mutter in den grauen Morgen. Keine Freundin suchte Therese auf, auch Klara längst nicht mehr; und Alfred war ihr nichts, weniger als nichts, denn er wusste nichts von ihr. Er war edel, er war rein, und sie spürte dunkel, dass sie es nicht war, nicht einmal sein wollte. Sie verspottete ihn innerlich, dass er sich ihr gegenüber nicht gewandter und verwegener anstellte, und wusste doch, dass sie sich keinen Versuch solcher Art hätte gefallen lassen. Sie dachte anderer junger Leute, die ihr flüchtig oder gar nur vom Sehen bekannt waren, und gestand sich ein, dass ihr mancher von diesen besser gefiel als Alfred, ja, dass sie sich sonderbarerweise manchem sogar vertrauter, näher, verwandter fühlte als ihm; und so ward sie sich bewusst, dass zuweilen ein Blick, rasch auf der Straße gewechselt, zwei Menschen verschiedenen Geschlechts enger aneinander zu knüpfen vermochte als ein stundenlanges, inniges, von Zukunftsgedanken durchwebtes Zusammensein. Mit einem angenehmen Schauer erinnerte sie sich des jungen Offiziers, der an einem Sommerabend in den Anlagen des Mönchsbergs mit einem Kameraden, die Kappe in der Hand, an ihr vorbeigegangen war. Seine Augen waren den ihren begegnet und hatten aufgeglüht, er war weitergegangen und hatte sich nicht einmal nach ihr umgewandt; – und doch war ihr in diesem Augenblick, als wüsste der mehr, viel mehr von ihr, als Alfred wusste, der sich mit ihr verlobt glaubte, sie viele Male geküsst hatte und mit ganzer Seele an ihr hing. Hier war irgend etwas nicht in Ordnung, das fühlte sie. Aber ihre Schuld war es nicht.
11
Am nächsten Morgen kam ein Brief von Alfred. Er habe die Nacht über kein Auge zugetan; sie möge ihm verzeihen, wenn er sie gestern gekränkt, eine Wolke auf ihrer Stirn verdüstere ihm den heitersten Tag. Vier Seiten lang ging es in diesem Tone fort. Sie lächelte, war etwas gerührt, drückte den Brief wie mechanisch an die Lippen, ließ ihn dann halb absichtlich, halb zufällig aus der Hand auf ihr Nähtischchen gleiten. Sie war froh, dass sie nicht verpflichtet war, ihn zu beantworten; – heute abend traf man einander ja ohnehin am gewohnten Orte des Stelldicheins.
Gegen Mittag trat ihre Mutter zu ihr ins Zimmer mit süßlichem Lächeln: der Graf Benkheim sei hier und habe eben die Bibliothek des Vaters zum zweiten Mal – von einem ersten Besuch hatte die Mutter nichts erwähnt – eingehender Besichtigung unterzogen. Er sei bereit, sie zu einem sehr anständigen Preis zu erwerben, und habe sich herzlich nach dem Befinden des Vaters, übrigens auch nach Theresen erkundigt. Als Therese mit gepressten Lippen stumm sitzen blieb und weiterstickte, trat die Mutter näher an sie heran und flüsterte: »Komm – wir sind ihm Dank schuldig, auch du. Es wäre eine Unhöflichkeit. Ich verlange es von dir.« Therese erhob sich und trat mit ihrer Mutter ins Nebenzimmer, wo der Graf eben im Begriffe war, einen großen illustrierten Oktavband, der neben anderen auf dem Tische lag, zu durchblättern. Er erhob sich sofort und äußerte seine Freude, Therese wieder einmal guten Tag sagen zu dürfen. Im Laufe einer höflichen und durchaus unverfänglichen Unterhaltung fragte er die Damen, ob sie nicht vielleicht gelegentlich seinen Wagen zu einem Besuch in der Anstalt beim Herrn Oberstleutnant benützen wollten; auch zu einer Spazierfahrt nach Hellbrunn oder wo immer hin stelle er ihn gerne zur Verfügung; doch schweifte er gleich wieder ab, als er in Theresens Mienen Befremden und Widerstand gewahrte, und entfernte sich bald mit der Bemerkung, dass er nach einer kurzen, aber unaufschiebbaren Reise gleich wieder seine Aufwartung machen werde, um die Bibliotheksangelegenheit in Ordnung zu bringen. Zum Abschied küsste er sowohl der Mutter als der Tochter die Hand.
Als sich die Türe hinter ihm geschlossen hatte, war zuerst ein dumpfes Schweigen; Therese schickte sich an, wortlos das Zimmer zu verlassen, da hörte sie die Stimme ihrer Mutter hinter sich: »Du hättest wohl etwas freundlicher sein können.« Therese wandte sich von der Türe her um: »Ich war es viel zu sehr«, und wollte gehen. Nun begann die Mutter ganz unvermittelt, als hätte sich seit Tagen oder Wochen der Groll in ihr gestaut, mit bösen Worten Therese wegen ihres unmanierlichen, ja frechen Benehmens mit Vorwürfen zu überhäufen. Ob der Graf nicht mindestens ein so feiner Herr sei wie der junge Nüllheim, mit dem das Fräulein Tochter überall in Stadt und Umgebung und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu sehen sei? Ob es nicht hundertmal anständiger sei, sich einem soliden, gesetzten, vornehmen Herrn gegenüber mit einiger Zuvorkommenheit zu benehmen, als sich einem Studiosus an den Hals zu werfen, der mit ihr doch nur seinen Spaß treibe? Und immer unzweideutiger, mit schonungslosen Worten, gab sie der Tochter zu verstehen, welches Wandels sie sie schon längst verdächtige, und ohne Scham sprach sie aus, was sie darum um so mehr von ihr zu erwarten und zu fordern sich für berechtigt halte. »Denkst du, es geht so fort? Wir hungern, Therese. Bist du so verliebt, dass du es nicht merkst? Und der Graf würde für dich sorgen, – für uns alle, für den Vater auch. Und niemand müsste es wissen, nicht einmal dein junger Herr Nüllheim.« Sie hatte sich näher an die Tochter gedrängt, Therese spürte ihren Atem im Gesicht, machte sich los, eilte zur Türe. Die Mutter rief ihr nach: »Bleibe, das Essen ist fertig.« »Ich brauche keines, da wir doch hungern«, höhnte Therese und verließ das Haus.
Es war Mittagszeit, die Straßen fast menschenleer. Wohin? fragte sich Therese. Zu Alfred, der im Hause seiner Eltern wohnte? Ach, der war nicht Manns genug, sich ihrer anzunehmen, sie zu beschützen vor Gefahr und Schande. Und die Mutter, die sich einbildete, er sei ihr Geliebter! Es war zum Lachen, wahrhaftig. Wohin also? Hätte sie nur Geld genug gehabt, sie wäre einfach zum Bahnhof gelaufen, davongereist wo immer hin, am liebsten gleich nach Wien. Dort gab es Gelegenheit genug, sich auf anständige Weise durchzubringen, auch wenn man nicht die letzte Lyzealklasse gemacht hat. Die Schwester einer Schulkameradin zum Beispiel war neulich sechzehnjährig als Kinderfräulein bei einem Hof- und Gerichtsadvokaten in Wien in Stellung getreten, und es ging ihr vortrefflich. Man müsste sich die Sache nur angelegen sein lassen. War es denn nicht längst ihr Plan gewesen? Unverzüglich kaufte sie eine Wiener Zeitung, ließ sich auf einer beschatteten Bank des Mirabellgartens nieder und las die kleinen Anzeigen. Sie fand manche Angebote, die für ihre Zwecke in Betracht kamen. Jemand suchte eine Bonne zu einem fünfjährigen Mädchen, ein anderer eine zu zwei Knaben, ein dritter zu einem geistig etwas zurückgebliebenen Mädchen, in dem einen Hause wurde etwas Kenntnis des Französischen, in einem anderen Fertigkeit in Handarbeiten, in einem dritten Anfangsgründe des Klavierspiels gewünscht. Mit all dem konnte sie dienen. Man war nicht verloren, Gott sei Dank, und bei der nächsten Gelegenheit würde sie einfach ihre Sachen packen und davonfahren. Vielleicht ließe es sich sogar so einrichten, dass sie zugleich mit Alfred nach Wien reiste. Sie lächelte vor sich hin. Ihm vorher gar nichts sagen und einfach in den gleichen Zug einsteigen – ins selbe Coupé, wäre das nicht lustig?! Aber da ertappte sie sich auch schon bei dem Gedanken, dass sie eigentlich lieber allein, ja, lieber sogar mit irgendwem andern diese Reise unternehmen würde, mit einem Unbekannten, mit dem eleganten Fremden zum Beispiel – es war wohl ein Italiener oder Franzose – der ihr früher auf der Salzachbrücke so unverschämt ins Gesicht gestarrt hatte. Und, zerstreut weiterblätternd, las sie in der Zeitung von einem Feuerwerk im Prater, von einem Eisenbahnzusammenstoß, von einem Unfall in den Bergen, und plötzlich kam sie auf eine Überschrift, die sie fesselte: Mordversuch am Geliebten. Da war die Geschichte von einer ledigen Mutter erzählt, die den treulosen Geliebten angeschossen und schwer verletzt hatte. Maria Meitner, so hieß das arme Geschöpf. Ja, auch dergleichen konnte einem passieren … Nein, ihr nicht. Keiner, die klug war. Man musste keinen Liebhaber nehmen, man musste kein Kind haben, man musste überhaupt nicht leichtsinnig sein und vor allem: man durfte keinem Manne trauen.
12
Langsam ging sie nach Hause, sie war ruhig, und in ihrem Herzen kein Zorn gegen die Mutter mehr. Das karge Mittagessen war warm gehalten worden, die Mutter stellte es ihr wortlos auf den Tisch und langte nach der Zeitung, die Therese auf den Tisch gelegt hatte. Sie suchte nach der Romanfortsetzung und las mit gierigen Augen. Therese nahm nach dem Essen ihre Stickerei zur Hand, setzte sich ans Fenster und dachte an das Fräulein Maria Meitner, das nun im Gefängnis saß. Ob sie wohl Eltern gehabt hatte? Ob sie eine Verstoßene war? Ob sie am Ende auch andere Männer in der Tiefe ihres Herzens lieber gehabt hatte als ihren Geliebten? Und warum hatte sie ein Kind bekommen? Es gab ja so viele Frauen, die ihr Leben genossen und keine Kinder bekamen. Allerlei fiel ihr ein, was sie im Lauf der letzten zwei oder drei Jahre in der Residenz und hier von Schulkolleginnen erfahren hatte. Der Inhalt so manchen unanständigen Gesprächs, wie sie dergleichen Unterhaltungen zu nennen pflegten, wurde in ihr lebendig, und ein plötzlicher Widerwille stieg in ihr auf gegen alles, was mit dergleichen Dingen zusammenhing. Sie erinnerte sich, dass sie schon vor zwei oder drei Jahren, zu einer Zeit also, da sie fast noch ein Kind gewesen, mit zwei Freundinnen zusammen beschlossen hatte, ins Kloster zu gehen, und in diesem Augenblick war ihr, als regte sich in ihr eine ganz ähnliche Sehnsucht wie damals. Nur dass diese Sehnsucht heute etwas anderes und mehr bedeutete: Unruhe, Angst – als gäbe es nirgendwo als hinter Klostermauern Sicherheit vor all den Gefahren, die das Leben in der Welt mit sich brachte.
Doch wie nun die Schwüle allmählich wich und über die Häuserwände bis in den vierten Stock hinauf die Abendschatten zogen, da schwand ihre Angst und ihre Traurigkeit, und sie freute sich dem Zusammensein mit Alfred entgegen wie noch nie.
Sie traf ihn draußen vor der Stadt wie gewöhnlich. Seine Augen glänzten mild, und ein solcher Adel schien von seiner Stirn zu strahlen, dass ihr ganz weh ums Herz wurde. Sie fühlte sich ihm in schmerzlicher Weise überlegen, weil sie um soviel mehr vom Leben wusste oder ahnte als er; und zugleich seiner nicht ganz würdig, weil er aus so viel reineren Lüften kam als sie. In Gestalt und Haltung glich er seinem Vater, dem sie oft genug in den Straßen der kleinen Stadt begegnet war, ohne dass er ihrer geachtet oder auch nur gewusst hätte, wer sie war. Auch Alfreds Mutter, die große blonde Frau, und seine beiden Schwestern kannte sie von Angesicht; die mochten wohl etwas vermuten; denn neulich einmal, bei einer zufälligen Begegnung, hatten sie sich beide zugleich neugierig nach ihr umgewandt. Sie waren zwanzig und neunzehn und würden wohl bald beide heiraten. Die Familie war wohlhabend und hochgeachtet. Ja, die hatten es leicht. Und dass der Dr. Sebastian Nüllheim, Arzt in den besten Familien der Stadt, je ins Narrenhaus kommen könnte, das war ein völlig unfassbarer Gedanke. – Alfred merkte, dass Therese mit ihren Gedanken wo anders war, er fragte sie, was ihr sei, sie schüttelte nur den Kopf und drückte innig Alfreds Hand. Die Tage waren schon kurz, es begann zu dunkeln. Alfred und Therese saßen auf einer Bank im Grünen; weit dehnte sich die Ebene, die Berge waren fern, ein dumpfes Rauschen klang aus der Stadt herbei, der Pfiff einer Lokomotive hallte lang und leise, jenseits der Wiese, über die Landstraße, rollte ab und zu ein Wagen, Fußgänger schatteten vorüber. Alfred und Therese hielten einander umschlungen, Theresens Herz schwoll vor Zärtlichkeit; und wenn sie später dieser ersten Liebe dachte, war es immer wieder diese Abendstunde, die in ihrem Gedächtnis aufschwebte: sie und er auf einer Bank zwischen Feldern und Wiesen, auf weithingedehnter Ebene, darüber die Nacht, die sich von Berg zu Berg spannte, verklingende Pfiffe aus der Ferne und von einem unsichtbaren Teich her Fröschequaken.
13
Manchmal sprachen sie von der Zukunft. Alfred nannte Therese seine Liebste, seine Braut. Sie müsse auf ihn warten, in sechs Jahren spätestens sei er Doktor, und dann würde sie sein Weib. Und als wäre nun ein geheimnisvoller Schutz um sie, wie ein Heiligenschein um die Stirn – in diesen Tagen bekam sie von der Mutter kein böses Wort zu hören, ja, diese verhielt sich geradezu liebevoll zu ihr.
Eines Morgens trat sie zu Theresen ans Bett mit flimmernden Augen, reichte ihr ein Zeitungsblatt hin; da war auf dem für dergleichen vorbehaltenen Raum der Beginn eines Romans abgedruckt: »Der Fluch des Magnaten, von Julie Fabiani-Halmos«. Und sie setzte sich auf den Bettrand, während Therese für sich zu lesen begann. Die Geschichte fing an wie hundert andere, und jeder Satz erschien Theresen, als hätte sie ihn schon hundertmal gelesen. Als sie fertig war und der Mutter wie in Bewunderung, doch wortlos, zunickte, nahm diese die Zeitung zur Hand und las nun das Ganze laut, wichtig und ergriffen vor. Dann sagte sie: »Drei Monate lang wird der Roman laufen. Die Hälfte habe ich schon bezahlt bekommen – fast so viel wie eine halbjährige Oberstleutnantspension.«
Als Therese am Abend dieses Tages mit Alfred zusammentraf, war er zu ihrer angenehmen Überraschung sorgfältiger, geradezu elegant gekleidet, ja, man hätte ihn für einen der vornehmen Reisenden nehmen können, wie zu dieser Zeit so viele in der Stadt zu sehen waren. Alfred freute sich der Befriedigung, die er in Theresens Augen las, und eröffnete ihr mit scherzhafter Förmlichkeit, dass er sich die Ehre gebe, sie für heute zu einem Abendessen im Hotel Europe einzuladen. Vergnügt nahm sie an, und bald saßen sie beide in dem hell erleuchteten, parkartigen Garten an einem köstlich gedeckten Tisch, für sich allein, unter vielen unbekannten Menschen, wie ein vornehmes Paar auf der Hochzeitsreise. Der Kellner nahm etwas herablassend Alfreds Bestellung entgegen; ein vortreffliches Mahl wurde aufgetragen, und an ihrem Appetit merkte Therese, dass sie sich tatsächlich seit längerer Zeit nicht so eigentlich satt gegessen hatte. Auch der milde, süße Wein schmeckte ausgezeichnet, und während sie anfangs etwas eingeschüchtert sich kaum recht umzusehen gewagt hatte, ließ sie nun die Augen immer lebhafter und unbefangener im Kreise gehen. Von da und dort richteten sich Blicke auf sie, nicht nur von jüngeren und älteren Herren, auch von Damen, Blicke des Wohlgefallens, ja der Bewunderung. Alfred war sehr aufgeräumt, redete allerlei galantes, ziemlich törichtes Zeug, wie es sonst seine Art gar nicht war, und Therese lachte manchmal in einer unnatürlich grellen Weise dazu auf. Als Alfred sie zum dritten- oder vierten Mal im Flüsterton fragte – er hatte eben keinen Überfluss an lustigen Einfällen –, wofür man sie beide wohl halten möchte: für ein durchgegangenes Liebespärchen auf der Flucht oder für ein junges Ehepaar aus Frankreich auf der Hochzeitsreise –, gingen einige Offiziere am Tisch vorbei, unter denen Therese sofort jenen schwarzhaarigen mit den gelben Aufschlägen erkannte, dessen sie in den letzten Wochen allzu viel hatte denken müssen. Auch der Offizier erkannte sie gleich; sie wusste es, obwohl er nichts dergleichen tat, sondern wohlanständig seinen Blick wieder abwandte und sich nicht, wie sie erwartet, an einem benachbarten, sondern in Gesellschaft seiner Kameraden an einem ziemlich entfernten Tische niederließ. Mit Alfreds guter Laune war es plötzlich vorbei. Es war ihm nicht entgangen, dass Theresens Augen aufgeleuchtet hatten, und er fühlte mit der eifersüchtigen Ahnung des Liebenden, dass etwas Verhängnisvolles geschehen war. Als er ihr das Glas wieder voll schenkte, drückte sie ihm wie schuldbewusst die Hand, und zugleich ihre Ungeschicklichkeit fühlend, sagte sie plötzlich: »Wollen wir nicht gehen?« »Die Mutter wird unruhig sein«, setzte sie hinzu, obzwar sie wusste, dass sie das nicht zu befürchten hatte. »Und was hast denn du zu Hause gesagt, Alfred?« Er errötete. »Du weißt ja«, erwiderte er, »meine Familie ist verreist.« – »Ach ja«, sagte sie. Darum also war er heute so kühn gewesen, sie hätte sich’s denken können. Und wie linkisch er sich jetzt erhob, nachdem er die Rechnung beglichen! Und statt dass er ihr den Vortritt ließ, wie es die Sitte erforderte, ging er vor ihr einher, und da merkte sie, dass er eigentlich doch nicht anders aussah als ein Schuljunge im Sonntagsgewand. Sie aber in ihrem einfachen, blauweißen Foulardkleid spazierte zwischen den Tischen dem Ausgang zu, wie eine junge Dame, die gewohnt wäre, jeden Abend unter vornehmen Fremden in einem großen Hotel zu speisen. Ja, ihre Mutter war eben doch eine Baronin, war in einem Schlosse aufgewachsen, hatte ein wildes Pony geritten; und zum ersten Mal in ihrem Leben war Therese ein wenig stolz darauf.
Sie gingen schweigend durch die stillen Gassen, Alfred nahm Theresens Arm, drückte ihn an den seinen. »Was würdest du dazu sagen«, bemerkte er in einem leichten Ton, der ihm nicht wohl anstand, »wenn man noch in ein Kaffeehaus ginge?« Sie lehnte ab. Es sei schon zu spät. – Ach ja, ein Schulbub! Er hätte nun wohl etwas anderes verlangen dürfen als eine Abschiedsstunde im Kaffeehaus. Warum zum Beispiel rief er nicht dort den Kutscher an, der auf dem Bock schlief, um mit ihr zusammen in die schöne, milde Sommernacht hinauszufahren? Wie hätte sie sich in seinen Arm geschmiegt, wie heiß ihn geküsst, wie lieb hätte sie ihn gehabt. Aber dergleichen kluge Einfälle durfte sie von Alfred nicht erwarten. – Bald standen sie vor Theresens Haustor. Die Straße war völlig dunkel. Alfred zog Therese an sich, heftiger als er es je getan, sie gab ihre Lippen den seinen mit Inbrunst hin, und mit geschlossenen Augen wusste sie, wie edel und rein seine Stirn war. Als sie die Treppen hinaufstieg, war sie voll Sehnsucht und Traurigkeit. Leise sperrte sie die Wohnungstüre auf, damit die Mutter nicht aufwache, dann lag sie noch lange im Bette wach und dachte, dass es heute abend doch nicht das Rechte gewesen war.
14
Am nächsten Tag, während sie mit der Mutter bei Tische saß, brachte man aus der Blumenhandlung wundervolle weiße Rosen in einem schlanken, geschliffenen Kelch. Ihr erster Gedanke war: der Offizier, ihr nächster: Alfred. Doch auf dem Kärtchen stand zu lesen: »Graf Benkheim bittet das liebe kleine Fräulein Therese die mitfolgenden bescheidenen Blumen freundlichst entgegennehmen zu wollen.« Die Mutter sah vor sich hin, als ginge sie das Ganze nichts an. Therese stellte das Glas mit den Blumen auf die Kommode, vergaß, sich wieder an den Tisch zu setzen, nahm ein Buch zur Hand und ließ sich in den Schaukelstuhl am Fenster sinken. Die Mutter aß allein weiter, sprach kein Wort und verließ dann mit schlürfendem Schritt das Zimmer.
Am gleichen Abend, auf dem Weg zum Bahnhof, in dessen Nähe Therese für heute eine Zusammenkunft mit Alfred verabredet hatte – sie wählten beinahe täglich einen anderen Punkt –, begegnete Therese dem Offizier. Er grüßte mit vollendeter Höflichkeit, ohne die Tatsache ihrer geheimen Vertrautheit auch nur durch ein Lächeln unzart zu betonen. Sie dankte unwillkürlich, dann aber beschleunigte sie ihre Schritte, so dass sie fast ins Laufen geriet, und war froh, dass Alfred, der sie schon erwartete, ihre Erregung nicht merkte. Er schien verlegen, verstimmt. Sie gingen die staubige, etwas langweilige Straße gegen Maria Plain weiter in einem mühseligen Gespräch, darin des gestrigen Abends mit keinem Worte gedacht wurde, kehrten bald wieder um, da ein Gewitter drohte, und trennten sich früher als sonst.
Die nächsten Abende aber, in all ihrer Traurigkeit, waren schön. Der Abschied war nah. In den ersten Septembertagen sollte Alfred nach Wien fahren, um dort vorerst mit seinem Vater zusammenzutreffen. Therese wurde es schwer ums Herz, wenn Alfred von der bevorstehenden Trennung redete, sie immer wieder beschwor, ihm Treue zu bewahren und der Mutter zu möglichst baldiger Übersiedelung nach Wien dringend zuzureden. Sie hatte ihm erzählt, dass die Mutter vorläufig nichts davon wissen wolle; vielleicht, dass es ihr gelänge, im Laufe des kommenden Winters sie allmählich dazu zu bestimmen. Von all dem war nichts wahr. Vielmehr befestigte sich in Theresen der Vorsatz immer mehr, das Elternhaus allein zu verlassen, ohne dass dabei der Gedanke an Alfred überhaupt eine Rolle spielte.
Es war längst nicht mehr die einzige Unaufrichtigkeit, die sie sich ihm gegenüber vorzuwerfen hatte. Wenige Tage nach jener Begegnung in der Nähe des Bahnhofs hatte sie den jungen Offizier wiedergesehen: er war ihr auf dem Domplatz entgegengetreten, als sie eben die Kirche verließ, die sie manchmal zu dieser Stunde nicht so sehr aus Frömmigkeit als aus einer Sehnsucht nach friedlichem Alleinsein in dem hohen, kühlen Raum zu betreten pflegte. Und er, als wäre es die natürlichste Sache von der Welt, war vor ihr stehengeblieben, hatte sich vorgestellt – sie verstand nur den Vornamen Max – und hatte sie um Entschuldigung gebeten, dass er diese Gelegenheit, auf geraume Zeit hinaus die letzte, zu benützen sich die Freiheit nehme, um Therese endlich persönlich kennenzulernen. Denn nun gehe er mit dem Regiment, dem er seit einem Monat zugeteilt sei, auf Manöver für drei Wochen, – und während dieser drei Wochen, das wünschte er sich so sehr, sollte doch das Fräulein Therese – oh, selbstverständlich kenne er ihren Namen, Fräulein Therese Fabiani sei durchaus keine unbekannte Persönlichkeit in Salzburg, und von der Frau Mama stehe ja jetzt ein Roman im Tageblatt; – nun, er wünsche, dass Fräulein Therese an ihn während seiner Abwesenheit wie an einen guten Bekannten denke, wie an einen Freund, einen stillen, schwärmerischen, geduldig hoffenden Freund. Und dann hatte er ihre Hand genommen und geküsst – und war auch schon verschwunden. Sie hatte sich rings umgesehen, ob irgend jemand von dieser Begegnung etwas bemerkt hätte. Doch der Domplatz lag fast menschenleer im grellen Sonnenschein, nur drüben gingen ein paar Frauen, die ihr natürlich vom Sehen bekannt waren – wen kannte man nicht in der kleinen Stadt –, aber von denen würde Alfred wohl nie erfahren, dass ein Offizier mit ihr gesprochen und ihr die Hand geküsst hatte. Er erfuhr ja überhaupt nichts, er wusste auch nicht, dass der Graf Benkheim ins Haus kam, nichts von den ersten Rosen, die der Graf ihr geschickt, nichts von den andern, die heute morgen gekommen waren, auch nichts von dem veränderten Benehmen der Mutter, die nun immer so freundlich und sanft zu ihr war, als könne sie der weiteren Entwicklung der Dinge mit Beruhigung entgegensehen. Und Therese hatte es auch ruhig geschehen lassen, dass allerlei Neues für sie angeschafft worden war. Nicht eben viel und Kostbares, aber immerhin manches, was sie wohl brauchen konnte: Wäsche, zwei Paar neue Schuhe, ein englischer Stoff für ein Straßenkleid; sie merkte auch, dass das Essen daheim besser geworden war, und konnte sich wohl zusammenreimen, dass all dies nicht von dem Romanhonorar bestritten würde, der nun Tag für Tag in der Zeitung weiterlief. Aber das war auch alles ganz gleichgültig. Es dauerte ja nicht mehr lange. Sie war fest entschlossen, das Haus zu verlassen, und am klügsten, dachte sie, wäre es wohl, über alle Berge zu sein, ehe der Leutnant von den Manövern wieder zurückkehrte. Von all dem, von Tatsachen wie von Erwägungen, wusste Alfred nichts. Er nannte sie weiter Liebste und Braut und redete wie von etwas durchaus Möglichem, ja geradezu Selbstverständlichem, dass er in sechs Jahren als Doktor der gesamten Heilkunde Fräulein Therese Fabiani zum Altar führen werde. Und wenn sie abends, wie es immer wieder geschah, auf jener Bank im Felde seinen Liebesworten lauschte und sie manchmal sogar erwiderte, glaubte sie beinahe selbst alles, was er, und manches von dem, was sie selbst sagte.
15
Eines Morgens – nach einem Abend, der gewesen war wie so viele andere vorher – kam ein Brief von ihm. Nur ein paar Worte. Wenn sie sie läse, so schrieb er, säße er schon im Zug nach Wien; er hätte es nicht übers Herz gebracht, ihr das gestern abend zu sagen, sie möge es verstehen und verzeihen, er liebe sie unsagbar, er wisse es in diesem Moment stärker als je, dass diese Liebe ewig währen würde. – Sie ließ das Blatt sinken, sie weinte nicht, aber sie war sehr unglücklich. Aus. Sie wusste, dass es aus war für immer. Und es war mehr unheimlich als traurig, dass sie das wusste und er nicht. – Die Mutter kam aus der Stadt zurück. Sie war auf dem Markt gewesen, einkaufen. »Weißt du, wer heute früh«, fragte sie vergnügt, »mit Koffer und Tasche an mir vorbeigefahren ist zur Bahn? Dein Seladon.1 Ja, nun ist er fort, hast du nicht gesehen.« Es war ihre Art, solche verblassten, aus der Mode gekommenen Romanphrasen ins Gespräch einzustreuen. Die Aufgeräumtheit der Mutter ließ deutlich erkennen, dass sie nun das schwerste, ja, das einzige Hindernis ihrer Pläne für beseitigt hielt. Therese aber dachte im gleichen Augenblick: Fort, nur fort. Heute noch, gleich, ihm nach. Die paar Gulden für die Reise borg’ ich mir aus – Klara hoffentlich …
Sie verließ das Haus, bald stand sie unter den Fenstern, hinter denen ihre Freundin wohnte, aber sie konnte sich kein Herz fassen, die Treppen hinaufzugehen. Übrigens waren die Vorhänge heruntergelassen, vielleicht waren Traunfurts aus der Sommerfrische noch nicht zurück. Doch da trat Klara aus dem Haustor, hübsch und adrett gekleidet wie immer, hold und unschuldig anzusehen, begrüßte Therese mit übertriebener Herzlichkeit und war gleich bei den Themen, die sie am meisten liebte. Ohne etwas Bedenkliches oder gar Unanständiges in Worten auszudrücken, spielte unter dem, was sie sagte, eine ununterbrochene Welle zweideutiger Gedanken. Nachdem sie beiläufig bedauert, dass man jetzt so gar nicht mehr zusammenkomme, erwähnte sie gleich die Familie Nüllheim, in einem Ton, der Therese nicht zweifeln ließ, dass die Freundin ihre Beziehungen zu Alfred für anders geartet hielt, als sie in Wirklichkeit waren. Therese, nicht verletzt, sondern nur im Gefühl ihrer Unschuld, klärte Klara auf, worauf diese einfach und fast etwas verächtlich bemerkte: »Wie kann man so dumm sein.« Eine bekannte Dame näherte sich, und Klara verabschiedete sich auffallend rasch von Theresen. –
Abends zu der Stunde, in der Therese sonst mit Alfred zusammenzukommen pflegte, versuchte sie ihm zu schreiben. Sie wunderte sich, wie schwer es ihr von der Hand ging, und so ließ sie sich an ein paar flüchtigen Worten genügen: dass sie noch viel unglücklicher sei als er, dass sie keinen anderen Gedanken habe als ihn allein und dass sie hoffe, Gott werde alles zum Guten wenden. – Sie trug den Brief auf die Post, ach, sie wusste, dass es ein dummer und unaufrichtiger Brief war, ging gleich wieder heim, vermochte nichts Rechtes anzufangen, nahm eine Handarbeit vor, versuchte zu lesen, spielte Skalen und Läufe, endlich, unruhig und gelangweilt zugleich, blätterte sie in den Zeitungsnummern, die den Roman ihrer Mutter enthielten. Was war das für eine abgeschmackte Geschichte, und mit welch hochtrabenden Worten war sie erzählt. Es war der Roman einer adeligen Familie. Der Vater war ein harter, strenger, aber doch großherziger Magnat mit dicken Augenbrauen, von denen immer wieder die Rede war, die Mutter sanft, wohltätig und kränklich, der Sohn ein Spieler, Duellant, Verführer, die Tochter engelrein und blond, eine wahre Märchenprinzessin, wie sie auch immer wieder genannt wurde; ein düsteres Familiengeheimnis harrte der Lösung, und irgendwo im Park, ein uralter Diener wusste das, lag von der Türkenzeit her ein Schatz vergraben. Es gab auch manches sinnige Wort über Frömmigkeit und Tugend in dem Werk zu lesen, und kein Mensch hätte der Schreiberin zutrauen können, dass sie es darauf angelegt hatte, ihre Tochter an einen alten Grafen zu verkuppeln.