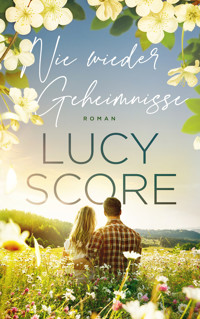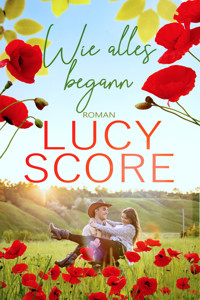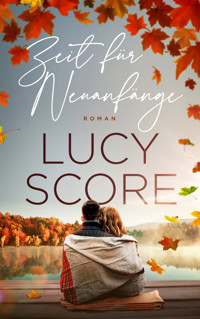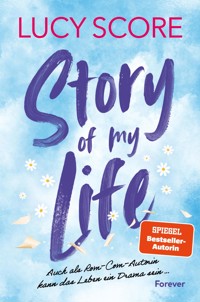8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knockemout
- Sprache: Deutsch
Endlich gibt es die Kleinstadt-Erfolgsserie auf Deutsch Der Tag könnte für Naomi nicht schlechter laufen. In einer Kurzschlussreaktion flieht sie von ihrer eigenen Hochzeit, wird von ihrer entfremdeten Zwillingsschwester ausgetrickst, steht ohne Auto und Handtasche da und muss sich plötzlich um ihre Nichte kümmern, von der sie nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Entgeistert bittet sie im erstbesten Diner um Hilfe – und wird hochkant hinausgeworfen. Denn ihre Zwillingsschwester, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht, ist in Knockemout äußerst unbeliebt. Und als ein attraktiver Fremder sie auf der Straße anbrüllt, reißt ihr die Hutschnur. Wo ist sie hineingeraten? Bad Boy Knox hat in seinem Leben keinen Platz für Drama. Doch die wunderschöne Fremde, die aus dem Nichts für Unruhe in Knockemout sorgt, bringt alles durcheinander. Als Naomis Leben direkt vor seinen Augen implodiert, ist das Mindeste, was Knox für sie und ihre Nichte tun kann, sein Gästehaus anzubieten. Doch dann werden aus ihren Schwierigkeiten handfeste Probleme … Knox ist sich sicher: Er wird sich auf gar keinen Fall verlieben. Band 1: Things We Never Got Over Band 2: Things We Hide From the Light Band 3: Things We Left Behind
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Things We Never Got Over
Lucy Score ist New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin. Sie wuchs in einer buchverrückten Familie in Pennsylvania auf und studierte Journalismus. Wenn sie nicht gerade ihre herzzerreißenden Protagonist:innen begleitet, kann man Lucy auf ihrer Couch oder in der Küche ihres Hauses in Pennsylvania finden. Sie träumt davon, eines Tages auf einem Segelboot, in einer Wohnung am Meer oder auf einer tropischen Insel mit zuverlässigem Internet schreiben zu können.
Endlich gibt es die Kleinstadt-Erfolgsserie auf Deutsch
Der Tag könnte für Naomi nicht schlechter laufen. In einer Kurzschlussreaktion flieht sie von ihrer eigenen Hochzeit, wird von ihrer entfremdeten Zwillingsschwester ausgetrickst, steht ohne Auto und Handtasche da und muss sich plötzlich um ihre Nichte kümmern, von der sie nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Entgeistert bittet sie im erstbesten Diner um Hilfe – und wird hochkant herausgeworfen. Denn ihre Zwillingsschwester, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht, ist in Knockemout äußerst unbeliebt. Und als ein attraktiver Fremder sie auf der Straße anbrüllt, reißt ihr die Hutschnur. Wo ist sie hineingeraten?
Bad Boy Knox hat in seinem Leben keinen Platz für Drama. Doch die wunderschöne Fremde, die aus dem Nichts für Unruhe in Knockemout sorgt, bringt alles durcheinander. Als Naomis Leben direkt vor seinen Augen implodiert, ist das Mindeste, was Knox für sie und ihre Nichte tun kann, sein Gästehaus anzubieten. Doch dann werden aus ihren Schwierigkeiten handfeste Probleme …
Knox ist sich sicher: Er wird sich auf gar keinen Fall verlieben.
Lucy Score
Things We Never Got Over
Roman
Aus dem Englischen von Dorothee Witzemann
Forever by Ullsteinwww.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin1. Auflage April 2023© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023© 2022 by Lucy ScorePublished by arrangement with Bookcase Literary AgencyDie amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel: Things We Never Got Over.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von © Kari March DesignsAutorinnenfoto: © Brianna WilburE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-95818-744-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1 Schlimmster. Tag. Ever
2 Ein Held wider Willen
3 Eine winzige Kriminelle
4 »Du bleibst hier nicht.«
5 Ein Fass Benzin und ein Nickerchen
6 Spargel und ein Showdown
7 Ein Schlag ins Gesicht
8 Die mysteriöse Liza J.
9 Urinieren im Garten & eine Bibliothek
10 Haarschnitte und Nervensägen
11 Ein Chef aus der Hölle
12 Heimfahrt
13 Geschichtsunterricht
14 Die Dinnerparty
15 Knox geht einkaufen
16 Der berühmt-berüchtigte Stef
17 Von Mann zu Mann
18 Typveränderungen für alle
19 Hohe Einsätze
20 Eine Gewinnerhand
21 Familiärer Notfall
22 Ein Kriegsbeil, zwei Kugeln
23 Knox, Knox. Wer ist da?
24 Unerwartete Gäste
25 Familienrummel
26 PMS und Mobbing
27 Feldmaus-Rache
28 Die dritte Base
29 Knox’ Haus
30 Das Frühstück of Shame
31 Zwielichtiges zwischen den Regalen
32 Mittagessen und eine Warnung
33 Ein geschickter Kick
34 Der Bräutigam
35 Die ganze Geschichte und ein Happy End
36 Der Einbruch
37 Eine Rasur und ein Haarschnitt
38 Alles gut
39 Aus, Ende, vorbei
40 Die Konsequenzen des Idiotendaseins
41 Die neue Naomi
42 Der alte Knox
43 Daydrinking
44 Die Babysitter
45 Abgeschleppt
46 Tina ist scheiße
47 Verschwunden
48 Das alte Verwirrspiel
49 Die Kavallerie
Epilog Partytime
Bonus-Epilog Fünf Jahre später
Anmerkung der Autorin
Danksagungen
Leseprobe: Story of My Life
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1 Schlimmster. Tag. Ever
Widmung
Für Josie, Jen und Claire, die unerschrockensten Herzen.
1 Schlimmster. Tag. Ever
Naomi
Ich wusste nicht so recht, was ich zu erwarten hatte, als ich das Café Rev betrat, aber ein Foto von mir selbst unter der fröhlichen Überschrift »Hausverbot« ganz sicher nicht.
Erstens: Ich hatte noch nie einen Fuß in die Stadt Knockemout, Virginia, gesetzt, ganz zu schweigen davon, dass ich niemals etwas getan hätte, was eine so ungeheuerliche Strafe wie Koffeinentzug rechtfertigte. Zweitens: Was musste eine Person in dieser angestaubten Kleinstadt anstellen, damit ihr Verbrecherfoto im örtlichen Café aufgehängt wurde?
Wie depresso. Ha. Weil ich in einem Café war. Meine Güte, war ich witzig, wenn ich sogar zum Blinzeln zu müde war.
So oder so war es drittens ein unglaublich unschmeichelhaftes Bild. Ich sah aus, als hätte ich einen Dreier mit einer Sonnenbank und einem billigen Eyeliner gehabt.
Ungefähr in diesem Moment drang die Realität in meinen erschöpften, benommenen, fast zu Tode mit Haarnadeln gespickten Kopf vor.
Wieder einmal hatte Tina es geschafft, mein Leben ein klein bisschen schlimmer zu machen. Und angesichts dessen, was in den letzten vierundzwanzig Stunden passiert war, wollte das schon was heißen.
»Kann ich Ihnen …?« Der Mann hinterm Tresen, die Person, die mir meinen geliebten Latte geben konnte, machte einen Schritt rückwärts und hob Hände in der Größe von Suppentellern. »Ich will keinen Ärger.«
Er war ein bulliger Typ mit glatter dunkler Haut und einem rasierten, schön geformten Kopf. Sein sauber getrimmter Bart war schneeweiß, und ich entdeckte ein paar Tattoos, die am Kragen und an den Ärmeln seines Overalls herauslugten. Der Name Justice war auf seine eigenartige Uniform gestickt.
Ich versuchte mein gewinnendstes Lächeln, aber dank des nächtlichen Roadtrips, den ich durch künstliche Wimpern weinend verbracht hatte, fühlte es sich eher nach einer Grimasse an.
»Das bin nicht ich«, sagte ich und zeigte mit einem Finger mit zerstörter French-Maniküre auf das Foto. »Ich bin Naomi. Naomi Witt.«
Der Mann starrte mich misstrauisch an, dann zog er eine Brille aus der vorderen Tasche seines Overalls.
Blinzelnd musterte er mich von Kopf bis Fuß. Ich sah, wie es ihm langsam dämmerte.
»Zwillinge«, erklärte ich.
»Tja, Scheiße«, murmelte er und strich mit einer seiner großen Hände über seinen Bart.
Justice sah immer noch ein bisschen skeptisch aus. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Wie viele Leute hatten schließlich wirklich einen bösen Zwilling?
»Das ist Tina. Meine Schwester. Ich soll sie hier treffen.« Für die Frage, warum mich meine entfremdete Zwillingsschwester bat, sie in einem Etablissement zu treffen, in dem sie eindeutig nicht willkommen war, war ich zu müde.
Justice starrte mich immer noch an, und mir wurde bewusst, dass sein Blick auf meinen Haaren ruhte. Reflexhaft tätschelte ich meinen Kopf, und ein verwelktes Gänseblümchen flatterte zu Boden. Ups. Wahrscheinlich hätte ich im Motel einen Blick in den Spiegel werfen sollen, bevor ich wie eine zerzauste und verstörte Fremde einen Fuß in die Öffentlichkeit setzte.
»Hier«, sagte ich, zog meinen Führerschein aus der Tasche meiner Yogashorts und streckte ihn dem Mann hin. »Sehen Sie? Ich bin Naomi, und ich hätte wirklich, wirklich gern einen sehr großen Milchkaffee.«
Justice nahm meinen Führerschein und musterte ihn genau, dann wieder mein Gesicht. Endlich wurde sein stoischer Gesichtsausdruck zu einem breiten Grinsen. »Ich fass es nicht. Es freut mich, dich kennenzulernen, Naomi.«
»Es ist auch wirklich schön, dich kennenzulernen, Justice. Vor allem, wenn du mir jetzt das bereits erwähnte Koffein zubereitest.«
»Ich mache dir einen Latte, von dem dir die Haare zu Berge stehen werden«, versprach er.
Ein Mann, der meine unmittelbaren Bedürfnisse verstand und sie mit einem Lächeln befriedigte. Ich konnte nicht anders: Ich verliebte mich auf der Stelle ein kleines bisschen in ihn.
Während sich Justice an die Arbeit machte, bewunderte ich das Café. Die Einrichtung sah stilmäßig nach Männergarage aus: Wellblech an den Wänden, glänzende rote Regale, gefleckter Betonboden. Alle Getränke hatten Namen wie Red Line Latte und Checkered Flag Cappuccino. Es war wirklich charmant.
An den kleinen runden Tischen, die im Raum verteilt standen, saß eine Handvoll frühmorgendliche Kaffeetrinker. Ausnahmslos alle schauten mich an, als freuten sie sich wirklich nicht, mich zu sehen.
»Was hältst du von Bacon-Ahornsirup, Darling?«, rief Justice hinter der schimmernden Espressomaschine.
»Sehr viel halte ich davon. Vor allem, wenn er in einem Becher in Eimergröße kommt.«
Sein Lachen hallte im Raum wider und schien die restlichen Gäste zu entspannen, die mich jetzt wieder ignorierten.
Die Eingangstür öffnete sich, und ich drehte mich in Erwartung von Tina um.
Doch der Mann, der hereinstürmte, war definitiv nicht meine Schwester. Er sah aus, als hätte er Koffein noch dringender nötig als ich.
Heiß wäre eine angemessene Art, ihn zu beschreiben. Höllisch heiß eine noch präzisere. Er war groß genug, dass ich mein höchstes Paar Heels tragen könnte und trotzdem noch den Kopf in den Nacken legen müsste, um ihn zu küssen – meine offizielle Kategorisierung männlicher Größe. Seine Haare bewegten sich farblich im straßenköterblonden Bereich, waren an den Seiten kurz geschnitten und oben nach hinten gekämmt, was auf einen guten Geschmack und brauchbare Körperpflegekompetenzen schließen ließ.
Beide Kriterien standen weit oben auf meiner Liste der Gründe, mich zu einem Mann hingezogen zu fühlen. Das mit dem Bart war neu. Ich hatte noch nie einen Mann mit Bart geküsst und bekam ein plötzliches, irrationales Interesse, das irgendwann mal zu erleben.
Dann kam ich zu seinen Augen. Sie waren von einem kühlen Blaugrau, bei dem ich an Metall und Gletscher denken musste.
Er marschierte direkt auf mich zu und hielt so dicht vor mir an, als besäße er eine Pauschaleinladung in meinen Personal Space. Als er tätowierte Unterarme vor einer breiten Brust verschränkte, machte ich hinten im Hals ein Quiekgeräusch.
Wow.
»Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt«, knurrte er.
»Äh. Hä?«
Der Mann starrte mich finster an, als wäre ich die meistgehasste Figur in einer Reality-TV-Sendung, und doch wollte ich immer noch wissen, wie er nackt aussah. So ein erbärmliches sexuelles Urteilsvermögen hatte ich seit dem College nicht mehr gezeigt.
Ich schob es auf meine Erschöpfung und die emotionalen Narben.
Hinter dem Tresen hielt Justice mitten in der Latte-Erschaffung inne und wedelte mit beiden Händen in der Luft. »Warte mal«, begann er.
»Ist schon okay, Justice«, versicherte ich ihm. »Mach du einfach weiter diesen Kaffee, und ich kümmere mich um diesen … Herrn hier.«
Um uns herum wurden Stühle von Tischen abgerückt, und ich sah, wie bis zum letzten Gast einfach alle auf direktem Weg die Tür ansteuerten. Manche nahmen sogar ihre noch vollen Tassen mit. Keiner von ihnen sah mir auf dem Weg nach draußen in die Augen.
»Knox, es ist nicht so, wie du denkst«, versuchte es Justice noch mal.
»Ich spiele heute keine Spielchen. Verpiss dich einfach«, befahl der Wikinger. Der blonde sexy Rachegott sank rapide auf meiner Sexyness-Checkliste.
Ich deutete auf meine Brust. »Ich?«
»Mir reicht’s. Du hast fünf Sekunden, dann bist du hier raus«, sagte er und kam noch näher, bis seine Stiefelspitzen meine nackten Zehen in ihren Flipflops berührten.
Verdammt. Aus der Nähe sah er aus, als wäre er gerade von einem Wikingerschiff gestürmt … oder vom Set einer Parfümwerbung. Für eines dieser künstlerischen Düfte, die keinen Sinn ergaben und Namen wie Ignorant Beast trugen.
»Hören Sie, Sir. Ich stecke gerade mitten in einer persönlichen Krise, und alles, was ich hier will, ist eine Tasse Kaffee.«
»Scheiße, Tina, ich hab’s dir gesagt: Wenn du noch mal herkommst und Justice oder seine Gäste belästigst, geleite ich dich höchstpersönlich aus der Stadt.«
»Knox …«
Das grumpy, sexy Tier hob den Finger in Justices Richtung. »Sekunde, Mann. Sieht aus, als müsste ich den Müll rausbringen.«
»Den Müll?« Ich schnappte nach Luft. Ich dachte, in Virginia wären alle so freundlich. Doch ich war kaum eine halbe Stunde hier und wurde schon wüst von einem Wikinger mit Höhlenmenschen-Manieren angepöbelt.
»Darling, dein Kaffee ist fertig«, sagte Justice und schob einen sehr großen Becher zum Mitnehmen über den Holztresen.
Mein Blick huschte zu dem dampfenden koffeinierten Gold.
»Denk nicht mal dran, diesen Becher zu nehmen, sonst haben wir ein Problem«, sagte der Wikinger mit leiser Stimme.
Aber Leif Eriksson wusste nicht, mit wem er sich heute anlegte.
Jede Frau hatte ihre Grenzen. Meine, die zugegebenermaßen zu weit hinten lag, war gerade überschritten worden.
»Mach nur einen Schritt auf diesen wunderschönen Caffè Latte zu, den mein Freund Justice extra für mich gemacht hat, und du bereust, mich je getroffen zu haben.«
Ich war ein netter Mensch. Laut diesem Online-Quiz, das ich vor zwei Wochen gemacht hatte, war ich eine People-Pleaserin. Ich war nicht besonders gut im Drohen.
Die Augen des Mannes wurden schmal, und ich weigerte mich, die sexy Fältchen in den Winkeln zu bemerken.
»Ich bereue es jetzt schon, und genauso geht es der ganzen verdammten Stadt. Nur weil du deine Frisur änderst, vergesse ich bestimmt nicht den Ärger, den du hier gemacht hast. Und jetzt schwing deinen Hintern zur Tür raus und komm nicht wieder.«
»Er hält dich für Tina«, warf Justice ein.
Und wenn mich dieser Arsch für eine kannibalische Serienkillerin hielt, es war mir egal: Er stand zwischen mir und meinem Koffein.
Das blonde Tier drehte den Kopf zu Justice. »Was redest du da?«
Bevor mein netter Freund mit dem Kaffee es erklären konnte, bohrte ich meinen Finger in die Brust des Wikingers. Dank der unverschämten Muskelschicht unter seiner Haut kam ich nicht weit. Aber ich achtete darauf, dass mein Fingernagel traf.
»Jetzt hörst du mir mal zu«, begann ich. »Es ist mir egal, ob du mich für meine Schwester hältst oder für das hinterhältige Arschloch, das den Preis für Malariamedikamente in die Höhe getrieben hat. Ich bin ein menschliches Wesen, ich hatte gestern den schlimmsten Tag meines Lebens, und der heute ist auch echt beschissen. Also geh mir besser aus dem Weg und lass mich in Ruhe, Wikinger!«
Eine Sekunde lang sah er vollkommen ratlos aus.
Ich wertete das als Zeichen dafür, dass es Zeit für meinen Kaffee war. Ich drängte mich an ihm vorbei, nahm den Becher, schnupperte den köstlichen Duft und schwelgte in der dampfend heißen Lebenskraft.
Ich trank einen großen Schluck, wartete darauf, dass das Koffein seine Wunder wirkte, während Aromen auf meiner Zunge explodierten. Ich war mir ziemlich sicher, dass das unangemessene Stöhnen, das ich hörte, aus meinem eigenen Mund kam, aber ich war zu müde, um mich darum zu scheren. Als ich schließlich den Becher absetzte und mir mit dem Handrücken den Mund abwischte, stand der Wikinger immer noch da und starrte mich an.
Ich drehte ihm den Rücken zu, schenkte meinem Helden Justice ein Lächeln und schob meinen Notfallkaffee-Zwanzigdollarschein über den Tresen. »Du bist ein Künstler. Was schulde ich dir für den besten Latte, den ich in meinem ganzen Leben je hatte?«
»So, wie dein Morgen war, geht der aufs Haus, Darling«, sagte er und gab mir meinen Führerschein und das Geld zurück.
»Du, mein Freund, bist ein wahrer Gentleman. Im Gegensatz zu manch anderen.« Ich warf einen finsteren Blick über die Schulter zum Wikinger, der breitbeinig und mit verschränkten Armen dastand. Mit einem weiteren Schluck von meinem Getränk steckte ich den Zwanziger ins Trinkgeldglas. »Danke, dass du am schlimmsten Tag meines Lebens nett zu mir warst.«
»Dachte, der wäre gestern gewesen«, mischte sich der missmutige Koloss ein.
Mein Seufzen war resigniert, als ich mich langsam zu ihm umdrehte. »Das war, bevor ich dich getroffen habe. Jetzt kann ich offiziell sagen: So schlimm der gestrige Tag auch war – der heutige hat ihn um eine Nasenlänge übertroffen.« Ich wandte mich wieder Justice zu. »Tut mir leid, dass dieser Idiot dir alle Kunden vertrieben hat. Aber ich komme sehr bald wieder und hole mir noch einen von denen.«
»Ich freu mich drauf, Naomi«, sagte er mit einem Zwinkern.
Ich wandte mich zum Gehen und prallte an einer Meile schlecht gelaunter Männerbrust ab.
»Naomi?«, fragte er.
»Geh weg.« Es fühlte sich fast gut an, einmal im Leben unhöflich zu sein.
»Dein Name ist Naomi«, stellte der Wikinger fest.
Ich war zu sehr damit beschäftigt, ihn mit meinem zornigen Blick einzuäschern, um zu reagieren.
»Nicht Tina?«, beharrte er.
»Sie sind Zwillinge, Mann«, sagte Justice, und man konnte das Lächeln in seiner Stimme hören.
»Scheiße.« Der Wikinger fuhr sich mit der Hand durch die Haare.
»Ich mache mir Sorgen um das Augenlicht deines Freundes«, sagte ich zu Justice und deutete auf das Fahndungsfoto von Tina.
Tina war irgendwann in den letzten zehn Jahren wasserstoffblond geworden, was unsere kaum merklichen Unterschiede deutlicher machte.
»Ich hab meine Kontaktlinsen zu Hause liegen gelassen«, sagte er.
»Neben deinen Manieren?« Das Koffein kam in meinem Blut an und machte mich ungewöhnlich kämpferisch.
Er antwortete nur mit einem hitzigen Blick.
Ich seufzte. »Geh mir aus dem Weg, Leif Eriksson.«
»Mein Name ist Knox. Und warum bist du hier?«
Was für ein Name sollte das denn sein? Erzählte er oft Knox-Knox-Witze? War es die Abkürzung für irgendwas? Knoxwell? Knoxathan?
»Das geht dich nichts an, Knox. Nichts, was ich tue oder nicht tue, geht dich etwas an. Genau genommen, geht dich meine ganze Existenz nichts an. Und jetzt geh mir freundlicherweise aus dem Weg.«
Ich hatte Lust, so laut und lange zu schreien wie ich konnte. Aber das hatte ich auf der langen Fahrt hierher ein paarmal im Auto versucht, und es hatte nicht geholfen.
Dankenswerterweise seufzte der gut aussehende Einfaltspinsel und tat das Lebensrettende: Er ging mir aus dem Weg. Mit so viel Würde, wie ich aufbringen konnte, fegte ich aus dem Café hinaus in die Sommerhitze.
Wenn sich Tina mit mir treffen wollte, konnte sie mich auch im Motel suchen. Ich musste nicht hier herumstehen und mich von einem Fremden mit der Persönlichkeit einer Kettensäge anpöbeln lassen.
Ich würde in mein schäbiges Zimmer zurückgehen, die Haarnadeln aus meiner Frisur fummeln und duschen, bis das heiße Wasser ausging. Dann würde ich mir überlegen, was als Nächstes zu tun war.
Ein solider Plan. Es fehlte nur eins.
Mein Auto.
Oh nein. Mein Auto und meine Handtasche.
Der Fahrradständer vor dem Café war noch da. Der Waschsalon mit seinen knalligen Postern im Schaufenster lag noch immer auf der anderen Straßenseite neben der Autowerkstatt.
Aber mein Auto war nicht mehr, wo ich es abgestellt hatte.
Der Parkplatz vor der Tierhandlung war leer.
Ich blickte die Straße auf und ab. Keine Spur von meinem verlässlichen, verdreckten Volvo.
»Hast du dich verirrt?«
Ich schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. »Geh. Weg.«
»Was ist dein Problem?«
Ich drehte mich um und sah, dass Knox mich mit einem To-go-Kaffee in der Hand aufmerksam beobachtete.
»Was mein Problem ist?«, wiederholte ich.
Ich wollte ihm ans Schienbein treten und seinen Kaffee klauen.
»Ich hör sehr gut, Süße. Kein Grund, zu schreien.«
»Hier kommt mein Problem: Während ich fünf Minuten meines Lebens damit verschwendet habe, dich kennenzulernen, wurde mein Auto abgeschleppt.«
»Sicher?«
»Nein. Ich weiß nie, wo ich meine Autos parke. Ich lasse sie einfach irgendwo stehen und kaufe mir neue, wenn ich sie nicht wiederfinde.«
Er warf mir einen Blick zu.
Ich verdrehte die Augen. »Das war ironisch gemeint.« Ich tastete nach meinem Handy, bis mir einfiel, dass ich kein Handy mehr hatte.
Ohne ein weiteres Wort stolzierte ich, wie ich hoffte, in die Richtung der örtlichen Polizeiwache davon.
Ich schaffte es nicht einmal bis zur nächsten Ladenfront, als sich eine große, harte Hand um meinen Oberarm schloss.
Der Schlafmangel, die emotionale Verletzung, sagte ich mir. Das waren die einzigen Gründe, warum ich das nervöse Zing spürte, als er mich berührte.
»Stopp«, befahl er mürrisch.
»Hände. Weg.« Ich ruderte unbeholfen mit dem Arm, aber sein Griff wurde nur fester.
»Dann bleib endlich stehen.«
Ich hörte mit meinen Befreiungsversuchen auf. »Ich bleib stehen, wenn du aufhörst, dich wie ein Arsch zu benehmen.«
Er blähte die Nasenflügel und blickte zum Himmel auf, und ich glaubte, ihn zählen zu hören.
»Zählst du jetzt ernsthaft bis zehn?« Ich war diejenige, der Unrecht geschah. Ich hatte Grund, den Himmel um Geduld anzuflehen.
Er kam bei zehn an und sah immer noch genervt aus. »Wenn ich aufhöre, ein Arsch zu sein, bleibst du dann wirklich kurz und redest mit mir?«
Ich nahm noch einen Schluck Kaffee und dachte darüber nach. »Vielleicht.«
»Ich lass los«, warnte er.
»Super«, gab ich zurück.
Wir blickten beide auf seine Hand auf meinem Arm. Langsam löste er seinen Griff und ließ mich los, aber erst nachdem seine Fingerspitzen über die empfindliche Stelle an der Innenseite meines Arms gestrichen waren.
Ich bekam Gänsehaut und hoffte, er würde es nicht bemerken. Vor allem, weil die Reaktionen Gänsehaut und harte Nippel in meinem Körper eng miteinander verwandt waren.
»Ist dir kalt?« Sein Blick ruhte ganz eindeutig nicht auf meinem Arm oder meinen Schultern.
Verdammt. »Ja«, log ich.
»Wir haben neunundzwanzig Grad, und du trinkst heißen Kaffee.«
»Wenn du damit fertig bist, mir meine innere Temperatur zu mansplainen, würde ich gern mein Auto suchen gehen«, sagte ich und hielt meinen freien Arm quer vor meine verräterischen Brüste. »Vielleicht könntest du mir sagen, wie ich zum nächsten Abschlepphof oder Polizeirevier komme?«
Er sah mich eine ganze Weile an, dann schüttelte er den Kopf. »Komm.«
»Wie bitte?«
»Ich fahr dich hin.«
»Ha!« Ich lachte erstickt. Wenn er glaubte, ich würde freiwillig mit ihm in ein Auto steigen, irrte er sich gewaltig.
Ich schüttelte immer noch den Kopf, als er weitersprach. »Komm schon, Daisy. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.«
2 Ein Held wider Willen
Knox
Die Frau starrte mich an, als hätte ich gerade vorgeschlagen, sie solle einer Klapperschlange einen Zungenkuss geben.
Mein Tag hätte eigentlich noch gar nicht anfangen sollen und war schon beschissen. Ich gab ihr daran die Schuld. Und ihrer Arschlochschwester Tina.
Zur Sicherheit nahm ich noch Agatha in den Kreis der Schuldigen auf, denn sie hatte mir geschrieben, dass Tina gerade ins Café marschiert sei und sicher wie immer Ärger machte.
Also stand ich nun hier, zu einer Uhrzeit, die man aus gutem Grund das Morgengrauen nannte, und stritt mich mit einer Frau, die ich nicht einmal kannte.
Naomi blinzelte mich an, als käme sie aus einem Nebel. »Das soll ein Witz sein, oder?«
Agatha sollte mal ihre scheiß Augen untersuchen lassen, wenn sie diese angepisste Brünette für ihre wasserstoffblonde, toastergebräunte, tätowierte Nervensäge von Schwester hielt.
Die Unterschiede waren auch ohne meine Kontaktlinsen verdammt offensichtlich. Tinas Gesicht hatte die Farbe und Beschaffenheit einer alten Ledercouch. Tiefe Zornesfalten umrahmten ihren Mund, vertieft von zwei Schachteln Kippen am Tag, und weil sie der Meinung war, die Welt schulde ihr was.
Naomi dagegen war aus anderem Holz geschnitzt. Aus exklusiverem. Sie war groß wie ihre Schwester. Aber statt des knusprig frittierten Looks ging sie mit dichtem Haar von der Farbe gerösteter Kastanien in die Disneyprinzessinnen-Richtung. Dieses Haar und die Blumen darin versuchten, aus einer kunstvollen Hochsteckfrisur zu entkommen. Ihr Gesicht war weicher, die Haut blasser. Volle rosa Lippen. Augen, die mich an Waldboden und weite Ebenen erinnerten.
Während sich Tina kleidete wie ein Bikerbabe, das in einen Häcksler geraten war, trug Naomi teure Sport-Shorts und das dazu passende Tanktop über einem straffen Körper, der mehr als ein paar nette Überraschungen versprach.
Sie sah aus wie die Art Frau, die nur einen Blick auf mich warf und dann, so schnell es ging, zum erstbesten golfhemdtragenden Vorstandsmitglied flüchtete.
Zu ihrem Glück hatte ich nichts für Dramen übrig. Rehäugige Prinzessinnen, die gerettet werden mussten, waren nicht mein Ding. Und ich verlor keine Zeit mit Frauen, die mehr als Spaß und eine Handvoll Orgasmen brauchten.
Aber da ich meine Nase schon in die Sache hineingesteckt, sie Müll genannt und angeschrien hatte, konnte ich die Angelegenheit zumindest schnell zu Ende bringen. Dann würde ich mich wieder auf den Rückweg ins Bett machen.
»Nein, das soll kein Witz sein«, erwiderte ich.
»Mit dir gehe ich nirgendwohin.«
»Du hast kein Auto«, erinnerte ich sie.
»Danke, Captain Obvious.«
»Damit wir uns richtig verstehen: Du bist eine Fremde in einer neuen Stadt. Dein Auto verschwindet. Und du lehnst eine Mitfahrgelegenheit ab, weil …«
»Weil du in ein Café gestürmt bist und mich angeschrien hast! Dann hast du mich verfolgt und schreist immer noch. Wenn ich mit dir in ein Auto steige, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich in Stücke gehackt und in der Wüste verstreut werde, als dass ich an meinem Ziel ankomme.«
»Hier gibt’s keine Wüsten. Aber ein paar Berge.«
Ihr Gesichtsausdruck deutete an, dass sie mich weder hilfreich noch amüsant fand.
Ich atmete durch meine zusammengebissenen Zähne aus. »Hör zu, ich bin müde. Ich wurde benachrichtigt, dass Tina schon wieder Ärger im Café macht, und genau das habe ich erwartet, als ich ankam.«
Sie trank einen großen Schluck Kaffee, während sie die Straße entlangschaute, als überlegte sie sich ihre Fluchtroute.
»Denk nicht mal dran«, sagte ich. »Du würdest deinen Kaffee verschütten.«
Als sie ihre hübschen Haselnussaugen aufriss, wusste ich, dass ich ins Schwarze getroffen hatte.
»Also gut. Aber nur, weil das der beste Latte meines ganzen Lebens ist. Ist das deine Vorstellung von einer Entschuldigung? Denn sie ist genauso scheiße wie die Art, mit der du Leute fragst, ob etwas nicht stimmt.«
»Es war eine Erklärung. Nimm sie an, oder lass es bleiben.« Ich verschwendete keine Zeit mit unwichtigen Dingen. Wie Small Talk oder Entschuldigungen.
Ein Bike röhrte die Straße entlang, aus seinen Lautsprechern plärrte Rob Zombie, obwohl es kaum sieben Uhr morgens war. Der Typ beäugte uns und drehte den Motor hoch. Wraith war an die siebzig, hatte aber immer noch eine astronomische Erfolgsquote mit diesem Tätowierter-Silberfuchs-Ding.
Naomi sah ihn fasziniert mit offenem Mund an.
Heute war nicht der Tag, an dem die kleine Miss Blümchen im Haar ihre wilde Seite ausleben würde.
Ich bedeutete Wraith, sich zu verpissen, schnappte mir Naomis wertvollen Kaffee und setzte mich in Bewegung.
»Hey!«
Wie erwartet rannte sie mir nach. Ich hätte sie an der Hand nehmen können, aber ich war kein großer Fan meiner Reaktion auf unsere erste Berührung. Es fühlte sich kompliziert an. »Ich hätte in meinem scheiß Bett bleiben sollen«, brummte ich.
»Was stimmt eigentlich nicht mit dir?«, wollte Naomi wissen, die joggen musste, um mich einzuholen. Sie griff nach ihrem Becher, aber ich hielt ihn knapp außerhalb ihrer Reichweite und ging weiter.
»Wenn du nicht gefesselt und geknebelt auf Wraiths Bike enden willst, schlage ich vor, du steigst in meinen Truck.«
Das zerzauste Blumenkind murmelte ein paar wenig schmeichelhaft klingende Dinge über meine Persönlichkeit und Anatomie.
»Hör zu. Wenn du fünf Minuten aufhören kannst, eine Nervensäge zu sein, bringe ich dich zum Polizeirevier. Du kannst dein scheiß Auto abholen, und dann verschwindest du aus meinem Leben.«
»Hat dir mal jemand gesagt, dass du die Persönlichkeit eines angepissten Stachelschweins hast?«
Ich ignorierte sie und ging weiter.
»Woher weiß ich, dass du nicht selbst versuchst, mich zu fesseln?«, wollte sie wissen.
Ich blieb stehen und musterte sie träge von oben bis unten. »Baby, du bist nicht mein Typ.«
Sie verdrehte so sehr die Augen, dass es ein Wunder war, dass sie nicht herausploppten und auf den Gehweg fielen. »Entschuldige mich bitte, ich muss Weinen gehen.«
Ich öffnete die Beifahrertür meines Pick-ups. »Steig ein.«
»Deine Ritterlichkeit ist scheiße«, beschwerte sie sich.
»Ritterlichkeit?«
»Das heißt …«
»Meine Güte. Ich weiß, was das heißt.«
Und ich wusste, was es bedeutete, dass sie es in einem Gespräch benutzte. Sie hatte scheiß Blumen im Haar. Die Frau war eine Romantikerin. Noch ein Punkt auf der Negativliste. Romantikerinnen waren am schwersten abzuschütteln. Sie klammerten. Sie behaupteten, sie kämen prima mit einer Nichtbeziehung klar. Währenddessen schmiedeten sie Pläne, wie sie »die Eine« werden konnten, versuchten, Männer dazu zu bringen, ihre Eltern kennenzulernen, und schauten sich heimlich Hochzeitskleider an.
Als sie nicht von selbst einstieg, beugte ich mich ins Auto und stellte ihren Kaffee in den Becherhalter.
»Das mit dir passt mir im Moment wirklich nicht«, sagte sie.
Die Lücke zwischen unseren Körpern war mit der Art von Energie aufgeladen, die ich normalerweise nur vor einer guten Kneipenschlägerei spürte. Gefährlich, aufputschend. Es gefiel mir nicht besonders.
»Steig in den scheiß Truck.«
Ich hielt es für ein kleines Wunder, als sie gehorchte, und knallte die Tür vor ihrem finsteren Blick zu.
»Alles klar da drüben, Knox?«, rief Bud Nickelbee vom Eingang seines Eisenwarengeschäfts herüber. Er trug seine übliche Uniform aus Latzhose und Led-Zeppelin-Shirt. Der Pferdeschwanz, den er seit dreißig Jahren hatte, hing ihm dünn und grau über den Rücken.
»Alles gut«, versicherte ich ihm.
Sein Blick glitt zu Naomi hinter der Windschutzscheibe. »Ruf mich an, wenn du Hilfe mit der Leiche brauchst.«
Ich setzte mich hinters Steuer und startete den Motor.
»Ein Zeuge hat mich in den Truck steigen sehen, ich würde es mir also sehr gut überlegen, ob ich mich umbringen will«, sagte sie und deutete auf Bud, der uns immer noch beobachtete.
Offensichtlich hatte sie seine Bemerkung nicht gehört.
»Ich bring dich nicht um«, fauchte ich. Noch nicht.
Sie war schon angeschnallt, hatte die langen Beine überschlagen. Ein Flipflop baumelte von ihren Zehen, als sie mit dem Fuß wippte. An beiden Knien hatte sie Abschürfungen, und ich bemerkte einen frischen Kratzer an ihrem rechten Unterarm. Ich beschloss, es nicht wissen zu wollen, und legte den Rückwärtsgang ein. Ich würde sie am Revier absetzen – hoffentlich war es früh genug, um zu meiden, wen ich meiden wollte – und dafür sorgen, dass sie ihr scheiß Auto bekam. Mit etwas Glück konnte ich noch mal ein Stündchen die Augen zumachen, bevor ich offiziell in meinen Tag starten musste.
»Weißt du«, begann sie, »wenn hier einer von uns sauer auf den anderen sein sollte, dann bin das ich. Ich kenne dich nicht mal, und du schreist mich an, kommst mir bei meinem Kaffee in die Quere und entführst mich dann praktisch. Du hast keinen Grund, dich aufzuregen.«
»Du hast ja keine Ahnung, Schätzchen. Ich habe massenhaft Gründe, angepisst zu sein, und einige davon haben mit deiner nutzlosen Schwester zu tun.«
»Tina ist vielleicht nicht der netteste Mensch der Welt, aber das gibt dir nicht das Recht, so ein Arsch zu sein«, schnaubte Naomi.
»Ich würde deine Schwester nicht als ›Mensch‹ bezeichnen.« Tina war ein Scheusal erster Güte. Sie klaute. Sie log. Sie fing Prügeleien an. Trank zu viel. Duschte zu selten. Und nahm keine Rücksicht auf irgendwen.
»Hör zu, wer immer du bist. Die einzigen Menschen, die so über sie reden dürfen, sind ich, unsere Eltern und die Abschlussklasse der Andersontown High von 2003. Und vielleicht noch die Feuerwehr von Andersontown. Du nicht, und deine Probleme mit meiner Schwester musst du auch nicht an mir auslassen.«
»Von mir aus«, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen.
Den Rest des Wegs fuhren wir schweigend. Das Knockemout Police Department befand sich ein paar Parallelstraßen von der Main Street entfernt und teilte sich ein neues Gebäude mit der städtischen Bibliothek. Sobald ich es nur sah, fing der Muskel unter meinem Auge an zu zucken.
Auf dem Parkplatz standen ein Pick-up-Truck, ein Streifenwagen und eine Harley Fat Boy. Keine Spur vom SUV des Chief. Gott sei Dank.
»Komm. Bringen wir’s hinter uns.«
»Du musst nicht mit mir reinkommen«, schniefte Naomi. Sie beäugte mit Hundeblick ihren leeren Kaffee.
Knurrend hielt ich ihr meinen mehr oder weniger unberührten hin. »Ich bring dich zum Empfang, sorge dafür, dass du dein Auto bekommst, und dann sehen wir uns nie wieder.«
»Na schön. Aber ich sage nicht Danke.«
Ich sparte mir eine Antwort, denn ich war zu sehr damit beschäftigt, zur Tür zu stürmen und die großen goldenen Buchstaben darüber zu ignorieren.
»The Knox Morgan Municipal Building.«
Ich tat so, als hätte ich sie nicht gehört, und ließ die Glastür hinter mir zuschwingen.
»Gibt es mehr als einen Knox in dieser Stadt?«, fragte sie, als sie die Tür aufzerrte und mir nach drinnen folgte.
»Nein«, sagte ich in der Hoffnung, dass es den Fragen ein Ende setzen würde, die ich ums Verrecken nicht beantworten wollte. Das Gebäude war relativ neu, scheißviel Glas, breite Flure und dieser Geruch nach frischer Farbe.
»Also steht dein Name auf dem Gebäude?«, sie joggte schon wieder, um mit mir Schritt zu halten.
»Sieht so aus.« Ich riss eine weitere Tür auf und bat sie mit einer Geste herein.
Die Polizeiwache von Knockemout sah eher nach einem dieser Co-Working-Läden, die Stadthipster mochten, als nach echter Polizeiwache aus. Es hatte die Jungs und Mädchen in Blau geärgert, die stolz waren auf ihren schimmligen, baufälligen Bunker mit seinen flackernden Neonröhren und dem jahrzehntelang von Kriminellen befleckten Teppichboden.
Ihr Ärger über die hellen Farben und die hochglänzenden neuen Büromöbel war das Einzige, das ich nicht daran hasste.
Beim Knockemout PD gab man sich die größte Mühe, die eigenen Wurzeln wiederzufinden, indem man die kippeligen Aktenstapel auf höhenverstellbaren Bambusschreibtischen aufschichtete und Tag und Nacht zu billigen und zu starken Kaffee braute. Auf dem Tresen stand eine offene Schachtel altbackener Donuts, und überall waren Puderzuckerfingerabdrücke. Doch bisher hatte noch nichts dem Scheiß-Knox-Morgan-Building seinen neuen Glanz nehmen können.
Sergeant Grave Hopper saß hinter seinem Schreibtisch und rührte ein halbes Pfund Zucker in seinen Kaffee. Früher war er Mitglied eines Motorradclubs gewesen, heute verbrachte er seine Abende als Trainer des Softballteams seiner Tochter und seine Wochenenden mit Rasenmähen. Nur einmal im Jahr packte er seine Frau hinten auf sein Bike, und sie zogen los, um die glorreichen Zeiten auf den Weiten der Straße wieder aufleben zu lassen.
Er entdeckte mich und meinen Gast und hätte fast die komplette Tasse über sich verschüttet.
»Alles klar, Knox?«, fragte Grave und starrte Naomi ungeniert an.
Es war kein Geheimnis in der Stadt, dass ich so wenig wie möglich mit dem PD zu tun hatte. Es war außerdem nicht gerade eine Neuigkeit, dass Tina die Art von Problem war, die ich nicht ertrug.
»Das ist Naomi. Tinas Zwillingsschwester«, erklärte ich. »Sie ist gerade in der Stadt angekommen und sagt, ihr Auto wurde abgeschleppt. Habt ihr’s draußen?«
Das Knockemout PD hatte normalerweise Wichtigeres zu tun, und ließ seine Bürger parken, wo und wann sie wollten, solange es nicht direkt auf dem Gehweg war.
»Auf die Sache mit der Zwillingsschwester komm ich noch mal zurück«, warnte Grave und richtete sein Kaffeerührstäbchen auf uns. »Aber erst mal: Bisher bin ich heute allein und hab gar nichts abgeschleppt.«
Scheiße. Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare.
»Wenn Sie es nicht waren, wissen Sie dann vielleicht, wer es sonst gewesen sein könnte?«, fragte Naomi hoffnungsvoll.
Klar. Ich eile herbei, rette die Welt und fahre sie hier runter, aber der angegraute Grave bekommt das Lächeln und die Freundlichkeiten ab.
Grave, der Mistkerl, hing an ihren Lippen und lächelte sie an, als wäre sie eine siebenlagige Schokotorte.
»Nun ja, Tin… ich meine, Naomi«, begann Grave. »So wie ich das hier seh, könn’ zwei Sachen passiert sein. A: Sie haben vergessen, wo Sie geparkt haben. Aber ne Frau wie Sie in einer so kleinen Stadt, das wäre eher unwahrscheinlich.«
»Da haben Sie recht«, stimmte sie ihm freundlich zu, ohne ihn Captain Obvious zu nennen.
»Oder B: Jemand hat Ihr Auto gestohlen.«
Ich schminkte mir meine Stunde Schlaf ab.
»Ich habe direkt vor der Tierhandlung geparkt, weil das in der Nähe des Cafés war, wo ich meine Schwester treffen sollte.«
Grave warf mir einen Blick zu, und ich nickte. Den Teil brachten wir am besten kurz und schmerzlos hinter uns.
»Also wusste Tina, dass Sie in die Stadt kommen, und auch, wo Sie sein würden?«, fragte er nach.
Naomi verstand nicht, was er damit sagen wollte. Sie nickte, mit großen Augen und voller Hoffnung. »Sie hat mich gestern Abend angerufen. Sie hatte irgendwelchen Ärger und wollte mich heute Morgen um sieben im Café Rev treffen.«
»Nun ja, Schätzchen.« Er räusperte sich. »Ich möchte natürlich niemanden in den Schmutz ziehen. Aber wäre es möglich …«
»Dass deine Arschlochschwester dein Auto geklaut hat«, warf ich ein.
Naomis haselnussbrauner Blick war schneidend. Jetzt sah sie nicht mehr lieb und hoffnungsvoll aus. Sie sah mich an, als wollte sie eine Ordnungswidrigkeit begehen. Vielleicht sogar ein Verbrechen.
»Ich fürchte, Knox hier hat recht«, sagte Grave. »Ihre Schwester macht Ärger in der Stadt, seit sie vor einem Jahr hergezogen ist. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Auto, bei dem sie zugegriffen hat.«
Naomis Nasenflügel blähten sich leicht. Sie hob meinen Kaffee an den Mund, trank ihn mit ein paar entschlossenen Schlucken aus, dann warf sie den leeren Becher in den Mülleimer neben dem Schreibtisch. »Danke für Ihre Hilfe. Falls Sie einen blauen Volvo mit einem ›Freundlichkeit siegt‹-Aufkleber am Heck sehen, sagen Sie mir bitte Bescheid.«
Herr im Himmel.
»Ich nehme nicht an, dass Sie eine dieser Apps auf Ihrem Handy haben, mit denen Sie sehen können, wo Ihr Auto ist, oder?«, fragte Grave.
Sie tastete nach ihrer Tasche, dann hielt sie inne und kniff kurz die Augen zu. »Doch, hatte ich.«
»Aber jetzt nicht mehr?«
»Ich habe kein Handy. Meins ist, äh, gestern Nacht kaputtgegangen.«
»Schon in Ordnung. Wenn Sie mir Ihr Kennzeichen geben, kann ich eine Meldung rausschicken, dann halten die Streifen die Augen offen«, sagte Grave und schob ihr hilfsbereit ein Blatt Papier und einen Stift hinüber.
Sie nahm es und begann, mit ordentlicher, geschwungener Schrift zu schreiben.
»Sie könnten auch Ihre Kontaktdaten hierlassen, wo Sie übernachten und so, dann können ich oder Nash Sie auf dem Laufenden halten.«
Der Name machte mich nervös.
»Sehr gern«, sagte Naomi und klang überhaupt nicht danach.
»Ah. Haben Sie vielleicht einen Ehemann oder Freund, dessen Kontaktinfo Sie dazuschreiben könnten?«
Ich starrte ihn böse an.
Naomi schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Vielleicht eine Freundin oder Ehefrau?«, versuchte er es noch mal.
»Ich bin single«, sagte sie und klang darüber gerade unsicher genug, dass es meine Neugier weckte.
»Stellen Sie sich vor, unser Chief auch«, sagte Grave so unschuldig, wie ein eins dreiundachtzig großer Biker mit einem Vorstrafenregister klingen kann.
»Können wir zu der Stelle zurückkommen, wo du Naomi sagst, dass du dich bei ihr meldest, falls ihr das Auto findet, was nicht passieren wird, wie wir alle wissen?«, schnauzte ich.
»Tja, mit der Einstellung sicher nicht«, tadelte sie mich.
Das war verdammt noch mal das letzte Mal, dass ich zu irgendjemandes Rettung angeritten kam. Es war nicht mein Job. Nicht meine Verantwortung. Und es kostete mich Schlaf.
»Wie lang sind Sie in der Stadt?«, fragte er, während Naomi ihre Daten auf das Blatt kritzelte.
»Nur so lange, bis ich meine Schwester gefunden und ermordet habe«, antwortete sie, steckte die Kappe auf den Stift und schob das Papier zurück. »Vielen Dank für Ihre Hilfe, Sergeant.«
»Es war mir ein Vergnügen.«
Sie drehte sich zu mir um. Unsere Blicke trafen sich kurz. »Knox.«
»Naomi.«
Damit fegte sie zur Tür hinaus.
»Wie können sich zwei Schwestern so ähnlich sehen und sonst nichts gemeinsam haben?«, wunderte sich Grave.
»Ich will es nicht wissen«, sagte ich ehrlich und folgte ihr nach draußen.
Ich fand sie vor der Rollstuhlrampe, wie sie auf und ab ging und vor sich hinmurmelte.
»Wie sieht dein Plan aus?«, fragte ich resigniert.
Sie sah mich an und schürzte die Lippen. »Plan?«, wiederholte sie mit brechender Stimme.
Meine Fluchtinstinkte sprangen an. Ich hasste Tränen. Vor allem Tränen weiblicher Überredungskunst. Bei einer weinenden Frau fühlte ich mich, als würde ich von innen heraus in Stücke gerissen; eine Schwäche, die ich niemals öffentlich preisgeben würde.
»Nicht weinen!«, befahl ich.
Ihre Augen waren feucht. »Weinen? Ich weine nicht.«
Sie war eine beschissene Lügnerin.
»Ich mein’s ernst: nicht weinen! Es ist nur ein Auto, und sie ist nur ein Stück Scheiße. Keins von beidem ist eine Träne wert.«
Sie blinzelte hektisch, und ich wusste nicht, ob sie weinen oder mich wieder anschreien würde. Doch sie überraschte mich, indem sie nichts von beidem tat. Sie straffte die Schultern und nickte. »Du hast recht. Es ist nur ein Auto. Ich kann mir Ersatzkreditkarten besorgen, eine neue Handtasche und einen neuen Vorrat Honig-Senf-Dipsoßen.«
»Sag mir, wo du hinmusst, dann setze ich dich dort ab. Du kannst dir einen Mietwagen nehmen, und schon bist du wieder weg.« Ich deutete mit dem Daumen zu meinem Truck.
Sie schaute wieder die Straße entlang, wahrscheinlich hoffte sie, ein Anzug und Krawatte tragender Held könnte auftauchen. Als keiner kam, seufzte sie. »Ich hab ein Zimmer im Motel.«
Es gab nur ein Motel in der Stadt. Ein einstöckiges Ein-Sterne-Drecksloch, das nicht einmal einen offiziellen Namen verdiente. Ich war beeindruckt, dass sie wirklich dort eingecheckt hatte.
Schweigend gingen wir zu meinem Truck. Ihre Schulter streifte meinen Arm, und meine Haut fühlte sich an, als würde sie wärmer. Wieder öffnete ich die Tür für sie. Nicht, weil ich ein Gentleman war, sondern weil irgendein perverser Teil von mir sich gern in ihrer Nähe aufhielt.
Ich wartete, bis sie angeschnallt war, dann schloss ich die Tür und umrundete den Truck. »Honig-Senf-Dipsoßen?«
Sie warf mir einen Blick zu, während ich hinters Steuer rutschte. »Hast du von dem Typ gehört, der im Winter vor ein paar Jahren durch eine Leitplanke gebrochen ist?«
Es kam mir vage bekannt vor.
»Er hat drei Tage lang nichts außer Ketchup-Päckchen gegessen.«
»Hast du vor, durch eine Leitplanke zu brechen?«
»Nein. Aber ich bin gern vorbereitet. Und ich mag kein Ketchup.«
3 Eine winzige Kriminelle
Naomi
»Welches Zimmer hast du?«, fragte Knox. Ich bemerkte, dass wir am Motel waren.
»Warum?«, fragte ich misstrauisch.
Er atmete langsam aus, als wäre er mit den Nerven am Ende. »Damit ich dich vor deiner Tür absetzen kann.«
Oh. »Neun.«
»Hast du die Tür offen gelassen?«, fragte er kurz darauf mit verkniffenem Mund.
»Ja. Das macht man so auf Long Island«, erwiderte ich trocken. »So zeigen wir unseren Nachbarn, dass wir ihnen vertrauen.«
Er warf mir noch einen dieser langen finsteren Blicke zu.
»Natürlich hab ich sie nicht offen gelassen. Ich habe sie zugemacht und abgeschlossen.«
Er zeigte auf Nummer neun.
Meine Tür stand einen Spalt offen.
»Oh.«
Er stellte mitten auf dem Parkplatz und mit mehr Kraft als nötig die Gangschaltung auf Parken. »Du bleibst hier.«
Ich blinzelte nur, als er ausstieg und auf mein Zimmer zuging.
Mein müder Blick heftete sich auf die abgetragenen Jeans, die eng an einem spektakulären Hintern klebten. Hypnotisiert von seinen langen Schritten brauchte ich einen Moment, bis mir wieder einfiel, was genau ich in diesem Zimmer gelassen hatte und wie extrem ungern ich wollte, dass ausgerechnet Knox es sah.
»Warte!« Ich sprang aus dem Truck und rannte hinter ihm her, aber er hielt nicht an, wurde nicht einmal langsamer.
Mit letzter Kraft sprang ich vor ihn. Er lief direkt gegen die Hand, die ich erhoben hatte.
»Geh aus dem Weg, Naomi!«, befahl er.
Als ich nicht gehorchte, schob er mich mit einer Hand an meinem Bauch rückwärts, bis ich vor Zimmer acht stand.
Ich wusste nicht, was es über mich aussagte, dass ich seine Hand dort wirklich mochte. »Du musst da nicht reingehen«, beharrte ich. »Ich bin mir sicher, es ist nur der Zimmerservice.«
»Sieht‘s hier aus, als gäbe es Zimmerservice?«
Da hatte er recht. Das Motel sah aus, als sollte es Tetanusimpfungen statt Shampoo in Miniflaschen ausgeben.
»Bleib hier«, sagte er noch mal, dann schlich er zu meiner offenen Tür zurück.
»Mist«, flüsterte ich, als er sie aufschob. Ich schaffte es ganze zwei Sekunden, bis ich ihm hineinfolgte.
Das Zimmer war, als ich vor weniger als einer Stunde eingecheckt hatte, gelinde gesagt unattraktiv gewesen.
Die Tapete in Orange und Braun löste sich in langen Streifen von der Wand. Der Teppichboden war von einem dunklen Grün, das aussah wie die kratzige Seite eines Spülschwamms. Die Armaturen im Badezimmer waren barbiepink, und in der Dusche fehlten mehrere Fliesen.
Aber es war die einzige Option im Umkreis von zwanzig Meilen, und ich hatte gedacht, für ein, zwei Nächte könnte ich das schon durchstehen. Wie schlimm konnte es schon werden?
Anscheinend richtig, richtig schlimm. Nachdem ich eingecheckt, meinen Koffer verstaut, meinen Laptop eingesteckt hatte und dann Tina treffen wollte, war jemand eingebrochen und hatte das Zimmer durchwühlt.
Mein Koffer lag umgedreht auf dem Boden, der Inhalt überall auf dem Teppich verstreut.
Die Kommodenschubladen waren herausgezogen, die Schranktüren standen offen.
Mein Laptop fehlte. Genauso wie der Reißverschlussbeutel mit dem Bargeld, den ich in meinem Koffer versteckt hatte.
»Loser« war mit meinem Lieblingslippenstift quer über den Badezimmerspiegel geschmiert. Dummerweise lag das Ding, von dem ich nicht wollte, dass mein grummeliger Wikinger es sah, das Ding, das mehr wert war als alles Gestohlene, immer noch als zerknitterter Haufen in der Ecke.
Das Schlimmste von allem war, dass die Verursacherin auf dem Bett saß, die schmutzigen Turnschuhe in ein Knäuel Laken verwickelt. Sie sah sich einen Naturkatastrophenfilm an. Ich war nicht gut im Alter-Schätzen, aber ich sortierte sie sicher in die Kategorie Kind ein.
»Hi, Way«, sagte Knox grimmig.
Der Blick des Mädchens mit den blauen Augen huschte kurz vom Bildschirm weg und landete auf ihm, bevor sie ihn wieder auf den Fernseher richtete. »Hi, Knox.«
Es war eine kleine Stadt. Natürlich kannten sich der örtliche Griesgram und die kindliche Straftäterin.
»Okay, hör mal«, sagte ich und ging um Knox herum, damit ich vor dem Ding in der Ecke stand, das ich wirklich nicht erklären wollte. »Ich weiß nicht, ob in Virginia andere Gesetze für Kinderarbeit gelten. Aber ich habe um ein zusätzliches Kissen gebeten, nicht darum, von einer winzigen Kriminellen ausgeraubt zu werden.«
Das Mädchen warf mir einen Blick zu.
»Wo ist deine Mom?«, fragte Knox, ohne mich zu beachten.
Achselzucken. »Weg«, sagte sie. »Wer ist deine Freundin?«
»Das ist wohl deine Tante Naomi.«
Sie sah unbeeindruckt aus. Ich dagegen sah vermutlich aus, als wäre ich gerade aus einer Kanone auf eine Ziegelmauer geschossen worden.
»Tante?«, wiederholte ich und schüttelte den Kopf in der Hoffnung, mein Gehör wieder in Ordnung zu bringen. Eine weitere verwelkte Blüte fiel aus den Überresten meiner Frisur und segelte zu Boden.
»Dachte, du wärst tot«, sagte das Mädchen und musterte mich mit vagem Interesse. »Schöne Haare.«
»Tante?«, fragte ich noch mal.
Knox wandte sich an mich. »Waylay ist Tinas Tochter«, erklärte er langsam.
»Tina?«, plapperte ich krächzend nach.
»Sieht aus, als hätte sich deine Schwester an deinem Zeug bedient«, bemerkte er.
»Hat gesagt, das meiste ist sowieso Mist«, verkündete das Mädchen.
Ich blinzelte hektisch. Meine Schwester hatte nicht nur mein Auto gestohlen, sie war außerdem in mein Hotelzimmer eingebrochen, hatte es durchwühlt und eine Nichte zurückgelassen, von deren Existenz ich nichts wusste.
»Alles okay bei ihr?«, fragte Waylay, ohne den Blick von dem Tornado zu lösen, der auf den Bildschirm wütete.
»Sie« war vermutlich ich. Und bei mir war überhaupt nichts okay.
Ich schnappte mir ein Kissen vom Bett. »Würdet ihr zwei mich bitte entschuldigen?«, quiekte ich.
Ohne auf eine Antwort zu warten, schaute ich, dass ich rauskam, nach draußen unter die heiße Virginia-Sonne. Vögel zwitscherten. Zwei Motorräder fuhren ohrenbetäubend laut vorbei. Auf der anderen Straßenseite stieg ein älteres Paar aus einem Pick-up und ging zum Frühstück ins Diner.
Wie konnte alles so unverfroren normal aussehen, während mein ganzes Leben gerade einfach implodiert war?
Ich hielt mir das Kissen vors Gesicht und ließ den Schrei heraus, der sich aufgestaut hatte.
Die Gedanken überschlugen sich in meinem Kopf wie ein Spinning-Rad mit Turboantrieb. Warner hatte recht. Menschen änderten sich nicht. Meine Schwester war immer noch furchtbar, und ich immer noch naiv genug, auf ihre Lügen hereinzufallen. Mein Auto war weg, genau wie meine Handtasche und mein Laptop. Ganz zu schweigen von dem Geld, das ich für Tina mitgebracht hatte. Seit gestern Abend hatte ich keinen Job mehr. Ich war nicht auf dem Weg nach Paris, was noch vor vierundzwanzig Stunden der Plan gewesen war. Meine Familie und Freunde dachten, ich hätte meinen Verstand verloren. Jemand hatte meinen Lieblingslippenstift an einem Badezimmerspiegel ruiniert. Und ich hatte eine Nichte, deren gesamte Kindheit ich verpasst hatte.
Ich holte noch einmal Luft und ließ sicherheitshalber einen letzten Schrei los, bevor ich das Kissen senkte.
»Okay. Du schaffst das. Du bekommst das hin.«
»Fertig mit deinem Pep Talk?«
Ich wirbelte herum und sah Knox am Türrahmen lehnen, die tätowierten Arme vor der breiten Brust verschränkt.
»Yep«, sagte ich und straffte die Schultern. »Wie alt ist sie?«
»Elf.«
Nickend drückte ich ihm das Kissen in die Hand und marschierte ins Zimmer zurück.
»Also, Waylay«, begann ich.
Es lag eine Familienähnlichkeit in der Stupsnase, dem Grübchen am Kinn. Sie hatte die gleichen Fohlenbeine, die ihre Mutter und ich in diesem Alter gehabt hatten.
»Also, Tante Naomi.«
»Hat deine Mom gesagt, wann sie wiederkommt?«
»Nö.«
»Wo wohnt ihr, Schatz? Du und deine Mom?«, fragte ich.
Vielleicht war Tina jetzt dort, sortierte ihre Beute, überlegte sich, was sich zu behalten lohnte und was sie einfach nur zum Spaß kaputtmachen wollte.
»Drüben in Hillside Acres«, antwortete sie und reckte den Hals, um besser an mir vorbei dabei zusehen zu können, wie der Tornado auf dem Bildschirm Kühe durch die Luft schleuderte.
»Ich brauch mal ’ne Minute«, erklärte Knox und nickte zur Tür.
Ich hatte anscheinend alle scheiß Zeit der Welt. Alle Zeit und keinerlei Ahnung, was ich tun sollte. Keinen nächsten Schritt. Keine To-do-Liste, mit der ich meine Welt in hübsche, ordentliche Punkte zum Abhaken ordnen konnte. Nur eine Krise und das totale Chaos.
»Klar«, sagte ich und klang dabei nur mittelhysterisch.
Er wartete, bis ich an ihm vorbei war, dann kam er ebenfalls heraus. Als ich stehen blieb, ging er weiter zum ausgebleichten Getränkeautomaten vor der Rezeption.
»Willst du wirklich, dass ich dir jetzt eine Limo kaufe?«, fragte ich perplex.
»Nein. Ich versuche, außer Hörweite der Kleinen zu kommen, der nicht klar ist, dass sie verlassen wurde«, schnauzte er.
Ich folgte ihm. »Vielleicht kommt Tina ja zurück«, sagte ich.
Er blieb stehen und drehte sich zu mir um. »Way sagt, Tina hätte ihr nichts erzählt. Nur, dass sie sich um was kümmern müsse und lange weg wäre.«
Lange? Was zum Geier war in »Tinazeit« lange? Ein Wochenende? Eine Woche? Ein Monat?
»O mein Gott. Meine Eltern.« Das würde ihnen den Rest geben. Als wäre das, was ich gestern getan hatte, nicht schon verstörend genug. Ich hatte es letzte Nacht auf einem Highway in Pennsylvania geschafft, ihnen zu versichern, dass es mir gut ging und ich definitiv nicht in einer Art Midlife-Crisis steckte. Und ich hatte ihnen das Versprechen abgenommen, meinetwegen nicht ihre Pläne zu ändern. Sie waren an diesem Morgen zu ihrer dreiwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt aufgebrochen. Der erste große internationale Urlaub, den sie je zusammen gemacht hatten.
Ich wollte nicht, dass er durch meine Probleme oder Tinas Chaos ruiniert wurde.
»Was hast du mit dem Kind dadrin vor?« Knox nickte zur offenen Tür hinüber.
»Was meinst du damit?«
»Naomi, wenn die Cops mitbekommen, dass Tina weg ist und Waylay hiergelassen hat, geht‘s direkt in eine Pflegefamilie.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin ihre engste lebende Verwandte, die keine Kriminelle ist. Ich bin für sie verantwortlich.« Genau wie für alles andere, was Tina angestellt hatte, bis wir achtzehn wurden.
Er sah mich lange eindringlich an. »Einfach so?«
»Sie gehört zur Familie.« Abgesehen davon war es nicht so, als wäre im Moment viel bei mir los. Ich trieb hilflos herum. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben hatte ich keinen Plan.
Und das jagte mir eine Scheißangst ein.
»Familie«, schnaubte er, als wäre meine Argumentation nicht vernünftig.
»Hör zu. Danke, Knox. Für das ganze Geschrei und fürs Fahren und den Kaffee. Aber wie du sehen kannst, habe ich hier etwas zu klären. Also ist es wahrscheinlich am besten, wenn du in die Höhle zurückgehst, aus der du heute Morgen gekrochen bist.«
»Ich geh nirgendwo hin.«
Jetzt starrten wir uns wieder finster an, das Schweigen aufgeladen. Diesmal brach er es als Erster.
»Hör auf zu mauern, Daisy. Was hast du vor?«
»Daisy?«
Er pflückte mir mit zwei Fingern ein Blütenblatt aus den Haaren. »Daisy. Gänseblümchen.«
Ich schlug seine Hand weg und machte einen Schritt rückwärts, damit ich nachdenken konnte. »Okay. Als Erstes muss ich …« Auf keinen Fall meine Eltern anrufen. Und ich wollte eigentlich auch nicht – schon wieder – die Polizei einbeziehen, wenn es nicht sein musste. Was, wenn Tina in einer Stunde wieder auftauchte? Vielleicht war es das Wichtigste, dass ich mir erst mal mehr Kaffee besorgte.
»Ruf die Cops und melde den Einbruch und die Kindeswohlgefährdung«, sagte Knox.
»Sie ist meine Schwester! Abgesehen davon, was ist, wenn sie in einer Stunde wieder auftaucht?«
»Sie hat dein Auto geklaut und ihr Kind verlassen. Das klingt nicht nach der Mutter des Jahres.«
Der tätowierte, miesepetrige Bär von einem Mann hatte recht. Das mochte ich wirklich nicht an ihm.
»Argh! Also gut. Okay. Lass mich nachdenken. Kann ich mir dein Handy leihen?«
Er stand da und starrte mich unbewegt an.
»Um Himmels willen! Ich habe nicht vor, es zu klauen. Ich muss nur einen schnellen Anruf machen.«
Mit einem langen Seufzen zog er es aus seiner Tasche.
»Danke«, sagte ich betont, dann stapfte ich zurück in mein Hotelzimmer. Waylay schaute immer noch ihren Film, jetzt mit den Händen hinterm Kopf.
Ich wühlte in meinem Koffer, bis ich ein Notizbuch fand, und ging zurück nach draußen.
»Du hast ein Notizbuch mit Telefonnummern dabei?«
Knox spähte mir über die Schulter.
Ich bedeutete ihm, zu schweigen, und wählte.
»Was zum Henker willst du?«
Die Stimme meiner Schwester schaffte es immer, dass ich innerlich zusammenzuckte.
»Für den Anfang vielleicht mal eine Erklärung«, schnauzte ich. »Wo bist du?«
»Wo bist du?«, imitierte sie mich mit dieser hohen Muppetstimme, die ich immer gehasst hatte.
Ich hörte ein langes Ausatmen.
»Rauchst du etwa in meinem Auto?«
»Sieht aus, als wäre es jetzt mein Auto.«
»Weißt du, was? Vergiss das Auto. Wir haben wichtigere Dinge zu besprechen. Du hast eine Tochter! Eine Tochter, die du in einem Motelzimmer sitzen gelassen hast!«
»Ich hab was zu erledigen. Kann im Moment kein Kind gebrauchen, das mich aufhält. Hab ’ne große Sache in Arbeit. Dachte mir, sie kann solange mit ihrer Tante Gutmensch abhängen, bis ich wieder da bin.«
Ich war so sauer, ich konnte nur noch stammeln.
Knox riss mir das Handy vom Ohr. »Jetzt hörst du mir mal gut zu, Tina. Du hast genau dreißig Minuten, um wieder hier auf der Matte zu stehen, oder ich rufe Scheiße noch mal die Cops!«
Ich sah, wie sein Gesichtsausdruck härter wurde, wie er die Zähne zusammenbiss, was seine Wangenknochen noch besser zur Geltung brachte. Sein Blick wurde so kalt, dass ich schauderte.
»Du benimmst dich mal wieder wie die letzte Idiotin«, fuhr er fort. »Aber denk dran, wenn du das nächste Mal von den Cops aufgegriffen wirst, gibt es einen Haftbefehl. Das heißt, du wanderst hinter Gitter, und ich glaube nicht, dass es irgendwer groß eilig haben wird, Kaution für dich zu zahlen.«
Er schwieg kurz und sagte dann: »Ja, fick dich auch.«
Er fluchte noch einmal und ließ dann das Handy sinken.
»Woher genau kennst du meine Schwester?«, überlegte ich laut.
»Tina geht allen auf die Nerven, seit sie vor einem Jahr in der Stadt aufgetaucht ist. Immer auf der Suche nach dem schnellen Geld. Hat in ein paar Geschäften hier die Nummer mit dem Ausrutschen und Hinfallen versucht, auch bei deinem Kumpel Justice. Jedes Mal, wenn sie ein bisschen Geld in der Tasche hat, ist sie voll wie ein Eimer und verwüstet irgendwas.«
Ja, das klang nach meiner Schwester.
»Was hat sie gesagt?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort eigentlich nicht hören wollte.
»Ihr ist es scheißegal, wenn wir die Cops rufen. Sie kommt nicht wieder.«
»Das hat sie gesagt?« Ich hatte immer Kinder gewollt. Aber nicht so. Nicht kurz vor der Pubertät einspringen, wenn die prägenden Jahre schon vorbei waren.
»Sie sagt, sie kommt wieder, wenn ihr danach ist«, sagte er und scrollte dabei durch sein Handy.
Manches änderte sich nie. Meine Schwester hatte immer ihre eigenen Regeln aufgestellt. Als Säugling schlief sie den ganzen Tag und war die ganze Nacht wach. Als Kleinkind wurde sie aus drei Krippen geworfen, weil sie gebissen hatte. Und als wir ins Schulalter kamen, na ja, das war dann noch mal ein ganz neues Rebellionslevel.
»Was tust du?«, fragte ich Knox, als er das Handy wieder ans Ohr hob.
»Das Letzte, was ich tun will«, sagte er gedehnt.
»Ballettkarten kaufen?«, war meine Hypothese.
Er antwortete nicht, marschierte nur mit steifen Schultern auf den Parkplatz. Ich konnte nicht alles hören, was er sagte, aber es kam eine Menge Fick dich und Leck mich am Arsch darin vor.
Ich fügte »Telefonetikette« der länger werdenden Liste der Dinge hinzu, in denen Knox Morgan schlecht war.
Als er wiederkam, sah er noch wütender aus. Ohne auf mich zu achten, fischte er ein paar Scheine aus seiner Brieftasche und steckte sie in den Getränkeautomaten.
»Was willst du?«, brummte er.
»Äh. Wasser, bitte.«
Er drückte fester auf die Knöpfe, als ich es für nötig hielt, und eine Flasche Wasser und zwei Limos fielen auf den Boden.
»Hier.« Er drückte mir das Wasser in die Hand und machte sich auf den Rückweg ins Zimmer.
»Äh, danke?«, rief ich ihm nach.
Ungefähr eine halbe Minute überlegte ich, ob ich einfach gehen und geradeaus laufen sollte, bis ich eine neue Realität fand, die weniger schrecklich war. Aber es war nur eine Denksportübung. Ich konnte auf keinen Fall weggehen. Ich hatte eine neue Verantwortung. Und mit dieser Verantwortung würde auch ein bisschen Sinn in mein Leben einkehren. Wahrscheinlich.
Ich kehrte in mein Zimmer zurück und fand Knox vor, der das Türschloss untersuchte. »Kein Fingerspitzengefühl«, beschwerte er sich.
»Ich hab ihr gesagt, sie hätte es knacken sollen.« Waylay öffnete ihre Limodose.
»Es ist gerade mal acht Uhr morgens, und du hast ihr eine Limo gegeben«, fauchte ich Knox an, während ich meinen Wachposten vor dem Berg in der Ecke wieder einnahm.
Er sah mich an, dann an mir vorbei. Nervös breitete ich die Arme aus und versuchte, seinen Blick abzuschirmen.
»Ist das ’ne Art Tischdecke?«, fragte er und spähte an mir vorbei.
»Hochzeitskleid«, verkündete Waylay. »Mom sagt, es war tierisch hässlich.«
»Na ja, Tina würde guten Geschmack nicht mal erkennen, wenn er ihr eine Birkin Bag über die Rübe ziehen würde«, sagte ich defensiv.
»Bedeutet das Kleid, dass ich da draußen irgendwo einen Onkel habe?«, fragte sie mit einem Nicken zu dem Haufen Spitzen mit Unterrock, in dem ich mich einmal wie eine Märchenprinzessin gefühlt hatte, aber jetzt nur noch wie eine Idiotin.
»Nein«, sagte ich fest.
Knox’ Augenbrauen gingen leicht in die Höhe. »Du hast einfach beschlossen, ein Hochzeitskleid auf einen Roadtrip mitzunehmen?«
»Ich wüsste wirklich nicht, wieso dich das irgendwas angeht«, erklärte ich ihm.
»Ihre Haare sind hochgesteckt, als ob sie zu was Schickem gehen würde«, sinnierte Waylay und beäugte mich.
»Sieht auf jeden Fall so aus, Way«, pflichtete Knox ihr bei und verschränkte mit belustigtem Blick die Arme vor der Brust.
Es passte mir nicht, wie die zwei sich gegen mich zusammenrotteten.
»Was haltet ihr davon, wenn wir uns weniger Sorgen um meine Haare und ein Kleid machen und lieber überlegen, was wir jetzt tun?«, schlug ich vor. »Waylay, hat deine Mom gesagt, wohin sie wollte?«
Der Blick des Mädchens kehrte zum Fernseher zurück. Sie hob die schmalen Schultern. »Keine Ahnung. Hat nur gesagt, dass das jetzt dein Problem ist.«
Zum Glück musste ich nicht antworten, denn ein knappes Klopfen sorgte dafür, dass wir alle drei die Köpfe zur Tür drehten.
Der Mann, der dort stand, ließ mir kurz den Atem stocken. Nicht schlecht, was hier in Knockemout so herumhing. Er trug eine makellose dunkelblaue Uniform mit einer extrem glänzenden Marke. Eine hübsche Schicht Stoppeln betonte seinen markanten Kiefer. Schultern und Brust waren breit, Hüften und Taille schmal. Seine Haare waren fast blond. Und irgendetwas an seinen Augen kam mir bekannt vor.
»Knox«, sagte er.
»Nash.« Sein Ton war so kühl wie sein Blick.
»Hey, Way«, sagte der Neuankömmling.
Waylay nickte dem Mann zu. »Chief.«
Sein Blick wanderte zu mir.
»Du hast die Polizei gerufen?«, quietschte ich an Knox gewandt. Meine Schwester war ein furchtbarer Mensch, aber die Polizei zu rufen, fühlte sich so endgültig an.
4 »Du bleibst hier nicht.«
Naomi
»Sie müssen Naomi sein«, sagte der Cop.