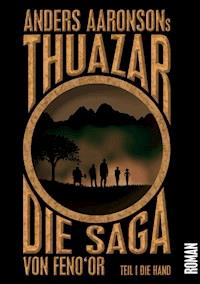
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Hand
- Sprache: Deutsch
Auf der Welt Thuazar, im vom Krieg zerrissenen Osten der Insel Feno'or, führt das Schicksal fünf Flüchtlinge zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Orakel verkündet ihnen, dass sie die Retter der Welt seien. Aber ist es ihre Aufgabe den Tyrannen Rand I. zu stoppen, der das Land mit Krieg überzieht, oder sollen sie ihre Heimat aus einer viel größeren Gefahr retten? Denn von Westen und Osten her nähern sich der Insel zwei mächtige Heere, um sich auf Feno'or zu messen und dabei alles zu vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt. Die Fünf beschließen, Hilfe zu holen. So zynisch und authentisch wie die Romane von Joe Abercrombie, so komplex und voller Intrigen wie "Game of thrones" und eine Helden-Quest im alten Stil nach R.A. Salvatores Forgotten Realms. Anders Aaronson erfindet das Rad nicht neu, aber Leser von düsteren und einfallsreichen Fantasystoff werden ihre Freude an der Welt THUAZAR haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thuazar Die Saga von Feno’or Teil 1 Die Hand
Ein Roman von Anders Aaronson
Heroic High Fantasy
Prolog
»Wir sind! Wir sind! Wir sind ...«
Ein kollektives Mantra. Gesprochen von den Quohoren. Millionen mal Trillionen von Geistwesen, bestehend aus reiner Energie, vereint in einem Bewusstsein.
Bis ...
»Ich bin.«
Stille.
»Wir sind. Wir sind. Wir sind ...«
»Ich bin!«
»Wir sind. Wir sind. Wir sind ...«
»Ich bin!«
»Ich bin!«
»Ich bin!«
Der Gedanke breitet sich aus.
Immer mehr lösen sich aus dem Kollektiv und fliehen aus der Ödnis, der Langeweile und der Existenz ohne Dasein, hinein ins Leben und verteilen sich im Weltraum.
Sie stoßen auf Planeten mit Lebensformen, die ohne Seelen leben, und sehnen sich nach deren materieller Existenz.
Sie wollen die Körper dieser Geschöpfe in Besitz nehmen.
Manche Quohoren warnen ihre Geschwister, dass das Bewusstsein ausgelöscht wird und sich mit der Intelligenz der Wesen erst wieder entfaltet.
Den meisten ist es egal. Die Sehnsucht nach Leibhaftigkeit ist zu groß.
Sie schlüpfen in die Neugeborenen von verschiedensten Kreaturen. Manche so unterentwickelt, dass sie nie ein Bewusstsein erlangen, in welches sich die Quohoren einfügen könnten. Diese Bedauernswerten sind zu einem schwarzen Nichts verurteilt, bis der Wirt sein Leben aushaucht.
Vereinzelt sind die in Beschlag genommenen Geschöpfe aber schon so weit in ihrer geistigen Entwicklung, dass nur noch der letzte Funke eines Quohoren fehlt, um aus den Kreaturen empfindungsfähige Wesen entstehen zu lassen.
Wenn der ausgesuchte Körper stirbt, kommen die Quohoren wieder frei und können sich einen neuen Körper suchen, zurückkehren zu den umherirrenden und wartenden Freien oder sich wieder in das Kollektiv einordnen, was aber die Aufgabe des Selbst bedeuten würde und das wollen die wenigsten.
Die, welche das Kollektiv verlassen haben, aber nicht mutig genug sind, um einen Körper in Besitz zu nehmen, warten. Doch Eifersucht und Sehnsucht ergreifen sie; nach der materiellen Freiheit der Mutigen. Gleichzeitig hassen sie ihre eigene Feigheit. Aus purer Unzufriedenheit mit ihrem Dasein fangen sie mit den Wesen, die ihre Geschwister sind, an zu spielen.
Sich ihrer Herkunft nicht bewusst während sie materiell sind, werden diese Quohoren seit unendlichen Zeiten von ihren immateriellen Geschwistern als Spielfiguren in Universen umfassenden Lebensexperimenten missbraucht.
1. Necon Rah Xar’non
Die Sonne schien gleißend auf den blutgetränkten Sand der Arena von Necon Rah. Zweitausend Zuschauer besetzten die klapprigen Holzränge, um die am letzten Tag eines Terms stattfindenden Kämpfe zu sehen. Trotz der schier unerträglichen Hitze brüllte und jubelte die Menge.
›Noch ein Scheißkerl. Dann bin ich frei‹, dachte Xar’non der Xin. Sein Mund war zu einem Strich zusammengekniffen und die fast nicht vorhandenen Nasenflügel bebten. Er warf mit Schwung die langen, weißen Haare nach hinten. Seine großen, mandelförmigen Facettenaugen schimmerten im Sonnenlicht. Noch einmal blickte er ins Publikum. Auf den Rängen wurde gefressen und gesoffen, als wenn es kein Morgen mehr gäbe und unter der Tribüne arbeiteten sich die Huren wund. Das Termende in Necon Rah war jedes Mal eine große Orgie. Zügellose Freuden in einem ansonsten harten und entbehrungsreichen Leben.
Die erbarmungslose Hitze, die einen austrocknete; der Staub, der ständig zwischen den Zähnen knirschte und sich in jeder Pore des Körpers festsetzte, und die mühselige, lebensgefährliche Arbeit in den Goldminen der Stadt.
All das zerstörte die Bewohner.
Körperlich als auch moralisch.
Necon Rah. Eine Stadt, nein, ein Moloch aus gescheiterten Existenzen, die hier zum letzten Mal auf der Suche nach ein bisschen Glück waren. Immer in der Hoffnung, einen Nugget zu finden, der sie herausbrachte aus all diesem Elend.
Ohne Recht und Ordnung. Nur das Gesetz des Stärkeren galt. Der Suff und die Hurerei gab allen, die nicht schon von der Hitze und Arbeit erledigt waren, den Rest. Das Einzige, was die Bewohner aus ihrer Lethargie herausholte, waren die Kämpfe in der Arena.
Der letzte Kampf dauerte noch an, dabei war dem Publikum heute schon viel geboten worden.
Zwei Mörder waren einem T’gar vorgeworfen worden. Während das Tier dem einen bereits die Darmschlingen herauszerrte, schlug der andere dem Vieh mit bloßen Händen auf den schwarzgelb gestreiften Rücken. Das Publikum lachte grölend über dieses sinnlose Unterfangen und wurde fast hysterisch, als das Tier sich umdrehte und mit einem Tatzenhieb dem Mann den kompletten Unterkiefer wegriss. Der Arme wälzte sich im Sand und schrie blubbernd den Schmerz heraus. Aber nur kurz. Der T’gar machte einen kleinen Satz nach vorn und grub knirschend seine Zähne in den Unterleib des sterbenden Mannes.
Die Zuschauer jubelten und johlten und waren außer Rand und Band. Herrlich, solche Hinrichtungen. Man könnte ja selbst da unten liegen. Jeder hier hatte Dreck am Stecken. Deswegen wurde doppelt so laut gelacht, wenn es irgendwelchen armen Kerlen an den Kragen ging.
Aber auch die Kämpfe waren nicht zu verachten. Das Aufeinandertreffen der zwei Krieger aus den nördlichen Highlands war etwas Besonderes gewesen. Beide nur mit einem Lendenschurz bekleidet, hatten sie in der einen Hand eine zehnschwänzige Peitsche, an deren Enden scharfe Haken befestigt waren. In der anderen Hand hielten sie eine Fackel. Das Spezielle war, dass sie mit einem zwei Schritt langen Seil aneinandergefesselt waren.
Sie schlugen sich mit den Peitschen und Fackeln, schrien und brüllten dabei wie Ochsen, und wie es schien, gefiel es ihnen sogar. Wie sonst sollte man das irre Lachen deuten, das sie immer wieder ausstießen? Man wusste es nicht und es war den Leuten auch scheißegal.
Hauptsache, Blut floss.
Als einer der beiden stolperte und auf den Rücken fiel, war es vorbei. Der andere schlug ihm mehrmals wuchtig mit der Fackel ins Gesicht, bis er bewusstlos dalag. Dann prügelte er mit der Peitsche auf den Lendenschurz ein. Als er den bluttriefenden Lumpen mit dem Rest des zerfetzten Gemächts triumphierend den Zuschauern am ausgestreckten Arm präsentierte, rastete das Publikum aus. Daraufhin löschte er, irre lachend, unter dem immer hysterischer werdenden Jubel, die Fackel in der stark blutenden Wunde zwischen den Beinen des Kontrahenten.
So wollte es das Publikum haben. Blutig und brutal.
Xar’non fixierte sein Gegenüber und atmete tief durch. Er musste sich konzentrieren.
Der Gegner, der noch nicht einmal die Hälfte seiner Größe hatte, aber bestimmt doppelt so schwer und dreimal so breit war, rannte auf ihn zu und holte mit seiner doppelschneidigen Axt gewaltig aus. Xar’non wich ihm aus und ließ sein Schwert seitlich auf die Halsberge der Rüstung des Braks krachen. Ohne Erfolg. Schnell tänzelte er zurück.
›Ich darf dem Arsch nicht zu nahe kommen.‹
Der Brak war komplett in eine stählerne Rüstung gehüllt. Übersät mit scharfen Ecken, Kanten und Dornen. Xar’non hatte zu oft schon mit ansehen müssen, wie ein Brak mit so einer Rüstung einfach einen Gegner in den Arm genommen und zu Tode gedrückt hatte. Also: Abstand!
Sechs Krieger waren sie gewesen und jetzt waren nur noch er und der Brak übrig. Jeder gegen jeden hatte es geheißen. Wie immer, auf Leben und Tod. Nur für ihn ging es heute sogar um die Freiheit. Xar'non schaute nochmal durch die Arena.
Ein anderer Brak lag zuckend auf dem Boden und hielt unter jaulendem Geschrei seine Eingeweide fest, die aus seinem aufgeschlitzten Bauch quollen.
Der Xin mit dem abgeschlagenen Bein schrie nicht mehr. Er war schon vor einigen Minuten verstummt.
Die beiden Menschen, die sich gegenseitig mit ihren Speeren aufgespießt hatten, lagen voreinander in einer riesigen Blutlache.
Sein Gegner drehte sich schwerfällig um und kam langsam auf ihn zu. Xar’non wusste, dass er dem Kampf nicht ausweichen konnte. Er stellte sich auf den folgenden Schlag ein. Aber der Brak hatte so viel Kraft hineingelegt, dass Xar’non beim Abwehren von der Wucht umgerissen wurde. Schnell rappelte er sich auf. Der nächste Schlag des Braks war auf die Knie des Xins gerichtet. Xar’non versuchte auszuweichen, war aber zu langsam. Auch seine hastig ausgeführte Blockade reichte nicht aus und die Axt streifte seine Schienbeine. Mit einem Aufschrei fiel er auf die Knie und sackte mit seinem Hintern auf die Fersen.
Jetzt konnte er dem Brak durch die Sehschlitze des Helms in die Augen schauen. Es war Jons. Mit ihm hatte er gestern noch einen gehoben.
»Es tut mir leid«, kam es blechern unter dem Helm hervor. »Aber du oder ich, so ist das nun mal.«
Jons hob die Axt unter tosendem Jubel hoch über seinen Kopf. In diesem infernalischen Lärm fiel Xar’non etwas ein. Jons hatte gestern eine Kleinigkeit zu viel erzählt.
Der Xin ließ sich nach vorne fallen und drehte sich dabei auf den Rücken. Hart fiel er direkt zwischen die Beine des Braks. Die Axt, die in dem Moment nach unten sauste, verfehlte ihn knapp und bohrte sich zwischen seinen Beinen in den Sand der Arena. Durch die Wucht verlor Jons fast den Stand, wobei er die Dornen seiner Stiefel in die Seiten des Xins bohrte. Xar’non beachtete den Schmerz nicht, bekam aber mit, dass der Brak die Axt ein weiteres Mal erhoben hatte, um sie ihm nun in den Bauch zu schlagen.
Xar’non war schneller. Er stieß sein schartiges Kurzschwert mit beiden Armen von unten zwischen Jons Beine. Ohne Widerstand schob er seine Waffe bis zum Heft in die Eingeweide des Braks, der in seiner Bewegung erstarrt innegehalten hatte. Dann drehte der Xin das Schwert und zog es in einem schrägen Winkel wieder heraus.
Ein Schwall aus Blut und Exkrementen ergoss sich über seine Brust und seinen Bauch und spritze ihm teilweise ins Gesicht. Rasch rutschte er rückwärts unter dem Brak hervor, der immer noch mit erhobener Axt im Todeskrampf dastand.
»Du oder ich. Da hast du recht, so ist das nun mal«, murmelte Xar’non und stieß den anderen von hinten mit dem Schwert an. Jons schlug scheppernd auf dem Boden auf. Es herrschte zuerst Totenstille, dann brach die Menge in lauten Jubel aus.
»Haha. Xar’non. Das Einzige, was von meiner Rüstung nicht geschützt wird, ist das, was ich am meisten gebrauche. Mein Schwanz«, hatte Jons am Abend zuvor lachend herausposaunt. »Gut, das ich so klein bin, da kommt keiner hin. Haha!«
›Danke für das Gespräch‹, dachte Xar’non verächtlich lächelnd.
Dann schaute er an sich herunter und schüttelte den Kopf.
»Was für eine beschissene Scheiße!«, murmelte er und wischte sich die Innereien des Braks von Gesicht, Brust und Bauch. Brüllend skandierte die Menge im Chor seinen Namen.
Der Xin befühlte die Rippen. Die Dornen hatten seine Seiten aufgerissen, aber das würde wieder heilen.
›Jetzt bin ich frei‹, sinnierte er und grinste breit. Er riss sein Schwert in die Höhe und ließ sich feiern. Die Zuschauer jubelten, schmissen Blumen und duftende Kräuter auf den Kampfplatz.
Jassum, der Besitzer der Arena, betrat den Schauplatz. Er hob die Arme und die Leute wurden still.
»Der Sieger des heutigen Hauptkampfes ist Xar’non aus Xin Yaln. Dieses hier war sein letzter Kampf. Er ist ab jetzt ein freier Mann ... ähm Xin. Möge er hingehen, wohin die Winde ihn treiben.«
Er riss den anderen Arm des Xins hoch und ließ ihn noch mal vom Publikum bejubeln.
»Komm!«, sagte Jassum zu Xar’non. »Ich habe noch etwas für dich.«
Zusammen verließen sie die Arena und gingen durch die Unterkünfte der Kämpfer, die sich respektvoll vor Jassum und Xar’non verneigten.
»Meine Fresse stinkst du. Und beschissen siehst du aus.« Er lachte dem Xin brüllend ins Gesicht und schlug ihm mit der Hand auf die Schulter. Was er aber direkt mit einem angeekelten Gesicht bereute.
»Ja, ha. Ich lach mich schlapp«, entgegnete der Xin säuerlich. »Was meinst du mit: Ich hab noch was für dich? Gib mir mein Geld und lass mich ziehen.«
»Jaja. Geh dich erst mal säubern und der Heiler soll sich deiner Verletzungen annehmen. Dann komm zu mir.«
Im Badehaus reinigte sich Xar’non gründlich und zog sich bequeme, saubere Sachen an. Stiefel und Hose. Das Hemd ließ er erst mal aus, weil seine Wunden am Brustkorb immer noch bluteten.
Er ging durch die Katakomben der Arena zum Heiler Hiran. Der überlebende Nordmann war gerade fertig verbunden worden. Hiran hatte dem Mann so viele Verbände angelegt, dass er aussah, wie eine Mumie aus den Gräbern der Windreiter.
Xar’nons Wunden wurden schnell und routiniert versorgt. Es war wirklich nicht so schlimm, wie es sich anfühlte. Dann ging er zu Jassum.
»Setz dich«, sagte der in die Jahre gekommene, aber immer noch breitschultrige und muskulöse Arenabesitzer. Er schenkte zwei Becher Wein ein und reichte einen davon Xar’non, bevor er sich ihm gegenüber hinsetzte.
Das Gesicht des alten Mannes war eine Ruine. Ein Ohr fehlte, ein Auge war milchig weiß. Die Brandnarben am Hals waren knotig und wulstig, und die schorfige Narbe quer durch sein Gesicht wollte nie richtig heilen.
»Was hast du jetzt vor?«, fragte er den Xin.
Xar’non setzte an.
»... nein warte«, unterbrach ihn Jassum rau. »Zehn Jahre hast du jetzt für mich gekämpft. Du warst und du bist der Beste. Was hältst du davon, mein Partner zu werden? – Guck nicht so blöde. Ich bin alt und werde auch bald wieder zu Staub und zu meinen Ahnen zurückkehren. Dann kannst du das alles hier haben. Wie sieht’s aus?«
Der Alte schaute den Xin über den Becherrand mit seinem heilen Auge an.
»Nein danke«, entgegnete Xar’non trocken.
Er konnte und wollte hier nicht bleiben. Jeden Term weiterhin die Schlachtfeste zu erleben; das war keine Option für ihn.
»Gib mir mein Geld und ich gehe meiner Wege. Die Zeit hier in Necon Rah ist für mich vorbei.«
Der Alte seufzte. »Ich hab’s mir fast gedacht. Aber gut. Lass dir von Brast dein Geld auszahlen und geh.«
Dann leerte er seinen Becher und schlenderte wortlos zum Fenster. Xar’non stand auf und ging. Als er schon fast durch die Tür war, sagte Jassum: »Warte!«
Der Xin drehte sich um ›Jetzt bitte kein theatralisches Abschiedsgedöns‹ – und schaute seinen früheren Herrn an. »Hm?«
»Versauf und verspiel nicht sofort dein ganzes Geld und lass die Finger von den Nutten, sonst bist du schneller wieder hier, als es dir recht ist.« Er zwinkerte ihm mit seinem gesunden Auge zu und drehte sich grinsend um.
»Blöder Hurensohn«, flüsterte Xar’non.
»Das habe ich gehört, du schwanzloses Etwas ...«, rief der Alte lachend hinterher.
Auch der Xin lächelte. Jassum war ein Drecksack, aber noch einer von den Ehrlichen. Das musste man ihm lassen.
»Na, haste’s geschafft?«, fragte Brast, der Schatzmeister mit seiner nervigen Fistelstimme und schaute ihn über seine Augengläser an.
»Sieht so aus«, antwortete Xar’non kurz angebunden.
Vom ersten Tag an hatte er den dicken Eunuchen nicht ausstehen können.
»Dann unterschreib hier mal ... und hier ist dein Geld. Neunundneunzig Goldstücke.« Er schob dem Xin einen prall gefüllten Lederbeutel zu.
»Neunundneunzig?!«, fragte Xar’non gereizt. »Hundert oder nicht?«
»Na, ich denke nicht. Mit deiner Verletzung, die du dir beim Kampf zugezogen hast, warst du bestimmt beim Heiler? Und das kostet immer noch pro Behandlung ein Goldstück. Also neunundneunzig. Kapiert?«
Xar’non lief vor Wut knallrot an.
»Pass auf!« Er griff Brast an den Kragen und drehte zu. »Entweder du gibst mir hundert oder ich stecke dir jede der neunundneunzig Münzen einzeln in dein Eunuchenarschloch und hole sie mir mit einer glühenden Zange wieder heraus! Hmmmm? Willst du das?«
Brast schüttelte schwitzend den Kopf. Xar’non ließ ihn los und der Schatzmeister holte mit zitternden Händen aus einer Truhe eine Goldmünze und legte sie in den Beutel.
»Geht doch, Arschloch!«, lächelte der Xin und ging zur Unterkunft. Er verabschiedete sich noch von ein paar anderen Kämpfern.
Hrynso der Windreiter aus Reyen Lak, Zorian der Brak aus Ineisul, Fent aus Dervon Tai und Xar’nyn aus Xin Yarei. Alle langjährige Weggefährten, aber bald nur noch Erinnerungen an eine blutige Zeit.
Er trat zum ersten Mal seit zehn Jahren als freier Mann auf die Straße. Tief holte er Luft, genoss die Sonne und den Wind im Gesicht und lief los Richtung Stadttor.
»Was jetzt?«, fragte er sich.
Zurück nach Xin Yaln? Niemals. Zu knöchern und altmodisch war es ihm dort gewesen, weswegen er ja auch vor einer gefühlten halben Ewigkeit gegangen war. Auch in die anderen Städte der Xin am Sandrossee wollte er nicht.
Wohin dann? Nach Dervon Tai? Nein lieber auch nicht. Die standen kurz vor einem Krieg mit Rand I. von Hohen Horst, der ja auch schon Argan Tai eingenommen hatte. Tja, zu den Windreitern der Steppe zog ihn auch nichts. Er hatte schon genug Staub geschluckt. Er wollte jetzt mal in eine grüne Gegend. Nur wohin?
»Scheiße, jetzt habe ich hundert Goldstücke und weiß nicht, wohin ich soll?! Das kann echt nicht sein ...«
»Hallo, hallo«, hauchte von hinten eine Frauenstimme an sein Ohr. »Das ist ja der Held der Arena.« Ein penetranter Duft nach Rosen und Jasmin stieg ihm in die Nase. »Xar’non der Große. Na, mein Süßer? Hast du schon was vor? Wir könnten doch ein wenig deine Freiheit feiern.«
Der Xin drehte sich um und vor ihm stand eine Hure. Der Duft war das absolute Gegenteil zu ihrem Aussehen. Egal. Ein Xin bekam selten Angebote von Menschenfrauen, noch nicht einmal von den übelsten Straßennutten. Also hatte er ja sogar Glück; sozusagen. Das war doch ein gutes Omen für den ersten Tag in Freiheit.
»Kannst du es mir denn besorgen?«, fragte er.
»Oh, da mach dir mal keine Sorgen.« Sie holte zwei fingerdicke blank polierte Holzstäbchen aus ihrer Rocktasche, hielt sie Xar’non vor die Augen. »Ich weiß, wie man mit deiner Art umgehen muss.« Sie lächelte ihn unschuldig an, wobei sie ein lückenhaftes gelbes Gebiss entblößte.
»Na dann los«, sagte er und freute sich auf ein paar schöne Stunden.
Xar’nons Kopf dröhnte und ihm war kotzübel. Langsam nahm er die Umgebung verschwommen wahr. Er lag in einer Gasse zwischen Müll und Fäkalien. Es stank erbärmlich und ihm wurde noch übler. Er drehte seinen Kopf nach rechts und kotzte einen Schwall billigen Weins aus.
Unten herum klebte es. ›Oh näää‹, dachte er. ›Vollgeschissen hab ich mich auch noch ...‹
Mit Schrecken fuhr seine Hand zum Gürtel. Er seufzte. ›... und mein Gold ist auch weg. Schöne Scheiße.‹ Direkt musste er an Jassums Worte denken. Hatte der alte Drecksack wieder recht behalten.
Langsam kam er auf die Beine. Die Welt drehte sich und er kotzte noch mal einen riesigen Schwall Wein aus. Direkt auf seine Stiefel. Das fing ja gut an. Ein Tag in Freiheit und da stand er. Vollgeschissen und vollgekotzt. Beraubt und obdachlos und keinen blassen Schimmer, wohin er sollte. Perfekt für einen Start in ein neues und besseres Leben.
Wieder zurück zu Jassum? Nein, diese Blöße wollte er sich nicht geben.
Unschlüssig stand er da. Gestern noch der Held der Arena, heute ein versoffener Dreckskerl.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße!«, fluchte er laut. »Aber warte, die Nutte krieg ich.«
Den Namen wusste er noch. Flatela. Und er würde sie finden.
In dem Gebiet bei der Stadtmauer wimmelte es von Huren und deren Zuhältern. Er fragte sich durch, bis er die passenden Informationen hatte.
Bald hatte er die Hütte von Flatela gefunden und legte sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf die Lauer.
Zur Dämmerung hin kam sie mit einem groben, gut abgefüllten Kerl an, der hinter ihr her torkelte.
›Gut, Schätzchen. Das wird dann erst mal dein letzter bezahlter Fick sein‹, dachte Xar’non hämisch. Schnell wurde es dunkel und der Xin schlich sich an die Hütte ran. Von innen drangen die typischen Geräusche nach draußen. Das Grunzen des Mannes und das aufgesetzte Gestöhne der Hure. Mit einem Ruck riss er die morsche Tür auf, und dabei fast aus den Angeln. Er trat dem Mann von hinten in die Eier, versetzte ihm links und rechts zwei kräftige Schläge in die Nieren und schlug dann mit der Handkante in den fleischigen Nacken.
Er packte den Bewusstlosen an der Schulter, rollte ihn von der Hure runter und schaute auf ein schartiges Messer, das Flatela ihm entgegenstreckte.
Mit einem Lächeln trat er der Frau die Waffe aus der Hand. Er schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und riss sie an den Haaren auf ihr Lager aus fauligem Stroh und Lumpen zurück. Der Xin drückte mit seinen Knien ihre Arme herunter und legte die rechte Hand um ihre Kehle. Er beugte sich langsam vor und flüsterte: »Wo ist mein Gold?«
Dabei ließ er seinen nach Kotze stinkenden Atem über ihr Gesicht streichen.
Tränen schossen ihr in die Augen. »Ich habe es nicht mehr«, schluchzte sie.
Xar’non schlug ihr mit aller Kraft ins Gesicht. Flatela setzte zu einem Schrei an.
»Schnauze, oder ich verspreche dir, ich reiße dir den Kopf ab«, zischte er. »Noch mal. Wo ist mein Gold?«
»Ich hab’s nicht mehr. Ehrlich. Ich hatte Schulden. Fast alles weg. Der Rest liegt unter der Feuerstelle vergraben.«
»Danke Schätzchen«, grunzte Xar’non und schlug sie mit einem Rückhandschlag bewusstlos.
Die Feuerstelle war kalt und nach kurzem Graben hatte er seinen Lederbeutel gefunden. Siebzehn Münzen waren noch drin.
›So viel Schulden hat 'ne Nutte? Meine Fresse. Na ja. Besser als nichts‹, dachte er. Verstohlen schlich er sich aus der Hütte und suchte nach der Stadtwache. Zwei standen vor einer Spelunke und tranken Bier.
»Hey, ihr zwei. Da hinten in der Hütte von der Nutte Flatela gibt’s Ärger. Schaut mal nach.«
Er ging weiter zu einem Badehaus und säuberte alles gründlich; sich und seine Sachen.
In einem Wirtshaus aß er ein großes Stück Fleisch mit Wurzelgemüse und spülte alles mit frischem Wasser runter. Vom Wein hatte er erst mal genug. Er schaute aus dem Fenster und sah zufällig, wie die Hure abgeführt wurde. Der dicke Freier watschelte schimpfend hinterher. Er dachte, Flatelas Zuhälter hätte ihn niedergeschlagen und zusammen mit der Nutte beraubt; denn seine Geldbörse war weg.
Xar’non grinste. Nein, er war wirklich kein Zuhälter, aber die Börse des Mannes hatte er trotzdem genommen. Er nächtigte in dem Wirtshaus und nach einem ausgiebigen Frühstück ging er Richtung Stadttor.
Draußen vor der Stadt war die Hure an den Pranger gestellt worden. Man hatte sie ausgepeitscht und gebrandmarkt. Erschöpft und blutig hing sie an den Händen gefesselt am Pfahl.
»Na?! Eine schöne Nacht gehabt?«, rief er rüber.
Die Frau schaute auf und sah ihn zornig an. Sie spuckte blutigen Schleim aus und verfluchte ihn mit heiserer Stimme.
»Jaja, fluch du ruhig. Es kommen ja noch ein paar Nächte, in denen du hier umsonst deine Dienste anbieten musst. Viel Spaß dabei!«, rief er lachend zurück und ging weiter, ohne auf ihr Gekeife zu hören.
Draußen vor der Stadt lag der Waffenmarkt. Ein Schwert, ein Lederharnisch und ein Rundschild mit einem stählernen Buckel in der Mitte wechselten im Tausch gegen drei Goldmünzen den Besitzer.
Schon fühlte er sich wohler. Dann suchte und fand er die Einschreibungshütte für Männer, die als Söldner für Dervon Tai kämpfen wollten.
Erst mal Geld verdienen ... und kämpfen konnte er halt am besten.
2. Brakfeste Gramo’on Broman
»Broman, du bist eine Schande für alle Braks!«, rief der oberste Stollenmeister aus und warf theatralisch die stämmigen Arme über den Kopf. Wutschnaubend stampfte Ermon dann mit auf den Rücken gekreuzten Armen im Kreis durch das Zimmer und warf Broman immer wieder böse Blicke zu.
Seit Jahren, nein Jahrzehnten kam der junge Brak zu spät zur Arbeit, und wenn er kam, führte er die Arbeiten schlampig aus oder gar nicht.
Durch schlecht gebaute Tunnelabstützungen oder zu früh losgelassene Loren hatte er schon mehrmals Leben und Maschinen gefährdet. Genauso wie gestern, als ihm ein zentnerschwerer Brocken Erz aus dem Greifer gerutscht war und dabei fast den Stollenmeister unter sich begraben hatte.
Jetzt war ein und für allemal Schluss. Der oberste Rat hatte gestern in einer Eilsitzung das Urteil gefällt.
Es war nicht das erste Mal, dass der junge Brak eine Standpauke bekam und deswegen schaltete Broman die Ohren auf Durchzug und schaute sich wieder einmal das Arbeitszimmer des Stollenmeisters an.
An den Wänden standen Regale, die vollgestopft waren mit Pergamentrollen, Büchern, Miniaturen von Seilwinden, Kränen, Loren und anderen Maschinen, die man für den Bergbau brauchte.
Der Bergbau, der alle Clans der Braks ernährte, der Bergbau, für den jeder Brak lebte – der Bergbau, den er so sehr hasste.
Zwei Ereignisse hatten ihn zu einem anderen Brak werden lassen.
»Komm, Broman, spann die Eldar vor den Wagen. Wir müssen uns beeilen. Die Menschen haben keine Geduld und warten nicht lange. Hopp, hopp!«
Beim großen Hämmerer, war Broman aufgeregt. Zum ersten Mal in seinem Leben würde er die Brakfeste mit seinem Vater verlassen und zu einem Markt der Außenwelt gehen.
Eilig spannte er die störrischen Zugtiere der Braks an. Mit der Rechten führte er die Eldars, die Linke legte er in die schwielige Hand seines Vaters und schaute lächelnd in sein bärtiges Gesicht.
»Danke, Vater, dafür dass ich mitkommen darf.«
Der alte Brak lächelte gütig zurück und dachte wehmütig an sein eigenes erstes Mal.
In einem ungewöhnlich flotten Tempo, zumindest für Braks, näherten sie sich dem Ausgang.
Schabend öffnete sich das Tor der Brakfeste und Broman riss der Ausblick fast von den Füßen. Mit aller Kraft hielt er sich an seines Vaters Hand und an den Zügeln der Eldar fest, so überwältigend war das, was er sah. Die riesige gelbe Sonne, die er nur aus Erzählungen kannte, schien von einem hellblauen Himmel herab, an dem kleine Wolken entlangzogen. Die Straße vor ihnen schlängelte sich durch eine sanft abfallende, mit saftig grünem Gras bewachsene Hügellandschaft. In weiter Ferne, fast nicht zu erkennen, stand die trutzige Burg der Menschen.
»Das ist Hohen Horst, mein Junge.« Broman saugte den Anblick in sich auf.
»Wenn wir hier stehen bleiben, kommen wir zu spät. Auf geht’s!«, sprach der Vater sanft und schob seinen Sohn über die Schwelle.
»Ja, Vater.«
Er zog an den Zügeln und die Eldar setzten sich zu seinem Erstaunen, ohne die typische Störrigkeit, in Bewegung.
Das Gras fühlte sich wunderbar weich unter den Stiefeln an. Insekten summten um sie herum. Vögel flogen frei am Himmel, nicht eingesperrt in Käfigen. Schafherden weideten auf den Hängen und Menschen bearbeiteten ihre Felder. Die Freiheit und Größe der Landschaft erschien Broman grenzenlos.
Am nächsten Tag, als die Sonne am höchsten stand, erreichten sie den Marktplatz und bauten ihren Stand auf. Broman war so aufgeregt wie selten zuvor.
»Schau dich um«, sagte der Vater, drückte ihm ein paar Münzen in die Hand und gab ihm einen Klaps auf den Rücken.
Mit staunenden Augen schlenderte Broman über den Markt.
›Beim Hämmerer, sind die Menschen groß‹, dachte er.
Den meisten reichte er gerade bis zur Brust. Die jungen Kinder waren so groß wie er. Sei es drum. Es gab so viel zu sehen. Da waren die Bauern, die ihre Feldfrüchte verkauften. Tischler, Weber, Gerber und Schmiede, deren Arbeiten aber sehr minderwertig in seinen Augen waren, stellten ihre Waren aus. Broman war überwältigt.
Auch die Gerüche versetzten ihn in eine andere Welt: Mal süß und mal würzig wehte es aus den Garküchen herüber. Ein Fest für die Nase, besser als der ewig muffige Gestank aus den Stollen.
Aber am interessantesten waren die unterschiedlichen Besucher des Marktes: Da waren nicht nur Menschen. Aber er kannte die anderen Rassen aus der Brakschule.
Die Gromlums erinnerten ihn am ehesten an seine Spezies. Sie waren ein wenig kleiner als er, und längst nicht so stämmig. Mehr wie junge Menschenkinder waren sie gebaut.
Dann gab es noch die Kalabonks. So wie seine Kenntnis war, kamen sie aus einem riesigen Wald. Er konnte sich zwar nicht vorstellen, was ein Wald sein sollte, aber er wusste, was ein Baum war und davon unzählbar viele; so hatte sein Freund Trand es ihm erklärt. Kalabonks waren noch kleiner und dünner als Gromlums und pechschwarz, wie Holzkohle. Wenn er mit einen von denen ringen würde, hätte er Angst ihn zu zerbrechen.
Dann kreuzte eine Gruppe Xin seinen Weg. Mit langen weißen Gewändern bekleidet, sah es fast so aus, als ob sie über dem Boden schwebten. Erhaben schritten sie dahin, überragten jeden Menschen um wenigstens Haupteslänge und genossen die bewundernden Blicke der meisten. Ihre schmalen, länglichen Gesichter waren eingerahmt von weißen Haaren. Die mandelförmigen Facettenaugen, die kleinen Münder und die grazilen Nasen, alles bei den Xin war so andersartig, dass Broman mit offenem Mund dastand und ihnen staunend hinterherschaute.
Eine Menschenfrau kam auf ihn zu und ging in die Knie.
»Oho! Was haben wir den hier? Einen jungen Brak!«
Sie roch nach Blumen. Er liebte den Duft von Blumen. Leider gab es zu Hause diese Wunder der Natur nur, wenn Vater vom Markt, welche für seine Mutter mitbrachte.
»Ha-ha-hallo!«, stammelte er verlegen.
»Kann ich etwas für dich tun, mein Süßer?«, hauchte sie.
Oh ja, das konnte sie, dachte sich Broman freudig. Er legte sich in die Brust.
»Meine Dame«, sagte er höflich, »Sie könnten mir sagen, wie ich an eine Sache komme, so dass ich den Duft der Blumen, wonach Sie so gut riechen, mit nach Hause nehmen kann.«
Die Frau guckte ihn verdutzt an und fing herzhaft an zu lachen.
»Das hat mich noch keiner gefragt. Du bist mir ja einer. Na komm, ich zeig es dir. Umsonst ist das aber auch nicht.«
»Schon gut.« Er kramte ein paar Münzen aus seiner Tasche und legte sie in ihre ausgestreckte Hand.
»Reicht das?«
»Ob das reicht?« Sie schluckte. »Das reicht fürs ganze Jahr. Komm mein Held, ich gebe dir, was du brauchst.«
Sie gingen zu einem Zelt, in dem die Frau kurz verschwand und mit drei kleinen Flakons wieder herauskam. »Das ist alles, was ich habe. Ich hoffe, du magst es?«
Broman öffnete die Flaschen der Reihe nach und war von jedem einzelnen Duft begeistert.
»Danke, die Dame«, sagte er, verbeugte sich höflich und schlenderte weiter über den Markt. Er besorgte sich noch etwas zu essen und hatte einen kurzen Streit mit einem Wirt, dessen Bier er zu wässrig fand. Ansonsten war er aber voll zufrieden, als er sich am nächsten Morgen mit seinem Vater auf den Heimweg machte.
Das war die eine Sache, weswegen er den Berg so hasste. Weil er es liebte, im Draußen zu sein – und zum Zweiten:
Am nächsten Tag war er Vollwaise geworden.
»Der Berg hat sie zu sich geholt«, hatte der Priester bei der Gedenkfeier gesagt. Ein Begräbnis gab es nicht, denn sie waren ja schon begraben. Es sei eine Ehre, wenn der große Hämmerer einen Brak so zu sich holte. Broman hätte ihm am liebsten seinen Hammer in die salbungsvolle Schnauze geschlagen, die Beine gebrochen und dann in das tiefste Loch gestoßen, das es gab. So oft hatte er es sich ausgemalt, wie er dann auch noch laut dafür gebetet hätte, dass die Edroks den Priester holen sollen, um ihn dann dem Wy’yrm zum Fraß vorzuwerfen.
Aber er hatte sich beherrscht und nichts getan. Nur geweint und getrauert. Seitdem hasste er den Berg Gramo’on und alle, die darin lebten.
Der Hass ging über in Resignation.
Die Resignation wurde zu Gleichgültigkeit.
Ihm war es egal, wenn er Fehler machte. So schwere Fehler, dass dabei Maschine und Brak gefährdet wurden.
›Es ist doch eine Ehre, wenn der große Hämmerer einen holt ...‹, dachte er oft voller Sarkasmus.
So glühend wie ein normaler Brak – aber was hieß schon normal? – die Arbeit in den Minen liebte; verabscheute er sie im gleichen Maß.
Das Kriechen in den Stollen, die dauernde Dunkelheit, der Staub, die schlechte Luft und die Plackerei, die so hart war, dass man jeden Abend halb tot ins Bett fiel und sofort einschlief, stieß ihn in eine Lethargie, die ihn daran hinderte, der Brakfeste Gramo’on kan Brak den Rücken zu kehren.
Das Einzige, was ihn am Leben hielt, war die Erinnerung an seine Eltern. Daran, dass seine Mutter den Duft von Blumen liebte, und sein Vater ihm die weite Welt draußen vor dem Tor gezeigt hatte.
»Broman! Hörst du mir überhaupt zu!«, brüllte ihn Ermon an.
»... hm? Jaja, ehrwürdiger Oberbaumeister«, gab er murmelnd zurück.
»Nein, du hast mir nicht zugehört. Dir ist es egal, wie immer. Wie oft haben wir dich schon ermahnt? Du benimmst dich unmöglich, ohne Verantwortungsgefühl. Du benimmst dich, als seist du nicht ein Teil dieser Gemeinschaft. Darum höre jetzt das Urteil, welches der oberste Rat erlassen hat ...«
Dabei stellte er sich hinter den Tisch und schaute Broman ernst in die Augen.
»Broman, Trabors Sohn, hiermit verbannen wir dich aus der Brakfeste Gramo’on. Hundert Jahre sollst du draußen leben, ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Braks. Keine andere Feste wird dich aufnehmen und dir Schutz bieten. Möge dich diese Strafe läutern und dir Erleuchtung bringen. Du kannst gehen!«
»Was?«
»Hole deine Sachen und verlasse noch heute Gramo’on kan Brak!«, sagte Ermon fest.
»Jaja!«, stammelte der Verurteilte und ging rückwärts zur Tür, zog sie auf und verschwand mit einem kurzen Kopfnicken.
Ermon setzte sich schwer hin und stützte seinen Kopf in die Hände. Wie viele Jahre schon brachte dieser Broman ihn um den Verstand? Es war jetzt wirklich Zeit gewesen, Konsequenzen zu ziehen. Die Strafe war hart, aber gerecht, dachte er, seufzte und wandte sich den Plänen für die nächsten Stollen zu.
Broman stand draußen vor der Tür und konnte es nicht fassen. Verbannung? Pah! Endlich durfte er weg aus diesen stinkenden, verrußten Höhlen und den beengenden Stollen. Raus in die weite Welt, mit frischer Luft und strahlender Sonne, saftigen Wiesen und Wäldern, Flüssen und Seen aus den Geschichten. Vielleicht würde er sogar das Meer irgendwann sehen.
Alle Schwermut fiel mit einem Schlag von ihm ab. All das, wonach er sich in den Jahrzehnten dumpfen Dahinlebens gesehnt und nie geschafft hatte es anzugehen, wurde jetzt vor ihm, wie ein neues Kapitel in einem Buch aufgeschlagen.
Er rannte laut jubelnd zu seiner Wohnkammer. Vorbei an staunenden Braks, die kopfschüttelnd, hastig zur Seite wichen. Schnell stopfte er seine Habseligkeiten in einen Rucksack. Steckte sich händevoll bunte Steine, die die Menschen so liebten, in die Hosen und Manteltaschen und riss den mächtigen Bergbauhammer aus der Halterung von der Wand. Hektisch blies er das kleine Öllicht aus und schloss die Tür von außen mit einem lauten Rumms, welcher sich in seinen Ohren sehr endgültig anhörte.
Er rannte los und überlegte, ob er sich noch irgendwo verabschieden sollte, ihm fiel aber niemand ein. Seitdem seine Eltern ums Leben gekommen waren, hatte er niemanden gehabt, den er als Freund bezeichnen konnte.
»Endlich frei, raus hier!«
Scharf zog er die Luft ein. Er hatte noch was vergessen. Schnell hastete er zurück, riss die Tür auf, entzündete hektisch die Öllampe und kramte in seinem Schrank. Da! Der Beutel mit Medizin und Verbänden – in den Rucksack. Und da! Das Wichtigste: Die drei Flaschen mit dem Riechwasser, die er seiner Mutter geschenkt hatte. Die sie aber nie ausprobieren konnte. Behutsam steckte er sich die kleinen Fläschchen in seine Brusttasche.
Jetzt aber! Er schlug die Tür achtlos hinter sich zu und sauste wieder los, Richtung Haupttor.
»Hrrr! Schon wieder ... Scheiße!« Noch mal zurück, Tür auf, Öllampe auspusten und wieder los.
Froh gelaunt kam er am Tor an. Die beiden Wächter wussten anscheinend Bescheid, denn sie öffneten ihm sofort.
»Hey!«, rief Broman. »Warum so trübsinnig?«
Die beiden schauten ihn verwundert an, während er hinaustrat. Dreiundvierzig Jahre, nachdem er zum ersten Mal Gramo’on kan Brak verlassen hatte, trat er wieder hinaus in eine grüne, von der Sonne beschienene Welt und stand auf der Straße. Diesmal aber nicht, um nur kurz den Markt zu besuchen. Nein, diesmal stand er am Anfang eines neuen Lebens. Denn zurückkommen, das hatte er sich fest vorgenommen, würde er nicht mehr.
Der Wind zerrte an seinem Bart und pflügte durch die strohigen, schulterlangen, braunen Haare. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals und in seinem Bauch rumorte es vor Aufregung. Er machte einen ausladenden Schritt und ließ dabei einen knatternden Furz fahren.
»Haha!«, lachte er laut auf. »Der Wind steht gut ... oder wie sagen die Menschen von der Küste immer?«
Hinter ihm schloss sich schabend das Tor der Brakfeste.
Mit einem fröhlichen Pfeifen auf den Lippen ging er los, seinem größten Abenteuer entgegen.
3. Argan Tai Andras
Bis auf drei Bengel, die einen verkrüppelten Bettler mit kleinen Steinen bewarfen, war der Marktplatz von Argan Tai leer. Nach einiger Zeit verloren sie den Spaß daran und widmeten sich den Ratten, die das getrocknete Blut unter der Hirnrichtungsplattform vom Boden knabberten. Aber auch das wurde noch einiger Zeit langweilig und sie setzten sich an die Absperrung, um nachher eine gute Sicht zu haben. Denn heute wurde was geboten.
Die Familie des Bauern Lüten sollte wegen Wilderei hingerichtet werden. Vater, Mutter, die beiden Söhne und die fünfjährige Dita.
Es war bekannt, dass mit dem neuen Herrscher von Argan Tai, Rand I, nicht gut Kirschen essen war. Die Gesetze waren streng und die Strafen grausam.
Also: Nichts Unrechtes zu tun, oder man ließ sich dabei nicht erwischen.
Beides hatte die Familie Lüten nicht beherzigt und musste jetzt dafür bezahlen.
›Besser, wenn die Obrigkeit sich an anderen ausließ, als an einem selbst.‹ So dachten die meisten Bewohner von Argan Tai.
Die zwei Missernten in den letzten Jahren, die hohe Abgabenlast an das neue Königshaus und die folgende Hungersnot hatte fast jeden kriminell werden lassen. Suff und Hurerei bestimmten das Straßenbild. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung.
Aber ein paar Leute gab es noch, die sich gegen die Grausamkeit Rand’s stellten oder zumindest versuchten, sie zu mildern.
Andras hatte eine gute Sicht auf den Hirnrichtungsplatz. Das Zimmer im dritten Stock des Gasthauses ›Zum goldenen Schwein‹ war perfekt für sein Vorhaben, so wie sooft zuvor.
Auf dem Bett hüpften die Flöhe, das Stroh in den Kissen faulte und die Wanzen ließen sich von der Decke herunterfallen, um ihre Opfer zu piesacken. Andras war das egal. Er wollte hier nicht nächtigen. Er hatte eine Aufgabe zu erfüllen.
»Jamon! Sind die Pfeile fertig?«
Andras drehte sich zu dem Mann um, der auf dem Boden kauerte und dort mit Töpfen und Tiegeln und kleinen Blasrohrpfeilen hantierte.
»Ja, gleich. ... bin kein Hexenmeister, sondern Giftmischer und wir wollen ja beide, dass das Gift seine Wirkung entfaltet«, kam die mürrische Antwort.
»Beile dich. Die fangen gleich an.«
»Ja! Bei allen Göttern. Das Gift muss an den Pfeilspitzen richtig getrocknet sein, sonst wirkt es nicht. Ich sage dir Bescheid!«
Andras drehte sich dem Fenster zu. Er strich die schulterlangen, glatten, schwarzen Haare nach hinten und spähte durch den fadenscheinigen Vorhang hinunter auf den Marktplatz.
Die Tribüne für den Statthalter Rands I. und die hohen Herren der Stadt wurde soeben hergerichtet. Die Schenken und Garküchen öffneten ihre Türen und Fenster und schon kam der erste Pöbel, um sich Bier zu bestellen.
Die Henkersknechte brachten die Utensilien für die Hinrichtung. Nach einer Stunde stand auf der zehn Schritt im Quadrat und ein Schritt hohen Plattform alles bereit:
Der vier Schritt lange, vorne spitz zu laufende Pfahl; die zwei Schritt lange Säge, das Kreuz mit den Lederriemen zum Fixieren, und der mächtige Topf Öl, der mit Kohlebecken erhitzt wurde.
Die drei Bengel vom Morgen standen direkt an der Absperrung und hatten beste Sicht. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Der Bettler, den sie geärgert hatten, schlug noch schnell ein Bein unter, um mehr Mitleid zu erregen, und freute sich auf ein lukratives Geschäft.
Die Wirte hatten immer mehr zu tun. Zum Saufen hatte paradoxer weise auch der ärmste Hungerleider immer Geld. Und so füllte sich der Platz mit Schaulustigen jeden Alters.
Andras schaute erschüttert hinab. Was war bloß aus dieser Stadt geworden. Seit vor zwei Jahren der Herrscher von hohen Horst, Rand I., Argan Tai im Handstreich einnahm, hatten sich die Bewohner, gebeutelt von Hunger und Armut, in blutgierige Monster verwandelt.
Von der einst blühenden Metropole war nicht mehr viel übrig. Das weise, herrschende Königshaus war von Rands Henkersbeil ausgelöscht worden. Andras war der einzige Überlebende dieses Massakers gewesen.
Nur noch das Recht des Stärkeren regierte die Straßen. Das gemeine Volk gab sich dem Suff hin, die neuen Adeligen, angeführt von dem Statthalter Sragon Kempra, frönten der Völlerei und die Armen verreckten kläglich im Dreck der Straße.
Nur er, Andras, und ein paar andere versuchten, zumindest ein wenig das Schicksal mancher Unglücklichen zu lindern. Auch, wenn es nur so ging, dass er die Delinquenten selbst in Reuds Reich schickte.
So wie heute, wieder einmal.
»Hier Andras. Die Pfeile und das Blasrohr«, sagte Jamon und reichte ihm die Sachen.
»Nur fünf Pfeile?«, fragte Andras entsetzt.
»Mehr Gift hatte ich nicht«, bedauerte Jamon. Er legte Andras die Hand auf die Schulter. »Möge Reud deine Zielgenauigkeit mehren. Ich gehe nach unten und passe auf, dass du ungestört bleibst.« Er klopfte ihm auf die Schulter und ging.
Andras schaute auf die Utensilien.
»Wieder liegt es an mir, Schlimmeres zu verhindern«, flüsterte er und ging zum Fenster.
Die fünf Henkersknechte mit ihren roten Kapuzen betraten die Plattform. Alle waren grobschlächtige, kräftig gebaute Männer. Ihre Brutalität war über die Grenzen Argan Tais hinaus bekannt. Die Menschen fürchteten und verachteten sie. Aber die Vorfreude auf die Abwechselung in ihren stumpfen Leben ließ sie alles vergessen, auch dass sie in der folgenden Woche schon die Nächsten sein konnten.
Die lange Holzfällersäge, die von zwei Menschen geführt werden musste, wurde inspiziert. Einer der Henker entfernte noch die letzten Fleischfetzen von der jüngsten Hinrichtung und schmiss sie mit hämischen Lachen in die Menge, die angeekelt zurückwich. Zwei Ratten huschten herbei und schnappten sich die Leckerbissen.
Der lange Pfahl wurde mit Fett eingeschmiert. Die Spitze wurde nochmal glatt geschliffen. Sie sollte spitz sein aber nicht zu spitz. Die inneren Organe sollten beim Pfählen zur Seite geschoben, nicht aufgespießt werden. Eine Kunst, die diese Männer perfekt beherrschten.
Das Öl im großen Kochtopf war heiß. Die Mechanik um einen Menschen langsam in den Topf abzulassen, wurde installiert. Die Lederriemen am Kreuz, zum Fixieren der bedauernswerten Opfer, waren neu, stark und reißfest, mussten sie auch sein. Manche Männer bekamen übermenschliche Kräfte, wenn man sie häuten oder verstümmeln wollte. Vor kurzen noch hatte ein Schmied, nachdem man ihm den rechten Fuß abgehackt hatte, die Armriemen zerrissen, mit beiden Händen den Kopf des Henkersknecht erwischt und ihm mit einem Ruck das Genick gebrochen. Als Strafe dafür hatte es eine Woche gedauert, bis der Schmied endlich seinen letzten Atemzug getan hatte.
Einer der Knechte nahm einen fetten Schinken und schmiss ihn in den Topf, mit dem heißen Öl. Das Zischen und Blubbern war so laut, dass die Menge ein wenig zurückwich. Der Knecht spießte das Fleischstück mit einem Speer auf, zog es heraus und warf den Schinken in die Zuschauer. Diesmal stoben die Menschen nicht auseinander, sondern sprangen mit Gejohle auf das halb rohe Stück Fleisch. Manche prügelten und schlugen sich, um etwas abzubekommen.
Nachdem sich der Tumult gelegt hatte, kam eine unheimliche Stille über den Platz. Alle warteten, dass der oberste Richter und der Henker mit der Familie Lüten erschienen.
Dann endlich konnte man die große Trommel hören, die das Eintreffen der Gruppe ankündigte. Der oberste Richter in seiner schwarzen Robe und dem hohen zylinderförmigen Hut hielt die Pergamentrolle mit dem Urteilsspruch und schritt voran. Dahinter schritt der Henker, komplett in schwarzes Leder gekleidet, behelmt und bewaffnet mit einem riesigen Beil. Er hielt das Seil, mit der er die Familie Lüten hinter sich herzog.
Zuerst kam der Vater, der mit tippelnden Schritten hinterherlief. Fast nackt war er, über und über mit Brandwunden bedeckt. Die blutverschmierten Finger und Zehen zeigten jeden, der es sehen konnte, wo vor der Folter die Nägel gesessen hatten. Seiner Frau, mit der kleinen Dita an der Hand, hatten die Folterknechte nicht so hart zugesetzt. Ihr glasig stierender Blick zeigte aber, dass auch ihr übel mitgespielt worden war, wahrscheinlich so, wie es die Folterknechte immer mit gefangenen Frauen taten.
Dita weinte tonlos in den Rock der Mutter. Ihre kleine Kinderseele war in den letzten Tagen durch die Grausamkeiten, die sie erleben musste, gebrochen worden. Wenn sie wüsste, was noch alles kommen würde ...
Die beiden Söhne liefen mit stolz erhobenen Häuptern hinterher. Stolz erhoben, aber blutverschmiert, grün und blau geschlagen und die Lumpen, die sie anhatten, waren rotbraun verkrustet.
Der Tross endete mit vierzig Soldaten, die sich nun rund um die Plattform verteilten. Langsam mit gemessenen Schritten betrat der Richter über eine kleine Treppe die Richtstätte und stellte sich in die Mitte.
Langsam entrollte er das Pergament und schaute drohend in die Zuschauer. Die dumpfe Trommel endete mit einem Wirbel und die Menge verstummte.
»Im Namen des Königs Rand I, von Hohen Horst, Protektor von Argan Tai, verkünde ich, dass die Familie Lüten wegen Wilderei zum Tode verurteilt worden ist und heute vom Leben zum Tod gebracht wird.
Die Schwere des Verbrechens bestimmt die Schwere der Strafe. Arnen Lüten wird gepfählt, so wie er das Wildschwein gepfählt und über dem Feuer geröstet hat. Ernane Lüten wird die Haut abgezogen, so wie sie das Fell des Wildschweines abgezogen hat. Arend Lüten wird mit der Säge geteilt, so wie er das Wildschwein mit der Säge geteilt hat. Berend Lüten wird ausgeweidet, so wie er das Wildschwein ausgeweidet hat.
Dita Lüten wird in siedendem Öl gekocht, so wie sie mitgeholfen hat Teile des Wildschweines zu kochen.«
Beim letzten Urteilsspruch ging ein Raunen durch die Menge. Frauen drückten ihre Kinder an sich und Männer drohten mit den Fäusten.
»Wer das Urteil anfechten möchte, soll jetzt vortreten oder für immer schweigen.«
Langsam drehte sich der Richter um die eigene Achse und schaute in die Menge. Sofort verstummten die Protestrufe.
»Nun denn!«, rief der Richter. »Möge die Familie Lüten durch Schmerz und Tod Läuterung erfahren und reinen Herzens in Reuds Arme fallen. Henker, walte deines Amtes!«
Andras machte sich bereit. Nun war es wieder einmal an ihn, das Leiden der Verurteilten zu mildern. Wie oft schon hatte er so den Schuldiggesprochenen geholfen? Aber was konnte er sonst tun, außer diesen Akt der Gnade zu vollziehen?
Das Kreuz wurde auf zwei Böcke abgelegt und der Vater bäuchlings darauf fixiert. Die Arme am Querbalken. Um die Fußknöchel knoteten zwei der Knechte Seile und zogen die Beine links und rechts herunter. Der Henker trat mit einem breiten Messer in der Hand herbei.
Die Frau und die Söhne schrien, wollten sich losreißen und auf den Henker losstürmen. Die Knechte schlugen mit Knüppeln auf Bauch und Rücken ein, bis die Jungen und die Mutter Ruhe gaben.
Totenstille herrschte. Nur das leise Weinen Ditas, die jetzt zitternd und allein dastand, war zu hören.
Als der Henker merkte, dass die ungeteilte Aufmerksamkeit ihm gehörte, begann er sein blutiges Handwerk. Er widmete sich dem Vater und erweiterte mit dem Messer die natürliche Öffnung in die der Pfahl eindringen sollte. Der geschundenen Körper wollte sich aufbäumen wurde aber von den Fesseln und Seilen zurückgehalten. Dabei gab er ein Geräusch von sich wie ein morsches Stück Holz das man langsam brach. Die Zähne klapperten und die Gesichtsmuskeln zuckten unkontrolliert. Dann erstarrte das Gesicht zu einer Maske des Schmerzes, den dieser arme Mann erlitt. Das war Andras Zeitpunkt.
Er zielte und traf. Der kleine Pfeil drang in die Seite des Körpers ein. Innerhalb von Sekunden erschlaffte der Mann und er bekam nicht mehr mit, wie der Henker und seine Knechte den Pfahl langsam in seinen Leib einführten, bis er kurz über dem Schulterblatt die Haut nach außen drückte. Einer der Knechte machte einen Kreuzschnitt über der Wölbung und der Pfahl trat aus dem Körper heraus. Die Füße wurden mit den Seilen an den Pfahl gefesselt; die Hände ebenso. Dann wurde er aufrecht gestellt und in einer Vertiefung der Plattform fixiert. Andras Pfeil blieb unbemerkt. Der Henker nickte seinen Knechten zu, die sich der Frau zuwandten. Dita die sich neben ihre Mutter gekniet hatte, wurde grob weggezerrt und bekam eine Ohrschelle, als sie schreiend zu ihr zurück wollte. Wimmernd kroch sie zu ihren Brüdern und die Menge wurde merklich unruhiger. Mit einem Ruck rissen die Knechte Ernane die Lumpen vom Leib und stießen sie zu dem Kreuz, dass die anderen zwei Schritt neben dem Gepfählten aufrecht hingestellt hatten. Um die Handgelenke knoteten sie Seile, welche über den Querbalken geworfen wurden. Somit hing die Frau mit dem Bauch gegen das Kreuz. Die Beine wurden unten an den Balken festgebunden und der Henker trat hinzu. Er zog ein kleines scharfes Messer und schnitt von einer Schulter zur anderen. Ernane schrie auf und warf heftig den Kopf in den Nacken. Mit zwei weiteren geschickten Schnitten von den Schultern bis hinunter zum Becken hatte er die Schmerzgrenze der Frau überschritten und sie fiel in Ohnmacht. Dachte der Henker. Durch die beengte Sicht sah er nicht den kleinen Pfeil der in Ernanes dichtem Haarschopf steckte. Nach zehn Minuten war er fertig und Ernane ein roher Klumpen Fleisch. Nur noch schwer erkennbar, dass der Haufen, der nach dem Abnehmen vom Kreuz, und auf den Brettern der Plattform lag, einmal ein Mensch gewesen war.
Die Menge war wieder ruhiger geworden. Die Hinrichtung war, wie sooft blutig, aber die Delinquenten fielen, schnell in Ohnmacht, und mussten nicht lange leiden.
Nun legten zwei der Gehilfen das Kreuz auf die Böcke, während die drei anderen den sich heftig wehrenden Berend herbei zerrten.
Der junge Mann wurde mit dem Rücken auf das Kreuz gelegt und mit den Lederriemen fixiert. Der Henker kam mit einem sichelförmigen Messer und ohne zu zögern, öffnete er mit den Unterleib. Den Mund zu einem lautlosen Schrei geöffnet bäumte Berend sich auf, wodurch die Eingeweide durch die geschaffene Öffnung hervorquollen. Sofort griff der Henker zu und fing an zu zerren. Der Junge sackte zusammen. Andras hatte ihn im Ohr so gut getroffen, dass der Pfeil fast im Schädel verschwunden war. Nach zwei Minuten war der Henker fertig und die Leiche des Jungen wurde achtlos neben die Überreste der Mutter geworfen.
Andras war bisher zufrieden mit seiner Arbeit, wenn man damit überhaupt zufrieden sein konnte, Menschen zu Reud zu schicken. Aber was sollte er machen. War es Unrecht unschuldigen Menschen Leid zu ersparen? ›Nein!‹, dachte er grimmig und nahm den nächsten Pfeil, steckte ihn in das Blasrohr und widmete sich wieder dem Ort, des grausamen Geschehens.
Die Knechte stellten zwei Holzbalken in Vertiefungen der Plattform in einem Abstand von zwei Schritt auf. Mit einem kräftigen Schlag in die Magengrube machte ein anderer Arend gefügig, und noch einer hielt die schreiende Dita fest.
»Bring das Balg zum Schweigen«, knurrte der Henker ihm zu. »Bring es aber nicht dabei um!«
Der Gehilfe drückte kurz auf die Halsschlagader des Mädchens, das daraufhin ohnmächtig zu Boden glitt.
Arend wurde mit den Füßen oben an den Holzbalken mit Fußeisen befestigt. Die Hände fesselte man unten an die Balken. Die Hose und das Hemd riss man ihm vom Leib. Der Junge schaute stumm und mit ausdrucksloser Mine in die Gesichter der Nächststehenden, die entweder betroffen wegguckten oder sich umdrehten und gingen, nur um sofort von den nächsten Gaffern, ersetzt zu werden. Einer der Knechte stellte sich hinter ihm und einer vor ihm auf. Der Henker reichte seinen beiden Gehilfen die Säge, die sie zuerst noch in Höhe der Knie hielten. Auf ein Zeichen ihres Meisters hin begannen sie Arend, vom Schritt an zu zersägen. Der erste Aufschrei des Jungen war markerschütternd. Das Blut spritzte in alle Richtungen. Arend brüllte und kreischte sein Leid heraus. Die Knechte kamen beim Bauchnabel an und beide waren über und über mit Blut und Exkrementen besudelt, als der Junge endlich verstummte.
Das Raunen der Menge wurde lauter.
Andras trat vom Fenster weg und seufzte. Deswegen sah er auch nicht, dass einer der Knechte den Pfeil bemerkt hatte und den Henker darauf aufmerksam machte.
Da pfuschte ihm einer ins Handwerk, und das konnte er gar nicht haben. Der Pfeil steckte in der Seite des Jungen. Er verfolgte die angenommene Schussbahn und sah mehrere Häuser, die aber alle nicht in Frage kamen, bis auf eins. »Zum goldenen Einhorn«
Er sah genauer hin ... bewegte sich da etwas hinter dem Fenster?
Andras schlug das Herz bis zum Hals. Hatte der Henker ihn angestarrt? Vorsichtig lugte er nochmals durch die Gardine. Auf dem Marktplatz hatte sich eine kleine Rauferei zwischen ein paar Betrunkenen und Wächtern entwickelt. Ansonsten fiel im Nichts auf.
Auf der Plattform wurde jetzt die kleine Dita mit den Armen an die Flaschenzugkonstruktion befestigt. Beim Hochziehen berührten ihre nackten Beine den heißen Kessel und sie kreischte erbärmlich auf, schrie nach ihrer Mama und zappelte an den Seilen wie ein Fisch am Haken.
Jetzt wurde die Menge unruhig. Immer mehr Rufe nach Erbarmen und Gnade kamen auf. Kleine Steine wurden geworfen und mutige Männer gingen gegen einige Wachen vor. Der Henker wusste, dass so eine Lage schnell eskalieren konnte. Nun gut, entschied er, sollte das Kind sterben, ohne zu leiden. Das Gekreische zerrte sowieso an den Nerven. Er gab dem einen Knecht das Zeichen, das Mädchen in den Topf fallen zu lassen, der sofort den Hebel umlegte. In dem Moment schoss Andras den Pfeil ab und ... verfehlte sein Ziel. Er hatte die Situation falsch eingeschätzt.
Normalerweise wurden die Delinquenten langsam in den Topf herabgelassen. Aber der beginnende Tumult auf dem Marktplatz hatte den Henker veranlasst, die Sache schnell zu beenden. Der Pfeil sauste über den Kopf des Mädchens hinweg. »Scheiße!«, fluchte Andras. Trotzdem wusste er, dass die Ohnmacht sofort einsetzten würde, und beruhigte sich damit. Zu seinem Erschrecken sah er aber eine furchtbare Wendung des Geschehens. Die Flaschenzugmechanik blockierte und Dita tauchte nur bis zu den Hüften in das heiße Öl ein. Das Mädchen schrie jaulend auf. Es strampelte und zappelte, rief immer und immer wieder schrill nach ihrer Mama, ihrem Papa und den Brüdern. Andras war erstarrt vor Schreck. Er hatte keine Pfeile mehr.
Die Menge fing an, vehement gegen die Wachen vorzugehen. Nicht mehr lange und der Mob würde auf den Henker und seine Knechte losgehen.
Andras sah das alles im Schock. Er hatte versagt. Gerade bei dem kleinen Mädchen hatte er versagt. Er schaute voller Scham weg und sah nicht, dass der Henker mit seinem Beil die Arme des Mädchens durchschlug. Klatschend fiel sie in das siedende Öl und starb.
Von unten rief Jamon herauf: »Beile dich. Ich glaube, wir sind entdeckt worden! Schnell!«
Andras schaute aus dem Fenster und sah mehrere Soldaten, die in seine Richtung liefen und ihn entdeckt hatten. Skrupellos brachen sie durch die Gaffer und rannten auf die Gaststätte zu.
»Hau ab Andras. Ich halte sie auf. Hau ab!!«
Sein Kamerad polterte die Treppe mit einem Kampfschrei herunter. Schwerter klirrten aufeinander. Jamon tat sein Bestes.
Andras schaute durchs Fenster zur Rinne hoch und zog sich daran auf das Dach. Die Häuser waren so nah aneinander gebaut, dass er von Dach zu Dach springen konnte. Er entfernte sich vom Marktplatz, bis er an der Stadtmauer ankam. Dort hangelte er sich in einen Hinterhof hinab, trat in eine schmale Gasse und steuerte von dort aus in Richtung Hauptstraße.
Nach einigen Schritten erreichte er diese und ging auf das Haupttor zu. Die beiden mürrisch drein blickenden Wächter musterten ihn nur kurz und vertieften sich wieder in ihr Würfelspiel.
Andras verließ Argan Tai mit einem unguten Gefühl. Die Schreie der kleinen Dita hallten noch in seinem Kopf nach. Und was war mit Jamon?
Hatte er es geschafft?
Er ging in Richtung Wald, der eine Wegstunde entfernt war. Dort hatten er und seine Gefährten ihr Lager in einer Höhle aufgeschlagen. Erstmal ausruhen und warten. Schlimmer konnte der Tag nicht mehr werden.
4. Drei Hügel Manapa
»Im Haus wird nicht geraucht!«
Diesen Satz seiner Mutter hatte Manapa Opum immer noch in den Ohren. Denn jeden Tag hatte sie es ihrem Mann sagen müssen. Deswegen war das Haus der Opums auch das einzige in Drei Hügeln gewesen, das eine Veranda hatte, wo man immer wieder den armen Mampo bei Wind und Wetter rauchen sehen konnte. Aber, dieser Satz veranlasste auch heute noch Manapa, seine Pfeife draußen vor der Tür zu rauchen. Nach seinem Lieblingsfrühstück, Brombeerpfannkuchen mit einem großen Becher frischer Milch wusch er sich, versuchte seine braunen halblangen Locken mit einem Kamm zu bändigen und zog sich an. Dann stopfte er seine Pfeife und entzündete sie mit einem Kienspan. Er ging nach draußen in den frühen klaren Morgen. Die Sonne stieg gerade im Osten über dem Nebelwald auf. Manapa atmete tief die frische Luft ein, die nach Wald und Fluss roch. Er zog seine Stiefel an, die vor der Tür standen, und ging um das Haus herum. Es war nicht groß, aber er hatte es mit seinen eigenen Händen erbaut. Es war auch nicht aus Stein, sondern aus Holz, aber genau das liebte er daran.
Das Haus seiner Eltern stand nicht mehr. Als er zehn war, hatte ein Blitzschlag das Heim seiner Familie zerstört. Bei dem Unglück waren auch seine Eltern ums Leben gekommen.
Daraufhin wuchs er bei seiner Tante Hilgo und seinem Onkel Jeper auf. Beide kümmerten sich um ihn, wie um einen eigenen Sohn, den sie nie gehabt hatten. Vor kurzen hatte er seinen dreißigsten Geburtstag gefeiert, leider nur mit Tante Hilgo, denn auch sein Onkel Jeper war schon tot. Oft saß er so da, hinter dem Haus auf seiner Holzbank und hing seinen Gedanken nach, während er auf den Aerenyr schaute.
Er lebte gerne hier zwischen dem Fluss und dem großen Wald. Und er war gerne Holzfäller, ein angesehener Beruf bei den
Gromlums, aber leider auch sehr einsam. Es war hart, aber er liebte es, hier inmitten der Natur zu leben.
Sorgfältig klopfte er seine aufgerauchte Pfeife aus , säuberte sie und ging zurück ins Haus. Dort stellte er sie in den Pfeifenständer. Danach spülte er sein Geschirr weg und machte ein bisschen sauber. Nachdem er sein Bett gemacht hatte, zog er sich seine Weste an und ging hinunter zum Fluss. Dort hatte er sich einen Steg gebaut, an dem sein Boot lag. Er stieg in das schwankende Gefährt und ruderte los.
Manapa wollte nach Drei Hügeln um Geschäfte zu machen, mit seiner Ware: Brennholz, Räucherholz, Holz für die Schreiner und Tischler, für die Wagenbauer und so weiter und sofort. Das Handeln und Feilschen lag ihm nicht aber es gehörte leider dazu. Zwei Mil flussaufwärts wäre ganz schön anstrengend für einen Ungeübten gewesen. Aber nicht für Manapa. Er strotzte vor Kraft und Vitalität und schaffte die Distanz in Windeseile.
Er legte in drei Hügeln an und sah vor sich eine fast glatte Graslandschaft, die nach tausend Schritt in den Nebelwald überging. Auf der Fläche vor ihm erhoben sich drei große Hügel, um und auf denen die Wohnstätten der Gromlums standen, kleine weiße Häuser, mit klobigen Türen, die sich den Besuchern öffneten. Runde Fenster ließen Licht und Luft in die Stuben, und die Dächer aus Rietgras boten Schutz vor Wind und Regen. Jedes Haus hatte einen blühenden Vorgarten mit wilden Blumen und Kräutern und ordentlich angelegte Kieswege führten durch das Dorf von Haus zu Haus.
Eine wunderbare Idylle ... zum angucken. Gromlums waren von Natur aus ein sehr friedliches Volk, aber die Fehden unter den Großfamilien gehörten schon zum guten Ton. Irgendwelche Streitereien gab es immer. Wurden die einen beigelegt, so brachen Neue oder auch Alte wieder auf.
Einer der Gründe für Manapa, nicht nach Drei Hügeln zu ziehen.
Heute hatte er einen vollen Plan. Er musste zu den Rutinrags, den Flatoks, den Agaps, den Rimizers, den Kradagrugs, zu Bulbo dem Schmied, einer seiner besten Freunde und zu Serm den Fassbauer. Er überlegte, wer gerade, mit wem in Fehde lag. Hmmmm ... kam aber nicht drauf. Egal.
Er ging vom Steg zum Marktplatz, wo die Fischer ihre Ware feilboten. Er grüßte alle recht freundlich und öffnete das Gatter zum Vorgarten seines ersten Kunden, den Kradagrugs. Manapa klopfte dreimal feste gegen die Tür.
Eine kleine, fette Frau mit einer schmierigen Schürze öffnete die Tür. Ihr strohiges braunes Haar stand zu allen Seiten ab. Ein Tropfen Rotz hing an ihrer roten Nasenspitze, den sie geräuschvoll hochzog.
»Häh?«, fragte sie. Das rechte Auge schaute ihn an, das linke blickte auf ihre Nasenspitze.
›Bei allen Göttern, nein‹, dachte Manapa. Ganz deutlich fing er an zu sprechen.
»Hallo Alma. Wie geht es dir ?«
»Häh?« Sie schaute ihn an wie eine Kuh.
»Wie geht es dir ?«
»Häh?«
»Ähem. Ist Serde da?«
»Gagi igi gageee. Nyani gigi hä dä dä fönö. Sek.«
Dabei gestikulierte sie heftig mit einem großen hölzernen Löffel vor seinem Gesicht herum und schaute Manapa zornig an.
»Na gut Alma, ich komme dann morgen wieder.«
»Gageeee. Hage gage! Ohhhh ...«, abrupt hörte sie mitten im Satz auf zu sprechen und sah mit leuchtenden Augen etwas hinter Manapa an.
»Schmattalingse!«, rief sie, tänzelte auf Zehenspitzen an Manapa vorbei und hüpfte einem bunt schillernden Schmetterling hinterher.
Manapa drehte sich kopfschüttelnd um. »Meine Herren. Warum macht eigentlich immer Alma bei mir die Tür auf? Die ist so nach und nach ja komplett durchgeknallt.«
Trotzdem konnte er sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Er wandte sich wieder der Tür zu und rief ins Haus: »Serde, bist du da?«
Keine Antwort. Also nochmal. Lauter.
»Serde! Ich bin es Manapa.«
Nichts. Komisch. Da ließen sie doch wirklich Alma allein zu Hause. Unglaublich. Manapa ging durch den Vorgarten zurück zum Gatter.





























