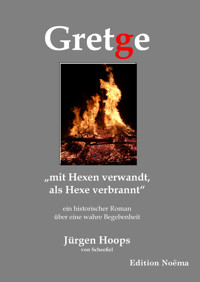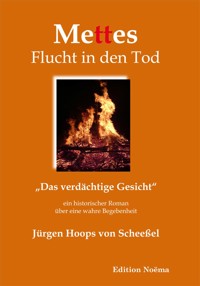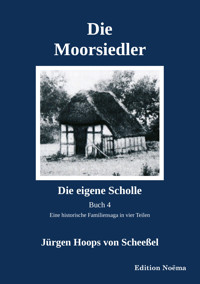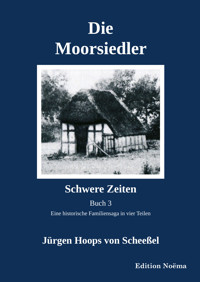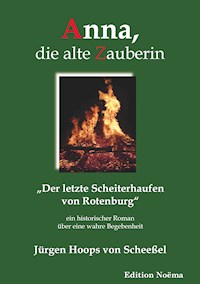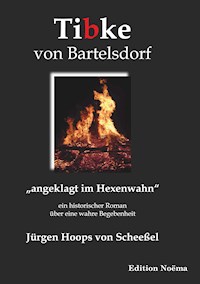
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Noema
- Sprache: Deutsch
„Weiter, weiter!“, forderte der Drost Gretge auf. „Wer war noch dabei? Dukannst Deine Seele noch retten, also sprich.“ Gretge schaute kurz zu Prottauf, meinte sie doch, aus seinen Worten Hoffnung für sich schöpfen zu können,wenn sie nur weiter reden würde. „Tibke von Bartelsdorf“, flüsterte Gretge.Mit diesen Worten der zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilten MargaretheMeinken, genannt Gretge, war das Schicksal Tibkes von Bartelsdorfbesiegelt. Jürgen Hoops von Scheeßel schildert in diesem historischen Romaneindrucksvoll das Leid und das Leben Tibkes, einer Frau, die ihren erstenEhemann durch einen tragischen Unfall verliert. Sie heiratet ein zweites Malund übersteht mit der Familie die Schrecken des 30jährigen Krieges und derschlechten Zeiten danach unbeschadet. Doch darauf wird sie erneut schwervom Schicksal getroffen: Sie wird der Hexerei beschuldigt und eingesperrt.Der packende Roman bezieht alle noch verfügbaren historischen Fakten des Falleseinschließlich der erhalten gebliebenen Prozessakten mit ein und macht einmalmehr deutlich, wie leicht Menschen sich durch Aberglauben – wie eben dem derHexerei – aufstacheln und sich in menschenverachtende Wesen verwandeln lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Das Buch
Karte
Hauptpersonenregister
Glossar
Zeichnungen
Prolog
Kapitel 1 Die Jahre 1607–1648
Kapitel 2 Die Jahre 1648–1663
Kapitel 3 Das Jahr 1664
Kapitel 4 Das Schicksalsjahr 1665
Epilog
Tibke
von Bartelsdorf
„angeklagt im Hexenwahn“
Ein historischer Roman über eine wahre Begebenheit
Das Buch
Über diesen – als „Hexenprozess“ bekannten Fall – gab es bereits sehr viele Veröffentlichungen. Er ist im Buch, „mißbraucht & verbrannt“, ibidem-Verlag Stuttgart, 2009 anhand aller noch vorhandenen Unterlagen und Hinweise umfassend bearbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.
Die Folgen des tragischen Prozesses gegen eine 17jährige Frau, welche 1664 als Hexe verurteilt und hingerichtet wurde, handelt mein erster historischer Roman „Gretge“ aus dem Jahr 2009.
Durch Gretges Beschuldigungen wurde auch gegen „Tibke“ ein Prozess wegen Hexerei geführt. Über Tibkes schicksalhafte Lebensgeschichte wird in diesem spannenden Roman berichtet.
Dieser Roman fußt auf wahren und folgenschweren Begebenheiten. Er beinhaltet überlieferte Tatsachen, die teilweise übernommen, zum Teil auch frei erfunden sind. Weiterhin sind frei erfundenen sowie authentischen Personen mitunter Aussagen und Handlungen zugedichtet worden.
Viel Spannung beim Lesen wünscht Ihnen
Jürgen Hoops von Scheeßel
Geschichte des Kirchspiel Scheeßel, Meyer, 1955, Seite 517
Hauptpersonenregister
Familie der Angeklagten
Tibke Hollmann, verwitwete Behrens,
geb. Hastede, Bartelsdorf Opfer und Angeklagte
Johann Behrens, Bartelsdorf Tibkes 1. Ehemann
Claus Hollmann, Bartelsdorf Tibkes 2. Ehemann
Mette Meinken, geb. Hoops Tibkes Cousine
Maria Hastede, geb. Döhrnemann Tibkes Mutter
Harm Döhrnemann, Bötersen Tibkes Großvater
Cord Döhrnemann, Bötersen Tibkes Großonkel
Personen aus dem Kirchspiel Scheeßel
Margarethe Meinken,
genannt Gretge Opfer und Denunziantin
Jacob Lorenz Becker Amtsvogt
Albert Dornemann Pastor bis 1654
Hinrich Meyer Pastor ab 1654
Christoph Wohlberg Jurat, Schmied, Kötner
Johann Jordan Oberförster u. stv. Vogt
Johann Bellmann Amtskrüger
Hinrich Köster Untervogt
Amtspersonen in Rotenburg
Thomas von Gerstenberg bis 1663 Drost
Jost Prott ab 1663 Drost und Oberinspektor
Peter Pabst Amtmann (2.Beamter)
Burghardt Schmidt 1. Amtsschreiber
Christoph Keubler 2. Amtsschreiber
Hans Zapf, auch Meister Hans Henker (Nachrichter)
Gerdt Schellermann Oberwächter, Schließer im Burggefängnis
Henning Schröder Probst und Pastor
Weitere Personen
Hibbel Röhrs, geb. Holsten Tibkes Patin 1607 Gretges Hebamme 1646 Beschuldigte 1664
Lütke Delventhal Fuhrmann in Rotenburg
Engel Delventhal Tochter von Lütke
Hier sind nur jene Personen aufgeführt, die am Geschehen wesentlich beteiligt sind. Dieses Register soll dem Leser zur Orientierung über die im Roman erwähnten Menschen dienen.
Zur besseren Vermittlung der Stimmung zu jener Zeit habe ich den Flecken zur Stadt mit Vorstadt umbenannt.
Neben Tibke von Gretge der Hexerei beschuldigten Frauen
Margaretha Sonnenberg, Rotenburg
Zillie Bassen, Wittkopsbostel
Cillia Meinken, Oldenhöfen
Anna Veersemann, Ostervesede
auch „Piepen Annken“ genannt
Catharina Heitmann, Abbendorf
auch Catharina „Budden“ genannt
Grete (Margarethe) Heitmann, Westeresch
Anna Hastede geborne Dreyer, Hetzwege
N.N., eine Frau aus Westerholz
[siehe unter Hibbel Röhrs geb. Holsten]
Anna Ratchen, Westervesede
Über das Schicksal und die nähere Lebensgeschichte von Anna Hastede berichtet mein dritter historischer Roman, der Ende 2011 erscheinen wird.
Glossar
Altenteiler Bauer, der die Führung seines Hofes an seinen Nachfolger übergeben hat
adjutierter Schulmeister beigestellter Lehrer zur Unterstützung des Hauptschulmeisters
Altvater Wotan bei den Südgermanen, Odin bei den Nordgermanen
Bademutter ortsübliche Bezeichnung für Hebamme
Bregenklöterich nicht mehr ganz richtig im Kopf
Flett Diele mit offener Feuerstelle im Niedersachsenhaus
Gevatter alte Bezeichnung für Pate
Groot Döör große Tür im Niedersachsenhaus
Häusling Bewohner eines kleinen Hauses ohne Ackerland
Häuslingshaus kleines Haus, gehörte zu einem Hof
Herrenmeier Erbpächter eines Amtshofes
Hester kleines Bäumchen
Holzklotschen geschnitzte Holzschuhe
Hochzeitsbitter Bote der Brautleute, der zur Hochzeit einlud, und von Haus zu Haus ging
Kate kleines Haus mit wenig Ackerland
Kistenpand vorsorglich zum Bauen der Aussteuer wie z.B. Truhen und Schränke vorgesehen
Kötner Bewohner einer Kate, welcher meist ein Handwerk (Schneider, Schuster) ausübte
Magister Doktorand mit Studium, z. B. Jurist
Mergel Kalk
Nervenfieber Krämpfe, Typhus
Notholz vorsorglich zum Sargbau gelagert; eine Bohle diente der Aufbahrung
Pollholz auf dem Waldboden liegendes Astwerk
Prieche Empore in der Kirche
Rähm Funkenschutz über dem offenen Feuer
Schauer überdachter Unterstellplatz für Fuhrwerke
snacken Plattdeutsch für „sich unterhalten“
Urfehde Eid, der Rache abzuschwören
Voller Hof ein ungeteilter Hof, Vollhof
Weinkauf Pachtzahlung nach der Hofübernahme an den Besitzer
Grundriss eines Niedersachsenhauses mit Flett und Diele
aus: Gerhard Eitzen, Bauernhausforschung in Deutschland, Seite 240 Abb. 15.2 Maßstab
Zweiständerhaus, Vorne ist die „Groot Döör“ zu sehen, Fachwerkhaus
aus: Wilhelm Bomann, Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im alten Niedersachsen, Seite 6. Abb. 4.
Prolog
9. September 1664
Das Feuer hatte die vollkommene Macht über den Holzstoß übernommen. Es hüllte den toten Körper in ein gleißendes Flammenmeer, dass er nicht einmal mehr zu erahnen war.
Die Menschen schauten fasziniert und gebannt mit großen Augen und offenstehenden Mündern auf das Geschehen. Sie warteten gebannt, bis der Scheiterhaufen unter Getöse zusammenfiel. Sie brachen bei jedem Einbrechen einzelner Teile, wenn Myriaden von Funken in neuen Qualmwolken blitzend aus den krachenden Scheiten aufstoben, in lautes Gejohle aus. Die Reste brannten dann langsam unter nur noch spärlicher Rauchentwicklung nieder. Die Menge war vom Schauspiel der Hinrichtung mit dem Schwert und dem Lodern des Feuers so sehr mitgerissen worden, dass die meisten in die Begeisterungsrufe ohne nachzudenken lauthals einfielen.
Claus Meinken und seiner Familie aber stockte der Atem, ihre Herzen schienen nicht mehr schlagen zu wollen und die Tränen rannen ihnen unaufhörlich über die Wangen.
Die Kinder krallten sich mit ihren kleinen Händen an den Hosenbeinen des Vaters fest. Sie versteckten sich angsterfüllt mit zugekniffenen Augen hinter ihm.
Von ihrer Schwester Gretge war nichts mehr zu sehen. Es war nicht mehr von ihr übrig als ein verkohlter Klumpen verbrannten Fleisches, der nun zu Asche wurde.
Der lange, eingegrabene Pfahl, an den ihr kopfloser Leichnam gebunden worden war, stand noch immer aufrecht brennend, einem Mahnmal gleich, auf dem Richtplatz. Er wies wie ein drohend erhobener Zeigefinger in den Himmel, als wollte er die Umstehenden mahnen, gottesfürchtig, rechtschaffen und sittsam zu sein. Vom zerstörenden, höllisch heißen Feuer des nieder-brennenden, mit Öl versetzten Holzhaufens umgeben, zog er die Blicke der Menschen in seinen Bann.
Der scharfe Geruch verbrannten Menschenfleisches roch anders als jener, der sich von den Spanferkelständen am Fuße des Galgenbergs ausbreitete. Stinkender Qualm kroch den Umstehenden beißend in die Nasen, was sie immer wieder von der Faszination der Flammen ablenkte und ihnen vergegenwärtigte, was eben geschehen war. Nur sehr wenige der Umstehenden waren wirklich nachdenklich geworden.
Eine junge Frau war eben erst vor ihren Augen mit einem Schwertstreich ihres Henkers enthauptet und anschließend zu Asche verbrannt worden. Etliche hatten sie persönlich gekannt oder gar in der Kirche neben ihr gesessen.
Sie war keine überführte Mörderin, Giftmischerin oder Diebin. Sie war eine junge Frau, eine von ihnen gewesen.
Der Drost hatte sie der Hexerei für schuldig befunden und verurteilt. So hatte er es vor der Hinrichtung im Urteil verlesen lassen, und die meisten der Anwesenden glaubten ihm.
Als nur noch das klägliche Häuflein des einst mächtigen Scheiterhaufens ein wenig rauchte und flackerte, entließ der Amtmann auf Weisung des Drosten durch das Abziehen der Wachen die Menge aus ihrer Pflicht zur Teilnahme. Ein jeder ging nun wieder nach Hause oder seiner sonstigen Wege. Sie hatten sehr viel Schreckliches gesehen und erlebt. Aber es gab auch endlich mal wieder etwas Ungeheuerliches zu berichten, was noch viele Abende am offenen Feuer in den Häusern bei den Leuten Thema sein würde. Die Sensationslust hatte die Menschen gepackt.
Die 17jährige Gretge war zwar körperlich tot, lebte aber in den abendlichen Geschichten an den Feuern weiter.
Damals hatte niemand ahnen können, dass man sich diese Geschichte nach mehr als 300 Jahren später noch immer erzählen würde.
Es hatte sich wie ein Lauffeuer unter den anwesenden Zuschauern herumgesprochen, dass Gretge noch kurz vor ihrer Hinrichtung zehn Frauen der Hexerei beschuldigt hatte. Das versetzte viele in Angst und Panik, denn jedermann hatte nun Furcht, ebenfalls angeschwärzt zu werden. Die Zeiten waren noch immer unruhig und unsicher, auch wenn der große, lange Krieg schon fast 16 Jahre vorbei war.
Anna Ratchen aus Westervesede wurde noch auf dem Hinrichtungsplatz öffentlichkeitswirksam verhaftet und sofort nach der Hinrichtung ins Gefängnis geworfen. Dieses Vorgehen hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Die Macht des Drosten hatten die Menschen hier sehr deutlich gespürt.
In der Burg bekamen die Bediensteten das Spektakel nur am Rande mit. Sie hatten alle ihre Aufgaben zu erfüllen und konnten deswegen nicht mit zum Hinrichtungsplatz gehen, was einige sehr bedauerten, andere nicht.
Gleich nach der Hinrichtung rief Schließer Gerdt Schellermann von oben seinen Wachen ins untere Gewölbe zu: „Hört zu Männer! Meister Hans hat sein Werk vollbracht! Er hat es mal wieder meisterhaft mit einem einzigen Hieb geschafft.“
„Sie musste nicht leiden“, dachte er, sagte es aber nicht. Dann schloss er schweren Herzens die Tür zum Gewölbe, ging in seine kleine Wachstube ans Fenster, schaute hinaus und weinte.
Der alte kriegs- und schlachtenerfahrene Mann weinte, weil ihm das junge Mädchen ans Herz gewachsen war. Das aber durfte er niemandem erzählen und es sich schon gar nicht anmerken lassen. Sie würden behaupten, Gretge hätte ihn verhext und ihn deswegen sofort entlassen.
Schließlich war er der Oberwächter der Gefängniswachen und durfte sich keine Gefühle zu den Gefangenen leisten.
Die Wachen unten im Gewölbe unterhielten sich so laut, dass es die Gefangenen in den Zellen mithören konnten. Sie hatten ihre hämische Freude daran, es lauter als nötig zu erzählen, damit es alle gut verstehen konnten. Vielleicht würde sich da ja die eine oder andere unter den eingesperrten Frauen aus Angst gefügig zeigen und einen oder mehrere ihrer Bewacher in der Hoffnung auf Hilfe „mal zwischen die Schenkel lassen“.
Bislang hatten die Wachen hier und da Erfolg. Einige Frauen glaubten in ihrer Verzweiflung wirklich, der einfache Wärter würde ihnen zur Flucht verhelfen, wenn sie sich ihm nur hingab und ihnen alle Wünsche erfüllte, auch wenn es sie ekelte und sie es als widerlich empfanden.
Die Wächter waren sich einig, der Schließer Gerd durfte nicht erfahren, dass sie sich ab und zu „ihren Spaß“ in den Zellen gönnten.
An die ihnen schutzlos ausgelieferten Frauen dachte dabei keiner, obwohl sie doch selbst Frauen oder gar Töchter zu Hause hatten.
Tibke Hollmann saß nun schon seit zwei Tagen zusammen mit vier anderen Frauen im Gefängnis der Rotenburger Burg, weil Gretge Meinken sie alle der Hexerei beschuldigt hatte.
Margaretha Sonnenberg, die Frau des Rotenburger Glasers war vor den Augen ihrer Kinder im eigenen Haus von den Männern des Rotenburger Amtmanns ohne Nennung von Gründen verhaftet worden. Sie brachten sie sogleich ins Verließ. Sie durfte sich noch nicht einmal von ihren Kindern verabschieden und wusste nicht, ob sie ihre Bälger jemals wieder sehen würde.
Die alte Anna Veersemann aus Ostervesede hatte der Scheeßeler Untervogt Hinrich Köster morgens als Erste beim Melken der einzigen Hofkuh verhaftet. An den Händen gefesselt fuhr er sie mit seinem Leiterwagen unter Bewachung nach Rotenburg. Dabei wählte er den Weg über Bartelsdorf und nahm dort noch Tibke Hollmann fest. Auch sie musste sofort, vom Fleck weg, auf den Wagen steigen, wurde an den Händen gefesselt und an die Sprossen gebunden, damit sie während der Fahrt nicht abspringen und flüchten konnte.
Den Protest von Peter Hollmann in Bartelsdorf ließ er unbeantwortet, schließlich war es ihm so befohlen worden. Da er selbst den Grund nicht kannte, war es ihm zwar peinlich, aber auch gleichgültig, denn es gehörte zu seinen Aufgaben als Untervogt, Gefangennahmen vorzunehmen.
So kam er mit den beiden Frauen nach Rotenburg gefahren und übergab sie dem Schließer Gerdt.
Zur sicheren Durchsetzung der ihm erteilten Order hatte Köster einen Degen und eine Pistole im Gürtel stecken. Die beiden ihm bekannten und berittenen Landsknechte Alfons und Thomas, welche ihm der Amtmann zur Unterstützung sandte, trugen Pistolen, Degen und Hellebarden.
Köster fuhr, nachdem er sein Stiefelgeld für diese Aufgabe aus der Amtskasse erhalten hatte, alleine mit einem schlechten Gewissen, wieder nach Hause zurück.
Er kannte alle Familien in der Vogtei Scheeßel persönlich. Seine Frau Floria litt oft unter der Bürde seiner Aufgabe, was Hinrich durchaus bemerkt hatte, aber sie sagte kein Sterbenswort, fraß es nur in sich hinein.
Daheim angekommen, spannte er geschwind ab und ging innerlich aufgewühlt und nachdenklich ins Haus.
Tibke Hollmann von Bartelsdorf, Anna Veersemann von Ostervesede, Margaretha Sonnenberg von Rotenburg, Anna Hastede von Hetzwege, Zillie Bassen von Wittkopsbostel, Catharina Baden von Abbendorf, Cillia Meinken von Oldenhöfen und Grete Heitmann von Westeresch saßen am Tag von Gretges Hinrichtung, jede für sich alleine und zitternd vor Angst, apathisch in ihren kahlen, dunklen Zellen.
Sie wussten, dass Gretge Meinken in diesen Minuten ihr Leben verloren hatte und hingerichtet worden war. Die Worte von Gerd, dem Schließer, waren deutlich zu hören gewesen.
Jede malte sich aus, dass sie die Nächste sein würde. Sie hatten entsetzliche Angst davor, dass die Tür aufgehen könnte und man sie holte. Gleichzeitig stieg eine unbändige Wut in ihnen hoch, dass diese junge Hexe daran schuld war, dass sie hier eingesperrt waren. Eine der Frauen schrie in ihrer Panik: „Das geschieht dem Aas recht. Brennen soll sie und in der Hölle schmoren!!!“
Da der Galgenberg weit weg war, konnten sie das Geschehen weder sehen noch hören. Der widerliche Gestank aus der Verbrennung von Menschenfleisch und dem tranigen Öl in den Holzscheiten hing wie eine Glocke über Burg und Vorstadt. Er drang den Frauen, selbst hier unten in die Nasen. Den Geruch wurden sie in ihrer Erinnerung nicht wieder los.
Einmal hörten sie den Aufschrei und das Gejohle aus Hunderten von Kehlen. Tibke ließ es das Mark in den Knochen gefrieren.
Kapitel 1 Die Jahre 1607–1648
I
1607
Als am 4. November 1607 in einer der Kammern eines alten Bauernhofes in Bötersen, einem Dorf im Kirchspiel Sottrum, ein Mädchen geboren wurde, lebte dessen Großvater Harm Döhrnemann, der Vater ihrer Mutter, schon nicht mehr.
Daran dachte Maria Hastede, die 24jährige Mutter des kleinen Mädchens nach der Geburt. Trauer überkam sie. Sie war sehr verbittert und voller Hass.
Sie dachte daran, dass ihr Vater vor etlichen Jahren mit der Familie Hoops von Höperhöfen gewaltig über Kreuz gelegen hatte. Er beschimpfte damals die Hebamme und Kräuterfrau Adelheid als „Zaubersche“ und „Hexe“. Sie war die Ehefrau von Harm Hoops, einem Halbhöfner.
Da der Großvater den Beweis für seine Anschuldigungen nicht erbringen konnte, wurde er vor sieben Jahren, nach vier Jahren Prozessdauer, des Landes verwiesen. Er wurde an die Grenze zum Amt Rethem geführt und ausgewiesen. Dort musste er am Grenzstein „Urfehde“ schwören und versprechen, nie wieder ins Amt Rotenburg zurückzukehren. Täte er es dennoch, drohte ihm der sichere Tod. So erzählte man es sich in der Familie wie im Dorf.
Wenige Tage später wurde er zwischen Kirchwalsede und Kirchlinteln tot am Ast einer Birke, am Hals hängend, aufgefunden. Er hatte sich selbst gerichtet.
Der Sottrumer Amtsvogt schrieb in seinem Bericht, dass die Leiche auch für einen gestandenen Mann schauerlich anzusehen gewesen war. Er beschrieb seinen Eindruck und seine Vermutung zum Tathergang im Protokoll mit sehr knappen Worten.
„Der aus dem Amt Rotenburg ausgewiesene Harm Döhrnemann muss mit dem Strick auf den Baum geklettert sein. Er knotete das eine Ende an einen beindicken Ast, ungefähr vier Meter über dem Boden, fest. Das andere Ende hatte er zu einer Schlinge gebunden und sich um den Hals gelegt. Dann muss sich der Selbstmörder sitzend vom Ast nach unten fallen lassen haben. Er muss sofort tot gewesen sein. Das Genick war gebrochen, eher zersplittert und der Hals bis zur rechten Schulter war aufs Heftigste aufgerissen, dass das Blut herausgelaufen und der Boden unter ihm rot getränkt war. Die Augen standen weit aus den Höhlen und das Gesicht war zur Fratze entstellt. Es ist ein Rätsel, warum der Körper überhaupt noch am Kopf hing. Die Herkunft des Stricks ist nicht bekannt.“
Marias alte Mutter hatte sich nach der Todesnachricht des geliebten Ehemanns, in der darauffolgenden Nacht, aus Verzweiflung im Brunnen des Hofes ertränkt, indem sie sich hintenüber mit dem Kopf voran hineinkippen ließ. Sie hatte keine Chance, zu überleben.
Der Nachbar Claus Holsten, Hibbels Vater, hatte Becke zufällig auf dem Brunnenrand mit dem Rücken zum Abgrund sitzen sehen und rief ihr noch zu: „Becke, lass ab.“ Sie schaute ihn lächelnd an, nickte freundlich, als wolle sie sagen: „Lass gut sein, Claus“, ließ sich dann nach hinten fallen und stürzte in den zehn Meter tiefen Brunnen. Claus rannte so schnell er konnte zum Brunnen. Fast wäre er noch hingefallen. Er beugte sich über den Rand und sah hinunter. Becke trieb regungslos auf der Wasseroberfläche, das Gesicht nach unten. Der Körper lag seltsam verdreht im engen, mit Felssteinen gemauerten Brunnenschacht.
Er rief, so laut er konnte: „Cord, Cord hörst du mich? Hilfe, Hilfe!“ Kurze Zeit darauf kam Cord, Beckes Schwager, halb angezogen in seinen Holzklotschen angelaufen. Claus rief ihm aufgeregt und laut entgegen: „Dien seligen Broders Fru licht dor ünnen un is dod. Se hed sich ümbröcht. Kümm gau her.“
Cord sah nach unten auf seine tote Schwägerin und schlug die Hände vors Gesicht. Dann sah er Claus mit großen schreckweiten Augen an. „Mein Gott“, sagte er fassungslos.
Claus legte dem älteren Nachbarn seine rechte Hand behutsam, beinahe väterlich auf dessen linke Schulter und begann zu berichten, was er gesehen hatte. Cord hörte ihm geistesabwesend zu, er war mit seinen Gedanken ganz woanders, weit, weit weg. Claus drückte ihm mit der Hand ein wenig fester die Schulter. Cord sah ihn fragend an. Claus holte tief Luft und sprach mit brüchiger Stimme: „Erst Dein Bruder und nun auch noch die Schwägerin. Soll ich Maria und Jürgen sagen, dass ihre Mutter nun auch im Himmel ist?“, fragte er ihn.
Cord schluckte und murmelte: „Lass gut sein, das mache ich schon selbst.“
Die beiden Männer beschlossen, Cords Schwägerin sofort aus dem engen Brunnen zu bergen. Die Kinder sollten ihre Großmutter so nicht sehen. „Gott sei Dank, sind die Kinder heute bei Cords Vetter in Worschen“, dachte Claus für sich.
Cord konnte wegen seiner Behinderung selbst nicht in den Brunnen hinuntersteigen. Claus hielt sich am Seil fest, an dem sonst der hölzerne Wassereimer nach unten gelassen wurde. Nun kletterte er auf den Brunnenrand und Cord ließ ihn am Seil nach unten. Cord stemmte sich mit beiden Füßen gegen die Brunnenmauer. Er musste seine ganze Kraft aufbringen, um den Nachbarn unbeschadet nach unten gleiten zu lassen. Dennoch war dieser recht schnell bei Becke angekommen. Er konnte im kalten Wasser stehen, es reichte ihm aber bis zur Brust.
Sogleich nahm er Beckes Kopf ganz vorsichtig, fast zärtlich, in beide Hände und hob ihn über Wasser. Er sah, dass sie tot war. An ihrer Schläfe klaffte ein großes Loch und seine Hände waren blutig. Er rief zu Cord hoch: „Sie ist tot. Becke muss mit dem Kopf an die Steine geschlagen sein, als sie sich nach hinten fallen ließ“, vermutete er. „Ich binde sie fest. Zieh Du sie hoch“, rief er nach oben. Er band das Seil unter den Armen um ihren Körper und Cord zog sie nach oben. Nachdem er Becke neben dem Brunnen niedergelegt hatte, warf er das Seil zu Claus hinunter und zog auch ihn wieder herauf.
Inzwischen waren einige Nachbarn herbeigeeilt, die sogleich kräftig mit anfassten. Sie brachten die vor Nässe triefende tote Nachbarin ins Haus und legten sie behutsam auf dem gestampften, kalten Lehmfußboden ab.
Alle standen nun um die Tote herum und schauten sich gegenseitig an. Das hatte keiner geahnt. Sie waren alle ratlos und schockiert.
Claus erzählte immer wieder, dass er sie noch retten wollte, es aber nicht geschafft hätte. Cord legte seine Hand auf den Arm des Nachbarn und sagte: „Claus, Du hast getan, was Dir möglich war. Becke wollte nicht mehr ohne meinen Bruder Harm leben. Hättest Du sie heute gerettet, hätte sie es morgen wieder versucht.“ Claus sah Cord dankbar an und wandte sich ohne weitere Worte um. Er ging hastig nach Hause. Unverzüglich zog er sich trockene Kleider an, er wollte nicht elend an Schwindsucht erkranken oder gar sterben.
Einer der anderen Nachbarn sandte seinen Knecht zum Pastor und Amtsvogt nach Sottrum, die schlechte Nachricht zu vermelden.
Einige Stunden später kamen beide gemeinsam auf dem Unglückshof an. Der Sottrumer Amtsvogt sah sich die Tote an. Dann sprach er mit allen Nachbarn.
Nun ließ er den Juraten aus dem Dorf kommen. Zusammen mit dem Pastor und dem Juraten nahm er eine Leichenschau an der noch immer am Boden liegenden Becke vor. Sie hatten sie mittlerweile mit einem Laken zugedeckt. Er zog das Tuch beiseite, sah sich die Wunden genau an, ließ sich von Claus, der inzwischen in trockenen Sachen dastand, den Vorfall erneut schildern und den Hergang am Brunnen noch einmal genau zeigen. Anschließend fuhr er wieder nach Sottrum zurück, um seinen Bericht abzufassen und dem Amtmann schnellstens von seinem eigenen Untersuchungsergebnis unterrichten zu können.
Es war für ihn eindeutig Selbstmord. So würde er es in seinen Bericht schreiben.
Auf dem Dachboden des alten Fachwerkhauses in einer Ecke lag das Notholz. Es waren mächtige, alte, schwere Eichenbohlen. Sie lagerten dort, um daraus, traditionell für die Familienmitglieder des Hofes, die Särge vom Tischler bauen zu lassen. Sie dienten keinem anderen Zweck.
Cord Döhrnemann hatte den Tischler Hesse aus Sottrum ins Haus kommen lassen, damit dieser daraus in der Diele zwei Särge anfertigten solle. Wenige Meter vor ihm lag Becke aufgebahrt.
Er hatte auch mit dem Sottrumer Pastor Hermann Müller gesprochen, denn Selbstmörder wurden nicht in geweihter Erde auf dem Kirchplatz innerhalb der Planken begraben.
Müller ließ sich nicht dazu überreden, den Tod der Bäuerin als Unfall zu werten. Für ihn waren Selbstmorde eine Todsünde und Schuldeingeständnis zugleich.
Mit dem Tod des Ehepaares, besonders dem von Harm Döhrnemann, galt die einst als „Zaubersche“ beschuldigte Hebamme Adelheid Hoops nunmehr erwiesenermaßen als unschuldig.
Cord bat den Pastor inständig, ja er flehte ihn förmlich an, die beiden wenigsten in einem Doppelgrab, neben der Kirchenmauer außerhalb des Kirchhofs an den Planken in die Erde zu geben. Der Pastor entgegnete ihm, dass auch das nicht zulässig wäre, da die Leiche von Cords Bruders in einem anderen Amt nach der Leichenschau dort vergraben worden sei. Cords Schwägerin war eine treue Seele und Kirchgängerin, weswegen der Pastor einem Begräbnis, in einem Sarge hinter der steinernen Mauer, ohne seine Beteiligung, zustimmte. Er sagte ihm: „Bettet sie in Gottes Namen im Sarge außerhalb der Kirchenmauer zur Ruhe. Erwarte von mir aber nicht, dass ich mich versündige, indem ich eine Leichenpredigt halte oder gar die Totenglocke läuten lasse.“
Die Beisetzung wurde mit den Nachbarn auf den über-nächsten Tag in aller Stille für den Abend vereinbart, denn der Tischler brauchte Zeit, die Särge zu fertigen.
Cord bat den Pastor noch, sich dafür zu verwenden, dass sein Bruder in Kirchlinteln in einem Sarge beigesetzt werden könne. Das lehnte dieser strikt ab, denn er wusste um die Bürokratie zwischen den Ämtern. Außerdem war auch Harm ein Selbstmörder. „Reicht es nicht, dass ich bei Becke ein Auge zugedrückt habe? Überspann den Bogen nicht zu sehr!“, mahnte er Cord. Dann schlug er ihm vor, er könne ja selbst nach Kirchlinteln zu dem dortigen Amtsvogt Schlucher eilen und ihm sein Anliegen vortragen, doch solle er sich keine große Hoffnung auf Erfolg machen.
Die Nachbarinnen hatten Becke nach der Leichenschau gewaschen, angezogen und im Flett aufgebahrt, damit alle, wie es üblich war, von ihr Abschied nehmen konnten.
Die Totenwache stellten die unmittelbaren Nachbarn reihum im Wechsel. Die Befindlichkeiten des Pastors wegen dessen Selbstmordansichten interessierten hier niemanden, denn alle verstanden Becke nur zu gut. Das Ehepaar Harm und Becke war im Dorf sehr beliebt gewesen und jeder wusste, dass sie sich auch sehr gemocht hatten. Es gab kein einziges lautes Wort zwischen den beiden Eheleuten. Die Umwohner trauerten um die tote Nachbarin, die sie als einen herzensguten Menschen in Erinnerung behalten würden. Sie wollten ihr eine schöne Beerdigung bereiten, auch ohne Pastor. Dann musste eben Altvater Wotan noch einmal helfen; davon durfte der Pastor aber nichts wissen.
Als Cord am folgenden Tag beim Amtsvogt Schlucher in Kirchlinteln vorsprach, entgegnete dieser, dass die Leiche seines Bruders bereits nach durchgeführter Leichenschau in ungeweihter Erde wie bei Selbstmördern üblich, anonym, ohne Sarg, durch den hiesigen Nachrichter, eingekuhlt worden sei. Seinen Bruder auszugraben und mitzunehmen lehnte der Amtsvogt ab. Er untersagte es ihm gar unter Androhung einer Strafe.
So kehrte Cord unverrichteter Dinge mit dieser traurigen Nachricht zu seiner Nichte Maria und seinem Neffen Jürgen nach Bötersen zurück. Er holte die Kinder bei seinem Vetter aus Hassendorf ab. Auf dem Weg nach Hause erzählte er ihnen, was geschehen war.
Der Tischler hatte bereits nachmittags seine Arbeit an den zwei Särgen beendet. Sie gefielen Cord sehr und er lobte den Tischler für seine Mühe. Als Lohn verlangte Hesse 24 Schillinge, die er sogleich in die Hand erhielt.
Die Nachbarn waren inzwischen beim Küster in Sottrum gewesen und hatten sich einen Begräbnisplatz zuweisen lassen, an dem sie das Grab für Becke ausheben durften.
Nach getaner Arbeit kehrten sie wieder nach Hause zurück.
Am späten Nachmittag kamen die Nachbarinnen ins Haus Döhrnemann, um die auf einer Bohle aufgebahrte Leiche in den fertigen Sarg zu legen und Abschied zu nehmen. Sie polsterten ihn mit Stroh vom Dachboden aus und legten ein leinenes Laken darüber. Inzwischen waren auch die Männer ins Haus gekommen. Trine Holsten, die eine Nachbarin und sehr enge Freundin der Toten, sprach einige Worte und, des Lesens kundiger als andere, las sie ein wenig aus der Bibel vor. Wenn schon der feine Pastor die Leichenpredigt verweigerte, so wollten sich wenigstens die Nachbarn würdig von Becke verabschieden. Sie fanden auch noch alte überlieferte Worte aus jener alten Zeit, in denen Altvater noch über alles wachte. Trine fragte Cord, was er denn nun mit dem zweiten Sarg vorhabe. Cord antwortete dumpf: „Das wird mein Sarg sein, wenn irgendwann einmal meine Zeit gekommen ist.“
II
Wenige Monate später heiratete die, mit ihren 17 Jahren, noch sehr junge Hoferbin Maria, Hinrich Hastede. Er war der jüngere Sohn von Claus, einem Halbhöfner in Hetzwege. Hinrich führte nach der Eheschließung den Halbhof seines seligen Schwiegervaters in Bötersen, auf dem er schon seit der Verlobung mit Maria arbeitete. Es war eine echte Chance für ihn, denn sein älterer Bruder Diedrich erbte seines Vaters Hof in Hetzwege.
Wenn Hinrich nicht dieses Glück gehabt hätte, Maria und somit in den Hof hinein zu heiraten, würde er wohl als Häusling oder Knecht zeitlebens beim Bruder auf dem Hof leben müssen. Die Heiratsvermittlung hatte ihr Oheim, Marias Vormund, sehr zügig vorangetrieben. Sie gefiel Hinrich auch und Maria fügte sich in ihr Schicksal, Erbin des Hofes zu sein. Ihr jüngerer Bruder Jürgen war mit seinen zehn Lenzen dafür noch viel zu jung.
Da die Brauteltern verstorben waren, richteten Hinrich Hastedes Eltern, entgegen der Tradition, eine bescheidene Hochzeitsfeier aus. Damit es niemand bemerkte, gaben sie dem alten Cord hierfür das Geld, denn als Bruder des seligen Vaters galt er ihnen als Ersatz für den Brautvater. Es waren ohnehin nur die engsten Familienangehörigen und die unmittelbare Nachbarschaft eingeladen worden.
Nach altem Brauch wurden ein Mistelzweig und die beiden Totenhemden des Ehepaares in den leeren Schrank gelegt, bevor die Aussteuer dazu kam. Wer es sich leisten konnte, legte noch eine Bibel dazu. Unter vorgehaltener Hand bezeichneten die Alten die Mistel als Hexenbesen oder Hexennest. Mit dem Notholz für die Särge wurde traditionell für den Todesfall vorgesorgt.
Maria brachte nur wenige Leinen, Laken und sonstige Wäschestücke mit in die Ehe.
Das lag wahrlich nicht darin begründet, dass sie ein faules Mädchen war. Sie musste zwangsläufig zehn Jahre früher heiraten, als es üblich war. Die meisten Frauen und Männer heirateten erst mit 27 Jahren, wenn die Bauern aufs Altenteil gingen.
So wurden die Kleider der Eltern umgenäht und von dem jungen Ehepaar aufgetragen. Dadurch sparten sie viel Geld ein. Hinrich brachte auch nur 20 Taler mit in die Ehe. Davon musste er dem Amt den Weinkauf, also die Erbpacht für die Übernahme des Hofes bezahlen. Nun erst war er offiziell der Bauer auf dem Hof. Die Menschen im Dorf und im Amt waren allesamt arm. Die meisten von ihnen litten Hunger und wussten oft nicht, wie sie ihre Familien durch den Winter bringen sollten. Die Ernten waren mäßig und die Not, als Folge des Großen Krieges, noch immer groß.
Hinrich und Maria waren nach der Hochzeit in die Kammer ihrer seligen Eltern gezogen. Sie hatten deren Bett, Schrank und Truhe übernommen. Hier erblickte Tibke nun das Licht der Welt.
Sie wurde in keine glückliche und wohlhabende Familie hinein geboren. Die kleine Tibke war die zweite lebende Tochter der Eltern. Ein älterer Bruder, Cord, war nur drei Wochen alt geworden. Er starb an Schwäche. Ihre vier Jahre ältere Schwester Sophia war gesund und wohlauf. Der vor zwei Jahren geborene Bruder Harm sollte später einmal den Hof erben. Maria hatte ihn im Gedenken an ihren toten Vater „Harm“ taufen lassen.
Der alte Hof mit den in die Jahre gekommenen Fachwerkgebäuden warf nur einen geringen Ertrag ab. Die Familie konnte soeben noch ihre Abgabepflichten an das Amt Rotenburg erfüllen, doch für sie selbst blieb zu wenig übrig, um sorgenfrei über die Winter zu kommen. In besonders strengen oder langen Schnee- und Eismonaten mussten sie häufig hungern und der Vater jedwede Lohnarbeit annehmen, wenn es überhaupt welche gab.
Das Amt baute die Befestigungen der Burg aus. Dafür wurden häufig kräftige Männer als Tagelöhner benötigt. Deren schwere Arbeit wurde schlecht bezahlt, oder als Hand- und Spanndienst verrechnet.
Am Beginn eines jeden Jahres wurden die dem Amt verpflichteten Bauern und Kötner zur Ableistung ihrer Dienstpflichten, den sogenannten Hand- und Spanndiensten, mit und ohne Pferd herangezogen. Dafür gab es kein Geld. Erst nachdem Hinrich seine ihm auferlegten Pflichtstunden abgeleitet hatte, erhielt er als Tagelöhner für zusätzliche Arbeiten eine sehr bescheidene Entlohnung.
III
Trotz der sehr bescheidenen Lebensverhältnisse wurde für Tibke eine, wenn auch überschaubare kleine Feier, nach der Taufe in der Kirche zu Sottrum im Kreise der Familie im elterlichen Hause ausgerichtet.
In der Diele war eine dünne Hühnersuppe, mit spärlich bestücktem Gemüse zubereitet worden, wofür eines der wenigen mageren Hofhühner sein kärgliches Leben lassen musste.
„Wer kein Ei legt, kommt in den Topf“, sagte sich die junge Mutter, der das Huhn irgendwie leidtat. Schließlich hatte sie es all die Jahre gefüttert und wie alle anderen Tiere auf dem Hof ins Herz geschlossen.
Auf dem Hof lebte noch Marias kränklicher Onkel Cord Döhrnemann, der ledig geblieben war und als Knecht seinen Lebensunterhalt verdiente sowie die 18jährige Jungmagd Margaretha Cordes aus Eversen.
Marias jüngerer Bruder Jürgen war bereits vor drei Jahren elendiglich an der Schwindsucht gestorben.
Er hatte über mehrere Wochen sehr leiden müssen. Sein kleiner Körper wurde immer schmächtiger, er verfiel zusehends. Am Tag seines Todes war sein dünnes jammervolles Husten die ganze Nacht über zu hören, bis es plötzlich still im Hause war. Jeder dachte, endlich hat er seinen Schlaf gefunden. Dass es der ewige geworden war, bemerkte die Mutter erst am Morgen, als sie nach ihm sehen wollte.
Als Taufpaten waren die Nachbartochter Hibbel Holsten und Marias Schwiegermutter aus Hetzwege gekommen. Mehr Paten vermochte die junge Familie nicht aufzubringen. Paten waren in diesen schweren Zeiten rar, mussten sie doch den obligatorischen Tauftaler zahlen, wobei dieser meist nur die Kosten der Taufe beim Pastor deckte. Davon wurde auch noch die Leihgebühr für das Taufkleidchen entrichtet.
Da sich die Familie kein Holz zum Heizen leisten konnte, wurde stets mit getrocknetem Heidekraut gefeuert und gekocht.
Das Heidehauen war eine sehr anstrengende und äußerst mühevolle Arbeit, welche überwiegend Frauenarbeit war. Bei den Männern war diese Arbeit wenig beliebt, aber sie musste getan werden, wollte man im Winter nicht erfrieren.
Der wenige Torf, der von den Männern abgegraben wurde, war ausschließlich für den Verkauf nach Bremen vorgesehen. Damit heizten die Bremer Bürger ihre Häuser. Mit diesem Geld wiederum wurden die fälligen Abgaben an das Amt bezahlt.
Cord stellte fest, dass nur noch wenig „Notholz“ sowie „Kistenpand“ auf dem Boden des alten Bauernhauses lag. Das letzte Notholz reichte noch für drei Särge und das Kistenpandholz bewahrte das junge Ehepaar für die Möbel zur Aussteuer ihrer Kinder auf.
Hinrich und Maria beschlossen in ihrer Hochzeitsnacht, dass es den Kindern nicht so ärmlich ergehen sollte, wie ihren Eltern.
Sie schworen es sich in die Hand, dieses Holz niemals zum Heizen zu verbrauchen.
Zur Tibkes Taufe hatte Marias Schwiegermutter Rebecca eine ganze Fuhre Pollholz aus Hetzwege mitgebracht. Der Knecht hatte es noch am Tag zuvor gesammelt und auf den Wagen geladen. Ihre Enkelkinder sollten warm durch den Winter kommen. Auch in Hetzwege waren die Zeiten nicht besser, aber der Hof warf wesentlich mehr Gewinn ab als andere. Dieses kleine Glück neideten der Familie Hastede viele in der Umgebung, was noch schlimme Folgen haben sollte.
Nachdem die kleine Festgesellschaft die wässrige Hühner-suppe genossen hatte, setzte sie sich um das wärmende Holzfeuer im Flett. Die hölzernen Teller und Löffel waren so sauber abgeleckt worden, dass ein Säubern gar nicht mehr notwenig erschien.
Sie begannen, sich alte Geschichten zu erzählen, aber auch ihre schwierige wirtschaftliche Lage zu bereden.
Cord kam dabei oft auf seinen seligen Bruder Harm zu sprechen. Er berichtete, dass er sich heute in der Kirche, während Tibkes Taufe, sehr zurückgehalten habe, denn Harm Hoops und seine „Hexe“ saßen nur zwei Bänke vor ihm. „Sie taten, als hätten sie mich nicht gesehen“, fügte er an. „Dabei ist doch die alte Hexe Adelheid schuld am Tod meines Bruders Harm und meiner Schwägerin Becke“, erzählte er weiter.
Da er selbst nicht gesund war, konnte er den Hof nach dem Tod des Bruders nicht als Übergangswirt übernehmen. Er war als Junge durch die Bodenluke gefallen und hatte sich die Hüfte gebrochen. Seitdem war er ein humpelnder Krüppel, der als Knecht auf dem Hof des Bruders lebte. Eine Frau hatte er auch nicht gefunden. Mittlerweile war es ihm auch gleich; er hatte sich mit seinem Schicksal abgefunden.
Der Verlust seines Bruders traf ihn hart, denn die gute Führung des Hofes sicherte auch ihm einen auskömmlichen Lebensabend. Unter der Führung seiner Nichte und ihres Mannes hatte sich die wirtschaftliche Lage jedoch deutlich verschlechtert. Er unterstützte den neuen Bauern und seine Nichte nach besten Kräften, aber die Einkünfte reichten alles in allem nicht mehr aus.
„Es ist wie verhext“, dachte Cord oft. Im letzten Jahr war fast der halbe Viehbestand verendet, weil die Futtervorräte für den Winter nicht ausreichten. Sie schlachteten deswegen eine abgemagerte Kuh. Wenigstens hatten sie damit ein wenig Fleisch. Offiziell galt das Tier als verendet. Das hatte der Bauernvogt Dreyer auch bestätigt und dem Amt schriftlich mitgeteilt. Diesen Dienst ließ er sich mit einer Rinderkeule entlohnen.
Es gab Momente, in denen Cord den Lebensmut zu verlieren drohte und überlegte, seinem Bruder und seiner Schwägerin zum Altvater nachzufolgen. Den Glauben an Gott und die Gerechtigkeit des Allmächtigen hatte er schon längst verloren, wenngleich er dessen Fegefeuer fürchtete. Doch die Verantwortung gegenüber seiner Nichte Maria hielt ihn immer wieder davon ab. Sie konnten sich keinen Knecht leisten. Er selbst nahm schon seit Langem kein Geld mehr, war mit Essen und der Einbindung in die Familie zufrieden. Für Maria war er Vaterersatz, was ihm in der Seele guttat. Er wusste, er würde weiterhin hier gebraucht werden. Beim Neffen war er selbst als Gevatter berufen worden und stolz, dass Maria ihn gefragt hatte. Sie hatte den Kleinen nach seinem Oheim „Cord“ taufen lassen, was den alten Cord stolz machte. Später sagte er sogar Großvater zu ihm.
Manchmal bedauerte Cord, dass die „Zaubersche“ aus Höperhöfen nicht als Hexe verurteilt wurde. Jedermann erzählte er noch heute, dass sie eine Hexe sei und den Richter mit einem Zauber manipuliert hätte. Deswegen sei der geliebte Bruder unschuldig des Landes verwiesen worden und so großes Unglück über die ganze Familie gekommen.