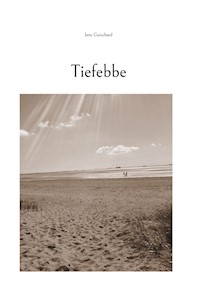
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 17-jährige Marcus bekommt, aufgewachsen in einer norddeutschen Kleinstadt, eines Nachts starke Bauchkrämpfe. Seine Eltern beschließen, ihn nach seiner Genesung zu seiner Tante, die ihren Lebensabend auf der nordfriesischen Insel Föhr verbringt, zu schicken. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs, genießt Marcus die Freiheit mit dem Irish-Setter Sissy. Die Erzählung kreist um die Pubertät eines 17 - jährigen, der als Erwachsener noch einmal zurückblickt auf seine Zeit als Jugendlicher in Friesland, seine unerfüllten Lieben und das Leben als Sohn von einem Vater, der den zweiten Weltkrieg mitmachte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für Tante Erika
Mein Dank gilt insbesondere:
Susanne
Kurt
Antonia und Marc
Volles Haus, doch wieder mal ein leeres Bett
Schließe meine Augen, leg mich neben dich
Wie viel wiegt 'ne Minute, wenn sie dich für immer schweben lässt
Ich versteh es jetzt
Glück kommt, wenn du es gehen lässt
Wieso renn ich vor dem Regen weg?
War nur ein Feigling, den man stehen lässt
Ich seh es jetzt
Und all die Jahre wie im Flug
Hab ich's nie wirklich versucht
Liebe braucht kein Baumhaus, braucht keine Traumfrauen
Liebe braucht Mut
Und davon hab ich grade nicht genug
Dreh mich um und mach die Augen wieder zu
badchieff, Edo Saiya & CRO
"Ich liebe"
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Teil II
Nachtrag
Teil I
Anika, unser Cockerspaniel, zog an der Leine; ich drehte eine Runde um den Teich, der direkt hinter dem Haus meines Freundes lag, vermutlich ein Bombenkrater oder vielleicht war dort irgendwann mal Kies abgebaut worden, auf jeden Fall vor meiner Zeit. Einige Kinder spielten am Ufer, der Schäferhund von nebenan kam auf uns zu, schnupperte kurz und verschwand so schnell wieder, wie er gekommen war.
Mein Bauch krampfte schon zum zweiten Mal so stark, dass ich kurz zusammenzuckte, ich dachte mir nichts weiter dabei, an diese Art Kapriolen in meinem Bauch war ich gewöhnt.
Es war April 1983, der erste warme Tag im Jahr, es war später Nachmittag, vielleicht 18 Uhr.
Mein Vater arbeitete im Garten, setzte die ersten Samen in den Boden: Spinat, Radieschen, Kopf- und Feldsalat. In der Küche klapperte meine Mutter mit dem Geschirr. Ich leinte Anika ab, sie trottete zu ihrem Knochen, an dem sie schon den ganzen Nachmittag genagt hatte. Ich setzte mich auf einen Stuhl im Garten, lauschte dem Zwitschern der Vögel; der endlose Winter war endlich vorbei, monatelange Dunkelheit, Regen und das schwere Grau der Wolken, das uns mehr und mehr runtergezogen hatte, mit einem Mal war alles vergessen.
„Abendbrot“, rief meine Mutter aus dem Fenster. Wir aßen immer zusammen, mein Vater mit seinen dreckigen Arbeitsklamotten, meine Mutter, mein Bruder und ich.
Mir ging es nicht so gut, das Ziehen beim Spaziergang entwickelte sich zu leichten Magen-Darm-Krämpfen. „Marcus, du musst was essen“, ermahnte mich meine Mutter. Ich konnte nicht, quälte mir dennoch ein, zwei Brote rein, vor allem damit meine Mutter nicht nervös wurde und sie ihre Fürsorge den gesamten Abend gezeigt hätte.
Gegen Abend steigerte sich das Stechen zu krampfartigen Beschwerden und gipfelte in einen Brechdurchfall; ich lag zumeist wach und hatte unerträgliche Schmerzen.
Völlig gerädert kam ich am Morgen zum Frühstück; meine Mutter rauchte am Tisch und erschrak: „Junge, wie siehst du denn aus?“ Sie drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, der zwischen Marmelade und Butter stand. Ich schilderte ihr meine Beschwerden. Sie bereitete sofort eine Wärmflasche vor, wickelte zwei alte Handtücher darum und führte mich zum Sofa. Sie stellte einen Pfefferminztee auf den Couchtisch und räumte sogar den halbvollen Aschenbecher beiseite, bei dessen Geruch mir wieder schlecht geworden war. „Warte ab, die Wärmflasche und der Tee wirken bald, dann geht es dir besser“, sie streichelte meine Hand, „ich ruf nur eben in der Schule an, dass du heute nicht kommst.“
Ich hörte sie telefonieren, hörte meine Mutter leise am Telefon mit dem Sekretariat sprechen: „Ja, krank, ja, mmh, ja, auf Wiederhören.“ Danach widmete sie sich der Hausarbeit: Frühstückstisch abräumen, saugen und so weiter; bei dieser für mich beruhigenden Geräuschkulisse döste ich langsam ein.
***
Zur Schule unterhielt ich eine Art Hassliebe; mit ihr ging es nicht, ohne sie auch nicht. Das Unglück begann schleichend zu Beginn der neunten Klasse, mit Beginn der Pubertät. Bis dahin war ich noch ein mittelmäßiger, bemühter Schüler, der auch ab und an mit besonderen Leistungen brillierte, aber ebenso auch mal die schlechteste Arbeit schreiben konnte. So hielt sich das die Waage, die einen Lehrer lobten mich über den grünen Klee, sahen in mir einen tollen Schüler – was zugegebenermaßen eher selten vorkam – während andere die Hände über dem Kopf zusammenschlugen, die Stirn runzelten und sich fragten, warum dieser Junge überhaupt auf dem Gymnasium sei.
So verbrachte ich die ersten beiden Jahre auf der Schule in einem ständigen Auf und Ab, aber meist in einem ruhigen, mittelmäßigen Fahrwasser.
Es begann wie ein Fehlstart eines Fußball-Bundesliga-Vereins zu Beginn einer Saison. Erstes Spiel verloren: passiert. Das zweite, auswärts auch, na ja, eben auswärts. Das nächste Heimspiel unterliegt man knapp, hat ordentlich gespielt, aber trotzdem keine Punkte. Beim vierten Spiel mangelt es an Selbstvertrauen und beim fünften verlorenen Spiel hat die Mannschaft eine ausgewachsene Krise: Man steckte mit null Punkten im Keller und kommt, wenn man Pech hat, auch nicht mehr raus, so sehr man sich auch abrackert.
Bei mir waren diese Spiele: Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde und Chemie. In Zahlen ausgedrückt: 55544 – es las sich wie eine Telefonnummer von einem Hausmeisterservice, leicht zu merken, und nicht wie der Notenschnitt eines hoffnungsvollen Schülers. Als ich diese Nichtleistung dann bei den zweiten Anläufen wiederholte, war klar, dass mein Team – also ich – nicht nur in der Krise war, sondern dass ich ein handfestes Problem hatte: Ich steckte im Abstiegskampf und zwar knietief. Zur Rückrunde, also im zweiten Halbjahr, bestätigte ich mein Auftreten, und mit Saisonabschluss – Ende des Schuljahres – war mein Abstieg besiegelt: Ich musste die Klasse wiederholen.
Es war auch nicht so, dass ich mich bemüht hätte, aus dieser Situation wieder herauszukommen, nein, ich quittierte den Dienst mit Beginn der 9. Klasse. Ich sah es nicht ein, irgendwas für die Schule zu tun. Warum auch immer, mir war alles verhasst, was mit dem Schulbetrieb zu tun hatte, ob Klausuren, der tägliche Besuch des Unterrichts, die Lektüre, die der Deutschlehrer vorschlug, oder die unverständlichen Wendungen, die unser Mathelehrer, Dr. Falk Oellermann, vornahm. Mir ging alles nur höllisch auf die Nerven – ich hatte auch keine Idee, was mir denn besser gefallen hätte – nein, eines war klar: Schule war für mich nichts.
So kam es, dass ein Brief von der Schulleitung im Briefkasten lag, worin stand, dass der Schüler aufgrund seiner fortlaufenden Unfähigkeit die Klasse wiederholen müsse.
Die Aufregung war groß bei meinen Eltern; sie hatten damit nicht gerechnet; zumal das letzte Zeugnis zwar nicht prickelnd gewesen war, aber nicht dazu Anlass gegeben hatte, in Besorgnis zu geraten.
Sie beschränkten ihre Bemühungen, meinen Schulalltag zu begleiten, ausschließlich darauf, halbjährlich aufs Zeugnis zu schauen und entweder – je nach Erfolg – es zu billigen oder in Panik auszubrechen, wenn die Noten eine deutliche Sprache sprachen. Diesmal brachen sie eben in Panik aus.
Dies war eine sehr unangenehme Situation für mich – so sehr ich mich gegen meine Schulautoritäten stellen mochte – so kleinlaut war ich bei meinen Eltern.
Meinen Vater und meine Mutter bei der Ausübung meines Jobs zu enttäuschen – und das war es de facto – war für mich inakzeptabel. Sie ließen mich in Ruhe, eine komfortable Situation, aber wenn ich nicht den Erwartungen entsprach, waren sie aufmerksam – zu aufmerksam – sehr zu meinem Leidwesen.
Nun war das Kind in den Brunnen gefallen – es gab kein Zurück: Ich musste die Klasse wiederholen, eine Katastrophe für alle: Für mich, der dies niemals vor seinen Freunden eingestehen konnte, und für meine Eltern, die einen Versager als Sohn hatten, der es nicht schaffte, das Gymnasium anständig zu absolvieren, obwohl sie seinen Besuch der Schule so oft mit Stolz angepriesen hatten: Seht her, Marcus, der ist aufm Gymnasium – damals nicht die Regel –, was für ein kluger Junge!
Die Situation war unerträglich: Mir wurde langsam klar, was ich verbockt hatte, und meine Eltern realisierten, dass ich es nicht drauf hatte – zumindest nicht momentan.
Niemand konnte sich erklären, woher diese Antihaltung kam – am wenigsten ich.
Die neue Saison begann, ich war geläutert. Die Schmach war zu groß, die dürftigen Erklärungen bei meinen Eltern, das peinliche Zugeben meines Versagens vor den Verwandten und Freunden und überhaupt, wer gibt schon gerne zu, dass er an seinen Aufgaben gescheitert ist.
Nun war es so, dass ich weder Spieler, Trainer, Management oder die Fitnessabteilung auswechseln konnte, ich hatte nur mich: Ich war all das in einem. Meine Eltern taugten nicht als Mentaltrainer, sie würden gerne die Methoden anwenden, die in der Vergangenheit bei ihnen selbst schon versagt hatten: Druck, Druck und noch mal Druck. Und deshalb übten sie keinen Druck aus, weil sie wussten, dass das keinen Erfolg bringen würde; alternativ taten sie: nichts.
Sie saßen in der Küche, rauchten und schauten mich verzweifelt an: Junge, streng dich an!
Das zweite Mal zehnte Klasse stand bevor, ich war gewappnet – diesmal würde nichts schief gehen.
***
Meine Eltern hatten sich Ende der 50er-Jahre kennengelernt. Mein Vater war 1913 geboren, 1983 demnach schon 70, kam aus Ostpreußen, verlor seine Heimat und den Krieg – beides hatte er nie wirklich verwunden. Wenn er am Heiligabend mit der Familie zusammensaß, und im Radio die Glocken verschiedener Kirchen in Deutschland läuteten, rannen ihm beim Hören des Glockengeläuts des Königsberger Doms die Tränen über die Wangen.
Manchmal erzählte er vom Krieg – mein Vater hatte den gesamten Durchmarsch der Wehrmacht mitgemacht bis zum jähen Ende, was er wohl nie wirklich verkraftet hatte.
Er hatte sogar Glück im Unglück gehabt, in den letzten Zügen vor Stalingrad ereilte ihn eine Tuberkulose, was ihn wohl vor dem sicheren Tod auf dem Feld oder einer langen Gefangenschaft bewahrt hatte. Der Krieg hatte ihn gezeichnet, so wirklich war er nie in der neuen Welt angekommen, er gab sich aber Mühe.
Wegen der Tuberkulose verschlug es ihn nach Dresden, wo er den großen Bombenangriff der Engländer miterlebt hatte. Er erzählte nie davon, zumindest kann ich mich nicht erinnern. Dann ging er – aus welchen Gründen auch immer – über Sylt nach Friesland, wodurch meine Existenz begründet wurde, da er meine Mutter kennenlernte. Er gehörte wohl nicht zu den ganz Bösen; ich glaube nicht, dass die Engländer ihn sonst Anfang der 50er-Jahre in eine Art paramilitärische Organisation aufgenommen hätten.
Dort arbeitete meine Mutter in der Verwaltung, sie hatte Arzthelferin in Wilhelmshaven gelernt; die Stadt wurde während des Krieges in Schutt und Asche gelegt. Ihr blieb nichts – außer Erinnerungen an Bunker, Bombenangriffe und Ruß. Und ein paar kleine, schöne Kindheitserlebnisse.
Mein Vater musste sich ordentlich ins Zeug legen, um das Herz meiner Mutter zu gewinnen, fast 20 Jahre Altersunterschied waren nicht von Pappe. Zahlreiche Briefe, die ich aus dieser Zeit auf dem Dachboden gefunden hatte, zeugen davon.
Es gelang ihm, sie bauten ein Haus, meinem Vater wurde ein Lastenausgleich zugesprochen, bekamen sodann ihr erstes Kind, meinen Bruder, und acht Jahre später mich.
Ihre Ehe war in Ordnung – meistens. Die Konfliktpotenziale machten sich am Geldmangel fest: Mein Vater hangelte sich von einem Job zum anderen. Er war gelernter Landwirt ohne Land und Offizier ohne Armee. So verdingte er sich als Autoverkäufer, Marktleiter bei einem Supermarkt oder auch mal als Sachbearbeiter bei einer Baufirma – irgendwas fand sich immer in der damals aufstrebenden Bundesrepublik, nur Geld verdienen konnte er damit nicht viel. Geld verdienen war sowieso nicht unbedingt seine Sache, er war eher Idealist, so bescheuert die Ideen auch waren.
Sie saßen oft am Wochenende zusammen, tranken Bier, Wein, Schnaps und leckten ihre Wunden, tja, was wäre, wenn..., dazu lief Klaus Wunderlich, zu später Stunde auch Lale Andersens Lied Lili Marleen.
Sie gaben sich Mühe mit mir und meinem Bruder, aber die Geister der Vergangenheit konnten sie nicht abschütteln – nie. Verlust war ihr großes Thema, bei meiner Mutter noch mehr als bei meinem Vater. Verlust – nie wieder wollten sie das verlieren, was sie hatten.
***
Ich startete mit den besten Vorsätzen in die Klasse – eigentlich kannte ich den Stoff der zehnten Klasse schon, was sollte passieren? Meine Lehrer im letzten Schuljahr waren schon das Härteste, was die Schule zu bieten hatte, dachte ich. Schlimmer konnte es nicht werden. Es kam auch nicht schlimmer, die Lehrer waren durchaus nicht so hart, drückten ein Auge zu, manchmal auch zwei – nur sie hatten einen ganz anderen Stil. Während mein ehemaliger Lateinlehrer, den ich seit der 7. Klasse hatte, immer den gleichen Unterricht machte – Buch aufschlagen, Seite sieben, Seite acht, Seite neun – hatte der neue Lehrer offenbar einen pädagogischen Anspruch und sogar ein neues Lehrbuch. Der Unterricht wechselte von Vokabeltest und Übersetzen zu „nun sprechen wir mal Latein“. Das neue Lehrbuch war bunt, mixte Grammatikübungen mit kleinen Textpassagen, Gruppenarbeit und Sprechübungen. Ich war überfordert – mündlich vier, schriftlich vier.
Und so ging es weiter – zumindest in den Hauptfächern Englisch, Deutsch, Mathe. Ich wusste, dass ich ein verschenktes Jahr hinter mir hatte, ruderte und ruderte und merkte, dass die Strömung stärker war als ich. Aber ich kam dagegen an, immer wieder schaffte ich es in den entscheidenden Klausuren die Kurve zu bekommen. Dachte ich.
***
Ich schlief ein, wachte kurz darauf wieder auf, ich hatte schlecht geträumt, der Zigarettenrauch aus der Küche zog zu mir ins Wohnzimmer.
Meine Mutter saß rauchend in der Küche und registrierte beängstigt die Entwicklungen meines Befindens, wollte sich aber noch nicht zu einem Besuch beim Arzt hinreißen lassen, denn bislang ging es ja immer gut. Gegen Nachmittag sah sie ein, dass an eine Selbstheilung nicht mehr zu denken war.
„Ja, das weiß ich jetzt auch nicht“, sagte unser Hausarzt am nächsten Tag, nachdem ich eine weitere Nacht im Dauerrhythmus meiner Krämpfe im Bett verbracht hatte und sich keinen Deut Besserung einstellte. Er klopfte vorsichtig auf die Bauchdecke, drückte hier etwas, drückte dort etwas, runzelte die Stirn und stellte abschließend fest: „Der Junge muss wohl ins Krankenhaus“.
Mein Erinnerungsvermögen ließ nach diesem Termin zunehmend nach, was sicherlich damit zusammenhing, dass ich seit nunmehr 24 Stunden nichts mehr gegessen und getrunken hatte.
Es folgte die Fahrt nach Wilhelmshaven in einem jamaikagelben Opel Commodore B auf der Rückbank liegend, Mutter am Steuer ohne Zigarette, Aufnahme, Darmspülung, Tropf, Schmerzmittel. Schwestern, Darmspülung, Ärztin, Pfleger, mein Vater, es wurde spät. Der Tropf, die Schmerzmittel oder beides zusammen brachten mir meine Lebensgeister zurück, zumindest nahm ich meine Umgebung wieder wahr, nahm wahr, dass ich neben einem 70-Jährigen lag, der einen künstlichen Darmausgang hatte. Nahm wahr, dass die Schwestern hübsch waren. Nahm wahr, dass es mir besser ging, aber nur ein bisschen, und dass das Radio lief:
Do you really want to hurt me
Do you really want to make me cry
Ich wurde durch alle möglichen Abteilungen des Krankenhauses geschoben, aber so richtig konnten die Ärzte die Ursache meiner Beschwerden nicht feststellen. „Tja, das weiß ich jetzt auch nicht“, sagte die Ärztin mit einem Doppelnamen. Sie war sehr hübsch, sehr gestylt, erschien mir alt, zwischen Mitte-Ende 30. Ich fand sie nicht nett, sie wirkte arrogant, kalt und abweisend, und ich hatte das Gefühl, sie würde mir die Schuld dafür geben, dass sie die Ursache meines Unbehagens nicht fand. Sie hatte einiges ausprobiert, Untersuchungen angeordnet, Blutabnahmen, Ultraschall, Röntgenaufnahmen, alles, was die achtziger Jahre an medizinischen Möglichkeiten an einem Provinzkrankenhaus hergaben. So vergingen langsam die Tage.
„Da müssen wir eine Darmspiegelung machen.“
Nun gut, das kann auch nicht schlimmer sein als diese Behandlungen, ich dachte, dass es nun gut wäre, wenn man mein Problem langsam in Griff bekäme, zumal meine Ernährung seit zwei Wochen ausschließlich aus flüssiger Nahrung über einen Tropf bestand.
Natürlich war ich nicht mehr im Vollbesitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte, hatte seit Wochen nichts Festes mehr zu mir genommen, die Schmerzen ließen auch nicht durchschlagend nach, die Ärzte waren ratlos. Morbus Crohn hatte ich zwischenzeitlich mal gehört, eine Krankheit, so erfuhr ich später, die sehr anhänglich war und quasi eine nicht scheidbare Ehe mit einem einging und die einen täglich daran erinnerte, zum Beispiel durch einen künstlichen Darmausgang und regelmäßige Krankenhausaufenthalte, dass sie noch da war.
Man rollte mich in das Behandlungszimmer und bereitete die Darmspiegelung vor. Eine Ärztin fiel mir auf, sie war jung – zumindest im Verhältnis zur Doppelnamen Ärztin – sie hielt meine Hand und streichelte sie, während dieser nicht enden wollende Schlauch in mein Innerstes eingeführt wurde. Die Betäubung war nur lokal, ich dämmerte im Halbschlaf vor mich hin und fühlte nur diese Schmerzen und das Streicheln der Ärztin, bis ein anderer Doktor, offenbar einer der behandelnden Ärzte unvermittelt sagte: „Jetzt auch noch so eine Scheiße vorm Wochenende“. Ich schaute kurz auf, mein Kopf fiel sofort wieder aufs Kissen, die Umgebung verwässerte sich, die Stimmen wurden dumpf wie beim Tauchen. Ich schlief ein, die Zeit drängte.
Es war ein fortgeschrittener Blinddarmdurchbruch. Konnte man Anfang der 80er-Jahre offenbar nicht so einfach erkennen, oder vielleicht doch, nur nicht in Wilhelmshaven. Oder nicht von meiner Doppelnamen-Ärztin.
Geschenkt, die OP hatte ich überstanden, der blinde Darm war raus und ich lag nun geheilt, aber noch nicht gesund in meinem Bett neben dem 70-Jährigen, der sich erst an seinen künstlichen Darmausgang gewöhnen musste.
Wow, dachte ich. Essen ging nicht, trinken ging nicht und aufs Klo konnte ich auch nicht allein gehen.
So verstrichen die Tage, meine Nahrung bestand vorerst aus Haferflocken mit Wasser und einem braunen Getränk, was süßlich eklig schmeckte und einen Brechreiz in mir hervorrief.
Meine Mutter besuchte mich, brachte Erdbeeren aus dem Garten mit, meine Klassenkameraden versorgten mich mit den nötigsten Hausaufgaben, sogar das ein oder andere für mich unerreichbare schöne Mädchen war bei mir. Es wurde mir ziemlich schnell klar, dass das Ganze wohl schwerwiegender gewesen war, als ich erst vermutet hatte. War es auch, das bestätigte unser Hausarzt bei der ersten Nachuntersuchung. Die Vergiftung war sehr weit fortgeschritten gewesen, und länger hätte man mit der Operation nicht warten dürfen. Zeugnis darüber gaben zwei Schläuche, die aus meinem Bauch herausschauten, und durch die der restliche Eiter, der sich im Bauchraum sammelte, ablaufen sollte.
***
Das Leben nimmt in solchen Fällen keine Rücksicht und läuft gemeinerweise einfach weiter, dies musste ich, oder besser meine Eltern, nach der ersten Woche Krankenhaus feststellen: Mein Vorsatz, von nun an habe ich meine Lehren aus meinen schulischen Fehlleistungen gezogen, griffen ins Leere. Die erbarmungslosen Automatismen des Schulbetriebes hatten im Frühjahr 1983 festgestellt, dass meine Leistungen zwar nicht mehr mangelhaft waren, doch aber schwach ausreichend und jenes führe nun unweigerlich zum Ausschluss aus der Schule. Dies teilte mir mein Vater, ein Mann, der es nicht gewohnt war, in die Erziehung einzugreifen, unmissverständlich am Krankenbett mit. Zweimal die 10. Klasse, na prima, Abgangszeugnis mit einem Durchschnitt knapp unter vier, dachte ich mir, meine Zukunft kann nur rosig aussehen.
Ich verstand die Welt nicht mehr: Meiner Einschätzung nach hatte ich alles getan, um nicht aufzufallen, alles getan, meinen miserablen Ruf zu reparieren, meine Leistungen auf einen Stand zu bringen, der eine Versetzung garantierte. Mein Lateinlehrer und mein Mathelehrer hatten eine diametral andere Einschätzung meiner schulischen Leistungen und befanden, dass meine Versetzung zum zweiten Mal gefährdet war, was konsequenterweise einen endgültigen Abgang aus der Schule bedeutete.
Da brach nun mein schulisches Kartenhaus zusammen; klar, ein bisschen mit einem möglichen Abgang zu spielen, ein wenig in den Abgrund zu schauen und damit zu kokettieren, herunterzufallen, war eine andere Nummer, als tatsächlich zu fallen.
Und die Schule meinte es ernst – der Klassenlehrer ließ meinem Vater gegenüber durchblicken, dass er den Eindruck habe, dass ich jegliches Interesse daran verloren hätte, an der Schule zu bleiben.
Das war eine komplett falsche Einschätzung des Klassenlehrers, denn ich schätzte den Status als Gymnasiast sehr wohl, schätzte den Nimbus, den dies altehrwürdige Gymnasium umgab, schätzte insgeheim die brutalen Latein-Klausuren an einem Samstag, weil es die Adern Unbeteiligter gefrieren ließ, die Latein-Klausuren nur aus den Buddenbrooks kannten. Was ich nicht schätzte war, kontinuierlich dafür zu arbeiten.
Mein Vater glaubte an mich – glauben nicht alle Väter an ihre Söhne – und versuchte zu retten, was zu retten war, im Rahmen seiner Möglichkeiten: Er beauftragte keinen außergewöhnlichen Rechtsanwalt, der in der Vergangenheit schon bewiesen hatte, dass er hoffnungslose Schüler vor dem sicheren Aus gerettet hatte, trat nicht spektakulär in Klassenkonferenzen auf und insistierte nicht durch ständige Schulbesuche bei den Verantwortlichen, sondern er tat nur eines: Er schrieb einen Brief an den Direktor: Ja, er wisse, dass sein Sohn wirklich viel Mist gebaut habe, und dass dies auch wirklich überhaupt nicht akzeptabel sei, und dass sein Verhalten auch kein Versprechen auf Reife für die Oberstufe bedeute. Aber, so mein Vater, man müsse bedenken, dass sein Sohn in einem schwierigen Alter sei und außerdem – so fügte er an – dass jemand, der immer geraden Weges ging, zwar ein aufrechtes Leben führe, aber eben auch ein armseliges.
Dies muss bei dem Direktor irgendwas ausgelöst haben wie: Ja, da hat er Recht. Oder: War ich nicht auch mal so? Oder: Kann man nicht auch mal verzeihen? Jedenfalls durfte ich auf der Schule bleiben, letzte Chance und so, obwohl der Brief in vielfacher Hinsicht geflunkert war. Denn ich habe nicht viel Mist gebaut, sondern ausschließlich. Und das waren nicht nur Bubenstreiche über die man dann irgendwann schmunzelt, sondern Dinge, die in der Tat die Reife zur gymnasialen Oberstufe keineswegs erkennen ließen: Wir schossen mit einer Luftpistole, die ich bei Carsten im Schuppen gefunden hatte, auf dem Schulhof. Ließen Klassenbücher verschwinden, wenn die Anzahl der Einträge eine gewisse Zahl überstieg und einen Eintrag im Zeugnis nach sich ziehen konnte und somit unsere Eltern auf den Plan rufen würde, oder machten ein kleines Feuerchen im Klassenraum, weil das – so fanden wir damals – so unglaublich witzig sei.





























