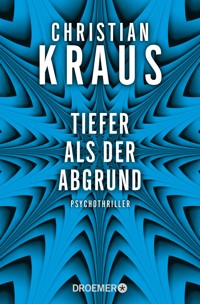
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was, wenn tief in dir ein Mörder lauert? »Tiefer als der Abgrund« ist ein wendungsreicher Psychothriller um einen verurteilten Mörder und einen Psychotherapeuten im Gewissenskonflikt. Hochintelligent, hochsensibel – und ein verurteilter Mörder: Elias, der neueste Patient des Psychologen Malte Fischer, ist ein ungewöhnlicher junger Mann. Zwar hat er keinerlei Erinnerungen an die brutale Tat, die er mit 16 begangen haben soll, aber die Beweislast war erdrückend. Frisch aus der Haft entlassen, fürchtet Elias nichts mehr als das Monster, das tief in seinem Inneren zu lauern scheint. Im Verlauf ihrer Sitzungen kommt Malte jedoch zu dem Schluss, dass Elias unschuldig sein könnte und wendet sich an die zuständige Kommissarin Freya Svensson. Freya will nichts von dieser Theorie wissen – bis es erneut Tote gibt und Elias spurlos verschwindet… Der deutsche Thriller-Autor und Psychoanalytiker Christian Kraus ist ein Experte für die Abgründe der menschlichen Psyche. Mit »Tiefer als der Abgrund« hat er erneut einen Psychothriller geschrieben, der eine unwiderstehliche Sogwirkung entwickelt. »Ein fesselndes Buch voller unvorhersehbarer Verstrickungen, das zeigt, welche Macht unsere Psyche und die Narben, die ihr zugefügt werden, über uns haben können.« Weser Kurier über den Psychothriller »Tief wirst du schlafen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christian Kraus
Tiefer als der Abgrund
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hochintelligent, hochsensibel – und ein verurteilter Mörder: Elias, der neueste Patient des Psychologen Malte Fischer, ist ein ungewöhnlicher junger Mann. Zwar hat er keine Erinnerung an die brutale Tat, die er mit 16 begangen haben soll, aber die Beweislast war erdrückend. Jetzt fürchtet er nichts mehr als das Monster, das tief in seinem Inneren zu lauern scheint. Im Lauf der Sitzungen kommt Malte jedoch zu dem Schluss, dass Elias unschuldig sein könnte. Die zuständigeKommissarin Freya Svensson will nichts von dieser Theorie wissen – bis es erneut Tote gibt und Elias spurlos verschwindet …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
Nachwort und Danksagung
Für Simon
Schicksalsschläge kann man ertragen, sie kommen von außen, sind zufällig. Aber an der eigenen Schuld leiden – ach!, das ist der Stachel des Lebens.
Oscar Wilde
Prolog
Es war wunderbar dunkel und still. Eine weiche Unterlage schmiegte sich an den Rücken des Jungen, sodass sich sein Körper beinahe schwerelos anfühlte. Das einzige Geräusch war das seines Atems. Er hätte die Ruhe und den Frieden gerne noch eine Weile genossen, aber sein erwachender Verstand ließ sich nicht weiter einlullen, sondern stellte Fragen: Wo war er, was war geschehen? Wie lange lag er schon hier?
Er öffnete die Augen, blinzelte, um sie an das taghelle Licht zu gewöhnen. Über ihm ragten die nackten Sparren des offenen Dachstuhls in die Höhe. Die Holzhütte im Wald. Der Gedanke tropfte in sein Bewusstsein wie zäh fließender Sirup auf einen Pudding.
Sein Gehirn funktionierte bestenfalls im Zeitlupentempo, und sein Körper fühlte sich an wie in Watte gepackt. Als wären allein seine Sinnesorgane aus dem Tiefschlaf erwacht, während der ganze Rest noch in einer dämmerigen Zwischenwelt festhing.
Er hob den Kopf. Das ging notdürftig, aber sein Herz protestierte mit lauten Schlägen gegen die Minibewegung. Vor seinen Augen regnete es bunte Sterne. Für eine Sekunde befürchtete er, der Puls könnte aussetzen, und er würde augenblicklich in das dunkle Nichts zurücksinken.
Er nahm einen tiefen Atemzug. Die Extraportion Luft schien seine Lebenskräfte anzuregen.
Der Junge sah an sich hinab. Sein Atem stockte, und das Herz schlug einen nervösen Trommelwirbel. In der rechten Hand hielt er den Holzgriff eines Küchenmessers mit schlanker, spitz zulaufender Klinge. Angetrocknetes Blut bedeckte beide Hände und Unterarme wie ein Paar roter Handschuhe. An den Handgelenken klafften quer verlaufende Schnitte mit noch feucht glänzenden Wundrändern. Auch sein T-Shirt und die Jeans waren blutgetränkt, einige Tropfen hatten es bis zu seinen nackten Füßen geschafft.
Neben ihm lag jemand, erkannte er aus den Augenwinkeln. Er stemmte den Oberkörper in die Höhe, drehte sich herum. Erneut flackerten Sterne durch seinen Kopf.
Es war Laura. Seine Schwester. Er stellte sich ihr Gesicht vor: Goldblonde, halblange Haare umrahmten ihre tiefblauen Augen, darunter markante Wangenknochen und ein schmaler Mund, in dessen Winkel sich lustige Falten bildeten, wenn sie lächelte.
Die Flimmersterne verblassten, und der Anblick der aus dem Streulicht auftauchenden echten Laura traf ihn wie eine Abrissbirne.
Sie lächelte nicht. Und würde es nie wieder tun. Ihr Gesicht war blass und wächsern, die Lippen weiß wie Kalk. Das linke Auge schwamm in einer tiefroten Pfütze, das rechte Auge starrte ins Nirgendwo. Laura war tot.
»Nein!« Es war ein leises Gewimmer, für einen Schrei reichte die Luft nicht. Irgendwie richtete er sich auf, kam auf die Beine, taumelte, schaffte die wenigen Schritte Richtung Tür, hob den Arm, sah das Messer, das er noch immer in der blutbefleckten Hand hielt, ließ es fallen, packte den Türgriff und zog daran. Die Tür war verschlossen, aber der Schlüssel steckte von innen im Schloss. Der Junge bot alle Reste an Kraft und Entschlossenheit auf, drehte ihn herum, stieß die Tür auf und torkelte ins Freie.
1
»Beschreiben Sie bitte, woran Sie sich erinnern. In der Gegenwartsform, als würden Sie alles noch einmal durchleben.«
»Ich versuche es. Also, ich sehe die dunkle Straße. Die Straßenlaternen sind kaputt oder abgeschaltet, auch der Bürgersteig und die meisten Hauseingänge liegen im Dunkeln. Auf beiden Seiten der Fahrbahn parken Autos, es sind nur Schatten. Ich überlege, ob ich den Umweg über die Hauptstraße nehme, um zu meiner Wohnung zu kommen. Ein Umweg von fünfzehn Minuten. Hätte ich nur auf mein Gefühl gehört.«
»Ich verstehe, dass Sie sich das wünschen. Aber bleiben Sie bitte bei den konkreten Sinneseindrücken.«
»Mir ist mulmig zumute. Man hört ja immer wieder von nächtlichen Überfällen. Aber ich gehe los, deutlich schneller als normal und nahe an der Hauswand. Es wird schon nichts passieren, sage ich mir, um mich zu beruhigen. Zur Not kann ich laut schreien, die Leute in den Mietshäusern würden mich hören und mir zu Hilfe eilen. Ich denke an meine helle Wohnung und meine Mitbewohnerin Sarah, die versprochen hat, mit dem Essen auf mich zu warten. Ich bin vielleicht zwanzig Meter gegangen. Die Anspannung wächst. Mein Herz pocht, es kribbelt am ganzen Körper, ich bekomme schlecht Luft. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Panikattacke, aber ich ahne, worauf das hinausläuft. Ich kann umdrehen, denke ich. Und doch den Umweg nehmen. Aber wie albern ist das bitte? Ich bin in meiner eigenen Straße, ein paar Hundert Meter von meiner Wohnung entfernt. Nein, das ziehst du jetzt durch, sage ich mir. Wenn du hier nachgibst, haben die, die Angst und Schrecken verbreiten, schon gewonnen. Ich atme also tief durch und gehe weiter. Laufen beschreibt es wohl besser. Auf der Fahrbahn steht ein Lastwagen. Von einer Umzugsfirma. Der blockiert mindestens drei Parkplätze und versperrt die Sicht auf die Straße. Ich drücke mich dichter an die Hauswand. Inzwischen renne ich, obwohl meine Brust wie zugeschnürt ist und ich schlecht Luft kriege. Es sind noch fünfzig Meter bis zu meiner Wohnung. Dann tauchen diese beiden Typen auf. Wie aus dem Nichts. Tatsächlich müssen sie hinter diesem Möbelwagen gewartet und mir aufgelauert haben. O mein Gott, mein Herz rast noch immer wie verrückt, wenn ich daran denke.«
»Nehmen Sie sich gerne einen Moment Zeit, wenn Sie möchten. Atmen Sie ein paarmal tief durch.«
»Es geht schon wieder.«
»Dann erzählen Sie bitte weiter.«
»Beide waren …, ’tschuldigung, ich soll ja in der Gegenwartsform erzählen. Also, beide sind mit Kapuzenpullis bekleidet. Sie eilen auf mich zu. Ich erstarre vor Schreck. Kann mich nicht rühren, nicht atmen. Trotz der Dunkelheit und der Kapuzen bilde ich mir ein, ihre Gesichter zu erkennen. Sie schauen mich an wie … wie eine Beute. Und genauso fühle ich mich. Als Beute. Dann sind sie bei mir. Der eine packt mich am Arm, der andere greift nach meinem Rucksack. Ich wehre mich nicht. Nicht einmal schreien kann ich. Ich meine, es ist eine Wohnstraße. Hätte ich gerufen, wären in wenigen Sekunden meine Nachbarn bei mir gewesen.«
»Was passiert weiter?«
»Der eine reißt mir den Rucksack runter, der andere verpasst mir einen Stoß, ich taumele zurück, verliere das Gleichgewicht und knalle rückwärts hin, die beiden rennen weg. Ich bleibe einfach liegen. Ich bin bei Bewusstsein, nicht schwer verletzt oder so, aber trotzdem bleibe ich liegen. Ich kann mich nicht rühren, bekomme kaum Luft. Es vergehen Minuten. Irgendwann rappele ich mich hoch, knie mich hin, Tränen laufen mir übers Gesicht, in meinem Kopf dreht sich alles, und noch immer kann ich nicht atmen. Ich schnappe nach Luft, immer wieder, aber es geht nichts rein. Mein ganzer Körper kribbelt, ich zittere. Ich befürchte, nein, ich bin mir sicher, dass ich an Ort und Stelle ersticke. Mein Gott.«
»Was spüren Sie jetzt, wenn Sie daran denken?«
»Meine Brust ist furchtbar eng. Mein Herz pocht im ganzen Körper. Alles kribbelt.«
»Okay. Erzählen Sie weiter.«
»Ich weiß nicht, wie lange ich dort knie. Aber dann kommt dieser ältere Herr mit seinem Hund aus der Tür. Ich reagiere zunächst gar nicht. Er spricht mich an, berührt mich an der Schulter. Da macht es irgendwie klick, und ich komme zurück. Das ist das Ende der Geschichte. Puh. Ich habe es erzählt, von vorne bis hinten. Und das, ohne erneute Panik.«
»Ja, das haben Sie geschafft.«
»Ich bin bereit, weiterzumachen.«
»Okay. Gibt es in Ihren Erinnerungen ein einzelnes Bild, das den Moment der schlimmsten Belastung darstellt?«
»Da muss ich nicht lange nachdenken. Es sind die Gesichter der beiden Männer. Der Raubtierblick, während sie auf mich zukommen.«
»Welche Worte oder welcher Satz beschreibt Ihre Gefühle und Gedanken zu sich selbst am besten angesichts dieses Bildes?«
»Ich bin schwach und hilflos. Ich bin die Beute. Echt erbärmlich. Ich fühle mich ohnmächtig und habe Todesangst.«
»›Ich bin die Beute.‹ Okay. Wenn Sie sich noch mal die Männer mit dem Raubtierblick vorstellen: Was würden Sie aus heutiger Sicht gerne über sich denken und fühlen?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht: Ich habe es überstanden. Ich hatte keine Chance. Ich hätte mich schützen müssen. So etwas in der Art.«
»Wie wäre es mit: Ich habe es überstanden. Und ich kann lernen, mich zu schützen?«
»Ja, das passt besser.«
»Gut. Ich möchte Sie jetzt bitten, sich noch einmal an das Raubtierbild zu erinnern und die damit verbundenen Gefühle zuzulassen. Während Sie das tun, folgen Sie mit Ihrem Blick der Bewegung meines Zeige- und Mittelfingers vor Ihrem Gesicht.«
»Ich habe ehrlich gesagt etwas Angst davor. Was wird passieren?«
»Die rhythmischen Augenbewegungen helfen Ihrem Gehirn, die traumatischen Erfahrungen besser zu verarbeiten. In den meisten Fällen werden die Gefühle milder, die Erinnerungen verblassen. Manchmal verstärken sich die Emotionen kurzzeitig, und Sie müssen weinen oder spüren Angst, bevor es besser wird. Vielleicht fallen Ihnen Situationen aus Ihrem Leben ein, die ähnliche Gefühle ausgelöst haben wie der Überfall. Die werden wir dann später bearbeiten.«
»Okay, ich bin bereit.«
»Gut. Machen wir weiter.«
2
Es war ein kurzer Weg von der Praxis in der Altstadt bis runter zum Hafen. Eine Strecke, die Malte regelmäßig in seiner Mittagspause zurücklegte, selbst an trüben Tagen wie diesem. Graue Wolken hatten sich am Hamburger Mittagshimmel festgesetzt, für einen Tag im Juni war es viel zu kalt. Die Tourismusmeile rund um die Landungsbrücken präsentierte sich entsprechend lustlos einer überschaubaren Anzahl von Besuchern. Die Nachfrage nach Hafenrundfahrten, Helgolandtouren und Fischbrötchen hielt sich in Grenzen.
Dem Wetter zum Trotz war Malte bester Stimmung. Er freute sich über die Fortschritte seiner Patientin Hannah Weber. Sie hatte richtig gut auf die Therapiesitzung angesprochen und war erleichtert, fast schon fröhlich aus der Stunde gegangen. Wenn es so weiterging, konnte sie bald ihre Arbeit als Ergotherapeutin wieder aufnehmen, die sie aufgrund ihrer starken Ängste nach dem Raubüberfall aufgegeben hatte.
Malte stieg die Treppe hinunter zu den Schiffsanlegern, die er weitgehend für sich allein hatte, setzte sich auf einen der Poller unmittelbar an der Kaimauer und ließ den Blick über die Wellen des dahinplätschernden Elbwassers schweifen. Es war ein wenig so, als schickte er seinen Geist auf Reisen. Weg von seinen Patienten und der Arbeit als Psychotherapeut. Weg aus seiner Heimatstadt, weg aus dem Alltagsleben mit all den kleinen und großen Problemen.
Das Flusswasser hatte, wenn es hier vorbeiströmte, bereits eine Strecke von gut tausend Kilometern durch Tschechien und Deutschland zurückgelegt, und wenn es sich bei Cuxhaven in die Nordsee ergoss, ging der eigentliche Trip durch die Weltmeere erst los. Manchmal, wenn Malte den Kopf nicht frei bekam und die Last seiner eigenen oder der ihm zugetragenen Themen ihn über Gebühr quälte, stellte er sich Hunderte kleiner Papierschiffchen vor, auf die er seine emotionale Last verteilte, um sie mit dem Wasser davontreiben zu lassen.
Sein Mobiltelefon klingelte in der Jackentasche. Er zog es hervor, sah auf dem Display den Namen des Anrufers und ging ran.
»Hallo, Julius«, sagte er. »Willst du dich entschuldigen, weil du wochenlang nicht auf meine Nachrichten reagiert hast?«
»Ich ertrinke in Arbeit, wie immer.« Julius lachte gepresst. Das kurze Schweigen und der hörbar tiefe Atemzug ließen Malte aufhorchen. Der unbeschwerte Teil seiner Mittagspause endete vermutlich gerade.
»Du erinnerst dich vielleicht daran, wie du mal sagtest, ich hätte etwas gut bei dir«, sagte Julius. »Damals.«
»Natürlich erinnere ich mich.«
»Ich … ich möchte dich jetzt um einen Gefallen bitten.«
»Ich bin ganz Ohr.«
»Ich betreue anwaltlich einen jungen Mann. Er heißt Elias. Ich habe dir nie von ihm erzählt, aber er ist mir im Verlauf der Jahre ans Herz gewachsen. Er wird demnächst aus dem Gefängnis entlassen. Und ich fürchte, ohne psychotherapeutische Begleitung geht er innerhalb kürzester Zeit vor die Hunde. Würdest du ihn in Therapie nehmen?«
»Du weißt, dass ich schon lange nicht mehr mit Straftätern arbeite. Du weißt das besser als jeder andere.«
»Woraus du ermessen kannst, dass ich dich nicht leichtfertig um diesen Gefallen bitte. Er ist ein besonderer Junge. Ohne Hilfe hat er keine Chance. Aber genau die hat er verdient.«
»Was hat er denn angestellt?«, fragte Malte. Obwohl er es eigentlich gar nicht wissen wollte.
»Elias wurde zu zehn Jahren Jugendstrafe wegen Mordes verurteilt.« Julius schnaufte erneut in den Hörer. »Er hat seiner Schwester ein Küchenmesser ins Auge gestochen und sich anschließend die Pulsadern aufgeschnitten.«
»Puh!«, sagte Malte. Er spürte die emotionale Welle, die von der Geschichte ausging. Sein Freund Julius war in dieser Welle offenbar jahrelang tapfer mitgeschwommen.
Malte hätte sich nur zu gern davongeschlichen. Eine Ausrede aus dem Ärmel gezaubert, auf Zeit gespielt oder auf kompetente Kollegen verwiesen. Wenn er hart bliebe, würde Julius zurückrudern, was sollte der auch sonst tun?
Aber zur Wahrheit gehörte auch, dass der Anwalt in der Zeit, die er als ›damals‹ bezeichnete, ihm ohne Wenn und Aber beigestanden hatte. Malte konnte sein damaliges Versprechen nicht brechen. Nicht ohne gute Gründe. »Wie ist es zu der Tat gekommen?«, fragte er.
»Nun, ich könnte dir alles erzählen und dir Hunderte Aktenseiten zur Verfügung stellen«, sagte Julius, und Malte konnte sich den erleichterten Gesichtsausdruck seines Freundes bildlich vorstellen. »Oder du sprichst selbst mit ihm.«
3
Die Geschichte der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel reichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück, damals waren die roten Backsteingebäude errichtet und erstmals in Betrieb genommen worden. Während der NS-Zeit hatte ein Teil der Anlage den Nazis als Konzentrationslager gedient, inzwischen umfasste das weitläufige Areal im Norden Hamburgs mehrere Haftanstalten mit Einrichtungen für Regelvollzug, Sozialtherapie, Sicherungsverwahrung sowie ein eigenes Gefängniskrankenhaus.
Maltes persönliche Knastgeschichte war zeitlich deutlich überschaubarer: Er hatte hier knapp zehn Jahre als Anstaltspsychologe gearbeitet, bevor ein Gewaltverbrecher fast alles, was ihm lieb und teuer gewesen war, zerstört hatte.
Das war lange her, Malte hatte sich gefangen, die Wunden waren verheilt, gelegentlich schmerzten die Narben, doch damit kam er zurecht. Gleichwohl konnte er an einer Hand abzählen, wie oft er seitdem seine alte Wirkungsstätte aufgesucht hatte, in der das Verhängnis damals seinen Lauf genommen hatte.
Vor ihm öffnete sich die schwere Metalltür der ersten Sicherheitsschleuse. Die Frau hinter der Panzerglasscheibe kannte er nicht. Malte legte seinen Personalausweis in ein kleines Schubfach und sprach in die ins Glas integrierte Sprechanlage. »Ich bin Doktor Malte Fischer. Ich habe einen Gesprächstermin mit dem Häftling Elias Kandel. Der Termin ist mit Frau Geppert abgesprochen.«
Die Beamtin zog das Schubfach auf ihre Seite des Sicherheitsglases, sichtete den Ausweis, tippte etwas in die Tastatur ihres PCs, griff zum Telefon, redete kurz mit jemandem, sah dann zu ihm hoch. »Haus fünf. Kennen Sie den Weg?«, klang es aus dem Lautsprecher.
Malte nickte. Nur zu gut, dachte er. Er trat durch eine zweite Metalltür in einen von hohen, stacheldrahtbewehrten Mauern umgrenzten Hof. Vor ihm lag eines der Häuser für Langzeitgefangene. Sein Weg führte rechts daran vorbei. Auf einer Rasenfläche hinter einem hohen Drahtzaun kickte eine Handvoll Gefangener lustlos einen Ball hin und her und beachtete ihn nicht. Malte erreichte die Zugangstreppe eines weiteren Rotklinkerbaus.
Er wurde erwartet. Vanessa Geppert, eine frühere Kollegin, stand am oberen Ende des Treppenaufgangs und winkte ihm zu.
»Schön, dich zu sehen, Malte«, sagte sie, als er oben angekommen war. Sie umarmten sich. Und obwohl es eine kurze und unzweideutige kollegiale Geste war, fiel Malte auf, wie selten er in den Genuss körperlicher Nähe kam.
»Du siehst gut aus«, sagte Vanessa. »Deutlich besser als deine blassgesichtigen Ex-Kollegen, mich eingeschlossen. Die Arbeit in der eigenen Praxis scheint dir gutzutun.«
»Ja, ist super«, sagte er.
Vanessa führte ihn durch das Eingangsportal über eine weitere Sicherheitsschleuse in einen Vorraum, hinter dessen panzerverglaster Rückseite die Zellentrakte des Hauses zu sehen waren.
»Wie geht es Emma?«, fragte sie. »Wie alt ist sie jetzt? Sechzehn?«
»Siebzehneinhalb«, sagte er. »Hat im Frühjahr ihr Abi gemacht, ist jetzt frisch immatrikulierte Physikstudentin und vor zwei Wochen für ein Auslandssemester nach Liverpool gegangen. Sie macht sich prächtig.«
»Wow«, sagte Vanessa. »Das freut mich zu hören.«
»Und wie geht es dir und Helen?«
Sie erzählte kurz von sich und ihrer Partnerin, dem Kauf eines Ferienhauses an der Schlei und einem geplanten Rucksackurlaub in Thailand. Dann kam sie zum Grund seines Besuchs. »Elias Kandel wartet im Gutachterzimmer auf dich«, sagte sie. »Du willst den echt in Therapie nehmen?«
»Ich denke zumindest darüber nach.«
»Hast du seine Akte gelesen?«
Malte nickte. »Zum Teil. Ich bin mit seinem Anwalt befreundet, der hat mir einiges berichtet und Unterlagen zur Verfügung gestellt. Ich hatte noch keine Zeit, alles gründlich zu lesen. Wie ist denn dein Eindruck von ihm?«
Vanessa verzog das Gesicht zu einem Ausdruck voller Sorge und Skepsis. »Elias Kandel wurde vor knapp drei Jahren aus der Jugendhaft zu uns verlegt, seitdem haben wir uns die Zähne an ihm ausgebissen. Er hat einen IQ von hundertachtunddreißig, das weißt du sicherlich. Und er gilt als hochsensibel. Er hat das psychosoziale Team regelrecht in zwei Lager gespalten. Die einen halten ihn für einen hoch manipulativen Blender, der genau weiß, was er tut, und mit seiner Intelligenz und empathischen Begabung alle nach Strich und Faden verarscht. Die anderen sehen in ihm einen armen Jungen, der zeitlebens mit sich und seinem Leben überfordert war.« Sie zögerte einen Augenblick, bevor sie weitersprach. »Nur in einem sind sich alle einig.«
»Nämlich?«
»Dass er eine tickende Zeitbombe ist.«
Die Zeitbombe entpuppte sich als schmächtiger Mann mit wuscheligen blonden Haaren und blassem Gesicht. Die rot umränderten Augen verstärkten den Eindruck, dass dieser Junge in den langen Jahren der Inhaftierung erkennbar gelitten und nur mit Mühe durchgehalten hatte.
»Guten Tag«, sagte Malte. »Sie sind Elias Kandel, richtig?«
Der Angesprochene nickte. »Und Sie Doktor Fischer? Danke, dass Sie mit mir sprechen.«
Malte schloss die Tür des Besprechungszimmers, dessen Mobiliar aus zwei schlichten Lederstühlen an einem kleinen Tisch bestand. Ein vergittertes Fenster ließ etwas Sonnenlicht herein. Sie setzten sich.
»Ihr Anwalt Julius Kießling hat mich gebeten, Sie in Therapie zu nehmen.«
»Er glaubt, dass ich nach meiner Entlassung psychologische Hilfe brauche.« Der schwächlichen Erscheinung zum Trotz blickte Elias Kandel Malte neugierig ins Gesicht.
»Und?«, fragte Malte. »Hat Julius recht?«
Elias Kandel zuckte mit den Schultern. »Schon möglich.«
Malte unterdrückte ein Schmunzeln. Mehr Offenheit konnte er von dem jungen Mann fürs Erste offenbar nicht erwarten. »Wie ich hörte, haben Sie bereits einige Zeit mit Psychologen gearbeitet. Ist Ihrer Meinung nach etwas dabei herausgekommen?«
»Allesamt kompetente Leute, die versucht haben, mir weiterzuhelfen.« Kandel lächelte auf eine Weise, die Malte herablassend und selbstgefällig vorkam. Er fragte sich, wie viel vom Auftreten des jungen Mannes nur Show war und dem Versuch diente, seine Unsicherheit zu verbergen. Oder ob er wirklich so cool war, wie er tat. »Bis auf den einen vielleicht, Manfred Münch«, redete Kandel weiter. »Dem ging es vor allem um sich selbst. Der wollte mich knacken, um vor seinen Kollegen damit anzugeben.«
Malte zog die Augenbrauen hoch, was dem Gefangenen nicht entging. »Entschuldigen Sie«, sagte der, ohne dass sein Blick und seine Stimme etwas von dem Selbstbewusstsein einbüßten. »Vermutlich steht es mir nicht zu, über die Anstaltspsychologen zu urteilen. Aber ich habe da so gewisse Antennen.« Er neigte den Kopf. »Nach drei Sitzungen hat Münch es übrigens aufgegeben.«
Malte kannte den angesprochenen Psychologen. Und er konnte der Einschätzung des jungen Mannes komplett zustimmen. Ex-Kollege Münch war einer der wenigen Unsympathen aus dem alten Team. Ein unverkennbarer Narzisst. Allerdings hatte Malte deutlich länger gebraucht, um das herauszufinden. »Das scheint Ihnen zu gefallen«, sagte er. »Sie haben ihn geknackt, nicht umgekehrt.«
»Geht so. Zum Dank hat Münch mir eine krass miese Beurteilung in die Akte geschrieben.« Der belustigte Teil verschwand aus dem blassen Gesicht. »Ich bin seit fast zehn Jahren inhaftiert. Genau genommen sind es dreitausendsechshundertfünfundfünfzig Tage. Sieben Jahre Jugendknast, fast drei Jahre geschlossener Erwachsenenvollzug.«
Kandel beugte sich auf seinem Stuhl zu Malte herüber. »Ich habe die Fähigkeiten, sie alle an der Nase herumzuführen. Ich hätte mir einfach irgendeine Geschichte ausdenken können. Ein unentdecktes Kindheitstrauma aus meiner Grundschulzeit als Beginn einer tragischen Leidensgeschichte, die mich durch eine Verkettung unglücklicher Auslöser zu der Tat getrieben hat. Die ersten Erinnerungen daran hätte ich als Höhepunkt einer intensiven Sitzung mit einem der Anstaltspsychologen aus mir herausbrechen lassen können. Alle wären froh und erleichtert gewesen über meine vermeintliche Offenheit. Ich hätte ihnen vorspielen können, intensiv an meinen ungelösten Konflikten zu arbeiten und dabei Fortschritte zu erzielen. Sie hätten mir Lockerungen gegeben, eine vorzeitige Entlassung in Aussicht gestellt inklusive Vorbereitung auf das Leben nach dem Gefängnis. Ich wäre vermutlich nicht mehr in Haft, wenn ich es so gemacht hätte.« Er schüttelte den Kopf. »Warum sitzen wir also hier? Weil ich von Anfang an bei der Wahrheit geblieben bin.«
»Dass Sie sich nicht an die Tat erinnern können?«
»Ich habe meine Schwester Laura ermordet. Meine Adoptivschwester, genau genommen. Ich habe ihr ein Messer durchs linke Auge ins Gehirn gestoßen.« Er lehnte sich wieder zurück, seine Stimme klang jetzt dünn wie Seidenpapier. »Sie war fünfzehn Jahre alt.« Fast sah es aus, als legte sich ein feuchter Schimmer auf die Augen des jungen Mannes. »Nach der Tat habe ich mir die Pulsadern aufgeschnitten. Mit demselben Messer, mit dem ich sie getötet habe. So ist es gewesen. Das habe ich akzeptiert und nie bestritten. Es gibt keine andere logische Erklärung. Und trotzdem, ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ich wünschte, ich könnte es. Ich wünschte, ich könnte die Antwort liefern auf die Frage, die sich seitdem alle stellen: Warum hat Elias Kandel diesen schrecklichen Mord begangen?«
»Keine Idee?«, fragte Malte.
Der junge Mann blinzelte. Falls es einen Anflug von Tränen gegeben hatte, waren sie wieder verschwunden. »Natürlich. Dutzende. Sie sind alle psychologisch plausibel und könnten zutreffen. Aber ohne Erinnerung sind es bloße Theorien.«
»Der Psychiater, der Sie kurz nach der Tat begutachtet hat, ist von einer überschießenden Wutreaktion ausgegangen. Sie seien eifersüchtig auf Ihre Schwestern gewesen, weil diese immer wieder von Ihren Eltern bevorzugt wurden. Kann da was dran sein?«
»Der Gutachter war ganz in Ordnung. Ich verstehe, wie er auf diese Geschichte gekommen ist.«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage.«
Elias Kandel nickte. »Wissen Sie, ich habe mir immer vorgestellt, dass normale Eltern die meiste Zeit des Tages an ihre Kinder denken. Dass sie sich am Vormittag fragen, ob ihr Sohn in der Mathestunde mitkommt. Oder nachmittags, wie er sich mit den anderen Jungs in der Fußballmannschaft versteht. Eine innere Verbindung, die zu einem positiven Grundrauschen wird und dem Kind Kraft und Mut gibt, wann immer es in Not ist.«
»Eine schöne Vorstellung. In der Psychologie gibt es dafür das Wort Urvertrauen.«
»Ich kenne das Konzept. In der Theorie.«
»Ihre Lebenswirklichkeit war eine andere?«
»Ich hätte es als Kind nicht in Worte fassen können. Aber vor vielen Jahren, ich war gerade von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt, habe ich einen Bericht über die internationale Raumstation im Fernsehen gesehen. Es ging darum, dass die Außenhülle immer wieder undicht wurde und dass aus den Lecks die Atmosphäre der Station ins Vakuum des Weltalls entwich. Je größer das Loch, desto weniger Zeit blieb der Besatzung, um den Defekt aufzuspüren und zu flicken. Ich glaube, so habe ich mich gefühlt. Falls fühlen das richtige Wort ist. Ein Objekt in absoluter Leere, im Vakuum, in dessen Hülle immer wieder Löcher gerissen wurden, die ich flicken musste, bevor mir die Luft ausging.«
»Ein eindrucksvolles Bild. Und das verbinden Sie mit Ihren Eltern? Mit Ihren leiblichen oder Ihren Adoptiveltern?«
»Meine Adoptiveltern haben es sich irgendwann zur Aufgabe gemacht, mit immer neuen Nadelstichen meine Außenhülle zu durchlöchern und mir dabei zuzuschauen, wie ich verzweifelt versuche, die Lecks zu flicken. Aber dass ich mich überhaupt wie eine verlorene Kapsel im Weltraum fühlte, verdankte ich wohl meinen leiblichen Eltern.«
»Wissen Sie denn etwas über sie?«
»Ich weiß, dass sie mich nicht wollten. Mein Vater war Junkie, meine Mutter hatte eine Borderline-Störung. Sie sind früh gestorben, und ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe mal einen Text von einem deutschen Psychoanalytiker gelesen. Er hat vom Glanz in den Augen der Mutter beim Betrachten ihres Säuglings gesprochen als die vielleicht wichtigste Grundlage in der seelischen Entwicklung eines Kindes. Der Blick meiner leiblichen Mutter, so habe ich es mir unendlich oft vorgestellt, hat sich bereits Sekunden nach meiner Geburt für immer von mir abgewandt. Falls er mich überhaupt je berührt hat.«
»Wann haben Sie erfahren, dass Sie adoptiert wurden?«
»Ich kann mich nicht an den einen Moment erinnern, an dem meine Adoptiveltern es mir erzählt haben. Es ist eher so, als hätte ich es immer schon gewusst. Oder zumindest gespürt.«
»Warum haben die sich Ihnen gegenüber so feindselig verhalten?«
Elias Kandel verzog das Gesicht. »Kennen Sie das Gefühl, dass Sie etwas unbedingt haben wollen? Und kurze Zeit nachdem Sie das Begehrte endlich bekommen haben, merken, dass Sie sich getäuscht haben?«
Eine offensichtlich rhetorische Frage. Malte schwieg und wartete, dass der junge Mann weitersprach.
»So ging es meinen Ersatzeltern mit mir. Meine Adoptivmutter ist, wenige Monate nachdem die Adoption rechtskräftig vollzogen war, entgegen allen medizinischen Prognosen schwanger geworden. Mit Zwillingen. Neun Monate später hatten die beiden, was sie sich immer gewünscht hatten – leibliche Kinder. Nicht nur eins, sondern gleich zwei. Noch dazu zwei zum Niederknien süße Töchter mit Goldlöckchen und sonnigem Temperament. Aber dann gab es da noch mich. Einen stillen, überempfindlichen Jungen, der viel weinte, schlecht schlief und dem man es kaum recht machen konnte. Hätten sie mich ohne viel Aufhebens zurückgeben oder entsorgen können – ich bin sicher, sie hätten es getan.«
»Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Familienleben. Wie ist es bei Ihnen zu Hause zugegangen?«
»Mein Vater war nie da. Ich nehme an, Sie wissen, dass er leitender Oberstaatsanwalt war. Seine Arbeit lief wie ein stummer Begleiter immer neben ihm her. Er war durchgängig im Dienst. Er trug nicht nur eins, sondern gleich zwei empfangsbereite Handys bei sich. Es vergingen selten mehrere Stunden am Stück, in denen nicht mindestens eines der beiden klingelte. Wahrscheinlich haben sie ihm die Dinger mit ins Grab gelegt.«
»Er ist tot?«, fragte Malte.
»Vor vier Jahren gestorben. Herzinfarkt, wie es sich gehört für einen Workaholic. Die drei hatten da schon länger in Kapstadt gelebt und den Kontakt zu mir komplett abgebrochen.« Kandel zuckte mit den Schultern. »Meine Adoptivmutter hat immer gesagt, dass es genau drei wichtige Dinge gibt im Leben meines Vaters: die Arbeit, die Arbeit und die Arbeit. Dann kommt lange nichts. Dann irgendwann sie und die Zwillinge. Sie hatte sich damit arrangiert, was hätte sie auch tun sollen? Sie hat sich um den Haushalt und uns Kinder gekümmert, sich nebenher in der Schule und der Kirchengemeinde engagiert. Laura und Melissa waren die strahlenden Mittelpunkte ihres Lebens. Meine Rolle hat sich von der des schwarzen Schafs zum Sündenbock weiterentwickelt. Ich war überempfindlich, kam in der Schule nicht zurecht, fand keinen Anschluss zu Gleichaltrigen. Eben das typische Schicksal von Kindern, deren Hochbegabung nicht oder zu spät erkannt wird.« Elias schwieg einen Moment, presste die Lippen aufeinander, suchte Maltes Blick. »Also, ja. Eigentlich hatte ich allen Grund, auf die Zwillingsmädchen eifersüchtig zu sein.«
»Waren Sie es denn?«
»Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich für die beiden empfunden habe. Ich mochte sie, glaube ich. Vor allem Laura war sehr sanftmütig, sensibel. Ich verbrachte gerne Zeit mit ihr. Ich glaube, sie war der einzige Mensch auf der Welt, dem ich mich je nahe gefühlt habe.«
»Mmh.« So recht schlau wurde Malte nicht aus dem, was der junge Mann ihm präsentierte. Eine üble Biografie, keine Frage, die Anlass bot für eine ganze Palette an miesen Gefühlen: allen voran Trauer, Wut, Neid und Eifersucht, dahinter Verzweiflung, Verbitterung, innere Leere und existenzielle Angst. Das Problem war: Von alldem war so gut wie nichts zu spüren. Elias Kandel erzählte seine Lebensgeschichte plastisch und bildreich, aber mit einer emotionalen Distanz, als spräche er über den Protagonisten eines langweiligen Romans. Malte nahm ihm die Coolness nicht ab. Der junge Mann versteckte seine Gefühle, absichtlich oder unbewusst. Vermutlich, weil sie ihn massiv überforderten. »Waren Sie verliebt in Laura?«, fragte er.
Kandel schüttelte den Kopf, schien aber nicht sonderlich überrascht über die Frage. Malte war sicher nicht der Erste, der sie ihm stellte. »Sie war meine Schwester.«
»Adoptivschwester wohlgemerkt. Sie waren nicht leiblich verwandt.«
Er zuckte mit den Schultern. »Wissen Sie, das ist genau mein Problem. Ich gelte als hochsensibel. Ich rieche und höre Dinge intensiver, erspüre die Stimmungen und Emotionen anderer auf eine Weise, die vielen unheimlich ist. Meine Antennen sind immer auf Maximalempfang eingestellt, ob ich nun will oder nicht. Ich kann in den meisten Menschen lesen wie in einem offenen Buch. Aber meine eigenen Gefühle bleiben mir verschlossen. Die Wahrheit ist: Ich weiß überhaupt nicht, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Genauso wenig kenne ich Eifersucht oder Neid. Ich habe gelitten, keine Frage. Aber Eifersucht oder Neid? Keine Ahnung.«
»Welche Gefühle kennen Sie denn?«
»Angst. Manchmal regelrechte Panik. Wenn ich aus einem Albtraum erwache oder wenn mich jemand bedroht. Hier im Knast habe ich ständig Angst. Beim Essen, beim Hofgang, es fühlt sich an, als ob meine Eingeweide unter Dauerstrom stünden. Es gibt hier einen Haufen Typen, die mich auf dem Kieker haben. Aber alle sonstigen Gefühle …«
»Traurigkeit? Mitleid oder Freude? Unsicherheit? Scham? Oder Wut?«
»Ich spüre das bei anderen, aber nicht bei mir selbst. Manchmal versuche ich, es mir einzureden. Dass ich mich freue, traurig bin, wütend und so. Aber eigentlich ist da nichts.«
Malte nickte. Schwieg.
»Was glauben Sie? Als Experte. Was stimmt nicht mit mir?« Der junge Mann neigte den Kopf zur Seite.
Derselbe Schachzug, dachte Malte. Kandel spielte ihm den Ball zu, um ihn aus der Reserve zu locken, und blieb selbst in Deckung. Nun, dieses Spiel beherrschte er auch. »Sie sind von zig Psychologen und Psychiatern begutachtet worden«, sagte er. »Ich nehme an, Sie haben die Gutachten und die Einschätzungen gelesen. Was glauben Sie selbst?«
»Es war alles dabei: Autismus, schizoide Persönlichkeit. Psychopathische Gefühlskälte. Extreme Verdrängung aufgrund frühkindlicher Traumata bis hin zur dissoziativen Identitätsstörung. Letztlich konnte mir keiner der Experten sagen, ob ich meine Gefühlswelt tief in mir vergrabe – oder ob ich schlicht keine Gefühle habe.«
Malte nickte, und es entstand ein spontanes Schweigen, in dem die beiden sich musterten und Malte sich fragte, ob Elias Kandel auch in ihm lesen konnte wie in einem offenen Buch. Falls ja, dachte er, würde er Neugierde gepaart mit Skepsis und Misstrauen vorfinden. Und darunter, nun ja, Malte wollte es sich selbst kaum zugestehen, eine gute Portion Sympathie. Irgendwie mochte er diesen forschen, klugen und dabei tief im Innern so hilflosen jungen Mann. Nach einigen Sekunden des Schweigens sah Malte auf seine Armbanduhr. Wohl wissend, dass sein Gesprächspartner dies bemerken und als Signal für das nahende Ende ihres Gesprächs interpretieren würde.
»Haben Sie sich entschieden?«, fragte der mit einem Ausdruck dreister Neugierde im Gesicht. »Nehmen Sie mich in Therapie?«
Malte schüttelte langsam den Kopf, schwieg weiter. Kandels Mimik blieb unbewegt. »Das ist nicht die entscheidende Frage«, sagte er.
»Sondern?«
»Sie kommen frei, das steht fest. Morgen verlassen Sie dieses Gefängnis, dann können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Julius wird Sie unterstützen, sich im Alltag zurechtzufinden. Die Frage ist, was Sie darüber hinaus in einer Therapie erreichen wollen.«
Kandel presste die Lippen aufeinander, nickte. »Ich habe meine Schwester umgebracht. Und beinahe mich selbst.« Erneut bildete sich dieser feuchte Schimmer in seinen Augen, und Malte fragte sich, ob die Rührung echt oder nur sehr gutes Schauspiel war. »Ich habe gelernt, das als Teil meiner Vergangenheit zu akzeptieren. Jetzt kann ich nach vorne sehen. Ich will leben, verstehen Sie? Eine zweite Chance. Mein Psychologiestudium abschließen, das ich an einer Fernuni begonnen habe. Leute kennenlernen, die keine Knastis sind.« Er wandte sein Gesicht in Richtung des vergitterten Fensters. »Ich habe keine Ahnung, wie ich draußen zurechtkomme. Leicht wird es sicher nicht.« Kandel verzog das Gesicht zu einem bitteren Grinsen. »Umbringen kann ich mich zur Not immer noch. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage wäre. Sterben kann ich allein. Aber beim Leben brauche ich Ihre Hilfe.«
4
Freya Svensson starrte an den Deckenventilator. Er lief auf der niedrigsten Stufe, so langsam, dass sie mit den Augen der Bewegung der einzelnen Blätter folgen konnte. Der Luftzug, den er erzeugte, war kaum der Rede wert. Aber der Anblick und das leise Geräusch beruhigten sie, wenn sie mitten in der Nacht erwachte, das blasse Licht der Laterne unten an der Straße durch ihr Schlafzimmer waberte und die Zeit stillzustehen schien. Die verlässliche, nicht endende Drehung half ihr dabei, ihre Gedanken einzufangen, die sich in alle möglichen Richtungen davonschleichen wollten.
Neben ihr bewegte sich etwas.
Ach ja, der Typ. Marc oder Mario oder so. Sie drehte den Kopf. Marc oder Mario lag auf der Seite, das Gesicht ihr zugewandt, sodass seine Atemluft über ihre Wangen und Lippen strich und das Aroma des Whiskys, den sie zusammen gekippt hatten, in ihre Nase trug. Seine Lippen waren einen Hauch geöffnet und zu einem seligen Lächeln verzogen.
Schlecht waren beide nicht gewesen. Weder der Whisky noch der Typ. Aber so zuverlässig, wie der Whisky-Geschmack im Mund mit zunehmender Nüchternheit immer bitterer wurde, verwandelten sich die hübschen Jungs, die sie in ihrer Stammbar kennenlernte und nach einer Handvoll Drinks immer wieder mal mit nach Hause und in ihr Bett nahm, in lästige Fremdkörper.
Dieser hier fing gerade an zu schnarchen. Das Geräusch erinnerte sie unangenehm an sein verhaltenes Stöhnen, als er vorhin gekommen war.
»Hey!« Sie stupste ihm mit dem Ellbogen in die Seite und ließ ihm ein paar Sekunden Zeit, aufzuwachen und sich zu orientieren.
»Freya.« Er hatte sich ihren Namen gemerkt. Natürlich, das passte zu ihm. Er lächelte sie an, wollte den Arm um sie legen und sich an sie kuscheln, in völliger Verkennung der Situation.
»Feierabend«, sagte sie, und das Wort vertrieb das Lächeln schneller aus seinem Gesicht, als es jeder Faustschlag vermocht hätte. »Ich will, dass du gehst.«
»Freya, was …«
»Sofort.« Sie setzte sich auf. Das Bettlaken fiel von ihr ab, sie verschränkte die Arme über ihrem nackten Busen.
Marc oder Mario starrte sie an, schüttelte den Kopf. Aber dann schälte er sich unter der Decke hervor, sammelte seine Klamotten vom Fußboden zusammen und begann sich anzuziehen.
»Sollen wir reden?«, fragte er. »Ist etwas nicht in Ordnung?«
Der arme Tropf war echt hartnäckig, dachte sie. Sie tat ihm unrecht, das war ihr durchaus klar, und tief im Inneren schämte sie sich für die kalte Abfuhr, die sie ihm verpasste. Marc oder Mario war ein netter Typ. Aufmerksam, freundlich, selbst mit ihrem bitterbösen Humor war er fertiggeworden. Er sah gut aus. Schlank und auf eine natürliche Weise muskulös, nicht so künstlich aufgepumpt wie diese Gockel, die immer um sie herumscharwenzelten, wenn sie sich in einer Bar blicken ließ. Auch im Bett war er okay gewesen, ziemlich okay sogar, von dem schnarchigen Gestöhne mal abgesehen. Er hatte sie erst zärtlich verwöhnt und genau im richtigen Moment auf eine härtere Gangart hochgeschaltet.
»Nein. Verschwinde einfach.«
»Soll ich …«
»Nein. Melde dich nicht bei mir. Und komm nie wieder hierher.«
Der Bursche sah ein, dass sie ihn nicht verarschte und eigentlich nur noch eins von ihm erwartete. Und das tat er. Sie hörte ihm zu, wie er barfuß durch den Flur tapste, die Wohnungstür öffnete und hinter sich schloss. Schuhe und Socken zog er sich offenbar erst im Treppenhaus an, vielleicht unten vor der Haustür, egal, Hauptsache, er war weg.
Sie sah kurz auf ihr Handy. Drei Uhr dreißig, also blieben ihr ein paar Stunden Schlaf. Die sollten reichen, um sowohl den Anflug von Kater als auch die Erinnerung an Marc oder Mario aus ihrem Gehirn zu vertreiben.
5
»Hab ich was verpasst? Beginnt unsere Arbeit neuerdings um zehn statt um acht?«
Freya kniff die Augen zusammen. Zumindest das mit der Erinnerung an den Typen, neben dem sie aufgewacht war, hatte mehr oder weniger geklappt. Sie nippte an ihrem Kaffee und versuchte sich vorzustellen, wie das Koffein mit dem Blut ins Gehirn strömte und dort die elenden Kopfschmerzen wegspülte. »Ich habe beschissen geschlafen, okay?«
»Schon das vierte Mal in diesem Monat«, setzte Tom nach. Er stand im Türrahmen, der den Flur mit der kleinen Küche verband. »Und der ist noch nicht Mal zur Hälfte rum.« Er kam herein, trat neben sie vor den Kaffeeautomaten, stellte eine eigene Tasse unter den Auslauf und drückte auf die Cappuccino-Taste. Er grinste, immerhin. Tom wusste besser als die meisten anderen, dass man ihr in dieser Verfassung nicht mit ernst gemeinten Ermahnungen kam.
Das Mahlwerk des Vollautomaten machte sich an die Arbeit, und Freya wartete, bis der Krach vorbei war. »Ich geh mal davon aus, dass du mich angerufen hättest, wenn was Dringendes passiert wäre.«
»Der Chef hat nach dir gefragt«, sagte Tom. »Ist das dringend genug?«
Sie schielte über den Rand ihrer Kaffeetasse in seine Richtung. »Und? Was hast du ihm gesagt?«
»Dass du zur Nachbefragung eines Zeugen unterwegs bist. Im Steinhöfer-Fall.« Die Maschine war fertig mit der Arbeit. Tom nahm seine Tasse, schlürfte am Cappuccino und leckte sich mit der Zunge einen Rest Milchschaum von der Oberlippe.
»Der ist abgeschlossen, die Akte liegt beim Staatsanwalt. Das müsste der Chef eigentlich wissen.« Ob es der Kaffee war oder nur ihre Einbildung: Die Kopfschmerzen ließen tatsächlich etwas nach.
»Ich glaube, er hat es geschluckt.«
»Danke«, sagte Freya.
»Aber ich habe echt keinen Bock, immer wieder für dich zu lügen.«
»Verstanden«, sagte sie. »Dafür hast du was gut bei mir.«
»Wie wär’s mit einem Feierabendbier?«
Freya senkte die Kaffeetasse, neigte den Kopf und musterte ihren Kollegen. Sie arbeiteten seit acht Monaten zusammen in der Sondereinheit. Tom war ein anständiger Kerl, keine Frage. Zehn Jahre älter als sie, nicht unwitzig, so zuverlässig und wartungsarm wie diese Kaffeemaschine – und leider ähnlich facettenreich. Er ging fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, sah entsprechend durchtrainiert aus. Er hatte ein etwas schräges Faible für Fantasy-Rollenspiele, trieb sich am Wochenende mit anderen Spinnern mittelalterlich kostümiert im Wald herum. Und das war es dann auch.
»Glaub mir. Du willst viel lieber mein hochgeschätzter Kollege sein als ein weiteres Grab auf dem Friedhof meiner gescheiterten Dates.«
»Darauf würde ich es ankommen lassen.«
»Du schon.« Sie kippte den letzten Schluck Milchschaum hinunter. »Und, steht was Besonderes an?«, fragte sie.
Tom schüttelte den Kopf. Er ließ sich nicht anmerken, ob die Abfuhr ihn gekränkt hatte. Vermutlich nicht allzu sehr, dachte sie. Es war schließlich nicht die erste.
»Ein paar Aktensachen, mehr nicht.« Er leerte seine Tasse. »Vorher einen zweiten Kaffee?«
»Ach, hier sind Sie. Und sogar Frau Svensson ist eingetrudelt. Schön, dass Sie gelegentlich die Zeit finden, hier vorbeizuschauen.«
Freya drehte sich um. In der Tür zur kleinen Küche stand Kai Sievers, ihr Chef. Wie üblich mit Nikotinfahne, nachlässig rasiert und mit Jeans, Rollkragenpulli und Allerweltssakko bekleidet. Er hatte die Hände in die Hüften gestemmt.
»Ich war heute Morgen zu einer …«
»Sparen Sie sich diesen Mist!«, sagte Sievers. »Sie beide müssen los. Ein Zivilfahnder hat Aktivitäten an einem der von uns überwachten Objekte beobachtet. Ich möchte, dass Sie dort hinfahren.«
»Wo ist es?«, fragte Freya.
»Jonischkies Gebrauchtwagen in Billwerder. Ein stillgelegtes Betriebsgelände. Sie fahren hin, sehen sich um.«
Tom streckte den Rücken durch. Freya nickte.
Der Blick des Chefs fiel auf den Kaffeeautomaten. Er griff hoch zum Regal und fischte sich eine Tasse heraus. »Falls Sie auf verdächtige Personen stoßen, schießen Sie Fotos. Aber greifen Sie auf keinen Fall ein.«
6
»Guten Morgen, meine Kleine!«
»Hi, Dad!«
Vormittags um kurz nach zehn. Für seine Tochter eine ungewöhnliche Zeit, um zu Hause anzurufen. Aber Emmas Stimme klang fröhlich, und Malte freute sich über das unverhoffte Lebenszeichen. Er klemmte sein Handy mit der linken Schulter ans Ohr und trocknete sich die Hände an einem Geschirrhandtuch ab.
»Passt es gerade?«, fragte sie.
»Klar. Ich beseitige das gröbste Chaos in der Küche, bevor ich in die Praxis fahre. Ich muss gestehen, es ist eher unordentlicher geworden, seit du nicht mehr hier bist.«
Emma lachte. »Du schaffst das schon, Daddy! Ich wollte dich etwas fragen«, sagte sie und kam damit zum Grund ihres Anrufs. Malte warf das Handtuch neben die Spüle, nahm das Handy in die linke Hand und griff mit der rechten nach der vollen Teetasse, die schon beim Wasserkocher wartete. Er trank einen Schluck, während Emma weitersprach. Es ging um irgendeine Bescheinigung für ihre Auslandskrankenversicherung. Kein Problem, er würde sich drum kümmern. Wie es bei ihm laufe, wollte sie wissen, und weil ihr seine oberflächliche Antwort offenbar nicht reichte, wurde sie konkreter: »Mit den Dates, meine ich.«
Ungewohnt, mit der eigenen Tochter über seinen Beziehungsstatus, besser gesagt Nicht-Beziehungsstatus zu reden. Aber Emma war zu einer aufgeweckten und emanzipierten jungen Frau herangewachsen und hatte sich von seinem kleinen Mädchen zu einer gleichberechtigten und ernsthaften Gesprächspartnerin gemausert. Außerdem war sie es gewesen, die ihn vor einigen Wochen überredet hatte, sich bei einem dieser Dating-Portale anzumelden.
»Es hat sich nichts ergeben«, sagte er. »Diese Ärztin hat mehr nach einer Vaterfigur respektive einem Therapeuten gesucht als nach einem Partner. Sie hat sich nicht mehr gemeldet, nachdem ich das angedeutet hatte. Und mit der Buchhändlerin hat die Chemie nicht gestimmt, wir hatten uns schon am zweiten Abend nichts mehr zu sagen. Aktuell schreibe ich mit einer Apothekerin. Aber ehrlich gesagt ist mir das Rumgedate ein bisschen über.«
»Nicht aufgeben, Daddy. Früher oder später ist die Richtige dabei. An mangelndem Charme scheitert es sicher nicht.«
»Lieb von dir!«, sagte er. »Und wie läuft es bei dir? So insgesamt?«
Emma erzählte vom Beginn ihres Studiums, ihren Mitbewohnerinnen und Kommilitonen und ihren durchwachsenen ersten Eindrücken von Liverpool. Sie lebte sich ein, hatte nette Menschen um sich herum, kam zurecht. Lauter Dinge, die ein Vater gerne von seiner Tochter hörte. Emma war endgültig flügge geworden und aus dem Nest geflogen.
Unwillkürlich war Malte mit Handy und Teetasse in den Händen durch den Flur bis vor die geöffnete Tür von Emmas Zimmer getrottet. Er blieb dort stehen, auch nachdem sie sich verabschiedet und das Gespräch beendet hatten. Der Raum sah aus wie immer. Als wäre sie nur übers Wochenende zu einer Freundin nach Berlin gefahren. Und nicht für ein halbes Jahr nach England gegangen.
Er fühlte sich einsam in der Altbauwohnung, wurde ihm klar. Er vermisste seine Tochter jeden Tag und freute sich von Herzen, ihre Stimme zu hören und sie spätestens in den Semesterferien im Herbst wiederzusehen, wenn er sie in England besuchen würde. Und trotzdem, er mochte es sich kaum eingestehen, war er gleichzeitig erleichtert darüber, dass sie weggegangen war. Seit er und Emma hier vor knapp fünf Jahren eingezogen waren, hatte über ihrem Zusammenleben der graue Schleier des Verlustes gelegen, den sie erlitten hatten. Sie waren die Übriggebliebenen. Die, die überlebt hatten. Emma war gerade mal zwölf Jahre alt gewesen, als sie ihre Mutter und ihren Bruder verloren hatte. Doch bereits nach ein paar Wochen, als Schmerz und Trauer die Taubheit und Lähmung abgelöst hatten, hatte Malte gewusst, dass sie besser mit dem Verlust zurechtkommen würde als er. Das Leben lag vor ihr. Sie würde früh fortgehen aus Hamburg, das hatte er damals schon geahnt, neue Leute kennenlernen, den grauen Schleier abwerfen und ihr Leben in die eigenen Hände nehmen.
Emma hatte offengelassen, ob sie nach dem Englandsemester zu ihm zurückkehren und in Hamburg weiterstudieren wollte. Vermutlich wussten sie beide, dass es dazu nicht kommen würde.
Und er? Er musste, nachdem ihm Frau und Sohn entrissen worden waren, jetzt auch seine Tochter loslassen. Freiwillig und mit einem tapferen Lächeln auf den Lippen. Das war Teil der Jobbeschreibung als Vater, und er würde es erledigen, so gut er konnte. Aber er spürte immer häufiger, wie die Angst vor der Einsamkeit nach ihm griff. Klar hatte er seine Arbeit, ein paar Freunde und vertraute Kollegen. Doch gab es diesen bestimmten Bereich in seinem Leben, den er nur mit Bettina geteilt hatte. Und der seit ihrem gewaltsamen Tod zusehends verkümmerte.
Vielleicht bot Emmas Weggang auch ihm die Chance, den grauen Schleier wegzureißen.
Malte schloss die Tür zu Emmas Zimmer, ging durch den Flur zurück in die Küche. Er hatte noch eine knappe Stunde Zeit, bevor er sich in die Praxis aufmachen musste. Zeit genug, um sich mit einem zweiten Tee und ein paar Nachrichten auf andere Gedanken zu bringen. Er goss sich einen frischen Earl Grey auf, griff sich den Tabletcomputer und setzte sich an den Küchentisch, überflog die Nachrichtenseite der Hamburger Tageszeitung und blieb an einer groß aufgemachten Überschrift hängen:
Gefährlicher Mörder kommt auf freien Fuß.
Elias Kandel hatte es samt pixeligem Foto in die Schlagzeilen geschafft. Der Artikel beschrieb die Lebensgeschichte des verurteilten Mörders, sparte nicht an den schrecklichen Details der Tat und betonte mit Verweis auf diverse Gutachten dessen vermeintliche Gefährlichkeit, bevor der Text die alle paar Jahre wiederaufflammende Diskussion über den Umgang mit gefährlichen Straftätern aufgriff.
Malte strich sich mit der Hand übers Kinn. Elias Kandel hatte sich im Gespräch über weite Strecken selbstbewusst, fast schon unnahbar präsentiert. Malte hatte ihm das keine Sekunde abgenommen und konnte erahnen, wie sehr der mediale Pranger dem sensiblen jungen Mann zusetzen musste. Und gleichzeitig traf der Artikel genau den wunden Punkt: Elias Kandel hatte gemordet. Aus Gründen, die er bisher für sich behalten hatte. Die ihm vielleicht selbst nicht zugänglich waren. Die irgendwo in den verborgenen Tiefen seines Unbewussten lauerten und erneut hervorbrechen konnten.
Malte hatte ihm einen Termin für morgen gegeben, dem Tag nach seiner Entlassung. Fast hoffte er, dass Kandel einen Rückzieher machte, gar nicht erst zur Therapie erschien und Malte so von der Verantwortung entband, die er mit seinem Angebot auf sich genommen hatte. Doch falls Kandel den Termin wahrnahm, dachte Malte, hätte der hochsensible junge Mann überaus bewegte erste Stunden in Freiheit hinter sich.
7
Alles war zu viel: Das Sonnenlicht brannte in Elias’ Augen. Das Geräusch eines beschleunigenden Lastwagens dröhnte in den Ohren und ließ seine Schädelknochen vibrieren. Selbst der laue Sommerwind, der erschöpft durch die Straße seufzte, fühlte sich unangenehm an. Zu warm, zu nah, wie eine schwitzige Umarmung.
Am liebsten wäre er umgekehrt. Schnell wieder raus aus der Welt, die sich in den letzten zehn Jahren unermüdlich ohne ihn weitergedreht hatte.





























