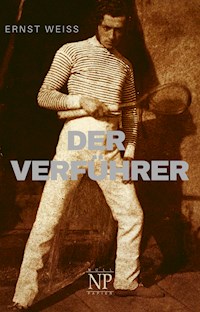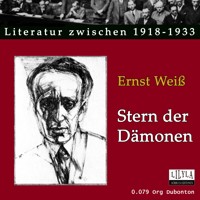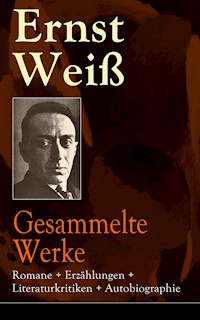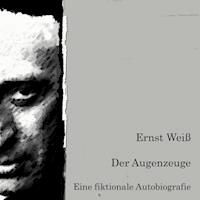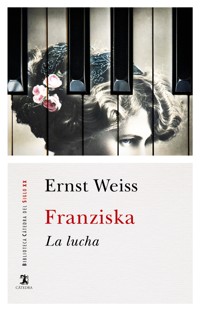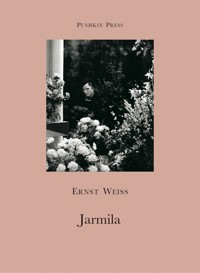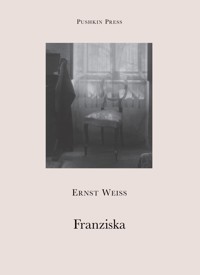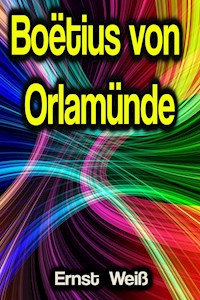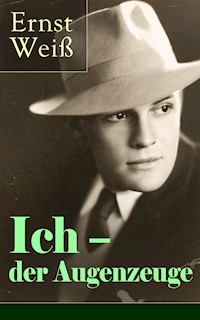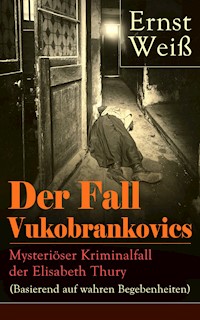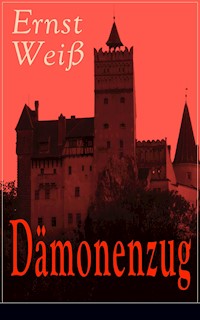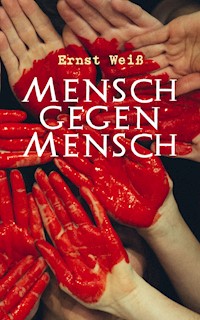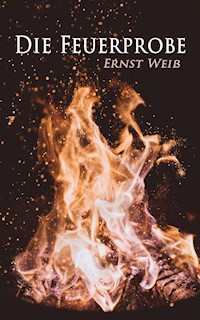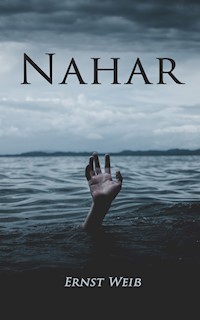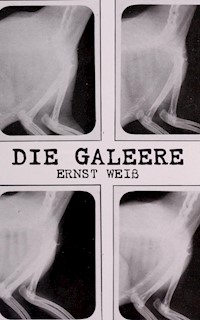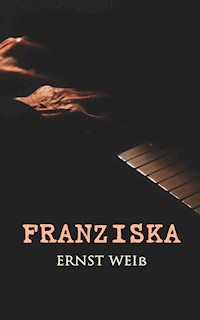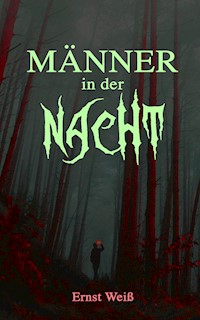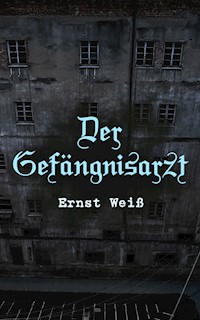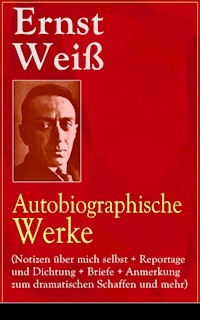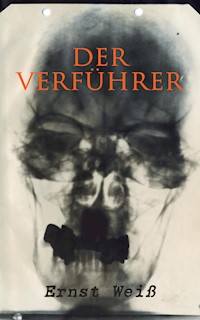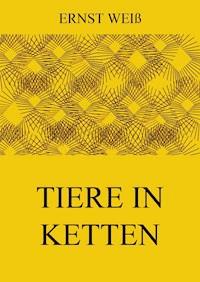
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Tiere in Ketten" erzählt die Geschichte der Prostituierten Olga, die von ihrem Zuhälter abserviert wird und mit ihren Habseligkeiten in die Heimat aufbricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tiere in Ketten
Ernst Weiß
Inhalt:
Ernst Weiß – Biografie und Bibliografie
Tiere in Ketten
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Dritter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Vierter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Tiere in Ketten, Ernst Weiß
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639662
www.jazzybee-verlag.de
Ernst Weiß – Biografie und Bibliografie
Österreichischer Arzt und Schriftsteller, geboren am 28. August 1882 in Brünn, verstorben am 15. Juni 1940 in Paris. Der aus einer jüdischen Familie stammende Weiß war der Sohn des Tuchhändlers Gustav Weiß und dessen Ehefrau Berta Weinberg. Am 24. November 1886 starb der Vater. Trotz finanzieller Probleme und mehrfacher Schulwechsel (unter anderem besuchte er Gymnasien in Leitmeritz und Arnau) bestand Weiß 1902 erfolgreich die Matura (Abitur). Anschließend begann er in Prag und Wien Medizin zu studieren. Dieses Studium beendete er 1908 mit der Promotion in Brünn und arbeitete danach als Chirurg in Bern bei Emil Theodor Kocher und in Berlin bei August Bier.
1911 kehrte Weiß nach Wien zurück und fand eine Anstellung im Wiedner Spital. Aus dieser Zeit stammt auch sein Briefwechsel mit Martin Buber. Nach einer Erkrankung an Lungentuberkulose hatte er in den Jahren 1912 und 1913 eine Anstellung als Schiffsarzt beim österreichischen Lloyd und kam mit dem Dampfer Austria nach Indien, Japan und in die Karibik.
Im Juni 1913 machte Weiß die Bekanntschaft von Franz Kafka. Dieser bestätigte ihn in seiner schriftstellerischen Tätigkeit, und Weiß debütierte noch im selben Jahr mit seinem Roman Die Galeere.
1914 wurde Weiß zum Militär einberufen und nahm im Ersten Weltkrieg als Regimentsarzt in Ungarn und Wolhynien teil. Nach Kriegsende ließ er sich als Arzt in Prag nieder und wirkte dort in den Jahren 1919 und 1920 im Allgemeinen Krankenhaus.
Nach einem kurzen Aufenthalt in München ließ sich Weiß Anfang 1921 in Berlin nieder. Dort arbeitete er als freier Schriftsteller, u.a. als Mitarbeiter beim Berliner Börsen-Courier. In den Jahren 1926 bis 1931 lebte und wirkte Weiß in Berlin-Schöneberg. Am Haus Luitpoldstraße 34 erinnert daran eine Gedenktafel. Im selben Haus wohnte zeitweise der Schriftsteller Ödön von Horváth, mit dem Weiß eng befreundet war.
1928 wurde Weiß vom Land Oberösterreich mit dem Adalbert-Stifter-Preis ausgezeichnet. Außerdem gewann er im selben Jahr bei den Olympischen Spielen in Amsterdam eine Silbermedaille im Kunst-Wettbewerb.
Kurz nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 verließ er Berlin für immer und kehrte nach Prag zurück. Dort pflegte er seine Mutter bis zu deren Tod im Januar 1934. Vier Wochen später emigrierte Weiß nach Paris. Da er dort als Arzt keine Arbeitserlaubnis bekam, begann er für verschiedene Emigrantenzeitschriften zu schreiben, u.a. für Die Sammlung, Das Neue Tage-Buch und Maß und Wert. Da er mit diesen Arbeiten seinen Lebensunterhalt nicht decken konnte, unterstützten ihn die Schriftsteller Thomas Mann und Stefan Zweig.
Ernst Weiß letzter Roman Der Augenzeuge wurde 1939 geschrieben. In Form einer fiktiven ärztlichen Autobiographie wird von der „Heilung“ des hysterischen Kriegsblinden A.H. nach der militärischen Niederlage in einem Reichswehrlazarett Ende 1918 berichtet. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wird der Arzt, weil Augenzeuge, in ein KZ verbracht: Sein Wissen um die Krankheit des A.H. könnte den Nazis gefährlich werden. Um den Preis der Dokumentenübergabe wird „der Augenzeuge“ freigelassen und aus Deutschland ausgewiesen. Nun will er nicht mehr nur Augenzeuge sein, sondern praktisch-organisiert kämpfen und entschließt sich, auf der Seite der Republikaner für die Befreiung Spaniens und gegen den mit Nazideutschland politisch verbündeten Franquismus zu kämpfen.
Als Weiß am 14. Juni 1940 den Einmarsch der deutschen Truppen in Paris von seinem Hotel aus miterleben musste, beging er Suizid, indem er sich in der Badewanne seines Hotelzimmers die Pulsadern aufschnitt, nachdem er Gift genommen hatte. Im Alter von 57 Jahren starb Ernst Weiß am 15. Juni 1940 im nahegelegenen Krankenhaus.
Wichtige Werke
Die Galeere, Roman, S. Fischer, Berlin 1913Der Kampf, Roman, S. Fischer, Berlin 1916 (seit 1919 Franziska)Tiere in Ketten, Roman, S. Fischer, Berlin 1918Das Versöhnungsfest, Eine Dichtung in vier Kreisen, in: Der Mensch (Zeitschrift), 1918Mensch gegen Mensch, Roman, Verlag Georg Müller, München, 1919Tanja, Drama in 3 Akten, UA 1919 in PragStern der Dämonen, Erzählung, Genossenschaftsverlag Wien/Leipzig 1920Nahar, Roman, Kurt Wolff Verlag, München 1922Hodin, Erzählung, Verlag H. Tillgner, Berlin 1923Die Feuerprobe, Roman, Verlag Die Schmiede, Berlin 1923Atua, Erzählungen, Kurt Wolff Verlag, München 1923Der Fall Vukobrankovics, Kriminalreportage, Verlag Die Schmiede, Berlin 1924Männer in der Nacht, Roman (um Balzac), Propyläen Verlag, Berlin 1925Dämonenzug, Erzählungen, Ullstein, Berlin 1928Boëtius von Orlamünde, Roman, S.Fischer, Berlin 1928 (seit 1930 Der Aristokrat)Georg Letham. Arzt und Mörder, Roman, Zsolnay, Wien 1931Der Gefängnisarzt oder Die Vaterlosen, Roman, Verlag Julius Kittls Nachf., Mährisch-Ostrau, 1934Der arme Verschwender, Roman, Querido Verlag, Amsterdam 1936Jarmila, Novelle, 1937Der Verführer, Roman, Humanitas Verlag, Zürich 1938Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Im Gesamten ist dieser Text zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wei%C3%9F_%28Schriftsteller%29.
Tiere in Ketten
Erster Teil
Erstes Kapitel
In dem Freudenhause einer kleinen Stadt lebte ein schönes Mädchen, das Olga hieß.
Olga liebte einen Mann, den Besitzer dieses Hauses, Franz Michalek.
Sie liebte ihn mehr, als Menschen lieben. Er war ihre Wollust, ihre Mädchenschaft, ihr alles und eines, ihr Wachen und Traum, Mord und Erbarmen, Tier und Mensch.
Ihr Schoß wurde angezündet, und sie verbrannte.
Sie wurde mit Wahnsinn geschlagen, sie mußte sich zertrümmern und ihre Welt.
Sie war in die gemeine Welt geworfen und mußte im Schmutze leben; Geld nahm sie und gab sie.
Sie liebte bis zum Wahnsinn, raste, ein unzerstörbarer Motor, ruhelos von der Erde zur Hölle; sternabwärts, sternaufwärts.
Ein Freudenmensch, bestimmt, sich zu verzehren, eine kinderlose Dirne, bestimmt zum Frieden der gesegneten Mütter, im Leben über dem Leben.
Ein Tier, gekettet zwischen Erde und Hölle, jetzt mitten in der gemeinsten Welt.
Man nannte sie Olga; die sie liebten, nannten sie Olympia.
Seit Jahren lebte sie im Hause Nr. 37. Nie hörte man sie etwas von sich erzählen.
Oft führte sie einen Mann an der Hand mit sich in ein Zimmer. Sie nahm ihn in ihre milchweißen Arme, dann ließ sie sich an ihm herabgleiten, sie rauschte weich vor seinen Füßen auf dem Boden zusammen. Die Beine rings um sich geschlungen, süß berührte sich Glied mit Glied, nackt und glatt unter der roten Seide ihres weiten Kleides und aus den Falten, tief ringsum gewellt, leuchtete ihm ihr weißes Gesicht empor, die niedrige, elfenbeinerne Stirn, die schwarzen Augen, ruhig glühend über dem tiefroten Mund, der in der Spannung der Sekunde, angespannt wie ein Muskel vor dem Sprung, zitterte in allen seinen Fasern. Leise klirrte ihr Lachen durch die vollen, kindlichen Lippen.
Ein junger Mensch verliebte sich in sie, wollte sie, als er die Reifeprüfung bestanden hatte, aus den Fesseln ihres Ausbeuters befreien, sie sollte fort aus der giftigen Atmosphäre des schlechten Hauses und mit ihm in die Universitätsstadt ziehen.
Aber ihr war das Haus nicht schlecht, die Luft nicht giftig, das Haus war heilig, die Luft gesegnet und gut.
Er wollte, daß sie ein neues Leben beginne, aber sie blieb, wo sie war.
In der letzten Zeit trieb es sie oft fort. Die Kirche war nicht weit, hoch ragte der heiligste Bau unfern dem Hause bei der stillgelegten Ölfabrik, das die Zahl 37 trug.
Zweites Kapitel
Das Haus Nr. 37 war nur nachts eine Spelunke. Tagsüber war es ein kleines, solides Wirtshaus, das "Der Felsenkeller" hieß, und in dem die Gäste sehr gutes böhmisches Bier sehr billig bekamen. Den Vormittag über waren die Mädchen unsichtbar. Sie schliefen. Der Geruch ihrer Pomade klebte noch an den Wänden, aber die Gendarmen und Kleinbürger, die morgens zum Frühschoppen kamen, vertrieben ihn sofort mit dem Knaster, der leise zischend aus ihren Pfeifen dampfte.
Wer spät am Nachmittag kam, hörte hinter verschlossenen Türen ein Mädchen summen; über die Treppen rauschten gestärkte Röcke, klirrend fiel eine Brennschere zu Boden. Eines Tages behauptete der Gymnasiast Robert, der zum ersten Male das Haus aufsuchte, er höre ganz deutlich ein Mädchen im Badewasser plätschern. Aber das war Irrtum, ein solcher Luxus wäre in der kleinen Stadt Unsinn gewesen. Abends, Schlag acht Uhr, wurde das Haustor zugesperrt, der Wirt bezog seinen Posten und ließ den Hausschlüssel nicht aus der Hand. Er öffnete sofort, wenn jemand klopfte; das Haus stand völlig frei, hundert Schritte hinter der Ölmühle, die jetzt stillgelegt war, aber noch dünsteten schmierige Abfälle schwer über die Straße, den Vorgarten, das einstöckige Haus.
Michalek trank sehr viel. "Ich habe das Bier halb umsonst. Wozu wäre ich auch sonst der Wirt?" – Aber seine Trunkenheit ging lange Zeit hindurch nicht so weit, daß er die Schelle draußen überhört hätte.
"Ordnung muß sein. Das Geschäft geht vor, das Bier bleibt stehen, es läuft mir ja nicht weg."
Oft lag ein militärischer Ton in seiner Redeweise; er wußte sich bei allen Leuten Respekt zu verschaffen, nicht nur bei den Mädchen, die in seinem Hause wohnten, sondern auch bei den Gästen, bei den Lieferanten, den ehrenwertesten Leuten der kleinen Stadt, die ihm beim Vorübergehen einen Händedruck zu versagen nicht den Mut hatten. Als er vor zwei Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte, war die Anteilnahme allgemein.
Michalek erholte sich zwar in der kürzesten Zeit; nach wie vor schritt er Sonntag vormittags mit strammer Eleganz über die Hauptstraße der kleinen Stadt, ja, er hielt sich sogar militärischer als früher. Nur eines hatte sich geändert: er begann beim Trinken zu reden. Der Arzt behauptete, ein Stück seines Gehirns, in dem sich das Sprachzentrum befand, sei in Unordnung geraten. Aber was er sprach, klang vernünftig. Er begann frühmorgens, wenn der Gendarmeriewachtmeister vor seinem Postengang zu ihm kam, mittags sprach er, wenn die Professoren aus dem Gymnasium sich zu einem heimlichen Frühschoppen bei ihm einfanden, denn im Sommer war das Bier des "Felsenkeller" kühler als anderswo; besonders aber geriet er abends und nachts ins Reden. Es wollte ihm niemand zuhören. Die Leute kamen nicht seinetwegen her. Das Erzählen, das Reden wurde seine Schwäche, seine Leidenschaft. Er trieb es so weit, daß er die Besucher halb mit Gewalt festhielt, daß er, der Wirt, ihnen Bier aufdrängte und ihnen herzegowinische, selbstgestopfte Zigaretten anbot, ja, daß er im Rausche des Erzählens die Einlaßsuchenden draußen, im Scheine der roten Laterne, ungebührlich lange warten ließ. Natürlich war es, daß sich die Leute beschwerten, vor allem der wertvollere Teil der Besucher, und wäre nicht das beste Bier, die jüngsten Mädchen bei Michalek gewesen, so wären sie überhaupt nicht wiedergekommen. Nun aber blieb Michalek nichts anderes übrig, als den Schlüssel zu seinem Haus dem Mädchen Olga zu übergeben.
Als nun Michalek alle ihm bekannten Anekdoten von sich gegeben hatte, nahm er die Privatverhältnisse, die letzten Geheimnisse der in seinen Diensten stehenden Mädchen vor. Aber diese letzten Geheimnisse waren zugleich die ersten. Die Geschichten dieser Mädchen waren ebenso gleichartig wie ihre Gesichter, es gab einige unter ihnen, die sich nur durch den Namen unterschieden. Zuerst erzählte er die Geschichte des stellenlosen Dienstmädchens und ihres Verführers, der Don Juan und Geschäftsmann zugleich war. Dann aber, nach längerem Schweigen, begann er von seinen Freunden zu berichten, von einem Oberleutnant, der, ebenso wie er, Franz hieß, einem Mordskerl in Liebe, Dienst und außerdienstlichem Schneid, mit dem zusammen er in einer kleinen ungarischen Stadt gedient haben wollte.
Bloß von Olga erzählte er nichts, ja, er vermied sogar, ihren Namen zu nennen; er schwieg lange, nicht etwa aus Schonung und Zartgefühl, denn er behandelte sie sehr schlecht, ein Grund mehr für die Studenten, die mit ihr einen Roman erleben wollten, ihr nun das Unselige ihrer jetzigen Lebensweise mit pathetischen Worten, mit zitternder Stimme, ganz wie eine überraschende Neuigkeit vor Augen zu halten und dann noch Antwort zu erwarten, ob sie das nicht auch fühle, ob sie nicht ein neues Leben, eine glücklichere Existenz anderswo ersehne.
Olga rührte sich nicht fort. So wie sie jetzt da war, war sie vor fünf Jahren da gewesen. Sie hatte, wie es schien, keine Ersparnisse, nicht einmal einen goldenen Ring.
Michalek merkte mit der Zeit, daß ihm der Stoff ausging. Man lachte, wenn er sich allzu genau kopierte, wenn er sich zum dreißigstenmal wiederholte. Aber Sprechen war ihm Leben. Er schwieg wohl, aber doppelt unersättlich blieb seine Redegier. Er konnte nicht fort, das Haus Nr. 37 erforderte seine Anwesenheit. Zwei Wochen lang beherrschte er sich, er ließ seine Wut an den Mädchen aus, entzog Olga wieder den Schlüssel des Hauses, beschimpfte sie, behauptete, sie sei an allem schuld, schlug sie, warf ihr vor, sie hatte in sein Bier etwas Giftiges getan, um ihn zu "verrücken". Aber selbst die Drohung mit der Polizei machte auf sie keinen Eindruck. Und eines Tages gab er ihr, da sie sich nicht abschaffen ließ, er ihre Nähe aber jetzt nicht mehr ertrug, den Schlüssel wieder zurück, vertraute ihr sogar ein kleines Büchlein an, in dem er mit Bleistift die Einnahmen und Ausgaben der Mädchen, mit Tinte aber die Adressen der Agenten verzeichnet hatte, welche ihm die Mädchen zugebracht hatten. Damit lieferte er sich ihr ganz und gar aus. Zugleich verbot er ihr aber, sich nach acht Uhr abends in dem Salon zu zeigen. Das bedeutete, daß Olga Haushälterin wurde und nicht mehr "eines von unseren guten, kleinen Menschern" war. Ihr Platz war der Korridor, die Küche, die Stadt; nicht mehr der Salon und die Kabinette.
An demselben Abend noch erzählte er zwei jungen Studenten und einem kahlköpfigen Reisenden, der die Adresse des Hauses Nr. 37 von einem Kollegen in der Eisenbahn erhalten hatte, etwas von seiner Geschichte und von der Geschichte Olgas, die man Olympia nannte.
Drittes Kapitel
Der Geschäftsreisende hatte sich schon von seinem Mädchen verabschiedet und setzte sich nun mit den zwei Gymnasiasten an einen Tisch in die Ecke. Michalek, blaß, etwas gedunsen, holte aus dem Keller neun Flaschen Bier und stellte sie in einen Winkel hinter sich; er baute sie zu einer kleinen Pyramide auf, was er "das kleine Einmaleins" nannte. Die Gymnasiasten schielten unaufhörlich nach Olga hin. Sie waren ihretwegen hergekommen und gedachten nicht, vor Mitternacht fortzugehen. Sie fühlten sich in dem kleinen, überhitzten Salon, in der Nähe der Mädchen wie zu Hause. Es war Sonnabend, die Schule machte ihnen keine Sorgen. Jemand kam, ließ das elektrische Klavier spielen, das losfuhr wie ein Wagen über Steine. Und während sie hier saßen, träumten sie von der Großstadt und ihren Lasterhöhlen, von rubinroten Laternen, von jungen Mädchen, die in Rudeln versammelt waren und deren Häßlichste schöner war als Olga.
Als Michalek sich gesetzt und die erste Bierflasche aus dem Winkel auf den Tisch gehoben hatte, verschwand Olga. Sein Blick war deutlich. Nun ging sie draußen, auf dem Korridor, hin und her; in Kürze kamen ihr auf den reifbeschlagenen Fenstern die stämmigen Schatten der Gäste entgegen. Bevor noch einer geschellt hatte, öffnete sich die schwere Tür. Olgas Hand schimmerte ihnen entgegen, schlüpfte aus dem weiten japanischen Ärmel ihres roten Seidenschlafrockes und leuchtete in hartem Weiß wie ein Stück Porzellan.
Im Salon aber erkannten die Gäste mit Befriedigung die alten Gesichter, sie bestellten bei den Mädchen Bier, Schachteln mit Zigaretten, in welche die Mädchen mit fleischigen Händen hineingriffen, während die Gäste umherschauten. Viele begannen mit den Madchen zu sprechen, ganz so, als ob es Menschen ihresgleichen wären.
Die Tür öffnete sich immer wieder, Olgas roter Schlafrock züngelte herein, die Neuangekommenen wurden mit Gelächter und Witzen begrüßt. Nur die Gymnasiasten blieben ernst. Einer von ihnen sah nach der Tür.
"Kommt denn Olga nicht zurück?"
"Nein, heute gibt es keine Olga", sagte Michalek ruhig. "Muß es denn Olga sein?"
"Die arme Olga! In ihrem leichten roten Schlafrock draußen auf dem offenen Korridor."
"Sie kann sich den Tod holen", sagte der zweite Gymnasiast.
"Den Tod? Ausgeschlossen!" sagte der Reisende. "Hier gibt es keinen Tod. Sie sind im Reich der Liebe."
"Ist sie nicht ein Mensch wie jeder andere?" fragte Robert, der Gymnasiast.
Olga kam ins Zimmer, sie führte einen anständig gekleideten Herrn an der Hand, der das Lokal noch nicht kannte. Durch die geöffnete Tür kam kalte Luft. Olga ging zum Ofen und wärmte sich. Die dünne rote Seide ihres Rockes kräuselte sich an den weißen Kacheln.
"Olympia," sang der Gymnasiast, "reich' mir die Hand, mein Leben, trink ein Glas Sekt mit mir!" Michalek lächelte. Die Glocke draußen ging. Olympia machte sich fort.
Der Reisende klopfte mit seinem Ring an das Glas. Augenblicklich kam Kathinka zu ihm und setzte sich auf seinen Schoß. Der Reisende lachte. "Nein, das ist zum Lachen! Ein andermal. Aber, wenn du deine Liebe beweisen willst, dann bring' schnell Kaffee mit Rum." Kathinka verschwand sofort. Das Lächeln war aus ihrem Gesicht fortgewischt.
"Warum darf nicht Kathinka draußen Wache stehen?" fragte Robert, der Gymnasiast. Kathinka war alt und blatternarbig. Sie hoffte, einmal nur Dienstmädchen zu sein. Inzwischen hatte sie die Narben in ihrem Gesicht mit Schminke ausgefüllt. Aber sie wandte sofort den Kopf weg, wenn sie jemand ansah.
"Kathinka oder Olga, zwei alte Dragoner!" sagte Michalek. "Länger dienende Unteroffiziere."
"Aber doch nicht immer? Es hat sicher eine Zeit gegeben, da sie kein alter Dragoner war."
"Ich weiß nicht, was Sie von ihr wollen", sagte Michalek. "Glauben Sie mir, ich kenne das Weib besser als Sie, ich weiß ganz genau, wie man mit solchen Menschen umzugehen hat. Wenn sie es nicht verdiente, dann wäre sie eben kein alter Dragoner. Übrigens hat sie es ganz gut. Verlassen Sie sich darauf, meine kleine Dame marschiert lieber sechs Stunden auf dem Korridor hin und her, als daß sie sich zu Ihnen an den Tisch setzt und Champagner mit Ihnen trinkt. Was ist ihr Champagner? Was bedeutet das für eine Olga? Ich kenne sie ganz genau, ich weiß, ich weiß alles. Ich habe sie noch gekannt, als sie Näherin war. Damals war sie das reinste Gespenst, eine Mumie in Flanell, wenn sie dabei nicht so hübsch gewesen wäre, hätten Sie sich vor ihr fürchten müssen. Erst hier ist sie so schön geworden. Ihre Augen waren so groß (er zeigte die beiden geballten Fauste), ja, sie war halb verhungert, und das andere an ihr war auch nur so la la. Das waren noch andere Zeiten als jetzt, und weil Sie vom Champagner reden, so gute Ideen hat bald einer, einmal hab ich ihr Champagner zu trinken gegeben, nicht etwa in schlechter Absicht, sehen Sie mich nicht so grimmig an, Herr Doktor, ich habe das nie notwendig gehabt, keine arglistige Betäubung an einem hilflosen Menschen, nein, ganz im Gegenteil. Ein normaler Mensch wird lustig, tanzt und singt, ich habe eine ungarische Komtesse gekannt, die tanzte auf einem Kaffeehaustisch Czardas, und wenn sie eine Flasche Champagner bekam, Czardas und alles andere, aber davon spricht man nicht... als Kavalier und Ehrenmann, aber die Olga, das arme Kind, sitzt ganz schüchtern im Chambre séparée" (er neigte den Kopf und schloß die Augen; er sah sehr verfallen aus) ... "die Zigeunerkapelle spielt und spielt, aber Olga sagt kein Wort, keine Spur von Singen und Tanzen, sie blickt mich gar nicht an... ah, da sieh her, sie legt den Kopf aufs Tischtuch und heult... Na, es gibt allerhand Menschen, warum auch nicht? ... nicht eine jede weint. Aber im Chambre séparée? Den Champagner hat die Komtesse getrunken, wir sind nach Hause gefahren.
Über uns hat ein guter Kamerad gewohnt, ein Oberleutnant aus demselben Regiment, ein geborener Musikant, er konnte Mundharmonika blasen wie ein junger Gott, alle möglichen Melodien, alles ohne Noten, direkt aus dem Kopf. Damals hat die Olga Musik noch sehr gern gehabt. Ein Mensch fliegt auf das, ein anderer auf etwas anderes ... Musik zum Beispiel. Ich glaube wenigstens, daß es die Musik war, was sie zu mir gelockt hat. Ich denke nie etwas Schlechtes von den Menschen. Übrigens waren wir auch damals noch ganz solid. Sie hat sogar versucht, mir das Sparen beizubringen, aber dafür habe ich ihr das Geldausgeben angewöhnt. Nicht für Sekt, aber für schöne Toiletten hat sie geschwärmt.
Im Grunde sind alle gleich ... Dirnen und Komtessen ... Sie sehen, noch jetzt paradiert sie mit einem seidenen Schlafrock, auch wenn sie es gar nicht mehr nötig hat, das liegt so in ihrer Natur. Und wenn sie auch gar nicht zum Schlafen kommt, sie schneidert sich doch ein paar Fetzen zusammen. Aber auch die Fetzen kosten Geld. Heut ist das eine Kleinigkeit. Aber damals! Sagen Sie selbst, was ist eine Gage von neunzig Gulden?"
"Das verdient unsereins auf einen Sitz!" sagte der Reisende. "Sagen Sie das dem Staat! Sehen Sie, ich habe gern gedient, ich wäre im Ernstfall losgegangen wie drei ungarische Teufel, wie ein wildes Tier. Aber zu Hause sitzen, exerzieren, schreiben in der Kanzlei, Rekruten dressieren, und alles für hundert Gulden monatlich? Nur fünfzig Gulden mehr, und alles wäre besser gewesen" Furcht habe ich nie gekannt; ich habe nie gewußt, wovor ich hätte Furcht haben sollen.
Daß ich da sitze, neben Ihnen, meine Herren aus dem Morgenlande, da in einer Spelunke, in ihren Augen vielleicht ärger als in einer Spelunke, das beweist Ihnen, daß ich nicht Furcht gehabt habe... vor nichts.
Ich bin auch ein Mensch, ich habe Gemüt. Und das hat mir den Kragen gebrochen. Ich habe nicht nur an mich allein gedacht. Wie leicht hätte ich mich rangieren können! Ich habe nicht Schulden gehabt wie andere, zweitausend Gulden und mehr; meine Schulden waren immer kleiner als eine Monatsgage. Fünfzig Gulden monatlich mehr! Man gibt Stipendien für Studenten, für arme Waisen, Gott weiß, was für welche! Aber für Offiziere? Ja, du trägst des Kaisers Rock! Du hast ein Ehrenmann zu sein im Dienst und außer Dienst! Ja, mit dem größten Vergnügen! Warum auch nicht? Aber wenn ich leben muß wie ein Hausierer? Was dann? Das Leben kostet Geld, meine Herren, das Essen, die Monturen, das Pferd und die kleinen Damen. Man sieht so ein Mädchen gern, man läßt sich ein wenig beneiden, man führt die Dame aus. Angezogen muß es sein, denn anders wäre es eine Schande. Schließlich muß sich jeder Mensch anständig, nur anständig, sage ich, tragen, und wenn der Mensch auch nur eine Schneidermamsell ist, müssen das die Leute nicht gleich merken. Essen muß schließlich der Mensch auch. In die Offiziersmesse habe ich sie nicht mitbringen dürfen, zu Hause lassen konnte ich das arme Kind auch nicht. Schließlich sind zwar ärgere Schlampen am Offizierstisch gesessen. Eigentlich aber... Ordnung muß sein... Zwei oder drei Monate lang ist alles schön und gut. Wenn es keine Rebhühner gibt, dann gibt's ja Wiener Schnitzel oder kalten Aufschnitt oder ein kleines Gulyas. Wenn man sich keine ägyptischen Zigaretten kaufen kann, dann stopft man sich siebzehner Tabak mit Papierhülsen. Das hat die gute Olga schnell gelernt. Ach Gott, das glaubt man gar nicht, was ein anständiges Mädchen nicht alles lernt, und je anständiger, desto besser. Verderben lassen sich die Kinder alle, mit Wonne sogar, aber erziehen nicht. Und bin ich abends fortgegangen ... der Mensch muß doch auch seine Zerstreuung für sich allein haben, nicht wahr, Herr Doktor? Einmal gibt es einen Herrenabend beim Regimentsarzt, ein andermal gibt es ein kleines Spiel oder eine Wagenpartie mit ungarischen Juckern ... hochfeudal... ja, was wollte ich Ihnen nur erzählen, wenn ich abends heimgekommen bin, saß die kleine Olga noch da ... stopfte Zigaretten, und draußen war es schon Tag! Sagen Sie, was hat das für einen Sinn? Richtig, die Mutter hat sie am nächsten Tag herausgeworfen. Selbstverständlich, auch in der Familie muß Ordnung sein, selbst hier in einem Bordeaux muß Ordnung sein. Übrigens war das nicht das schlimmste Unglück. Sie war in einem Atelier angestellt. Wenn so ein Luder eine Nähmaschine in einer Scheuer stehen hat, nennt sie das schon ein Atelier. Wenn der Mensch fleißig ist, kann er überall etwas verdienen durch Überstunden und allerhand solche Sachen, verstehen Sie? Schließlich und endlich hat sie auch zu Hause nicht umsonst gewohnt, sie hat ihren Leuten für den Zins und das Essen tüchtig zahlen müssen. Umsonst ist der Tod. Und jetzt hat sie eben billiger gewohnt oder mehr gespart, sie hat immer Kleingeld im Taschchen gehabt... sie hat mir oft sogar was mitgebracht: eine Flasche Wein oder ein paar Zigaretten... allerhand dergleichen.
Jetzt sagt einmal! Es kommt euch so ein kleines Menschenkind daher, können Sie sich das vorstellen, Herr Doktor, ein niedliches Kind, keine siebzehn Jahre alt, in ›der ersten Liebe erstem Traum‹ und bringt die Hände voll guter Sachen. Nun, Hand aufs Herz, werden Sie fragen: Woher hast du das, was hast dafür gezahlt? oder hast du es überhaupt nicht bezahlt, sondern von zarter Freundeshand geschenkt bekommend Nein, mir als Mann können Sie es schon sagen. Sie werden ruhig die Bagatellen annehmen und das Maul halten. Und wenn Sie einmal im Kartenspiel Pech haben und das süße Geschöpf hat gerade einen Zehner übrig, so werden Sie ihn ruhig einstecken, wenn es niemand sieht, und ihr dafür als nobler Kavalier das nächste Mal einen Hut für dreißig Gulden kaufen, stillschweigend.
Welcher Kavalier redet mit seiner Dame von Geldgeschäften?"
An der Tür stand Olga und lauschte. Durch den dicken Zigarettenrauch leuchtete ihr rotes Seidenkleid. Ein Gymnasiast hatte sich mit Kathinka fortgeschlichen, der Reisende aber schlief. Er liebte es nicht, zuzuhören, war aber selbst unermüdlich im Flunkern und im Erzählen unzüchtiger Anekdoten, die er sogar im Kaffeehaus aus dem "Kleinen Witzblatt" ausschnitt. Robert, der Gymnasiast, war bedrückt.
"Erlösen", dachte er. "Wenn doch nur die Menschen wüßten, was sie eigentlich sind. Kein Mensch ist unrettbar, selbst eine Kathinka nicht."
"Sie haben doch Olga sehr geliebt?"
"O nein, woher denn?" sagte Michalek. "Ich habe zu dieser Zeit, zur Zeit der Überstunden, nicht mehr mit ihr gelebt.
Ich habe sie nicht einmal mehr mit einer Fingerspitze angerührt. Muß man mit jedem Mädchen, das man einmal gern gehabt hat, auf ewige Zeiten eine Liebschaft haben? Man kann doch rein kameradschaftlich zusammenleben, ganz platonisch, das kommt tausendmal vor. Wenn das Fräulein Vertrauen zu mir hat, warum darf sie mir dann nicht ihre Ersparnisse in die Hand geben?
›Ja, aber das hätten Sie sich doch denken müssen‹, sagen die Herren vom Ehrenrat, ›daß die Sache nicht ganz ehrenhaft ist. So wie Sie handelt kein Offizier, so benimmt sich kein anständiger Mensch! Was heißt das,›Sie wissen nicht?‹ Das sieht doch ein Blinder ... Das ist Scheidemünze. Scheidemünze stinkt!‹
Ah, da staunst du! Ist das nicht gemein? Spricht so ein Kamerad? Ich habe ein Mädchen lieb, und alles ist schön und gut, ich staffiere sie aus eigenen Mitteln heraus wie einen leibhaftigen Engel, wie eine echte Komtesse. Ehrenwort! Das haben sogar die Offiziere zugegeben, und wenn sie mir einmal zum Geburtstag oder sonst bei einer Gelegenheit ein paar Geschenke macht, da soll ich sie erst vors Gericht stellen, vor den Ehrenrat!
Fürs Gefühl gibt es keinen Ehrenrat, Gott sei Dank! Ich soll ihr alles vor die Füße werfen? Warum nicht gar den Polizeispitzel spielen und sie bei der Polizei anzeigen? Nein, o nein, dann lieber: Danke schön. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe gern gedient. Aber so ... nein, das ist kein Kaffeehaus für mich. Sie glauben, ich sage das im Scherz? Keine Idee.
Ich weiß ganz genau, was ich getan habe, das haben tausend andere auch getan, die es gar nicht notwendig gehabt haben. Jeder Mensch, jeder anständige Mensch handelt so wie ich.
Mir haben sie den Rang abgeschnitten, die andern, die hinter mir waren, sind schneller avanciert. Mich haben sie herausgefeuert, was soll ich dagegen tun? Was kann ich antworten wenn ein alter Oberst mich andonnert wie verrückt? Schweigen, schweigen, und nicht weiterdienen. Aber Ihnen kann ich es, offen und ehrlich sagen: Stellen Sie sich vor, Sie sind der junge Mann von vierundzwanzig Jahren, Sie haben ein kleines Katzerl liebgehabt. Weiß wie Schnee das Katzerl, Sie wissen, im Grunde ist und bleibt es anständig, das muß Ihnen genug sein.
Und wenn sie auch einmal... wenn sie gerade einmal, na in Gottes Namen, etwas anstellt, schließlich ist ein junger Offizier kein Sittenrichter. Ich hätte die Olga schön angeschaut, wenn sie mich nach meinen Liebschaften ausgefragt hätte.
Was kümmern mich dann ihre Amouren? Nur nicht fragen! Das müssen Sie sich merken. Nie fragen nach dem, was vorher war, seien Sie froh, wenn Sie wissen, vorher war nichts. Es gibt solche Zufälle im Leben, glauben Sie nicht, Herr Doktor? Aber wenn Sie es nicht genau wissen, dann halten Sie schön den Mund. Fragen Sie auch nicht danach, was nachher passiert. Nein, mein Lieber, man muß nichts wissen wollen.
Sehen Sie sich hier um: Sie amüsieren sich, und auch die Mädchen amüsieren sich. Sie bekommen ihre Prozente von den Getränken, jede hat ihr eigenes Konto. Daß mir die Mädel auch ihrerseits Prozente zukommen lassen, entschuldigen Sie, Herr, für nichts und wieder nichts würden selbst Sie sich nicht hierher setzen und das Haus führen, den Krempel anständig zusammenhalten. Ich habe noch eine stramme Hand ... aber wo käme auch sonst unsereins hin?"
Der Salon war voll von Leuten. Olympias roter Schlafrock war verschwunden. Der Lärm stieg, das elektrische Klavier dröhnte, und man hörte, wie oben, eine Treppe höher, ein Paar nach der Musik tanzte.
Bisweilen klang der Schall von Olgas Schritten, wie der eines Soldaten auf Wache, vom Korridor herein.