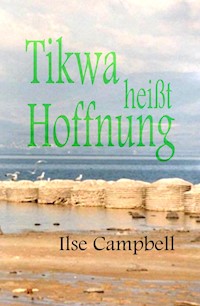
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Israel 1982, Beginn der Operation "Frieden für Galiläa". Der israelische Panzerkommandant Schalom verliert während des Einmarsches in den Libanon seine Kameraden. Während er als einziger Überlebender in feindlichem Gebiet versucht zu seiner Einheit zurückzugelangen, erinnert er sich in den einsamen Nächten an seine Kindheit und Jugend. Seine deutsche Frau Susanne wartet währenddessen an ihrem Fenster zum See Genezareth auf seine Rückkehr und kehrt in ihren Erinnerungen in die Zeit ihrer Ankunft in Israel, zum Leben im Kibbuz und dem Beginn ihrer Liebe zurück. Als Schalom schwer traumatisiert zurückkehrt ist in ihrem gemeinsamen Leben nichts mehr wie zuvor und Susanne muss begreifen, das sie keine Chance haben in einem Land Frieden zu finden, in dem es keinen Frieden gibt. Vor dem Hintergrund einer Liebesgeschichte gibt die Autorin faszinierende Einblicke in Arbeit und Leben in einem Kibbuz in den späten 70er-Jahren. Sie führt kundig in den israelischen Alltag, in das Getümmel Tel Avivs und in die oftmals naive Suche nach der idealen Lebensform im Kibbuz. Dabei werden Land und Leute vor den Augen des Lesers lebendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ilse Campbell
Tikwa heißt Hoffnung
Roman
Copyright: © 2015 Ilse Campbell
Umschlag & Satz: Erik Kinting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
FÜR SHANI
Nachricht
Sie saß in einem Café am See und blickte auf die Fischerboote, die ruhig auf dem Wasser schaukelten. Der See erschien ihr so ruhig und friedlich, die Farbe des Wassers wechselte zwischen tiefem Blau und hellem Grün. Sie hörte das gleichmäßige Plätschern der Wellen, die ans Ufer schlugen. Um sie herum herrschte hektisches, lautes Treiben, wie immer in diesem Land. Erregte, lärmende Stimmen drangen an ihr Ohr. Man redete hier viel und laut, meist begleitet von heftigem Gestikulieren. Die Geräusche hörte sie, aber trotz ihrer mittlerweile guten hebräischen Sprachkenntnisse erreichten die Worte sie nicht. In ihrem Kopf dröhnten nur diese drei Worte: Vermisst im Libanon!
Seit er wegging, um in diesem Krieg zu kämpfen, hatte sie unsagbare Angst, die sie immer wieder fortschob, die sie nicht an sich ranlassen wollte, die sie lähmen würde, die ihr nicht erlauben würde zu funktionieren. Sie aber wollte Normalität für das Kind. Es sollte die Angst nicht spüren. Schlimm genug, dass der Vater fort war, aber wenigstens das tägliche Leben sollte normal verlaufen. Es war zu klein um zu verstehen, warum er abends nicht nach Hause kam.
Abends, wenn das Kind endlich schlief, machte sie sich gewöhnlich eine Tasse Tee mit Minze und setzte sich an ihren Platz am Fenster. Die breite, erweiterte Fensterbank, so wie man sie aus amerikanischen Filmen kannte, hatte damals den Ausschlag gegeben, diese Wohnung zu nehmen. Der Platz am Fenster mit dem herrlichen Ausblick war zu ihrem Ort, ihrer Zuflucht geworden. Vom dort sah man zunächst auf die Stadt hinunter und dann auf die weite Fläche des See Genezareth oder des Kinnerets, wie ihn die Israelis nannten.
Doch heute hatte sie sich diese Stunde fortgestohlen. Sie musste allein sein mit dieser Nachricht, nicht umgeben von Freunden, nicht von ihrem Kind. Hier wollte sie in Ruhe nachdenken über die Nachricht, versuchen zu begreifen, sie irgendwo einordnen. Aber alles was ihr einfiel Verwundung, Gefangenschaft und Tod, machte die Angst nur noch schlimmer. Sie hatte sich erhofft hier allein sein zu können, inmitten all dieser Fremden, inmitten dieses pulsierenden Lebens, aber der Gegensatz zwischen ihren Gedanken und ihrer Umgebung war unüberwindbar. Sie musste hier weg, sie musste nach Hause.
Plötzlich glaubte sie zu wissen, wo der richtige Platz für sie war. Sie musste zurück zum Haus, die Freunde bitten ihr Ruhe zu gönnen und das Kind für einige Stunden mitzunehmen. Sie musste ihre Gedanken sammeln, die lähmende Angst zurückdrängen, um wenigstens äußerlich normal zu funktionieren. Sie musste zurück an ihr Fenster zum See.
Vermisst
Die Zeit verging quälend langsam, seit Susanne die Nachricht erhalten hatte. Mittlerweile wusste sie, dass mehrere Soldaten vermisst waren. Es gab keine Ankündigungen seitens der Milizen, dass Gefangene gemacht wurden. Ein gutes Zeichen! Der Vormarsch der israelischen Armee auf Beirut verlief sehr schnell. Die Militärs vermuteten, dass in den Gefechten einige Panzer von ihren Einheiten getrennt wurden und die Kommunikation unterbrochen war, sie sozusagen im Moment verloren wären, aber wieder auftauchen würden. Sie wusste nicht, ob dies nur Beschwichtigungen waren oder es wirklich zum Chaos des Krieges gehörte.
Ihre Freundin Dorit hatte sich um das Kind gekümmert und allen Besuchern erklärt, sie brauche Ruhe, sie sollten morgen wieder kommen, vielleicht gäbe es bis dahin ja gute Neuigkeiten. Sie war ihr dankbar, Dorit verstand sie ohne viele Worte, begriff, was gut für sie war.
Jetzt, da das Kind schlief, konnte sie sich endlich mit einer Tasse Tee an ihr Fenster setzen. Sie schaute auf die Lichter der Stadt und den See, der im Dunkeln nur dort zu sehen war wo der Mondschein sich auf ihm spiegelte. Alles schien so friedlich, bis auf die zuckenden Blitze am Horizont, links hinter dem See. Was aussah wie Wetterleuchten oder weit entferntes Feuerwerk waren in Wahrheit die Gefechte im Libanon.
Ab und zu flogen Kampfflugzeuge über die Golanhöhen auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Sie flogen so tief und schnell, dass alles vibrierte und sie fürchtete, eins der Fenster würde zersplittern. Sie war froh, dass sie flogen, hoffte, dass sie den Krieg vielleicht schneller beenden würden. Sie stellte sich vor, wie er mit seiner Panzerbrigade vorrückte, ein gut aussehender Kommandant, selbstbewusst, mutig und entschlossen wirkend, so wie ein israelischer Offizier zu sein hatte. Nur sie wusste von seinen Albträumen des letzten Krieges, dem Jom-Kippur-Krieg, in dem er fast alle seine Freunde verloren hatte. Nächte, in denen er, der tapfere Soldat, geschluchzt hatte wie ein Kind. Diese Erinnerungen, von denen er nicht reden, die er nicht mit ihr teilen konnte.
Sie starrte auf die schmale, kurvenreiche Straße, die den Berg hinauf verlief, die einzige Straße, die in ihr Viertel führte. Wenn die Militärs kamen, um die Nachricht des Todes zu überbringen, kamen sie immer in drei Autos. Das erste Auto ein Jeep des Verteidigungsministeriums mit einem Oberst, dem Überbringer der Nachricht, gefolgt von einem Rabbi und einem Psychologen; am Ende ein Krankenwagen. Viele Frauen saßen ganze Nächte am Fenster und beobachteten die Straße. Sie tat es immer nur ein paar Stunden, mehr konnte sie nicht ertragen. Zweimal schon hatte sie die Kolonne beobachtet, mit angehaltenem Atem, doch sie waren am Haus vorbeigefahren. Heute wurde sie noch verschont, aber wie lange noch?
Die letzten Tage waren alle ähnlich verlaufen. Sie wachte morgens auf, sah den Sonnenschein, der ins Zimmer fiel, und für einen kurzen Moment schien alles normal. Ihr kam es vor, als würden ihre Gedanken eine Minute später als der Rest ihres Körpers aufwachen. Es traf sie mit voller Wucht, plötzlich war alles wieder da: Er war noch immer vermisst! Gleichzeitig befiel sie die Angst, kroch an ihr hoch, legte sich ihr auf die Brust, bis sie meinte, nicht mehr atmen zu können. Sich zu bewegen kostete ungeheuerlich viel Kraft.
Dennoch schaffte sie es jeden Morgen aufzustehen, mit dem Kind zu frühstücken und es bei Dorit abzugeben, die es in den Hort brachte. Sie wollte dort nicht hingehen und die mitleidigen Blicke und Fragen ertragen, dafür fehlte ihr die Kraft. Tagsüber kamen Freunde und Bekannte, brachten Mahlzeiten, versuchten eine Unterhaltung. Sie versuchten ihr Mut zu machen, meinten es gut mit ihr und sie war froh in diesem Land so viele Freunde zu haben. Sie gab sich Mühe, tat, als würde es ihr gut tun. Sie war selten allein und dennoch immer einsam. Sie hasste die Tage und wartete auf den Abend. Die ihr wichtigste Zeit war der Abend mit den Erinnerungen an eine vergangene, bessere Zeit.
Sie blickte auf den See und dann auf die gegenüberliegende Seite, dahin, wo der Kibbuz lag, wo sie sich kennengelernt hatten. Sie konnte die Lichter des Kibbuz sehen, der direkt am gegenüberliegenden Ufer und zu Füssen der Golanhöhen lag. Auf dieser Seeseite hatte ihre gemeinsame Geschichte, ihr gemeinsames Leben begonnen. Ihre Situation erschien ihr so unwirklich, war ihrem bisherigen Leben so fern.
Ankunft
Welcher Gegensatz zu der Frau, die vor fünf Jahren vollkommen naiv in dieses Land gekommen war, ohne große Pläne, ein Abenteuer suchend, fasziniert von allem, was sie gelesen hatte, gelangweilt vom geregelten Leben in Deutschland.
Susanne hatte Abitur gemacht und keine der Optionen, die sie danach hatte, erschienen ihr verlockend. Ihre Freunde hatten ganz normale Ziele wie Studium oder Lehre. Ihr jedoch schien das alles eintönig, langweilig, das Leben musste mehr zu bieten haben. Jedes Mal wenn sie gefragt wurde, was sie denn machen wolle, konnte sie keine Antwort geben. Je mehr sie darüber grübelte, desto sicherer wurde sie, dass sie einen anderen Weg gehen musste. Sie wollte das Leben spüren, Aufregung, Abenteuer und Ungewissheit.
Der Zufall half ihr, als sie von der Möglichkeit hörte, in einem Kibbuz zu leben und zu arbeiten. Damals schien es ihr die perfekte Lösung zu sein. Einfach hinfliegen, sich in einem Büro in Tel Aviv melden und dann Voluntärarbeit in einem Kibbuz leisten, Unterkunft und Verpflegung gegen Arbeit. So musste sie nicht allein durch die Welt reisen und konnte trotzdem ein anderes Leben führen.
Ihre Freunde bewunderten ihren Mut; nur sie wusste, tief drinnen, dass es mehr eine Flucht war. Ihr erschien dieser Weg so viel einfacher, als sich einen Studienplatz zu suchen und in eine andere Stadt zu gehen. So viele Entscheidungen, die sie hätte treffen müssen. Wie viel einfacher war es da, in ein Flugzeug zu steigen und sich dem neuen Unbekanntem entgegentreiben zu lassen. Erst als sie am Flughafen stand und noch einmal in das weinende Gesicht ihrer Mutter blickte, wurde ihr klar, dass sie von da an auf sich allein gestellt war. Alles ihr Vertraute blieb zurück. Sie fühlte die Angst, alles in ihr wollte umkehren, zurück zu dem Leben, dass ihr gestern noch so öde vorgekommen war. Nur ihrem Stolz hatte sie es zu verdanken, dass sie sich umdrehte und durch die Passkontrolle ging.
Schon im Flugzeug wurde ihr bewusst, in welch andere Welt sie da eingetaucht war. Um sie herum saßen viele junge Israelis, die sich lautstark unterhielten, in dieser Sprache, die keiner der Sprachen die sie kannte ähnelte. Schon der Klang der Stimmen schien Aufregung und Abenteuer zu versprechen. Die Unterhaltungen schienen ihr erregt, fast ärgerlich, als ob man über wichtige Dinge heftig diskutieren musste. Später würde sie erfahren, dass Israelis sich auch bei ganz alltäglichen Gesprächen laut, aufgeregt und heftigst gestikulierend unterhielten. Gleich zu Beginn mochte sie den Klang des Hebräischen und wollte diese Sprache unbedingt lernen.
Langsam fing sie an sich auf dieses neue Leben zu freuen, mit jeder Flugstunde wich die Angst und sie spürte wie sie sich schon jetzt von zu Hause entfernte.
Sie kam spät abends in Tel Aviv an. Das Flugzeug landete sanft und rollte zu einem breiten, flachen Gebäude, aus dessen Fenstern Licht schien. Sie blieb auf ihrem Platz, folgte den Anweisungen der Stewardess aus dem Lautsprecher. Alle sollten angeschnallt sitzen bleiben, bis sie die Parkposition eingenommen hatten.
Die Israelis standen trotzdem auf, fingen an ihre Gepäckstücke, von denen sie eine Menge besaßen, aus den Fächern über den Sitzen zu reißen. Es gab lautstarke Rangeleien, wenn Taschen und Koffer auf andere Passagiere fielen. Die wenigen Europäer, die auf ihren Plätzen geblieben waren, betrachteten amüsiert das wilde Treiben.
Als das Flugzeug nicht weit vom Gebäude entfernt zum Stehen kam, standen fast alle Passagiere dicht gedrängt mit ihren Taschen im Gang. Als die Tür aufging, wurde gedrängelt und geschubst. Warum hatten es alle so eilig? Es gab um diese Zeit keine Verbindungsflüge, die sie erreichen mussten. Erst, als sich die drängende Menge langsam zum Ausgang geschoben hatte, stand sie auf, griff nach ihrer kleinen Tasche mit den wichtigsten Dokumenten und verließ das Flugzeug.
Die heiße stickige Luft draußen nahm ihr fast den Atem. Sie trug Jeans, Turnschuhe, eine Bluse und einen Parka. Sie fühlte, dass ihr der Schweiß über Gesicht und Rücken lief. Noch während sie die Treppe des Flugzeugs hinunterging, zog sie schnell die Jacke aus. Wie mochte die Hitze erst tagsüber sein?
Sie sah, wie die letzten Israelis im Laufschritt hinter einer Glastür des großen Gebäudes in der Halle verschwanden und eilte ihnen nach, in der Hoffnung auf Abkühlung. Als sie durch die Tür trat, befand sie sich in einer hohen, hell erleuchteten, voll klimatisierten Halle. Vor sich sah sie eine Menschenschlange, die sich langsam auf zwei Schalter zubewegte. Während sie sich dem Schalter näherte und sich aufmerksamer umschaute, entdeckte sie ein Schild, auf dem in großen hebräischen Buchstaben und darunter in kleineren englischen Lettern stand: Nur israelische Staatsbürger! Ein Moment der Panik ergriff sie. Wo sollte sie hin? Sie blickte sich um, erspähte fünfzig Meter weiter einen anderen Schalter, an dem nur wenige Leute standen. Sie verließ ihren Platz, bevor sie an der Reihe gewesen wäre, und eilte zu dem anderen Schalter. Einige der Europäer, die hinter ihr standen, folgten.
Erneut musste sie warten. Hier stand ein Schild mit der Aufschrift Non-Israelis und jeder Einzelne wurde ausgiebig befragt. Es dauerte eine Ewigkeit, bis die Reisenden vor ihr abgefertigt waren. Mittlerweile war sie müde geworden und die Frage, wo sie die Nacht verbringen sollte, hatte sie noch nicht geklärt.
Endlich war sie an der Reihe, freundlich lächelnd zeigte sie ihren Pass. Der junge Beamte blickte auf das Dokument und anschließend auf Susanne. Sie fühlte sich unter dem kritischabschätzenden Blick unwohl. Auf Englisch, mit dem heftigen israelischen Akzent, wollte der Beamte wissen, warum sie nach Israel reiste. Sie gab ihm den Brief mit der Einladung der Kibbuz Organisation und er fragte, wie lange sie bleiben wollte. Sie sagte: »Ein Jahr.« Ihr Gegenüber hob scheinbar skeptisch die Augenbrauen. Sie hasste es dass er ihr das Gefühl gab, ein Eindringling zu sein. Noch einmal musterte er sie von Kopf bis Fuß. Dann hob er den Stempel und knallte ihn auf ihren Pass. Als sie das Dokument zurücknahm, zwinkerte er ihr zu: »Welcome to Israel!« Sie hätte ihn erwürgen können, ging jedoch vorwärts und war offiziell im Gelobten Land.
Wieder schaute sie sich in der Halle um. Der Schalter für die Israelis war geschlossen, knapp vor sich entdeckte sie einige von ihnen. Sie folgte ihnen, gelangte in eine andere, viel kleinere Halle, an deren Ende große Fensterscheiben waren, hinter denen viele Menschen standen, die den Fluggästen zuwinkten und kleine Kinder hochhoben. Manche Kinder hatten Luftballons in der Hand, Erwachsene hielten Blumen und Schilder. Dies war die letzte Station, bevor man von Familien und Freunden empfangen wurde.
Sie wurde von niemandem erwartet.
Weil ihre Maschine die letzte des Abends war, fand sie das Band mit den Koffern schnell. Die meisten anderen Passagiere hatten ihr Gepäck schon heruntergewuchtet. Auf dem Band liefen noch ein halbes Dutzend Gepäckstücke im Kreis. Sie sah ihren prall gefüllten blauen Rucksack auf den ersten Blick, ging ein Stück vor ihm auf das Transportband zu, wartete darauf, bis der Rucksack in greifbare Nähe kam, und griff ihn mit aller Kraft. Zu Hause hatte sie ihn auf einen Stuhl gestellt, um ihn auf ihren Rücken zu heben. Vom Boden aus, neben dem Transportband, war das schwieriger. Sie kniete sich hin, griff mit den Armen an den Riemen vorbei und versuchte mit wackligen Knien aufzustehen. Sie schaffte es erst beim zweiten Versuch.
Jetzt musste sie nur noch zum Ausgang und sich schnell überlegen, wo sie die Nacht verbringen würde. Für ihren ursprünglichen Plan, direkt zum Büro der Kibbuzime zu gehen und weiter in einen Kibbuz zu fahren, war es bereits zu spät. Sie würde in Tel Aviv übernachten.
Als sie aus dem Flughafengebäude trat, bemerkte sie als Erstes den Geruch, wie andere Ländern hatte auch Israel seinen spezifischen Geruch. Hier roch es nach heißem Asphalt, Dieselmotoren, aber auch nach Palmen und etwas unbeschreiblich Orientalischem. In den darauf folgenden Jahren, wenn sie von Urlauben zurückkam, war es immer dieser Geruch, der ihr das Gefühl der Heimkehr vermittelte. Dieses seltsame Gefühl des Fremden, aber trotzdem Vertrauten sollte sie ihr ganzes Leben begleiten. Kein anderes Land hatte ihr jemals dieses Gefühl gegeben.
Sie ging durch die lange Absperrung, an der links und rechts erwartungsvolle Familien standen, die ihre Verwandten und Bekannten abholen wollten, bis zum Ende, dort wo die Taxen warteten. Sie entschloss sich ein Taxi zu nehmen und den Fahrer zu bitten, zu einem der teuren Hotels zu fahren. In den letzten Minuten war sie zu dem Entschluss gekommen lieber ein teures Hotel zu nehmen und kein Risiko einzugehen. Sie war sehr müde und erschöpft und wollte an diesem Abend nur noch duschen und schlafen. Für Abenteuer war auch morgen noch Zeit.
Der Taxifahrer verstand etwas Englisch und nannte ihr das Hotel Dan, ein 5-Sterne-Hotel direkt am Meer.
Sie fuhren mitten durch Tel-Aviv, eine typische Großstadt mit viel Verkehr und vielen Lichtern. Der Unterschied zu Städten in Europa waren die Gebäude: drei- bis vierstöckige Häuser, die früher wohl alle weiß gestrichen waren, aber an denen die Zeit und die Witterung Spuren hinterlassen hatten, Häuser wie aus einer anderen Epoche. Auf jedem dieser Gebäude ragte auf dem Dach ein riesiger Wassertank auf und an den Seiten hingen unter fast allen Fenstern viereckige Kästen. Wie sie später erfahren sollte waren das Klimaanlagen. Zwischendrin sah man aber auch ein modernes Tel Aviv mit imposanten Hochhäusern und gläsernen Fassaden.
Nach fünfzehn Minuten hielt der Taxifahrer vor einem luxuriös aussehenden, hell erleuchteten Hotel. Sie bezahlte und trat in eine sehr vornehm wirkende Eingangshalle. Mit ihrem Rucksack fiel sie hier sofort auf und erntete abschätzende Blicke, aber als sie ihre Kreditkarte zeigte, hatte man ein Zimmer für sie.
Am nächsten Morgen, ausgeruht und voller Tatendrang, fragte sie an der Rezeption nach dem Weg zum Büro der Kibbutzimbewegung. Das Büro lag nicht weit vom Hotel, sodass sie sich entschloss zu Fuß zu gehen. Sie schulterte ihren Rucksack und trat nach draußen.
Trotz der frühen Uhrzeit nahm ihr die Hitze fast den Atem, daran würde sie sich noch gewöhnen müssen. Sie ging die breite Straße direkt am Meer entlang, auf der einen Seite fiel der Blick auf den Strand und das Meer, auf der anderen Seite standen mehrere Hotels. Anders als gestern Abend bemerkte sie jetzt die Lautstärke und Hektik der Stadt, überall wurde gehupt, die Busse und Lastwagen mit ihren lauten, nach Diesel stinkenden Motoren, Motorräder und Mopeds knatterten an ihr vorbei. Sie genoss dieses pulsierende Leben um sie herum, war aber froh, als sie endlich das Gebäude der Kibbuzime erreichte.
Es war ein altes Haus, doch zu ihrer Erleichterung funktionierte die Klimaanlage und es war angenehm kühl. Sie fand das Büro dank eines Schildes in englischer Sprache. Alle anderen Schilder waren in Hebräisch, ein Umstand, der es einem in Israel nicht gerade leicht machte sich zu orientieren.
Sie klopfte an und trat ein. Auf ihr fröhliches »Schalom« folgte nur ein mürrisch gemurmeltes »Schalom« einer älteren Frau, die in einem kleinen Raum an einem alten Schreibtisch saß. Die Jalousien waren zugezogen. Es roch nach Zigarettenrauch und Kaffee. In dem Zimmer standen nur ein paar Regale mit alten Ordnern. Die Wandfarbe mochte früher weiß gewesen sein, war aber wegen des Zigarettenrauchs in das dafür typische Ocker übergegangen.
Susanne nannte der Frau ihren Namen und erklärte, warum sie hier war, woraufhin ihr die Frau einen Zettel gab. Darauf standen der Name des Kibbuz und die Nummer des Busse, den sie in Richtung Tiberias nehmen sollte. Die Frau erklärte ihr kurz den Weg zum Zentralbahnhof. Susanne hoffte, dass nicht alle Kibbuzniks so unfreundlich sein würden. Erneut beschlich sie das Gefühl einen Fehler gemacht zu haben, aber so schnell wollte sie nicht aufgeben.
Sie trat wieder auf die Straße in die immer schlimmer werdende Hitze. Ihr Rucksack erschien ihr schwer wie Blei, aber sie musste sich jetzt beeilen um den Bus zu erreichen.
Erst nach mehrmaligem Nachfragen fand sie den Busbahnhof. Dort wimmelte es wie in einem riesigen Ameisenhaufen. Alle versuchten irgendwo hinzukommen, es wurde gedrängelt und geschubst. Sie hatte Mühe mit ihrem Rucksack, immer wieder rempelte sie Leute an und erntete böse Blicke. Sie versuchte Bus Nummer elf zu finden, aber alle Schilder waren wieder nur in Hebräisch beschriftet und daher für sie unlesbar.
Sie suchte nach einem Informationsschalter, den sie nach einigem Herumirren fand. Die junge Israelin hinter dem Schalter war sehr freundlich und auch in der Lage, ihr in Englisch zu erklären, wo ihr Bus halten würde.
Erleichtert bahnte Susanne sich den Weg zurück durchs Getümmel und fand die Haltestelle. Der Bus wartete schon und war fast vollständig besetzt.
Sie fand einen Sitz nicht weit vom Fahrer entfernt, sodass er ihr sagen konnte, wann Sie aussteigen musste. Ihr Kibbuz hieß Ha ’On, das war alles, was sie wusste. Ihr war vollkommen unklar, wo in Israel dieser Kibbuz lag und wie lange diese Fahrt dauern sollte.
Überall im Bus saßen junge Soldaten und Soldatinnen in grünen Uniformen, kräftig und sportlich aussehende junge Männer und Frauen, aber beunruhigenderweise alle mit Gewehren. Nicht dass sie davor Angst hatte, aber der Anblick war für jemanden aus Europa sehr ungewöhnlich. Neben ihr saß ein Mann, mittleren Alters, blond, mit freundlichem, offenem Gesichtsausdruck. Als sie aus Tel Aviv herausfuhren, auf eine große breite Straße, die direkt am Meer entlangführte, sprach er sie auf Englisch an. Er wollte wissen, wohin sie fahren würde. Froh über die Unterhaltung und dankbar für jede Information, nannte sie ihm den Namen des Kibbuz.
Er erzählte ihr, dass der Kibbuz sich am See Genezareth am Fuße der Golanhöhen befinde. Mit dem Stolz, den alle Israelis für ihr Land empfinden, bekam sie noch eine kostenlose Unterrichtsstunde in Geografie und über die Geschichte der Region, des Sees Genezareths sowie der Stadt Tiberias. Sie war froh, jetzt wenigstens die Richtung ihrer Reise zu kennen.
Nach einer Stunde verließ er den Bus und wünschte ihr viel Glück. Sie war erfreut, wie einfach es hier schien Kontakte zu knüpfen, so unkompliziert, und dass sie bis jetzt noch auf keine Abneigung gestoßen war, obwohl sie aus Deutschland kam.
Im Bus war es ruhig. Die meisten der jungen Soldaten und Soldatinnen schliefen ein, sobald sie einen Platz gefunden hatten. Die anderen Fahrgäste schauten aus dem Fenster. Nur hier und da unterhielt sich jemand mit seinem Nachbarn. Sie blickte ebenfalls hinaus. Die Landschaft wechselte häufig. Mal sah sie kahles, ausgedörrtes Gelände, mal bepflanzte Felder. Häufig sah sie Bewässerungsanlagen, deshalb waren die Pflanzen auf den Feldern trotz der sengenden Hitze satt grün.
Je weiter sie sich von Tel Aviv entfernte, umso weniger Verkehr herrschte.
Tal
Nach etwa zwei Stunden erreichten sie eine Anhöhe, von der man in ein wunderschönes Tal blickte, in dessen Mitte ein großer, blau schimmernder See lag. Rechts sah sie eine Stadt, die sich an die Hügel festzuklammern schien und sich bis hinunter an die Ufer des Sees erstreckte. Auf der gegenüberliegenden Uferseite erhoben sich zerklüftete braune Bergketten, an deren Fuß sich grüne Felder und Plantagen entlangzogen. Dieser Anblick machte sie atemlos, nie hatte sie so etwas empfunden, so wunderschön, fremdartig und gleichzeitig so vertraut, als wäre sie hier schon gewesen, als würde sie heimkehren. Dieses Gefühl war so einzigartig, sie würde es nie richtig erklären können, ohne lächerlich zu klingen, aber es sollte sich nie verändern. Sie würde diesen Ort später ihren Heimkehrort nennen und dieses Tal, dieser See würden ihr Leben entscheidend verändern.
Der Bus quälte sich den Berg hinunter durch die kleine orientalisch wirkende Stadt Tiberias. Anders als in der modernen Stadt Tel Aviv, schien hier die Zeit stehen geblieben zu sein. Überall priesen Händler an kleinen Marktständen ihre Waren an. Im Vorbeifahren sah sie Gewürz-, Obst- und Gemüsestände sowie kleine Verkaufstische, auf denen Töpfe und Haushaltswaren angeboten wurden, so wie sie es schon oft in arabischen Staaten gesehen hatte. Die Häuser der Altstadt unterschieden sich wenig von denen in Tunesien oder Marokko. Sie nahm sich vor, später auf jedem Fall einen Ausflug hierher zu machen.
Schließlich verließ der Bus die Stadt und fuhr entlang des Sees auf einer schmalen Uferstraße, die zum See hin den Blick auf kleine Strände freigab. An den Stränden sah sie Familien, die in der Sonne lagen, schwammen und grillten.
Je mehr sie sich von der Stadt entfernten desto wilder und ursprünglicher wurde die Landschaft. Hier war das Ufer komplett überwuchert von Büschen und Sträuchern. Sie war so mit der Landschaft und ihren Eindrücken beschäftigt, dass sie kaum merkte, als der Bus plötzlich hielt. Der Fahrer gab ihr zu verstehen, dass sie hier raus musste. Froh endlich am Ziel zu sein, stieg sie aus.
Der Bus fuhr geräuschvoll los und alles was sie sah war die Straße und dahinter der See, keine Gebäude, keine Siedlung, nichts. Sie drehte sich um und auch hinter ihr nichts als endlos weite Felder. Für einen Moment konnte sie es nicht fassen. Hatte der Busfahrer sie nicht verstanden oder sich mit ihr einen üblen Scherz erlaubt? Panik kroch in ihr hoch. Sie wollte weinen, gleichzeitig war sie aber wütend auf sich selbst. Das hatte sie nun von ihrer Abenteuerlust. Gestrandet in einem fremden Land, hier gab es weder Taxen, noch sonst was, das man mit Geld regeln konnte. Es gab noch nicht einmal Schatten, um sich vor der erbarmungslosen Sonne zu schützen.
In den letzten zehn Minuten war nicht ein Auto an ihr vorbeigefahren. Sie musste einen klaren Kopf bewahren und erst einmal in Ruhe nachdenken.
Kibbuz
In der Ferne, an der linken Seite des Sees lag Tiberias, schätzungsweise zehn Kilometer entfernt. Zur Not musste sie dahin zurückgehen.
Als sie sich mit dem Gedanken fast abgefunden hatte, hörte sie ein Motorengeräusch aus der entgegengesetzten Richtung kommen. Es kam immer näher und sie sah einen offenen Jeep auf sich zu fahren. Als der Jeep auf ihrer Höhe war, erkannte sie darin drei junge bärtige Männer, die alle die gleiche etwas verschmutzte, blaue Arbeitskleidung trugen. Sie sahen nicht sonderlich vertrauenserweckend aus.
Der Jeep fuhr vorbei und obwohl ihre einzige Option ein langer, heißer, beschwerlicher Fußmarsch war, fühlte sie eine gewisse Erleichterung. Sie schulterte ihren schweren Rucksack und war im Begriff loszugehen, als sie das Motorengeräusch wieder hörte. Ihr erster Gedanke war wegzulaufen, aber wohin in dieser Einöde? Sie bremsten direkt neben ihr. Aus der Nähe betrachtet sahen die drei mit ihren sonnengebräunten bärtigen Gesichtern nicht ganz so Furcht einflößend aus. Alle drei grinsten sie an und der Beifahrer fragte in gebrochenem Englisch, wo sie denn hin wolle. Zögerlich nannte sie ihnen den Namen des Kibbuz. Sie lachten und er meinte sie, solle einsteigen, das wäre ihr Kibbuz. Der Kleinere, der hinten saß, sprang aus dem Jeep, gab ihr zu verstehen dass sie den Rucksack hinten verstauen sollte und half ihr beim Einsteigen.
Ihr rasten tausend Gedanken durch den Kopf. Gedanken an Entführung, Vergewaltigung, sogar Mord, man würde sie nie finden. Sie war sich bewusst, obwohl sie sich nicht als gut aussehend bezeichnen würde, dass sie hier auffiel mit ihren blonden Haaren, den blauen Augen, jung, europäisch aussehend, nicht unattraktiv. Sie versuchte sich wieder zu beruhigen, die drei sahen wirklich freundlich aus und Israel war nicht für hohe Kriminalität bekannt.
Kaum saß sie hinten im Wagen, fuhr der Fahrer in rasantem Tempo wieder auf die Straße zurück, wobei er sie mit einem verschmitzten Lächeln im Rückspiegel musterte. Er sah gut aus mit seinen braunen Augen, den tiefbraunen gelockten Haaren, einer klassisch geraden Nase, dem dunklen Bart und den Grübchen, die sich zeigten wenn er lächelte. Er stellte sich ihr als Schalom vor, nachdem sie ihnen gesagt hatte, dass sie Susanne hieße. Sie wusste, dass viele hebräische Vornamen eine besondere Bedeutung hatten, aber seinen Sohn Schalom, also Frieden zu nennen, fand sie außergewöhnlich. Auch der etwas dickere Beifahrer lachte sie fröhlich an und stellte sich als Beda vor. Nur ihr Sitznachbar blieb stumm und schaute nicht einmal in ihre Richtung.
Durch den Fahrtwind und das Motorengeräusch des Jeeps war es schwer sich zu unterhalten, deshalb nutzte sie die Zeit, die drei etwas genauer zu betrachten. Alle drei hatten die gleichen blauen Arbeitshemden mit an den Schultern abgeschnitten Ärmeln an, dazu trugen sie die gleichen kurzen verwaschenen Hosen und grobe braune Arbeitsschuhe. Sie entsprachen genau dem Bild, das sie sich aus Berichten von Kibbuzniks gemacht hatte. Nun etwas beruhigter wandte sie sich der Landschaft zu. Sie befuhren die Straße am Ufer des Sees, rechts lagen große Bananenfelder und dahinter erhoben sich die zerklüfteten Steilhänge der Golanhöhen. Aus dieser kurzen Entfernung sahen sie noch imposanter aus. Auf der Seite zum See hin sah man große Hecken, die entlang der ganzen Straße wuchsen und den Blick zum See versperrten. Der Fahrer, der sich ihr als Schalom vorgestellt hatte, unterhielt sich lautstark auf Hebräisch mit seinem Beifahrer, aber sie bemerkte auch, dass er sie immer wieder im Rückspiegel beobachtete. Wann immer sich ihre Blicke trafen lächelte er sie aufmunternd an. Sie fühlte sich zwar immer noch fremd, hatte aber ihre Angst fast verloren.
Nach einigen Minuten erreichten sie auf der linken Seite ein großes Tor. Der Jeep hupte kurz und ein Mann, in der gleichen blauen Einheitskleidung, mit einem Gewehr über seiner Schulter, kam aus einem kleinen Wachhaus auf sie zu, nickte kurz und öffnete. Der Jeep fuhr jetzt über eine breite Einfahrtsstraße, vorbei an landwirtschaftlichen Gebäuden auf der einen und hohen Palmen und Grasflächen auf der anderen Seite. Alles sah sehr gepflegt aus. Am Ende der Straße hielt der Jeep in einem Rondell, in dem mehrere Traktoren und einige Autos parkten.
Die Männer sprangen aus dem Jeep. Der Kleinere, dessen Namen sie immer noch nicht kannte, zerrte ihren Rucksack von der Ladefläche und gab ihr durch ein Zeichen zu verstehen ihm zu folgen. Die beiden anderen gingen auf einen großen, rechteckigen Flachbau zu und verschwanden darin.
Sie war etwas enttäuscht, sie hätte sich ein wenig mehr Aufmerksamkeit gewünscht, aber sie folgte dem kleinen stummen Kibbuznik. Da er bisher noch kein Wort mit ihr gesprochen hatte, nahm sie an, dass er kein Englisch verstand.
Sie gingen auf einem der vielen kleinen Wege, die hier überall durch das Parkgelände führten. Rechts des Wegs standen alle fünfzig Meter kleine einstöckige Flachdachhäuser. Sie sahen in ihrer grauen verblichenen Farbe, mit zwei bis drei kleinen Fenstern, einer Tür und einer kleinen Veranda vor dem Haus, alle gleich aus. Auf den Dächern befanden sich die Wassertanks, die ihr schon auf der Busfahrt aufgefallen waren, sowie die viereckigen Kühlaggregate, ohne die bei dieser Hitze wohl niemand auskam. Fast vor jedem Haus wuchsen prächtige Hibiskusbüsche. Vor manchen Häusern standen kleine Tische und Stühle aus Rattan, vor einigen lag Kinderspielzeug. Je mehr sie sah, desto besser gefiel es ihr hier.
Ihr Kibbuzführer blieb so plötzlich stehen, dass sie ihn fast umgerannt hätte. Er zeigte mit ausgestrecktem Arm auf ein zweistöckiges Haus, das sich hinter einigen Bäumen zu verstecken schien. Sie lächelte ihrem stummen Begleiter zu und ging zum Haus Dieses Haus unterschied sich aufgrund der Anzahl der Türen von allen anderen. Es gab drei Türen. Da auf einer Office stand, klopfte sie dort an und trat in einen kleinen Raum. Ein junges Mädchen ihres Alters saß an einem alten, schäbigen Schreibtisch. Sie lächelte Susanne freundlich an, begrüßte sie mit »Schalom« und stellte sich als Lilach vor. Sie sprach fließend Englisch und erklärte Susanne die wichtigsten Dinge, die diese wissen musste: Sie würde bei den anderen Volontären in einem Doppelzimmer untergebracht. Am nächsten Morgen würde sie mit den anderen um sechs Uhr zur Arbeit eingeteilt werden. Es gab täglich drei Mahlzeiten in der Dining Hall, ihre Wäsche konnte sie einmal die Woche zum Waschhaus bringen, dort würde sie gewaschen und gebügelt. Monatlich bekam sie ein Taschengeld, mit dem sie in dem kleinen kibbuzeigenen Laden die nötigsten Kleinigkeiten einkauften konnte. Bettwäsche, Arbeitskleidung und -schuhe wurden gestellt.
Lilach ging zu einem braunen Schrank, musterte sie kurz und kramte einige kurze blaue Hemden und Hosen aus dem Schrank, die schon bekannte Einheitskleidung. Sie fragte Susanne nach ihrer Schuhgröße und stellte ein Paar hässliche, braune, gebrauchte Arbeitsschuhe auf den Schreibtisch. Zuletzt bekam sie auch noch einen Satz verwaschener grauer Bettwäsche. Zu Hause hätte Susanne niemals gebrauchte Schuhe anderer Leute getragen und derartige Arbeitskleidung trugen dort nur Leute vom Bau.
Endlich packte Lilach alle Sachen in einen großen Wäschesack. Sie ging vor Susanne aus dem Büro, schloss hinter ihnen ab und begleitete sie zu den Quartieren der Volontäre. Wieder kamen sie an den kleinen, gleich aussehenden Häusern vorbei; erstaunlich, wie weitverzweigt das Gelände war. Sie erreichten einen Bereich, in dem fast nur Palmen und Hecken standen, fast so, als wäre der Kibbuz hier zu Ende, aber der kleine Weg ging mitten durch zwei größere Büsche hindurch.
Plötzlich standen sie auf einer Lichtung, an deren Ende aneinandergereiht etwa zwanzig Baracken standen. Waren die Häuser der Kibbuzniks schon spartanisch, so sahen diese Gebäude hier sehr viel älter und verfallener aus. Wie Susanne später erfahren sollte, waren dies die ersten Häuser des Kibbuz aus dessen Gründungszeit. Die Häuser standen etwas erhöht auf Holzpfosten, alle paar Meter führte eine kleine Treppe auf eine schmale Holzveranda, von der die Türen zu den einzelnen Zimmern abgingen.
Lilach erklärte Susanne, dass sie ein Zimmer mit einem deutschen Mädchen namens Silke teilen würde und ihr gemeinsames Zimmer sich am Ende der Reihe befinde. Sie zeigte ihr die Toiletten und Waschgelegenheiten, die versteckt auf der linken Seite des Platzes, hinter hohen Büschen lagen. Sie musste sich zusammenreißen, um die junge Israelin nicht sehen zu lassen, wie sehr sie dieser Anblick schockierte. Die Waschplätze befanden sich in einer offenen Baracke, in der rund zwanzig Duschen installiert waren. Die einzelnen Duschen waren durch Holzwände getrennt. Als Tür diente eine halbe Tür, ähnlich den Saloontüren in Westernfilmen. Nebenan befanden sich die Toiletten, zehn winzige Verschläge mit alten klapprigen Holztüren, die an der Hinterseite mit kleinen Öffnungen versehen waren, die als Fenster dienten.
Lilach begleitete Susanne bis zu deren Zimmer am Ende des Platzes und verabschiedete sich.
Sie sehnte sich danach allein zu sein, um ihre Eindrücke erst einmal zu verarbeiten. Sie war erschöpft von der Reise und die Enttäuschung über ihre neuen Lebensbedingungen saß tief. Sie stieg die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf und trat ein.
Der Raum war etwa vierzehn Quadratmeter groß, auf der linken Seite stand ein altes Bett, auf dem die gleiche graue Bettwäsche lag wie die, die sie in ihrem Wäschesack trug. An der Wand hingen selbst gemalte bunte Bilder. Als Nachttisch hatte sich die ihr unbekannte Silke Orangenkisten aufgestapelt und ein buntes Tuch darüber gelegt. In der Ecke stand noch ein alter, schmaler, bunt bemalter Kleiderschrank. Durch die Mitte des Zimmers war eine Schnur gespannt, an der ein Leinentuch mit Batikmuster als Vorhang befestigt war. Auf der rechten Seite standen ein identischer Kleiderschrank als Raumteiler und dahinter das Bett, das nun das ihre sein würde.
Sie befreite sich von ihrem schweren Rucksack und warf sich auf das ungemachte Bett. Alles, was sie in diesem Moment wollte, war nach Hause fahren und ihre Abenteuerlust einfach begraben. Sie wollte losheulen aber selbst dazu war sie zu müde.
Volontäre
Sie musste wohl über ihrem Kummer eingeschlafen sein und wachte auf, weil sie Stimmen hörte. Plötzlich flog die Tür auf. Ein Mädchen, ungefähr in ihrem Alter, mit blondem Lockenkopf, klein und zierlich betrat den Raum. Sie lachte Susanne an und kam auf sie zu, um sie zu begrüßen. Silke hatte wohl aus ihrer eigenen Erfahrung sofort verstanden, wie ihr zumute war. Sie erzählte, dass alle hier am Anfang etwas erschüttert waren, aber die meisten lebten sich rasch ein und gewöhnten sich an die äußeren Umstände.
Zusammen bezogen sie das Bett und räumten Susannes Sachen ein. Schließlich kramte Silke aus ihrem Schrank zwei Poster hervor, eins von Che Guevara und das andere mit einem riesigen Cannabisblatt. Sie lachte und meinte, es sei nicht wichtig, ob die Poster zu ihrer Gesinnung passen würden, Hauptsache, die scheußlichen Wände wären verdeckt. Erstaunlich, wie schnell Susannes Stimmung sich hob. Sie begann sich wohler zu fühlen. Dieses Zimmer fühlte sich beinahe wie ein neues Zuhause an.
Silke erklärte Susanne die Tagesabläufe im Kibbuz: Morgen waren sie beide für die Arbeit in den Bananenplantagen eingetragen. Das hieß um fünf Uhr aufstehen, duschen und um sechs traf man sich im Speisesaal zur Arbeitseinteilung. Um neun kam man zurück und es gab Frühstück, danach ging man wieder bis zwölf Uhr arbeiten. Die Mittagspause dauerte bis vierzehn Uhr, da sie wegen der Hitze nicht arbeiten konnten, der Arbeitstag endete um siebzehn Uhr.
Silke nannte den Bereich der Volontäre ihr kleines Weltdorf. Zurzeit lebten hier Jugendliche aus zehn Ländern. Sie fühlten sich als eingeschworene Gemeinschaft, die meisten von ihnen waren aus ähnlichen Gründen hier und verstanden sich gut. Natürlich gab es auch hier, wie überall, die eine oder andere Ausnahme. Während sie erzählte, kramte Silke einen alten Wasserkessel aus dem Schrank, ging nach draußen und kam mit dem gefüllten Kessel zurück. Sie erklärte Susanne, dass dies zu ihrem Ritual gehöre, nach der Arbeit erst einmal eine Tasse Tee mit Minze zu trinken. Ein Ritual, mit dem sich Susanne sehr gut anfreunden konnte.
Sie tranken Tee und erzählten wo sie zu Hause waren und was sie in dieses Land verschlagen hatte.
Nach einer halben Stunde kam Silke vom Duschen zurück. Sie wollte Susanne vor dem Abendessen noch einige der anderen Volontäre vorstellen. Sie verließen ihr Zimmer und traten auf die Veranda. Überall waren nun Lichter an, es war sehr schnell dunkel geworden. Vor den meisten kleinen Baracken saßen Jugendliche und unterhielten sich. Am Ende ihrer Barackenreihe hörte sie Gitarrenklänge und auf diese Gruppe steuerte Silke zu. Als sie dort ankamen, begrüßten alle Silke freundlich und Susanne wurde ihnen vorgestellt. Sie hatte Schwierigkeiten, sich alle Namen zu merken.
Da war Alex, der Gitarre spielte, ein langhaariger, älter aussehender Schotte. Er war, wie sie von ihrem Gespräch wusste, Silkes Freund. Er lachte sie freundlich an und sagte etwas in Englisch, aber sie verstand kein Wort. Es sollte noch Wochen dauern bis sie den schottischen Akzent von Alex verstehen würde. Dann war da noch Ian, ein Junge aus London, mit der für Engländer typischen rötlich-verbrannten Haut und rotblonden Haaren. Er hatte ein verschmitztes Lächeln und taxierte Susanne von oben bis unten. Jette war ein etwas pummeliges, blondes norwegisches Mädchen, die sofort aufsprang und sie herzlich umarmte. Daneben stand Anneke, dunkelbraune zerzauste Haare, die aus Holland kam und freundlich nickte. Zum Schluss wurde ihr noch ein sehr gut aussehender, braun gebrannter, schwarzhaariger Franzose namens Jean-Marc vorgestellt.
Nach der Begrüßung spielte Alex wieder Gitarre und die meisten sangen mit. Ian reichte ihr eine Cola und bat sie, sich zu setzen. Sie fühlte sich nicht unerwünscht in dieser eingeschworenen Gemeinschaft, aber etwas verunsichert. Die Stimmung war ungezwungen und sie spürte, dass sie hier dazugehören wollte. Plötzlich brach Alex mitten im Spiel ab und lauschte. Aus einiger Entfernung hörte man ein Glockengeräusch, die Essensglocke. Alex brachte seine Gitarre in sein Zimmer und gemeinsam brachen sie zum Speisesaal auf.
Sie schlenderten den gleichen Weg zurück, den Susanne heute Mittag mit Lilach genommen hatte. Aus allen Richtungen strömten die Kibbuzniks herbei und reihten sich ein in die Gruppe, die auf dem Hauptweg in Richtung Speisesaal unterwegs war. Sie musste innerlich schmunzeln, denn es erinnerte sie an die Filme, in denen alle wie ferngesteuert auf ein Ziel zusteuerten, ein fremdes UFO oder eine Gottheit. Die kleine Völkerwanderung hier steuerte auf das Abendessen zu.
Alex, der mit Silke Hand in Hand neben Susanne ging, erklärte ihr, dass nach einem solch langen Arbeitstag alle hungrig wären und deshalb die meisten direkt zum Essen gingen. Das Abendessen wurde zwar zwei Stunden lang serviert, aber fast alle kamen gleich um sieben.
Als sie den Speisesaal erreichten, hatte sich dort eine lange Schlange gebildet. Das gab Susanne die Gelegenheit, sich die Leute in Ruhe anzusehen. An diesem Abend erschien niemand in der blauen Einheitskleidung. Die Männer kamen alle in kurzen Hosen, T-Shirts und Sandalen, die Frauen trugen entweder Jeans und T-Shirt oder einfach geschnittene Sommerkleider. Hier war niemand auffällig gekleidet, keiner stach aus der Masse hervor. Die jungen Israelis, sowohl Frauen als auch Männer, hatten sportliche, gebräunte Körper, selten hatte sie so viele gut aussehende Menschen gesehen. Es gab natürlich auch alte Kibbuzniks, denen man die harte Arbeit und das oft entbehrungsreiche Leben ansah. Deren Gesichter waren von Furchen und Falten gezeichnet.
Während Susanne diese Beobachtungen machte, bewegte sich die Schlange langsam Richtung Eingang, die Stufen hinauf. Als Susanne die Tür fast erreicht hatte, wurde sie von hinten geschubst und von zwei starken Händen zur Seite geschoben. Sie drehte sich etwas unwirsch um und sah direkt in das Gesicht ihres Fahrers von heute Morgen. Schalom! Seinen Mund umspielte wieder dieses verschmitzte Lächeln, bei dem sie nicht wusste, ob er sie anlächelte oder irgendwie mit ihr spielte.
Bevor sie ein Wort sagen konnte, meinte er in perfektem Englisch mit dem gewissen israelischen Akzent: »Entschuldigung, ich bin zu spät, muss heute das Essen ausgeben.« Schon war er an ihr vorbei und im Gebäude verschwunden.
Sie verstand selbst nicht genau, warum dieser Mann sie jetzt schon zum zweiten Mal aus der Fassung brachte. Eigentlich war überhaupt nichts geschehen, ein kurzes Schubsen, seine Hände auf ihrem Rücken, sie konnte sie noch immer fühlen, ein Lächeln, mehr nicht. Ihre Neugierde aber war geweckt. Sie drehte sich zu Silke um und fragte, ob sie diesen Kibbuznik kenne. Silke verdrehte nur die Augen und meinte, er lebe mit einer Israelin zusammen, würde mit jedem Mädchen flirten, aber bei den Partys der Volontäre und jungen Israelis tauche er nie auf. Sie hörte Silke zu und spürte die Enttäuschung die sie empfand.
Gemeinschaft
Der Speisesaal, der genug Platz für ungefähr dreihundert Leute bot, war mit Reihen von langen Holztischen und Stühlen ausgestattet, einfach und praktisch. Der Saal war weiß gestrichen, vereinzelt hingen ein paar Bilder an den Wänden. Der Boden war mit grauen, sauberen Fliesen ausgelegt. Auf der einen Seite des Raumes befanden sich Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichten, auf der anderen Seite eine Wand.
Die Schlange schob sich mittlerweile langsam am Buffet vorbei. Sie griff sich ein Tablett, Besteck und Teller und nahm sich nur Salat. Es gab die tollsten frischen Salate, die in Israel zu jedem Essen gehörten, selbst zum Frühstück. Außerdem gab es eine vegetarische Abteilung mit Gerichten die sie nicht kannte: verschiedene Teigtaschen mit Gemüsen, Blätterteigrollen, gefüllte Avocados, gegrillte Paprika und vieles mehr. Sie war überwältigt von der Auswahl. An jeder Buffettheke bediente ein Kibbuznik mit Schürze. Obwohl sie immer wieder betonte, sie wolle nur wenig, war ihr Teller schon jetzt fast überfüllt. An der Fleischausgabe wollte sie eigentlich vorbeigehen, doch da stand er, zwinkerte ihr zu und meinte, wer aus Deutschland komme brauche ein Schnitzel. Bevor sie sich versah, landete ein Schnitzel auf ihrem Teller. Zu spät ihm zu sagen, dass sie sehr selten Fleisch aß. Schon wurde sie weitergeschoben. Irgendwie schienen ihre Unterhaltungen sehr einseitig zu sein, sie war einfach nicht schnell genug.
Sie drehte sich um und ging zu einem der Tische, an dem die Volontäre saßen. Sie bemerkte viele neugierige Blicke von benachbarten Tischen.
Der Geräuschpegel im Speisesaal war enorm hoch, wieder konnte sie beobachten wie heftig gestikuliert wurde und man sich in einem fast brüllenden Ton unterhielt. Selbst die Volontäre unterhielten sich hier in einer anderen Lautstärke, was aber unvermeidlich war, wenn man sich verständigen wollte. Susanne hörte den verschiedenen Gesprächen angestrengt zu, ihr Englisch war etwas eingerostet, aber sie hoffte, es würde mit der Zeit besser werden. Trotzdem genoss sie die angeregte Atmosphäre, all das Neue. Ab und zu beantwortete sie ein paar Fragen, die an sie gerichtet wurden. Meist jedoch hörte sie zu, wenn die anderen von der Arbeit sprachen oder Pläne fürs Wochenende schmiedeten.
Als sie das Essen beendet hatten, kamen einige der jungen Israelis mit Weinflaschen und setzten sich zu ihnen. Susanne erkannte den etwas dickeren Beifahrer des Jeeps, Beda, wenn sie sich recht erinnerte. Er war sehr lustig, seine Geschichten brachten alle zum Lachen. Auch ihr stummer Begleiter kam an den Tisch. Sie fragte Silke, ob sie ihn kenne. Silke nickte, dies sei Yossi, er wäre sehr nett, aber schüchtern, außerdem wäre sein Englisch nicht sehr gut.
Beda schenkte ein Glas Wein ein und sie begann den Abend langsam richtig zu genießen. Er erzählte den anderen lachend, dass sie heute von ihnen aufgelesen worden war, und wahrscheinlich ziemliche Angst gehabt hatte.
In dem Moment kam Schalom durch den Mittelgang, an seiner Seite eine kleine zierliche israelische Frau, mit langen schwarzen Haaren. Er blieb stehen, grinste und meinte, Susanne hätte wohl Angst vor Entführern gehabt, so erschrocken hätte sie bei ihrem Anblick gewirkt.
Sie schämte sich jetzt, dass ihr ihre Emotionen so deutlich anzusehen waren. Sie hatte sich eingebildet mutiger gewirkt zu haben. Er strich ihr über die Schulter und meinte, so schlimm seien sie doch gar nicht. Seine Freundin, offensichtlich ungehalten darüber, dass er bei Susanne stehen geblieben war, zog ihn energisch weiter. Er ging mit ihr, schaute sich aber noch einmal um und zwinkerte ihr wieder zu.
Sie versuchte sich nichts anmerken zu lassen und tat so als würde sie den Gesprächen lauschen, aber er ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie wollte sich nicht schon am ersten Tag unglücklich verlieben dachte sie müsste ihn einfach ignorieren.
Yossi schien sie hin und wieder mit recht kritischem Blick zu beobachten, oder bildete sie sich das nur ein?
Sie saßen noch eine Weile zusammen, redeten, lachten und tranken, während der Speisesaal sich langsam leerte. Mittlerweile waren die meisten der jungen Israelis an ihren Tisch gekommen. Silke stellte Susanne jedem vor. Immer mehr Namen fielen: Victor, Nissim, Matti … heute würde sie sich nicht mehr alle merken können.
Eine ältere Israelin forderte sie auf den Speisesaal zu verlassen, da sie noch putzen müssten. Alle erhoben sich, gingen lachend und sich unterhaltend zurück zu ihren Unterkünften.
In vielen der kleinen Bungalows brannte jetzt Licht, vor einigen saßen Kibbuzniks und unterhielten sich. Nach einem anstrengenden Arbeitstag herrschte friedliche Ruhe.
Ihre Gruppe wurde immer kleiner, einer nach dem anderen der jungen Kibbuzniks scherte aus und nahm eine der Abzweigungen zu den Häusern, manche von ihnen mit einer der Volontärinnen im Arm. Susanne war sehr müde und zu ihrer Erleichterung erklärte ihr Silke, dass die meisten während der Arbeitswoche sehr früh schlafen gingen. An ihrer Baracke angekommen, verabschiedeten sie sich von den anderen und betraten ihr Zimmer.
Es kostete Susanne einige Überwindung zu den Waschräumen zu gehen, aber auch daran musste sie sich gewöhnen, wenn sie hier leben wollte.
Als sie endlich unter ihrer Decke lag und Silke das Licht ausmachte, war sie müde, aber auch glücklich hier zu sein. Sie hatte die richtige Entscheidung getroffen. Hier gab es Abenteuer und eine neue Welt, so wie sie es sich vorgestellt hatte. Menschen die eine andere, gerechtere Lebensform gefunden hatten, die nicht bestimmt war von Status und Geld.
Sie schloss die Augen und schlief, über dem gleichmäßigen Brummen der Klimaanlage, langsam ein.
Alltag





























