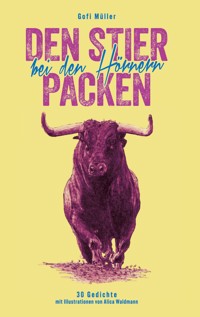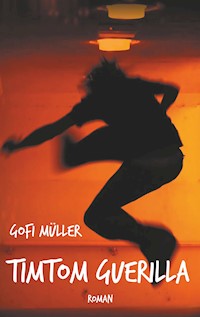
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Rockband TimTom Guerilla fehlt der durchschlagende Erfolg. Deshalb beschließen die vier Musiker, noch einmal alles dranzusetzen, um ihn zu erzwingen. Und das hat schlimme Folgen. Dieses Abenteuer führt seine Helden auf eine Odyssee quer durch das Deutschland des Jahres 2011. Es ist eine Geschichte über den Traum, ein Rockstar zu sein, über die Liebe und den Sinn des Lebens. Es ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Es ist die Geschichte von TimTom Guerilla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch: Timotheus Tengelmann wird von seinen Freunden nur TimTom genannt. Er ist zweiunddreißig, Sänger und Posaunist einer Punkband und völlig planlos, was er - abgesehen vom Musikmachen - mit dem Leben anstellen soll. Zusammen mit dem Gitarristen Foo hat er in Bielefeld Stellung bezogen, um ausgerechnet von hier aus in einem letzten, verzweifelten Anlauf den musikalischen Durchbruch zu schaffen. Als der Geschäftsmann Paulo seine Dienste als Manager anbietet, kommen die Dinge ins Rollen. Mit seiner Unterstützung gelingt es, die anderen Bandmitglieder nach Ostwestfalen zu lotsen und sich einen zweifelhaften Ruf als unterhaltsame Krawalltruppe zu erspielen. Ermutigt durch diesen Erfolg unterschreibt die Band einen Label Deal, produziert eine CD und geht auf Deutschland-Tournee. Doch es treten unerwartete Probleme auf, die wenig mit Musik zu tun haben. Denn TimToms große Liebe Sonja kommt mit dem eingeschlagenen Weg so gar nicht zurecht.
Gofi Müller wurde 1970 in Bremen geboren und hat in Bielefeld Literaturwissenschaften studiert. Er ist Künstler und Publizist und lebt mit seiner Familie in Marburg an der Lahn. Neben einigen Sachbüchern und einem Gedichtband hat er ein Rock-Album veröffentlicht, auf dem er singt und Posaune spielt.
Für Tipps, Ratschläge und andere Hilfe während meiner Arbeit an dieser Geschichte danke ich folgenden Menschen sehr herzlich: Andie, Anja, Birthe, Christine, Jay, Manu, Mareike, Martin, Philip, Tinka, Toby, Tobias, Simon, Stini und meiner Agentin Christine.
Inhaltsverzeichnis
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
FÜNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
SIEBENUNDVIERZIG
ACHTUNDVIERZIG
NEUNUNDVIERZIG
FÜNFZIG
EINS
http://timtom-guerilla.de/band/:
»Die Idee, TimTom Guerilla zu gründen, entstand in einer langen Regennacht im Bunker am Welfenplatz in Hannover, einem Zufluchtsort für Penner und andere Gestrandete. Den Gütersloher Foo und den Bremer TimTom hatte es beide unabhängig voneinander hierher verschlagen. Eingehüllt in ihre Schlafsäcke und den Geruch von Kot und Urin, ihre Habseligkeiten fest an den Körper gepresst, schmiedeten sie Pläne, um sich wachzuhalten und die nächsten Stunden heil zu überstehen. Als sie den Bunker am nächsten Morgen verließen, war die Idee geboren: Die Punkband TimTom Guerilla sollte ihr gemeinsames Projekt sein.
Zufälligerweise kannten sie beide Hannibal aus Friedberg, den weißen ostafrikanischen Bassisten. Foo hatte schon diverse Gigs mit ihm gespielt, TimTom war von ihm auf einer Hochzeit gerettet worden, als ein amoklaufender Schlagzeuger ihn hatte töten wollen. Hannibal, der Lust auf ein Abenteuer hatte, sagte sofort zu. Schließlich stieß noch BoingBoing, der einarmige Drummer aus Hamburg, zur Band. TimTom kannte ihn aus einer dort ansässigen Freikirche. BoingBoing, dem die Lobpreis-Musik seiner Gemeinde allmählich auf die Nüsse ging, freute sich auf eine echte Herausforderung.«
ZWEI
Dienstag, 29. März 2011
Das Miles liegt gleich um die Ecke. Wenn ich aus dem Eingang meines Wohnhauses auf die Straße trete, wende ich mich nach rechts und folge der Hermannstraße nur wenige Meter bis zum Niederwall. Dort überquere ich die Kreuzung, biege nach links ab und gehe die leichte Steigung nach oben, bis ich an die Stelle komme, an der die Detmolder Straße in die Kreuzstraße übergeht. Und da ist es auch schon. Rechter Hand führt eine Treppe hinab in den ehemaligen Bunker. Ich öffne eine Glastür und gehe rein. Hm. Das sieht anders aus, als ich es erwartet habe. Irgendwie zu nett. Irgendwie nicht abgefuckt genug. Bin ich hier wirklich richtig?
Ein junger, dicklicher Typ in Karohemd und mit rötlichen Landeierbacken steht hinter einem Tresen und begrüßt mich ostwestfälisch, nämlich überhaupt nicht.
»Äh, hallo. Ich hab ne Frage«, sage ich.
Mein Gegenüber reagiert nicht, sondern schaut mich schweigend an. Wahrscheinlich will er, dass ich weiterrede.
»Ich hab ein Demo bei euch in den Briefkasten geworfen. Ich, also wir sind ne Band, und wir würden gerne mal bei euch auftreten.«
Jetzt reagiert er. Er lässt seinen Kopf Richtung Tresen sinken, klatscht eine Hand gegen den zotteligen Pony und macht mit den Lippen ein ratterndes Geräusch, indem er eine Menge Luft aus seinem Körper entweichen lässt. »O Mann«, sagt er. »Sag mal, weißt du, wie viele Demos hier bei uns reinkommen?«
Soll ich darauf antworten? Was weiß ich? Sind es viele? Wahrscheinlich. Das muss eine rhetorische Frage sein. »Und werden die alle bei euch in den Briefkasten gesteckt?«
Mit einer Gegenfrage hat er nicht gerechnet. Seine Selbstsicherheit schwankt.
»Ja, nee, weiß nicht, nicht so viele. Wie heißt ihr denn?«
»TimTom Guerilla.«
Kein Wiedererkennen, kein Erinnern. Sein Gesicht bleibt völlig ausdruckslos.
»Und was macht ihr für Musik?«
»Punk.«
Jetzt wieder eine Reaktion. Und was für eine. Seine Augen weiten sich. Sein fusseliger Bart bebt. Er ist richtig entsetzt. »Punk!«, stößt er hervor. »Hast du Punk gesagt? Weißt du überhaupt, wo du hier bist?«
»Ich, äh, im Miles am Niederwall?«
»Ja, im Miles! Und was wir hier spielen ist Jazz. Verstehst du? JAZZ! Nicht Punk! Sag mal, weißt du eigentlich, wie sehr mir das auf die Nüsse geht, dass ihr Typen euch nicht einfach mal vorher über den Laden erkundigt, in dem ihr auftreten wollt? Warst du schon mal auf unserer Homepage? Hast du dir einfach mal das Programm angeguckt? Macht ihr das immer so, dass ihr irgendwo reinspaziert und spielen wollt?«
Der Fusselbart hat einen unerschöpflichen Vorrat an rhetorischen Fragen. Gut, dass man die nicht beantworten muss. Da ich gerade mit einer Gegenfrage einen gewissen Erfolg gehabt habe, versuche ich den Trick nochmal. »Bist du der Geschäftsführer?«
»Nein, äh. Ich bin der Zivi. Der Geschäftsführer ist Uwe. Der sitzt da hinten.«
»Okay, ich geh mal zu Uwe. Mal gucken, was der sagt.«
»Das kannste sowieso vergessen«, ruft der Zivi hinter mir her. »Der sagt dir auch nichts anderes als ich. Außerdem«, brüllt er, kurz bevor ich in Uwes Büro trete, »ich hab euer Demo gehört. Das ist überhaupt kein Punk! Das ist REGGAE oder SKA. Mit Punk hat das überhaupt NICHTS ZU TUN!!!«
Uwe mag vierzig sein, vielleicht ist er auch älter. Seine Gesichtshaut ist grau, seine Augen dunkel umrandet, und als ich eintrete, hustet er rasselnd. Seine öligschwarzen Haare hat er zur Seite gestrichen. Eine tägliche Rasur hält er wohl für übertriebene Körperpflege. Das Büro, in dem er hockt, ist verraucht, auf dem Schreibtisch steht ein übervoller Aschenbecher. Die Wände sind kahl. Das einzig Farbige in diesem Raum sind rote, gelbe und grüne Aktenordner. Vor ihm liegt der Ausdruck einer Excel-Tabelle, in der jede Menge Zahlen stehen.
Jetzt hebt er seinen Kopf und betrachtet mich mit einem müden Blick. »Ja?«, sagt er. Mehr nicht. Der Sauerstoff ist knapp hier. Da muss man sich kurz fassen.
Ich bleibe vor ihm stehen, weil er mir den Stuhl vor dem Tisch nicht angeboten hat. Mir wird klar, dass ich die Sache eben beim Zivi ganz falsch angepackt habe. »Ich bin Musiker«, sage ich.
»Aha?« In seinen Augen blitzt so etwas wie Interesse auf. »Was spielst du denn?«
»Posaune.«
»Okay.« Es ist eins von diesen Okays, bei denen die Stimme am Ende nach oben geht und bei denen man nie so recht weiß, ob es eine Frage oder eine Aussage ist. »Ich spiele auch Posaune.«
»Ach, echt? Cool«, sage ich, weil mir nicht Schlaueres einfällt.
»Ja, echt.« Es klingt nicht besonders freundlich. »In was für Formationen spielst du denn?«
»Formationen? Ach so, nee, äh, wir sind ne Punkband«, stottere ich. Irgendwie hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt.
»Punk!«, sagt er. Ist das ein Déjà-vu? Der Raum hat ja gar keine Fenster. Hier könnte wirklich mal einer Luft reinlassen, finde ich. »Punk! Mit Posaune?«
Sein Gesicht ist jetzt ganz offen. Er ist ratlos. Was sag ich mal am besten? Vielleicht wieder eine Frage? Das hat bisher doch ganz gut hingehauen. »Warum nicht?«
Uwe klappt den Mund zu, blinzelt zweimal und setzt sich anders hin. Jetzt hat er sich wieder gefasst. »Also, macht ihr so was John-Zorn-Mäßiges? Was muss ich mir denn vorstellen? Ist das so experimentelles Zeug, oder was? Du bist doch hier, weil ihr bei uns spielen wollt. Da versteh ich dich doch richtig, oder nicht?«
»Ja, genau. Nee, John Zorn eher nicht. Also, wir sind ja ne Punkband. Punkrock. Mit Posaune halt.«
»Punkrock mit Posaune«, wiederholt Uwe langsam und mit ausdruckslosem Gesicht. Und dann lacht er. Das kommt so plötzlich, so unvermittelt, dass ich zusammenzucke. »Punk!«, keucht er. »Mit Posaune? Zugposaune, oder was?«
»Äh, ja genau.«.
Eine weitere Lachsalve schallt durch den Raum, so laut, dass der Zivi den Kopf durch den Türspalt steckt.
»Posaune!«, krächzt Uwe, zeigt mit der einen Hand auf mich und wischt sich mit der anderen die Tränen von den Wangen. »Die spielen Punkrock mit Posaune. Punk!«
Im nächsten Moment lachen die Jazz-Schweinepriester im Duett. Aber der Zivi hat recht: Ich hätte vorher die Homepage checken müssen.
DREI
http://timtom-guerilla.de/band/timtom/:
»TimTom (Gesang) – eigentlich Timotheus Tengelmann, geboren am 3.4.1979 in Bremen, aufgewachsen im Stadtteil Huchting. Er lernte seinen Vater niemals kennen, der kurz nach TimToms Zeugung als Pirat in See stach und vor den Seychellen verscholl. TimToms Mutter arbeitete als Kassiererin bei Kaiser’s und hatte nur wenig Zeit für den Jungen. Nachdem sie versehentlich einen Kassenbon in den falschen Mülleimer geworfen hatte, wurde sie fristlos entlassen und verdiente von da an als freiberufliche Prostituierte den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn. Im Alter von sieben Jahren war TimTom so fett geworden, dass er nicht mehr durch die Schulbustür passte. Er fristete den größten Teil der Kindheit in seinem Kinderzimmer, lernte in dieser Zeit viele Musikinstrumente, las und schrieb Gedichte. Als TimTom in die Pubertät kam, machte ihm seine Fettleibigkeit derart zu schaffen, dass er durch eine radikale Cola-Mentos-Kur innerhalb kürzester Zeit viele Kilo verlor. Von diesem Wunder tief erschüttert, bekehrte er sich zu Jesus Christus als seinem persönlichen Herrn und Heiland. Mit 23 Jahren schrieb er sich in der Hochschule für bildende Künste in Hamburg ein. Das Studium brach er ab. Zurzeit ist er Musiker. TimTom lebt in Bielefeld.«
VIER
Ich heiße TimTom. Keine Ahnung, wer mich als Erster so genannt hat. Vielleicht mein Vater. Ich habe ihn nie kennengelernt. Als ich noch ein sehr kleiner Junge war, ging er zur See. Seitdem ist er verschollen. Das jedenfalls sagte meine Mutter, als ich sie das letzte Mal nach ihm fragte. Da war ich sieben. Seitdem haben wir nie mehr über ihn gesprochen. Ich glaube, sie hat mich deshalb angelogen, weil sie mir die viel brutalere Wahrheit nicht zumuten wollte: dass er wegging, weil er auf das Leben mit ihr und mir keinen Bock hatte.
Es gibt ein paar Fotos von ihm und mir, verwackelte Aufnahmen, ein Mann mit einem Baby. Sein Gesicht ist ein Allerweltsgesicht, so wie meins. Würde ich ihm morgen begegnen, ich würde einfach an ihm vorbeigehen.
Natürlich ist er nie zur See gefahren. Er ist Musiker. Genau wie ich. Er spielt sogar das gleiche Instrument wie ich. Und er hat eine Band, das ›Tom-Major-Quintett‹. Das ist natürlich nur ein Künstlername. In Wirklichkeit heißt er Hans Zachert. Ich lege keinen besonderen Wert darauf, irgendetwas mit ihm zu tun zu haben, aber das eine, dass wir beide Posaune spielen, das verbindet uns natürlich schon irgendwie. Ich habe mich oft gefragt, warum ich nicht ein anderes Instrument gelernt habe – Schlagzeug, Gitarre, Bass, etwas Normales halt, jedenfalls für einen wie mich, der sich in der Rockmusik zu Hause fühlt. Aber ein Instrument suchst du dir nicht aus. Es sucht dich aus. Als ich das erste Mal eine Posaune in der Hand hielt, habe ich gewusst, dass das mein Instrument ist. Der Musiklehrer suchte eigentlich einen Trompeter, und meine Arme waren auch viel zu kurz für den Zug der Posaune, aber das war mir egal. Ich musste einfach Posaune spielen lernen!
Mit meinem Vater hat das nichts zu tun. Ich glaube, ich habe damals gar nicht gewusst, dass er Posaunist ist und in Jazz- und Funk-Formationen spielt. Ich hab ihn ja gar nicht gekannt! Wie hätte ich also wissen sollen, was für ein Instrument er spielt?
Im Nachhinein ist mir diese vermeintliche Nähe zu ihm fast unangenehm. Aber das ist natürlich Quatsch, schließlich ist die Tatsache, dass er und ich beide Musiker sind, das Einzige, was uns verbindet. Und natürlich, dass er mich gezeugt hat. Aber was bedeutet das schon? Jeder, der einen Penis hat, kann seinen Samen in irgendeine Frau schleudern. Ob er sich hinterher um das kümmert, was er da angerichtet hat, das ist der entscheidende Punkt, das macht einen Vater überhaupt erst zum Vater. Und deshalb ist er auch nicht mein Vater. Ich kenne ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Es hat ihn nie gegeben. Und dabei bleibt es.
FÜNF
Jetzt stehe ich an der Haltestelle Landgericht in Sichtweite des Miles und warte auf die 1 Richtung Schildesche. Von der erhöhten Plattform blicke ich über die Straßenbahnschienen auf den Niederwall. Direkt gegenüber ist eine große Ampel, da wo Hermannstraße und Niederwall sich kreuzen. Autos rauschen vorbei, sie halten, sie fahren an. Der an- und abschwellende Klang der Motoren hat etwas Einlullendes, so ähnlich wie Kneipen-Jazz, Rolltreppen-Jazz, Kaufhaus-Jazz – ein Sound, dazu geschaffen, um wegzuhören. Wichser!
Die 1 kommt, hält an und öffnet ihre Türen. Ich lasse mich auf eine der hässlichen polyesterbezogenen Sitzbänke fallen und starre aus dem Fenster. Der Second-Hand-Laden, das Piercingstudio, das Hotel, das Theater und die Haltestelle Rathaus. Dann geht es unter die Erde, Richtung Jahnplatz. Ich fahre raus zu Foo. Wir müssen uns überlegen, wie es weitergeht. Jetzt ist es kurz nach halb zwölf. Er könnte schon wach sein.
Von Schildesche, der Endstation der Linie 1, fahre ich mit dem Bus weiter raus aus der Stadt, vorbei am Obersee Richtung Brake. Foo bewohnt einen ehemaligen kleinen Bauernhof im Kerksiekweg, zwischen dem Industriegebiet auf der einen und der spießigen Einfamilienhaussiedlung auf der anderen Seite, umgeben von Feldern.
An der Haltestelle Langeoogweg steige ich aus und gehe die restlichen zehn Minuten zu Fuß. Es ist ein herrlicher Frühlingstag, und während ich an den Äckern vorbeilaufe, öffne ich den Reißverschluss meiner Kapuzenjacke. Foos Hof erkenne ich schon aus ein paar Hundert Metern Entfernung. Er liegt da, wo die Straße eine Kurve nach rechts macht, und besteht aus zwei Gebäuden. Aber erst als ich direkt davor stehe, entdecke ich Foo im Garten.
Ich bleibe kurz stehen und beobachte ihn. Das kleinere Gebäude, eine Art Schuppen oder Speicher, steht näher zur Straße, so dass ich das Grundstück betreten kann, ohne sofort bemerkt zu werden. Foo steht regungslos auf dem ungemähten Rasen und fuchtelt wild mit den Händen vor seinen Augen herum. Während die linke Hand immer nur kleine, rhythmische Bewegungen macht, fährt der rechte Arm wieder und wieder heraus, so dass der Zeigefinger Bögen und Linien in die Luft malt. Sein Rücken ist gerade durchgestreckt, jeder Muskel ist gespannt.
Ich habe schon öfter gesehen, dass er merkwürdige, ruckartige Handbewegungen macht, immer dann, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Doch jedes Mal, wenn man zu ihm herüberschaut, hört er sofort damit auf. Ich fühle mich wie ein Voyeur, während ich so im Schatten des Schuppens stehe und ihn beobachte.
Schließlich halte ich es nicht mehr aus. Ich verlasse mein Versteck und gehe auf ihn zu. »Hey!«, sage ich.
Er hört sofort mit seinen autistischen Bewegungen auf und blickt mir scheinbar gelangweilt entgegen. Nur an seinen leicht geröteten Wangen bemerke ich, dass er erregt ist. »Alter«, sagt er, »hast du mich erschreckt. Wieso schleichst du dich denn so an?«
»Wieso anschleichen? Ich bin gerade von der Bushaltestelle hierher gelatscht. Ganz schön warm heute.«
»Willst du n Bier oder n Kaffee?« Er schlurft in Richtung des größeren Gebäudes, das er immer als Kotten bezeichnet. Jetzt ist er wieder ganz cool, ein Cowboy auf seiner Ranch, ein Rockstar vor seiner Villa. Nichts an seinem schlaksigen Körper deutet darauf hin, dass er noch vor wenigen Minuten unter Hochspannung gestanden hat.
»Kaffee ist gut.« Wir treten durch eine Glastür direkt in die vermüllte Küche des Hauses. Durch die dreckigen Fenster bescheint die Mittagssonne ein Chaos aus schmutzigem Geschirr, Essensresten, Unmengen leerer Bierflaschen, einer Akustikgitarre mit gerissener e-Saite, einem Mountainbike und zwei Hanteln.
»Mach dir irgendwo Platz.« Er spült zwei schmutzige Kaffeetassen mit kaltem Wasser aus. Ich räume einen Stapel Musikzeitschriften und mehrere CDs zur Seite und klemme mich hinter einen Tisch auf eine Eckbank am Fenster.
»Und wie gehts sonst so?«, fragt Foo über seine Schulter, während er den Kaffee aufsetzt.
»Geht so. Ich war gerade im Miles.«
»Und?«
»Haben mich ausgelacht.«
»Wichser. Hab ichs mir doch gedacht.«
»Wieso?«
»Naja«, sagt Foo, dreht sich zu mir um und zuckt mit den Schultern. »Ist doch n Jazz-Laden.«
»Das wusstest du?« Ich werde wütend.
»Türlich, das weiß doch jeder.«
»Aber wieso sagst du mir denn, ich soll im Miles ein Demo abgeben und mal nachhaken, ob wir da spielen können, wenn du ganz genau weißt, dass das ein Jazz-Laden ist? Ich hab mich total zum Affen gemacht!«
Foo ist erstaunt. »Ey, was weiß ich. Ich dachte, du weißt, dass das ein Jazz-Laden ist, weil das ja wohl jeder weiß.
»Ach, vergiss es.«
»Hätte ich bei denen nachfragen sollen?«
»Nein!«
»Hätte ICH in den Bus steigen sollen und zum Niederwall fahren sollen und bei denen nachfragen, obwohl DU da direkt gegenüber wohnst? Oder was?«
»Nein, weder du noch ich hätten in einem Jazz-Laden nachfragen sollen! Wir sollten im Falkendom nachfragen, du Depp. Oder im Forum. Oder im AJZ. Oder im Plan B.«
»Ja, machen wir doch. Jetzt reg dich doch nicht auf. Machen wir doch alles.«
Die Kaffeemaschine röchelt. Foo dreht sich um, nimmt die Kanne heraus und gießt Kaffee in die zwei halbwegs sauberen Tassen. Er trägt sie zum Tisch, schiebt die Neue Westfälische zur Seite, die auf ihrer Titelseite schlechte Nachrichten aus Fukushima verkündet, und setzt sich.
»Danke. Hast du Milch?«, frage ich, als Foo eine Tasse zu mir rüberschiebt.
»Nee, glaub nicht. Die ist schlecht.«
»Egal«, sag ich und nehme einen Schluck. Der Kaffee ist verdammt stark. »Es ist doch sowieso alles Scheiße. Solange die anderen nicht hier sind, können wir eh nichts machen. Wie willst du denn so ein Band-Ding durchziehen, wenn die Band überhaupt nicht da ist? Das bringt doch nichts!« Ich habe schon seit dem Besuch beim Miles schlechte Laune. Jetzt rede ich mich in Rage. »Ich frag mich allmählich, was ich hier überhaupt soll in dieser Scheißstadt. BoingBoing sitzt schön in Hamburg und lässt sich von seiner Frau durchfüttern, Hannibal macht in Friedberg einen auf Tanz-Mucker. Und wir beiden sollen uns hier den Arsch aufreißen, oder was? Und wenn dann mal was läuft, dann kommen die hier auf nen Gig vorbei, oder wie stellen die sich das vor? Das ist doch Amateur-Kacke!«
Foo steckt sich eine Zigarette an und guckt dem aufsteigenden Qualm hinterher.
»Ist doch so!«
»Ja«, sagt er schließlich. »Mich kotzt das Rumgeeiere ja auch an.« Er nimmt noch einen tiefen Zug, legt die Zigarette auf dem Aschenbecher ab, steht auf und fängt an, auf dem Küchentisch herumzukramen.
»Was suchst du denn?«, frage ich.
»Mein iPhone. Muss hier irgendwo sein.«
»Wieso? Wen willst du anrufen?«
»Hannibal.« Foo hat sein Smartphone entdeckt, ruft Hannibals Telefonnummer auf und tippt mit dem Finger auf den Screen. Er wartet einen Augenblick »Ja, hi, ich bins«, sagt er dann. »Na, wie läufts? – Hm-hm. – Ah, super. – Ja, geht so. Ich sitze hier gerade mit TimTom. – Nee, der ist stinkig. – Naja, weil er meint, dass es mal endlich mit uns losgehen sollte. Und ich seh das auch so.«
Ich gestikuliere. Foo versteht erst nicht, was ich will. Dann begreift er, und kurz darauf ertönt Hannibals Stimme aus dem Lautsprecher. »... aber ich hab hier den Arsch voll Arbeit! Die nächsten Wochenenden hab ich Jobs, und die MUSS ich machen, weil ich das Geld einfach BRAUCHE. Und außerdem spiel ich für ne Produktion, die KANN ich mir nicht entgehen lassen! Die verschafft mir gleich wieder ein paar Folgeaufträge. Und das kann ja auch nicht sein, dass Frieda das Geld ALLEINE reinholt, und ich spiel hier den Rockstar und verwirkliche meine Träume, weil, da kommt sowieso nichts dabei rum, also, sorry, Jungs, wenn ich das einfach mal so sage, aber ich glaub, ich bin für die Punk-Nummer irgendwie zu alt, ich muss sehen, wo ich bleibe, und Frieda sieht das genau so ...«
Während ich Hannibals Redeschwall zuhöre, spüre ich ein zunehmendes Kribbeln im Nacken, meine Beine wippen auf den Fußballen auf und ab, und ich atme heftig durch die Nase. Irgendwann platzt mir der Kragen.
»Hey!«, rufe ich ziemlich laut, so dass Foo erschrocken zusammenzuckt. Hannibal unterbricht seinen Monolog und ist ruhig. »Ist ja gut, wir haben es kapiert!«
»Ja«, setzt Hannibal neu an, »das hab ich euch ja schon letztes Mal ...«
»Ja, genau. Und letztes Mal haben wir zu dir gesagt, dass wir das alles verstehen und so, aber dann sollst du doch bitteschön einen Schnitt machen und die Band knicken.«
»Nee, das haben wir so nicht ...«
»Das haben wir GENAUSO gesagt«, kanzele ich ihn ab, »und da hast du gesagt, dass du das ja so auch wieder nicht gemeint hast.«
Am anderen Ende zieht Hannibal es vor zu schweigen. Ich werte das als ein gutes Zeichen und setze nach. »Und jetzt hab ich einfach keinen Bock mehr, ständig über dieselbe Sache zu reden. Du hast gesagt, du bist dabei. Und jetzt SEI verdammtnochmal auch dabei!«
Am anderen Ende ist es immer noch ruhig. Foo und ich warten auf eine Reaktion. »Hallo?«, fragt Foo in den Hörer. »Bist du noch da?«
»Ja.« Hannibals Stimme klingt belegt und flach.
Ich kenne diesen Ton. Ich weiß genau, was jetzt kommt. »Ja, und? Was ist jetzt?«
»Ja, weiß nicht. Muss ich mit Frieda klären.«
Foo schnaubt verächtlich durch die Nase. »Ja, mach das. Klär das mit Frieda.«
»Ja«, sagt Hannibal nochmal, »also ich muss dann jetzt mal los.«
»Ja, tschüss«, sag ich und verdrehe die Augen zur Decke.
»Ciao«, sagt Foo.
»Tschö«, sagt Hannibal und legt auf.
»Tja«, sagt Foo, »und dann gibts da ja noch den anderen Kandidaten.«
»Los. Wir geben uns den Rest.«
»Bringt eh nichts«, sagt Foo, während er BoingBoings Nummer wählt. »Aber egal.«
Ich schlage ein Porno-Magazin auf und betrachte einen erigierten Penis. »Vielleicht ist ja ein Wunder geschehen. Vielleicht hat sie sich von ihm scheiden lassen.«
»Schön wärs«, sagt Foo, während er dem Freiton lauscht und darauf wartet, dass jemand am anderen Ende abhebt. »Foo hier. Na, wie gehts?«
Ich mache wieder Gesten. Diesmal kapiert er sofort und stellt den Ton laut. »... gut soweit. Und dir? Was verschafft mir die Ehre?«
»Ich sitze hier gerade mit TimTom, und wir überlegen, wann du nach Bielefeld kommst, damit wir endlich durchstarten können.«
Am anderen Ende der Leitung höre ich BoingBoings Atem. »Ähm«, sagt er dann, »naja, ihr wisst ja, wies bei mir aussieht. Ich kann hier ja nicht einfach weg.« Er lacht unsicher.
»Aber du bist noch Teil der Band, oder?«, fragt Foo.
BoingBoings Stimme klingt eifrig. »Jaja, doch klar, natürlich! Ich tu ja auch, was ich kann. Echt jetzt. Aber euch muss doch klar sein, dass ich nicht einfach so meine Sachen packen und abhauen kann. Ich meine, Rebekka arbeitet, und irgendjemand muss auch für die Jungs da sein ...«
»Wir wollen ja auch gar nicht, dass du für immer nach Bielefeld kommst«, schalte ich mich ein, »aber vielleicht kannst du wenigstens ab und zu mal hier sein. Also auf jeden Fall schon mal an den Wochenenden. Und dann natürlich, wenn wir Konzerte spielen. Ich meine, so ein kleines bisschen mehr Einsatz muss bei dir doch drinne sein. Das versteht Rebekka doch, oder nicht?«
»Ähm«, BoingBoing sucht nach Worten, »also – wir sind uns da manchmal – nicht so ganz einig. Also, sie findet das schon gut, dass ich ne Band habe. Aber sie fände das wahrscheinlich besser, wenn ich hier in unserer Lobpreisband spielen würde ...«
»Wo?«
»In unserer Lobpreisband.«
Foo sieht mich ratlos an.
»Lobpreis«, komme ich BoingBoing zu Hilfe. »Das ist so Kirchenmucke. BoingBoing ist doch in so ner Kirche.«
»Ja«, sagt BoingBoing, »ich bin doch hier in so ner Gemeinde. Und da gibts ne Band. Die suchen einen Schlagzeuger. Naja, und Rebekka meint halt, die Musik passt besser zu mir, und außerdem muss ich dann an den Wochenenden nicht weg und irgendwo spielen, sondern ich spiele hier in unserer Gemeinde. Wir sehen uns ja in der Woche jetzt auch nicht so viel. Und zur Gemeinde gehen wir immer als ganze Familie.«
Foo wirkt erschöpft. Er hat den Ellenbogen auf die Tischplatte gestützt, in seiner Hand hält er schlaff das iPhone. Sein Mund ist leicht geöffnet, während er einen Punkt weiter oben an der Wand betrachtet. »BoingBoing ...«, sagt er.
»Ja?«
»Ich glaub, sie hat recht.«
Auf der anderen Seite ist es still.
»Spiel deinen scheiß Lobpreis, pass auf deine Kinder auf, und gut. Dann hast du ein Problem weniger, und wir auch.«
Man kann förmlich hören, wie BoingBoing sich windet. »Jungs, ich WILL ja weiter mitmachen, wirklich! Es ist nur ...«
»Rebekka sieht das aber anscheinend anders!«, rufe ich dazwischen.
» ... ja, ich weiß.« BoingBoings Stimme klingt weinerlich. »Aber ihr seid mir als Freunde echt wichtig! Ich meine, wir sehen uns ja eigentlich nur dann, wenn wir Musik machen. Wenn ich nicht mehr in der Band bin, sehe ich euch überhaupt nicht mehr. ... Kommt doch alle nach Hamburg!«, versucht er dann mit einem lahmen Scherz die Stimmung etwas aufzuhellen. Wir lachen nicht. »Nein, im Ernst.« In BoingBoings Stimme schwingt plötzlich so etwas wie Begeisterung mit. »Wieso denn nicht? Eine Band, die was werden will, die lebt doch in Hamburg und nicht in Bielefeld, oder? Und wenn wir dann alle hier sind, dann habe ich auch das Problem nicht, dass ich mich zwischen euch und meiner Familie entscheiden muss.«
Eins muss ich BoingBoing lassen: Im Gegensatz zu Hannibal sucht er wenigstens nach einer Lösung. Meine Wut lässt etwas nach. »BoingBoing«, sage ich, »Foo hat hier den Kotten, und das heißt: Wir können alle bei ihm unterkommen, und wir haben einen Proberaum, bei dem die Nachbarn nicht gestört werden – und das alles auch noch umsonst! Hamburg kann sich echt kein Mensch leisten!«
»Ja klar, verstehe ich« sagt er kleinlaut. »Tut mir echt leid. Aber ich kann hier nicht weg.«
»Überleg dir einfach, was du willst, okay?« Foo klingt sehr genervt. »Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir wollen endlich wissen, was los ist.«
»Okay.« BoingBoings Stimme ist kaum zu hören.
»Okay, bis dann«, sagt Foo.
»Tja«, sagt BoingBoing und legt auf.
»Scheiße!«, sage ich.
Foo lässt das iPhone auf den Tisch fallen, fischt nach dem Päckchen Manitou und steckt sich eine Zigarette an. Er inhaliert den Rauch und atmet dann durch die Zähne zischend aus. Die Sonne steht im Westen und taucht die Küche in gleißendes Licht. Die Fensterscheiben müssten dringend geputzt werden. Foo fällt das nicht auf. Er schaut nachdenklich zur anderen Seite, rüber zur Kaffeemaschine, die leise vor sich hin pufft.
»Was machen wir jetzt?«, fragt er.
»Keine Ahnung.«
Er richtet sich in seinem Stuhl auf und sieht mich an. »Scheiß drauf. Ich sorg dafür, dass diese Penner gar nicht anders können als mitzumachen. Und wenn wir am Ende des Jahres immer noch da stehen, wo wir heute sind, dann bin ich raus. Dann können die mich mal am Arsch lecken.« Er sieht mich auffordernd an.
»Ja«, sag ich, »ich bin dabei. Aber wie willst du das hinkriegen?«
Er grinst boshaft. »Mir fallt schon was ein. Du ziehst zu mir.« In dem Satz steckt keine Frage oder ein Vorschlag. Er stellt einfach fest.
»Alles klar. Ich muss sehen, ob mein Vermieter mich aus dem Vertrag rauslässt.«
»Du schaffst das schon.« Er steht auf und setzt noch einmal Kaffee auf.
SECHS
http://timtom-guerilla.de/band/foo/:
»Foo (Gitarre) – eigentlich Fabian Bäumer, geboren am 7.7.1982 in Gütersloh. Foos Vater hatte einen höheren Posten bei der Bertelsmann AG und schwängerte mehrere seiner Sekretärinnen. Foos Mutter war die siebte. Dass Foo an einem siebten Siebten geboren wurde, hielt seine Mutter Hanna für ein gutes Zeichen und ließ ihn von einem katholischen Priester taufen. Mit diesem Priester zog sie nur wenige Monate nach der Taufe zusammen und gründete mit ihm heimlich eine Großfamilie. Schon früh musste Foo als ältestes von vierzehn Kindern Verantwortung übernehmen und den nicht anwesenden Vater ersetzen. Schließlich entzog er sich seiner immer dominanter werdenden Mutter und wurde Straßenmusiker. Seine Fähigkeiten an der Gitarre erwarb er sich in den Fußgängerzonen der Republik. In einer Notunterkunft für Obdachlose in Hannover lernte Foo TimTom kennen. Heute lebt er in Brake bei Herford.«
SIEBEN
Foo heißt eigentlich Fabian. Fabian Bäumer. Er kommt aus Gütersloh. Sein Vater war irgendein hohes Tier bei Bertelsmann. Ich glaube, Foo hat auch eine Schwester. Das weiß ich aber nicht so genau. Er redet eigentlich nie über seine Familie.
Was ich weiß, ist, dass Foo irgendwann abhaute. Da war er vierzehn Jahre alt. Auf diesen Teil seiner Geschichte ist er irgendwie stolz, glaube ich, denn den erzählt er öfter, vor allem, wenn er betrunken ist und den Punk raushängen lässt. Als Punk ist es ja ein Problem, wenn du aus einer gutsituierten Familie kommst. Da fehlt die Glaubwürdigkeit. Vielleicht haute Foo auch nur deshalb ab, weil er Punk sein wollte und meinte, dass das nicht geht: Punk sein und Sohn eines hohen Tieres bei Bertelsmann.
Jedenfalls, wenn es stimmt, was Foo sagt, dann verließ er eines Morgens das Haus, angeblich, um zur Schule zu gehen. Seine Gitarre hatte er dabei. Aber in seinem Rucksack steckten nicht die Bücher für die Schule, sondern Klamotten und Lebensmittel. Und dann war er weg. Für die nächsten zwei Jahre sah oder hörte man nichts mehr von ihm. Natürlich suchte seine Familie nach ihm, aber ohne Erfolg.
Schließlich glaubten alle, er wäre tot. In Gütersloh muss damals die Hölle los gewesen sein. Es kam sogar in den Nachrichten und Zeitungen. Ich erinnere mich noch an die Titelseite der BILD, mit diesem unscharfen Foto von einem Jungen und der Schlagzeile ›Wo ist Fabian?‹.
Als er sechzehn war, tauchte Foo wieder auf. Was er in den zwei Jahren gemacht und wie er überlebt hat, darüber will er nicht reden. Einmal hab ich ihn gefragt, als er betrunken gewesen ist. Er hat mir aufs Maul gehauen. Seitdem habe ich es nie wieder versucht. Hannibal und BoingBoing sind sich sicher, dass er sich als Stricher über Wasser gehalten hat. Aber das ist Quatsch, glaube ich.
Jedenfalls tauchte er plötzlich wieder auf, und zwar in Darmstadt. Die Familie erwartete natürlich, dass er zu ihr zurückkommt. Aber Foo wollte nicht. Irgendetwas muss passiert sein, bevor Foo stiften gegangen ist. Aber was, weiß ich wirklich nicht.
Immerhin kam die Mutter noch ein paar Mal nach Darmstadt. Foo durfte im Keller des Pfarramtes wohnen. Er holte seinen Realschulabschluss nach, machte Zivi und dann eine Ausbildung zum Mechatroniker in Frankfurt am Main, wurde übernommen und blieb dort erstmal.
Wir haben uns zweitausendsechs in Hamburg kennengelernt, auf einer Party, und haben uns sofort gut verstanden. Weil ich nicht gewusst habe, was ich im Norden noch soll, bin ich nach Frankfurt gegangen und bei ihm eingezogen. Später haben wir Hannibal kennengelernt und zusammen eine Band gegründet. Eigentlich ist so weit alles ganz gut gelaufen.
Dann starb Foos Vater. Und das Erstaunliche ist: Er vererbte ihm etwas! Derjenige, der sich am meisten darüber wunderte, war Foo selbst. Bis zum Tod des Vaters hatten die beiden kein einziges Wort mehr miteinander gewechselt, und dann sowas! Allerdings bekam er kein Geld, sondern ein altes Haus. Und zwar den Kotten im Kerksiekweg in Brake bei Herford.
Im vergangenen Herbst sind wir zwei also nach Ostwestfalen umgezogen, weil wir Frankfurt schon immer scheiße gefunden haben, Foo in seinen Kotten, und ich hab mir eine Wohnung in der Hermannstraße in Bielefeld genommen. Ich mag ihn, wirklich, aber das Zusammenleben mit ihm ist manchmal etwas anstrengend.
Hannibal ist immer noch wütend, dass wir aus Hessen abgehauen sind. Und wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das sogar. Der sitzt in Friedberg und hat eigentlich, genau wie wir auch, vorgehabt, mit TimTom Guerilla durchzustarten. Dass er uns jetzt nicht unbedingt nach Bielefeld hinterherziehen will, kann ich nachvollziehen. Aber andererseits: Wann erbt man schon mal einen Kotten?
ACHT
Sonntag, 3. April 2011
Draußen nieselt es. Wir sitzen im Chattanooga, trinken Beck‘s, essen mit Käse überbackene Nachos und feiern meinen Geburtstag. Zweiunddreißig. Das ist alt, finde ich. Ich versuche normalerweise, nicht darüber nachzudenken. Aber heute fällt mir das schwer. Kurt Viles ›Smoke Ring for my Halo‹ klingt aus den Boxen. Eigentlich mag ich das Lied. Aber heute hilft es mir nicht gerade dabei, meine gute Laune wiederzufinden. Der Typ ist ungefähr so alt wie ich, nein sogar ein Jahr jünger! Aber im Gegensatz zu mir hat er es geschafft. Ich beschließe, dass ich noch ein Bier brauche.
»Willst du auch noch eins?«, frage ich Foo, der halb auf dem Tisch liegt und sein Gesicht auf eine Hand stützt.
»Hm-m«, bestätigt er, ohne dabei seine Sitzposition oder seinen Gesichtsausdruck zu verändern.
Ich stehe auf und schlurfe durch den halbleeren Laden zur Theke, an der eine junge Frau arbeitet, die mir schon vorhin aufgefallen ist. Sie ist nicht sehr groß, vielleicht einen halben Kopf kleiner als ich, hat lange dunkelblonde Haare und ein herzförmiges Gesicht. Am auffälligsten sind ihre Augen. Sie sind ungewöhnlich groß, haben lange Wimpern und scheinen immer zu lächeln, selbst wenn das Gesicht, zu dem sie gehören, ernst schaut. Wie jetzt zum Beispiel, da sie einen leeren Bierkrug im Spülbecken abspült und ihn umgedreht immer wieder auf die Spülbürste stößt, die im Becken installiert ist. Sie macht das mit einer Gewissenhaftigkeit, die mich fasziniert.
Als sie den Krug endlich zum Abtropfen hinstellt und sich mir zuwendet, sage ich: »So, der dürfte sauber sein!«
Sie lächelt etwas verunsichert und fragt: »Was?«
Ich deute auf den Krug. »Der ist jetzt bestimmt schön sauber.« Während ich das sage, komme ich mir schon dämlich vor. Ich hätte einfach die Fresse halten sollen. Sie muss ja denken, dass ich mich über sie lustig mache. Dabei wollte ich nur freundlich sein.
»Ja, du willst doch bestimmt aus sauberen Gläsern trinken, oder nicht? Oder soll ich dir lieber ein benutztes geben?«
Na bitte. Da haben wir’s. Sie fühlt sich verarscht. »Sorry! Nee, natürlich nicht. Ich wollte nur ... Vergiss es. Tut mir leid. Ähm, ich hätt gerne zwei Pils, bitte.«
»Herforder?«
»Nee Beck‘s!« Scheiße, das hat jetzt viel heftiger geklungen, als es gemeint war. Die junge Frau stutzt und guckt schon wieder leicht verärgert.
»Wieso? Hast du was gegen Herforder, oder was?«
»Nee«, stottere ich, »ja, weiß nicht, ich mags halt nicht so gerne. Ich mag Beck’s halt lieber.«
»Wieso? Was soll an Beck’s denn besser sein?« Sie schaut mir direkt ins Gesicht, und mir fällt auf, dass ihre Augen nicht immer so aussehen, als würden sie lächeln. Jetzt zum Beispiel tun sie es nicht.
»Ich finde halt... Das ist natürlich Geschmackssache ... Ich komm halt aus Bremen, und vielleicht ist das ja so ein Lokalpatriotismus-Ding. Also, Beck’s schmeckt irgendwie voller, finde ich. Das Herforder ist mir ein bisschen zu ... Also, das kann man natürlich ganz gut wegziehen, so ... Auf Partys ist das super. Aber mir ist Beck’s einfach lieber.«
Ohne zu antworten, schnappt sie sich zwei Flaschen, öffnet sie und stellt sie vor mich auf den Tresen: »Da haste dein Beck’s.«
»Danke. Wie viel kriegst du?«
»Nichts.« Sie lächelt plötzlich. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!«
Ich bleibe regungslos stehen und starre sie an. »Äh – woher weißt du denn ...?«
»Von deinem Kumpel«, sagt das Mädchen und deutet rüber zu Foo, der breit grinst, aber nicht zu uns schaut, sondern weiter ein Stadtszene-Magazin durchblättert.
Ich schaue wieder zu dem Mädchen.
»Ich heiße übrigens Sonja.«
»Ich bin TimTom. Also, eigentlich Timotheus, aber alle nennen mich TimTom.«
»Hallo, TimTom.« Ihre obere Zahnreihe ist etwas unregelmäßig, die Eckzähne stehen ganz leicht vor. Ich finde, das sieht toll aus. Dazu diese Augen, die jetzt wieder blitzen und lächeln. Offensichtlich freut sie sich diebisch darüber, dass sie mich drangekriegt hat.
»Ja, also ...«
»Ja«, sagt sie, »schöne Party noch.«
»Ja, danke.« Dann kehre ich widerstrebend zu unserem Tisch zurück.
»Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr«, begrüßt mich Foo, und fügt, als ich das Bier vor ihn auf den Tisch stelle, hinzu: »Danke!«
»Idiot.«
»Du bekommst heute Freibier auf meine Kosten«, grinst er, »zum Trost, weil du schon so verdammt alt bist. Das ist mein Geburtstagsgeschenk.«
»Du bist nicht viel jünger.«
»Nicht viel, aber ich bin noch keine dreißig.«
»Nächstes Jahr schon.«
»Aua. Naja, du weißt ja, was ich von dir erwarte, falls wir dann immer noch nicht reich und berühmt sind.«
Ich nehme einen Schluck aus der Flasche. »Vielleicht sollten wir mal was dafür tun.«
»Ja? Was denn?«
»Was weiß ich. Demos verteilen, auf uns aufmerksam machen, Auftritte an Land ziehen.«
»Wow. Da hat sich ja einer schon richtig Gedanken gemacht.«
»Du bist echt ein Idiot! Guck mal, hier finden doch manchmal Konzerte statt. Wieso haben wir kein Demo mitgebracht und geben es einfach mal ab?«
»Bei der schönen Barkeeperin?«
»Meinetwegen auch beim buckligen Bar-GLÖCKNER, falls der hier arbeitet!«
Jetzt muss er lachen. »Bar-Glöckner? Was ist denn das für eine Scheiße?«
Ich lache auch. »Ist doch egal. Bei irgendwem halt.«
»Naja, das ist hier aber nicht das Forum oder das AJZ. Hier spielen doch nur Hobby-Bands, oder?«
»Im Moment sind wir auch nicht viel mehr als eine Hobby-Band.«
»Auch wieder wahr.« Foo fummelt an der Innentasche seiner Motorrad-Lederjacke herum, um die ich ihn beneide, seit ich ihn kenne. Dann zieht er einen CD-Rohling heraus und hält ihn in die Höhe. »Bitteschön.«
»Was ist das?«
»Unser Demo, du Spätzünder.« Er klatscht die CD vor mir auf den Tisch und schaut mich auffordernd an. »Dann mach mal.«
»Ich? Wieso ich?«
»Wieso du? Weil du dich gerade eben darüber beschwert hast, dass wir angeblich kein Demo dabei haben. Und weil du gesagt hast, wie wichtig du das findest, dass wir hier ein Demo abgeben. DA ist das Demo, und DA«, er zeigt Richtung Tresen, »ist die schöne Bar-Glöcknerin. Also, dann mach doch mal!«
Ich leere mein Bier in drei großen Zügen. Dann klaube ich die CD vom Tisch und stehe auf. Es hilft nichts. Ich muss das jetzt durchziehen.
Zögernd nähere ich mich der Theke und Sonja. Sie sieht mich und lächelt. Das macht mir Mut. Entschlossen bleibe ich vor ihr stehen und hole tief Luft.
»Na, willste noch eins?«, fragt sie.
»Nee, ja doch, gib mir mal n Herforder, bitte.«
Sie zieht belustigt die Augenbrauen hoch. »Klar doch. Ist dir plötzlich eingefallen, dass du Herforder doch magst, oder was?«
»Ja, nee, ich mags ja schon, nur nicht so gerne, wie – ist ja auch egal. Ich will noch was anderes: Ich hab ne Band. Und wir würden hier gerne mal auftreten. Meinst du, das geht?«
»Ne Band?«, fragt sie über ihre Schulter, während sie leere Flaschen in einen Kasten räumt. »Was denn für ne Band?«
»Wir sind ne Punkband.«
»Punk«, sagt sie und richtet sich auf. Ihre Augen lächeln. »So siehst du gar nicht aus.«
Ich werde verlegen, weil mir plötzlich klar wird, dass Sonja sich genauso über mein Äußeres Gedanken macht, wie ich mir über ihres. »Ja, kann sein, vielleicht machen wir auch eher so Post-Punk oder sowas. Manche würden das vielleicht auch Indie-Rock nennen. Was weiß ich.«
Sie steht mittlerweile wieder direkt vor mir und sieht mich an. Ich betrachte ihre Lippen und ihr kleines Kinn. Sie ist schön. Über dem weiten Ausschnitt ihres olivgrünen T-Shirts kann ich den Ansatz ihrer Brüste sehen. Unter den Achseln zeigen sich kleine dunkle Flecken. »Jetzt wehr dich doch mal. Wenn du Punk bist, und ich sage, dass du gar nicht wie ein Punk aussiehst, dann kannst du das doch nicht einfach so schlucken! Wie heißt ihr denn?«
»TimTom Guerilla.«
Jetzt lacht sie. Ein vergnügtes, hohes Mädchenlachen. Ich bin entzückt. Ich bin beschämt. Ich möchte im Boden versinken. Ich möchte sie küssen.
»TimTom GUERILLA?«, kichert sie. »Wie süß!« Wahrscheinlich bin ich rot geworden. Sie bemerkt es und hört auf zu lachen. »Tut mir leid!«, sagt sie, »Ich bin manchmal etwas direkt.« Dann muss sie doch nochmal kichern, fängt sich aber schnell wieder. »Also, ich denke schon, dass ihr hier mal spielen könnt. Hier spielen öfter Bands. Gerade auch so alternative Bands: Punk, Indie, Rock und so. Ich kann das natürlich nicht entscheiden. Das macht Theo, mein Chef. Der ist aber gerade nicht da. Habt ihr irgendwas, wo man mal reinhören kann?«
»Ja klar«, sage ich und schiebe die CD zu ihr rüber, »hier.«
»Danke. Was spielst du denn?«
»Ich bin der Sänger und spiele auch noch Posaune.«
Sonjas Augen nehmen einen Ausdruck an, den ich bisher noch nicht bei ihr gesehen habe. »Sänger und Posaunist«, sagt sie. Sie betrachtet mich mit einem Lächeln, das mich sonderbar erregt. Dann dreht sie sich um, geht mit zwei kleinen Schritten zum CD-Player, nimmt eine CD heraus und legt dafür unsere Demo-CD hinein. Das alles geht so schnell, dass ich gar nicht dazu komme, irgendetwas zu sagen. Nein, denke ich! Bitte nicht! Es ist mir unendlich peinlich, meine Musik anderen Leuten vorzuspielen.
Aus den Boxen ertönen die ersten Takte von ›Lirum Larum‹, die wir von The Clashs ›London Calling‹ geklaut haben. Dann hört man mich singen:
Hierum, darum
Lirum Larum
Löffelstiel
Ich weiß, ich weiß nicht viel
Nimm mich, lass mich
Lieb mich, hass mich
Ich bin was wert, bis sich mein Wert verkehrt
Gnadenloser Gnadenstoß
Zungenloser Zungenkuss
Mittelloser Mittelsmann
Was fang ich mir dir an?
Du
Du bist
Du bist ein
Ein Arschloch
Sonja grinst mich an. »Klingt gut!« Sie weiß ja nicht, was sie mir gerade antut. »Und der da singt, das bist du? Hätt ich nicht gedacht. Du kannst ja richtig rotzig sein! Ist das okay, wenn ich die laufen lasse?« Sie zeigt mit dem Daumen über ihre Schulter zum CD-Player.
»Ja klar. Gefällt dir das echt?«
»Ja!« Sie blickt mich erstaunt an. »Wundert dich das? Du magst deine eigene Musik doch auch, oder nicht?«
»Ja, meistens schon. Aber manchmal kann ich sie auch nicht mehr hören. Das kommt auf meine Stimmung an.«
Sonja stützt beide Hände auf den Tresen, lehnt sich etwas nach vorne und sieht mir direkt ins Gesicht. Ihre Augen lächeln nicht, sondern schauen ungläubig. »Du magst deine eigene Musik nicht?«
»So hab ich das nicht gesagt ...«
»Aber du willst die doch vor Leuten spielen, oder nicht? Du hast mich doch gerade gefragt, ob ihr hier mal auftreten könnt. Da musst du doch daran glauben, dass deine Musik gut ist und dass sie bei Leuten gut ankommt, oder nicht?«
»Ja, türlich, das glaub ich ja auch«, sage ich so bestimmt wie möglich.
»Na, dann ist ja gut«, sagt Sonja, wischt mit einem Lappen über die Theke, schnappt sich eine Flasche Bier und öffnet sie. »Also, ich finde deine Musik gut.« Sie lächelt mich an und stellt das Bier vor mich auf den Tresen. Es ist ein Beck’s. »Nochmal herzlichen Glückwunsch.«
Als ich zurück zum Tisch gehe, läuft schon der zweite Song unseres Demos, ›Casting Show‹.
»Du hättest mir ruhig eins mitbringen können!« Foo zeigt auf mein Bier. Er schaut mich neugierig an und grinst schließlich. »Wie hast du das denn geschafft?«
»Was?«
»Na, dass sie unsere Musik spielt. Das ist der Hammer!«
»Eigentlich wollte ich das gar nicht. Sie hat die CD einfach angemacht.«
»Geil!« Foo schaut zur Theke rüber. »Wie heißt sie denn?«
»Sonja.«
»Und ihr beiden habt euch ein bisschen kennengelernt, oder was? Worüber habt ihr denn so lange geredet?«
»Ach, über dies und das. Sie ist echt nett.« Ich versuche, neutral zu klingen und nehme demonstrativ beiläufig einen Schluck Bier.
»Entschuldigt, Jungs.« Eine Männerstimme unterbricht uns. Wir haben ihn gar nicht kommen sehen. »Darf ich mich einen Augenblick zu euch setzen?« Vor uns steht ein Mann, der zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt ist. Seine Haut ist gebräunt, sein schwarzes Hemd, unter dem sich der Bauch etwas wölbt, steckt in einer Jeans. Die Ringe an seinen Fingern und das Kettchen an seinem Hals passen gut zu seinem blonden, nach hinten gekämmten Haar, dessen Ansatz schon etwas zurückgeht. Der ganze Typ wirkt souverän und vertrauenerweckend.
»Klar«, sag ich, während Foo ihn misstrauisch beäugt.
Der Mann dreht einen Stuhl mit der Rückenlehne nach vorne, setzt sich breitbeinig darauf und lehnt sich auf seine überkreuzten Unterarme. »Mein Name ist Paulo«, sagt er und sieht uns mit blauen Augen an. »Was ich hier gerade mache, ist total spontan. Vielleicht ist das alles Blödsinn. Aber irgendwie denke ich, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ärgere ich mich hinterher für den Rest meines Lebens.«
Erst jetzt fällt mir auf, dass Paulo doch nicht so souverän ist, wie es zunächst den Anschein gehabt hat. Er ist sogar ziemlich aufgeregt. Foos Ausdruck wird immer abweisender. Und auch mich beschleicht ein mulmiges Gefühl. Paulo scheint das zu spüren, denn er redet schnell weiter. »Hört mal«, sagt er, »die Musik, die da läuft – seid ihr das? Ist das eure Musik?«
»Ja ...«, sagt Foo, aber seine Stimme geht am Ende nicht nach unten, wie bei einer Aussage, sondern nach oben, wie bei einer Frage.
Paulo hebt beschwichtigend beide Hände. »Ich finde euch großartig«, versichert er. »Ich mag die Musik. Ehrlich! Seid ihr denn erfolgreich damit?«
Foo und ich schauen uns an. »Nee, überhaupt nicht«, sage ich und erkenne sofort an Foos Gesichtsausdruck, dass er anders geantwortet hätte. Aber jetzt ist es zu spät. »Nee, ehrlich gesagt haben wir uns gerade vorgenommen, es in diesem Jahr nochmal zu versuchen, weil es bisher nicht funktioniert hat. Und wenn wir am Ende des Jahres immer noch nicht weiter gekommen sind, dann scheißen wir drauf.«
Foo verschränkt die Arme vor der Brust und schaut rüber zu Sonja, die gerade wieder Gläser spült. Ihm ist das alles überhaupt nicht recht. Paulo wird dagegen sicherer. Ich merke, dass er sich entspannt.
»Das wäre schade«, sagt er, und ich glaube ihm, dass er das aufrichtig meint. Mittlerweile läuft im Hintergrund ›Die Ballade vom Amoklauf‹. Paulo hört der Musik ein paar Takte lang zu und schüttelt dann den Kopf. »Das wäre wirklich zu schade! Eine Band wie ihr sollte eigentlich Erfolg haben.«
»Tja«, schaltet Foo sich wieder ins Gespräch ein, »das sagt sich so leicht. Es gibt ziemlich viele gute Bands. Aber die haben nun mal nicht alle Erfolg. Da gehört eben auch ein bisschen Glück dazu.«
»Das stimmt«, sagt Paulo, »aber nicht nur. Oder sagen wir mal so: Man kann dem Glück auch auf die Sprünge helfen.«
Jetzt scheint Foo etwas zu dämmern. »Du bist so ein Casting-Show-Typ!«, stößt er hervor. »Ja, natürlich, du suchst Leute für so ne Fernsehsendung, oder? – Vergiss es, Alter! Ich mach bei so einem Scheiß nicht mit.« Dann sieht er mich scharf an und sagt drohend: »Tim-Tom, wir machen bei so nem Scheiß nicht mit!«
Paulo lächelt und schüttelt den Kopf. »Nein, so ist das nicht. Entschuldigt, ich sollte mich einfach mal vorstellen. Hätte ich sofort machen sollen. Sorry! Mein Name ist Paulo, so nennen mich jedenfalls meine Freunde. Eigentlich heiße ich Paul Heidemann. Ich bin Geschäftsmann und leite ein Möbel-Outlet hier in Bielefeld. Ich war selber mal Musiker, und mein Herz hängt immer noch an der Musik, auch wenn ich es nicht geschafft habe, damit erfolgreich zu sein. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass gute Musik gehört werden sollte. Deshalb habe ich in der Vergangenheit des Öfteren jüngeren Musikern geholfen. Ich hab Bandräume besorgt, ich hab Tipps gegeben, ich hab sogar bei CD-Produktionen finanziell geholfen. Reich geworden bin ich damit nicht. Aber das ist okay, weil mein Geschäft gut läuft. Jetzt habe ich hier schon die ganze Zeit im Laden gesessen, da hinten in der Ecke«, Paulo dreht sich um und zeigt mit dem Finger auf einen Tisch am anderen Ende des Raumes, »und euch beobachtet. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber man sieht eben sofort, dass ihr Musiker seid, deshalb seid ihr mir gleich aufgefallen. Und als ich dann auch noch eure Musik gehört habe, da hab ich gedacht, ich spreche euch jetzt einfach mal an. Kostet ja nichts, und schiefgehen kann auch nichts.«
Foo und ich wissen nicht, was wir sagen sollen. »Was meinst du denn mit ›dem Glück auf die Sprünge helfen‹?«, frage ich nach einer Weile.
»Marketing«, sagt Paulo.
»Marketing?«, erwidert Foo. »Glaub mal nicht, dass ich mir irgendwie Werbung auf meinen Arsch tätowiere oder den nächsten Stadionsong für Arminia Bielefeld schreibe. Also, so ein bisschen Musiker-Ehre haben wir ja schon.«
»Ihr habt doch gerade eben euer Demo vorne an der Theke abgegeben, oder nicht?« Paulo ist kein bisschen mehr aufgeregt, sondern voll in seinem Element. Das macht ihn aber nicht unsympathischer. »Ja«, fährt er fort, als wir nicken, »DAS ist Marketing.«
Wir schauen ihn entgeistert an, worauf Paulo lächeln muss. »Schaut mal, alles was ihr tut, um eure Musik bekannter zu machen, gehört zum Marketing dazu. Das ist überhaupt nichts Ehrenrühriges oder so, sondern total normal. Schließlich wollt ihr, dass eure Musik gehört wird. Und ich nehme an, dass ihr wie alle Musiker davon träumt, dass ihr von eurer Musik leben könnt. Aber wenn ihr von eurer Musik leben können wollt, dann müsst ihr sie auch verkaufen. Und ohne Marketing geht das nicht.«
Aus Foos Gesicht ist jede Abwehr und jedes Misstrauen verschwunden. Er betrachtet Paulo, und ich kann die kleinen Rädchen hinter seiner Stirn beinahe rattern hören. »Okay«, sagt er langsam, »warum erzählst du uns das alles?«
Paulo blickt zur Decke und sucht nach den richtigen Worten. »Ich denke ... oder ich vermute – oder nein, anders: Habt ihr einen Manager, der für euch das Marketing übernimmt, damit ihr euch weiter auf die Musik konzentrieren könnt?«
»Nein«, sage ich und schaue Paulo fragend an. Von Foo scheint es diesmal keine Einwände gegen eine ehrliche Antwort zu geben. Und selbst, wenn er welche haben sollte, wäre es mir egal. Ich will unbedingt wissen, worauf Paulo hinauswill, auch wenn ich es natürlich schon längst ahne.
»Okay«, sagt Paulo bedächtig. »Was würdet ihr davon halten, wenn ich euer Manager werden würde?«
Foo und ich denken nach. Paulo schaut uns hin und wieder kurz an und dann wieder auf seine Hände, in denen er eine Sonnenbrille hin- und herdreht.
»Wir kennen dich doch gar nicht«, sagt Foo endlich. »Woher sollen wir denn wissen, ob du das überhaupt kannst?« Seine offene und angriffslustige Art, die ich normalerweise mag, ist mir in diesem Augenblick unangenehm. Schließlich bietet uns hier gerade jemand seine Hilfe an, nur weil er unsere Musik mag. – Oder?
»Was würde denn für dich dabei rausspringen?«, frage ich. »Das klingt zwar ganz hübsch, dass du willst, dass gute Musik gehört wird und dass du gerne jungen Bands hilfst und so weiter. Aber du sagst ja selber: Du bist Geschäftsmann. Also, was erhoffst du dir davon, unser Manager zu sein?«
Paulo wirkt überhaupt nicht beleidigt. »Gute Frage. Ich sag mal so: Wenn man eine Band bekannter machen will, dann braucht man normalerweise mehr als ein Jahr. Man braucht sicher mindestens zwei. Vielleicht noch mehr. Am Anfang muss man vor allem investieren. Das ist so wie bei jedem anderen Geschäft auch. Dazu wäre ich bereit. Ich glaube an eure Musik. Ich bin überzeugt, dass sie Erfolg haben kann. Und ich bin bereit, das Geld vorzuschießen, das ihr nicht habt. Wenn sich dann der Erfolg einstellt, möchte ich natürlich mitverdienen. Das ist ja wohl klar. Aber ich verdiene an der Sache erst, wenn es soweit ist. Vorher will ich gar nichts von euch. Vorher will ich euch helfen. Ich glaube, ihr verdient es.«
Wir schweigen wieder. Ich denke: Kann das sein? Ist das so eine Art Geburtstagsgeschenk vom lieben Gott? Ich schaue verstohlen zu Paulo, der wieder die Sonnenbrille in den Händen dreht und auf unsere Reaktion wartet. Der sieht nicht aus wie ein Halsabschneider. Der meint das ernst.
»Ich bin dabei«, sage ich und fange sofort wieder einen alarmierten Blick von Foo, der mahnend die Hand hebt und Paulo anschaut.
»Moment!«, sagt er. »Was ist denn dein Plan? Was würdest du denn machen, was wir nicht auch machen könnten?«
»Ich würde erst mal euer Booking übernehmen«, antwortet Paulo ganz ruhig. »Ich habe immer noch Kontakte zur Musikszene in ganz Deutschland, die kann ich für euch nutzen. Ihr müsst auf die Bühne. Wenn ihr nicht auftretet, kennt euch auch keiner. Dann solltet ihr eine CD machen. Das wäre erst mal eine Produktion mit einem kleineren Budget bei einem Indie-Label. Aber für den Anfang ist das genau das Richtige. Und wenn die im Kasten ist, macht ihr eine Tour durch Clubs in ganz Deutschland. Das ist der harte, aber ehrliche Weg ins Musikbusiness. Wir haben jetzt Anfang April, das kann also alles noch in diesem Jahr laufen, wenn ihr dabei seid.«
Paulo merkt, dass Foo noch unschlüssig ist. »Du überlegst noch, oder?«
»Wir können das nicht alleine entscheiden«, sagt Foo schmallippig. Er sieht nur mich an, als würde er auf Paulo gar nicht eingehen. »Wir müssen erst die anderen fragen.«
»Tut das«, antwortet Paulo. »Ich geb euch meine Karte, und wenn ihr euch einig seid, dann meldet ihr euch bei mir. Okay?«
Paulo schiebt seine Visitenkarte zu mir über den Tisch und lächelt mich an. »Danke für dein Vertrauen. Wie heißt du überhaupt?«
»TimTom«, sage ich und lächle zurück.
»Und du?«, wendet sich Paulo an Foo.
»Foo«, sagt Foo und sieht Paulo dabei in die Augen.
»Und die Band heißt TimTom Guerilla«, füge ich hinzu.
»Sehr gut«, sagt Paulo und erhebt sich. »Ich freue mich auf euren Anruf. Ciao!«
Er geht rüber zu Sonja, bezahlt seine Rechnung und verlässt das Chattanooga. Foo und ich bleiben wie erschlagen sitzen.
»Ich hol noch ein Bier«, sagt Foo. »Willst du auch noch eins?«
»Auf jeden.«
NEUN
Dienstag, 12. April 2011
Mein Vermieter Herr Vollrath ist ziemlich beeindruckend. Er ist etwa eins neunzig groß, trägt maßgeschneiderte graue Anzüge und fährt entweder mit einem silbergrauen Mercedes 500 SEL oder einem roten Alfetta Spider vor. Natürlich wohnt Herr Vollrath nicht in seinem Haus in der Hermannstraße, in dem ich ganz oben unterm Dach ein Appartement gemietet habe. Seine Villa steht irgendwo hoch über der Stadt am Teutoburger Wald, links von der Sparrenburg. Steinerne Löwen flankieren das schmiedeeiserne Gittertor, das Spaziergängern den unerlaubten Zutritt verwehrt, und dahinter steht das herrschaftliche Haus – das ich noch nie gesehen habe, denn weiter als bis zum Tor kam ich nicht, und das Haus liegt hinter Hecken und Mauern verborgen.
Herr Vollrath spricht mit leiser, tiefer Stimme. Das macht ihn noch beeindruckender. Seine Körpergröße, sein Alter – er ist vielleicht Ende fünfzig, wirkt aber älter, weil sein Haarkranz und sein sorgfältig gestutzter Schnauzbart schlohweiß sind – und sein gebieterisches Auftreten lassen mich wieder zu dem schüchternen, kleinen Jungen werden, der ich früher mal gewesen bin. Vollraths Hände spielen mit einer Schachtel Ernte 23, während er nicht zu mir sieht, sondern seinen Blick durchs Fenster schweifen lässt, nach draußen, Richtung Hinterhof. Ich wage einen verstohlenen Blick in sein Gesicht. Die schweren Tränensäcke und die rote Gesichtsfarbe lassen darauf schließen, dass Herr Vollrath gerne Alkohol trinkt. Während mein Vermieter über mir an seinem Schreibtisch thront, sitze ich zu seiner Rechten ziemlich tief auf einem glatten, dunkelbraunen Ledersofa. Um uns herum herrscht reges Treiben. Die Arbeiten in Vollraths Werbeagentur, die sich im unteren Stockwerk des Hauses in der Hermannstraße befindet, sind in vollem Gange.
»Das kommt überhaupt nicht in Frage«, sagt Herr Vollrath, ohne mich anzusehen. »Sie haben einen Mietvertrag mit mir abgeschlossen. Und in diesem Mietvertrag haben Sie sich verpflichtet, eine dreimonatige Kündigungsfrist einzuhalten. Also, Sie können gerne den Vertrag jetzt kündigen. Und dann verlassen Sie in drei Monaten Ihre Wohnung in dem Zustand, den wir vertraglich vereinbart haben. Und dann kriegen Sie Ihre Kaution wieder. Aber bis dahin zahlen Sie Miete. Ist doch klar.«
Ich habe Herrn Vollrath gefragt, ob ich schon am Ende des Monats ausziehen kann. Ich habe ihm erzählt, dass ich bei meinem Freund ein Zimmer beziehen kann. Und dass ich dort nur die Nebenkosten bezahlen muss. Und dass ich das wirklich sehr gerne tun möchte, weil ich einfach nicht so viel Geld habe und manchmal ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich die Miete überhaupt aufbringen soll. Und dass das auch meinem Freund sehr wichtig wäre, weil der sich in seinem Haus ziemlich allein fühlt und außerdem, was die Nebenkosten angeht, echt Unterstützung brauchen könnte.
Und das ist seine Antwort. Ich versuche es nochmal. »Sie haben ja völlig recht ...«
»Natürlich habe ich recht«, unterbricht er mich und schaut mich jetzt doch an, mit einem Blick, als hätte ihn gerade sein Hund angesprochen.
»Ja, ja, natürlich«, pflichte ich ihm eifrig bei und fange an, mich vor mir selbst zu ekeln, »klar, das steht alles so im Vertrag. Das weiß ich auch. Meine Frage ist eigentlich nur, ob Sie vielleicht eine Ausnahme machen können. Also, ausnahmsweise.«
Die Augen, die mich zwischen seinen dicken Lidern und schweren Tränensäcken hindurch ansehen, bewegen sich nicht. »Nein«, sagt er.
Ich warte einen kurzen Moment, ob er noch etwas hinzufügen möchte. Aber das will er nicht. Er bleibt reglos sitzen und starrt mich an.
»Okay«, sage ich und stehe vom Ledersofa auf, »gut, ähm, dann weiß ich Bescheid. Tja, also, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wiedersehen.«
»Wiedersehen«, antwortet Vollrath, dreht sich weg und zündet sich eine Zigarette an. Ich verlasse die Agentur, ohne dass noch irgendein Mitarbeiter eine Notiz von mir nimmt, und stehe verloren im Treppenhaus, während sich die Tür hinter mir geräuschlos schließt.
Es ist dunkel. Nur durch das große Glasportal, das direkt zur Straße geht, scheint helles Tageslicht herein. Ansonsten hat das Treppenhaus keine Fenster. Ich drücke auf den Schalter zu meiner Linken. Das Deckenlicht flammt auf, und die Wandvertäfelung aus rosa Marmor wird sichtbar.
Ich überlege, was ich jetzt mache. Das Gespräch mit Vollrath ging in die Hose. Ich komme mir albern vor, dass ich auch nur einen kurzen Augenblick darauf gehofft habe, er würde einlenken und mich einfach so ausziehen lassen. Der doch nicht! Dieses kapitalistische Arschloch! Wie konnte ich denken, dass mir ein Mann entgegenkommen würde, der mir eine Bruchbude zu solch einem horrenden Preis vermietet? Weil mir nichts Besseres einfallt, reiße ich wütend die weiße Metalltür zu meiner Rechten auf und betrete den altertümlichen Fahrstuhl. Ich drücke auf den Knopf mit der 3, eine automatische Schiebetür schließt sich geräuschvoll, dann wuppt der Fahrstuhl leicht an und gleitet nach oben. Im dritten Stockwerk steige ich aus, gehe rechts um den Fahrstuhl herum und erklimme die letzte Treppe in den vierten Stock, der sich direkt unter dem Hausdach befindet.
Oben angekommen, gehe ich durch einen sehr engen Flur. Hier sind die Wände nicht vertäfelt. Und auf dem Boden liegt ein brauner Teppich. Durch die ebenfalls braunen Türen meiner Nachbarn dringen Geräusche: Hinter der einen zischt heißes Fett in einer Pfanne, hinter der anderen hat der heruntergekommene Typ wieder einen seiner Hustenanfälle, die so heftig sind, dass man denkt, er kotzt sich gleich die Lunge aus dem Leib. Ganz am Ende des Flurs befindet sich links die Tür zu meiner Bude. Ich wohne direkt neben einer Frau, die ich nicht kenne und erst einmal gesehen habe. Sie ist mittleren Alters und blond. Was sie tagsüber macht, wo sie arbeitet, ob sie überhaupt eine Arbeit hat, ob sie in einer Beziehung lebt oder ob sie aus Bielefeld stammt – ich weiß das alles nicht. Und ehrlich gesagt, ich will’s auch gar nicht wissen. Denn die Wände sind so dünn, dass wir alles hören können, was wir in unseren Wohnungen so treiben. Auf eine gewisse Art sind wir uns also sehr nah. Ohne dass wir es wollen, rücken wir einander akustisch auf die Pelle.