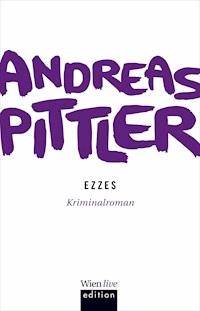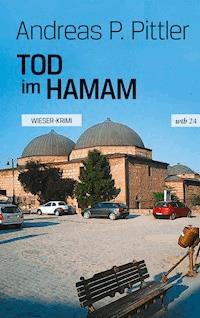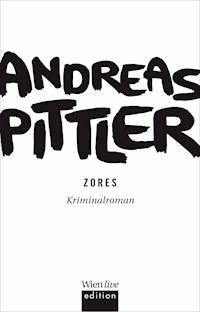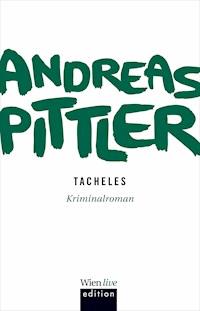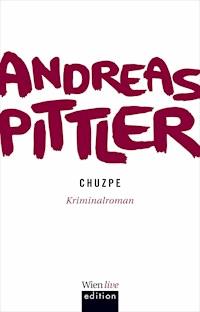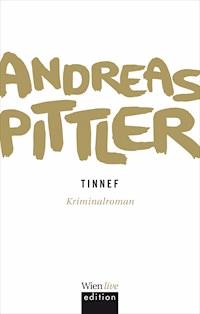
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: echomedia buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer Vorstadtwohnung hängt ein junger Generalstabsoffizier vom Kronleuchter. Der zuständige Polizist, David Bronstein, mag nicht so recht an einen Selbstmord glauben. Als er wenig später die Tochter eines Finanzbarons aus einer misslichen Lage befreit, nutzt dieser seine Verbindungen, um Bronstein einen Posten in der Mordkommission zuzuschanzen. Und das Fräulein Tochter findet Gefallen an dem jungen Kommissar. Bronsteins Ermittlungen bringen schon bald pikante Details ans Licht, die nicht allen Beteiligten genehm sind. Und auch seine neue Herzdame fühlt sich vernachlässigt. Muss Bronstein zwischen Pflicht und Liebe wählen? Wie wird seine Entscheidung ausfallen? Mit „Tinnef“ legt Andreas Pittler den vierten Band seiner Kriminalsaga vor, mit der er die Geschichte Österreichs vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis zum Ende der Ersten Republik ebenso mitreißend wie spannend aufrollt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
TINNEF
Andreas Pittler
Impressum:
ISBN 978-3-902672-42-1
2011 echomedia buchverlag ges.m.b.h. A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 24 Alle Rechte vorbehalten
Produktion: Ilse Helmreich Produktionsassistenz: Brigitte Lang Layout: Elisabeth Waidhofer Lektorat: Thomas Hazdra Herstellungsort: Wien eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Informationen zum Verlag unter:
www.echomedia-buch.at
Prolog
Ich werde endlich doch bald ganz tot sein. Innerlich bin ich es schon lange. Seit mir die große Liebe meines Lebens unmissverständlich klargemacht hat, dass sie meine Gefühle nicht zu erwidern imstande ist. Lange habe ich gehofft, meine Liebe könnte für uns beide reichen, doch nun sehe ich ein, dass all mein Hoffen vergebens ist. Und was, so frage ich mich, hat das Leben für einen Sinn, wenn der einzige Mensch, den man liebt, nichts für einen empfindet? Der Mensch, so heißt es, ist ein soziales Wesen, er muss sich anderen zugesellen, um glücklich sein zu können. Ich bräuchte nur einen einzigen anderen Menschen, um mein Glück zu finden, doch genau dies ist mir nicht vergönnt. Und so komme ich zu dem Schluss, dass es besser ist, diesem Jammertal Lebewohl zu sagen. Vielleicht liegt mein Glück ja in einer anderen Welt, die frei ist von Qualen und dieser unendlichen Trauer, die mich seit Wochen gefangen hält.
Ich habe mir diesen Entschluss nicht leicht gemacht. Tag um Tag verging mit der aussichtslosen Suche nach einer anderen Lösung als jener, die ich nun wählen werde. Doch weder vermochte mir die flüchtige Ablenkung durch diverse abendliche Vergnügungen noch gar die Religion irgendeinen Trost zu verschaffen, und so stehe ich nun vor den Trümmern jener Existenz, die ich bald gewesen sein werde. Es mag sein, dass ich vieles in meinem Leben falsch gemacht habe, möglicherweise ist dies auch der Grund dafür, dass ich keine Liebe verdient habe. Doch nun werde ich einmal in diesem verkorksten Sein etwas richtig machen.
Der Haken neben dem Luster ist für meinen Zweck hervorragend geeignet. Er ist ganz fest in der Decke verankert, gerade recht, um eine beträchtliche Last zu tragen. Ich fixiere den Strick an diesem Haken und kontrolliere durch kräftiges Ziehen nochmals, ob er seinem Zweck auch gerecht wird. Dann stelle ich mir den Sessel zurecht. Ich kontrolliere noch einmal vor dem Spiegel meine Erscheinung. Die Uniform sitzt hervorragend, und es steht zu hoffen, dass dies auch noch der Fall sein wird, wenn man diesen Körper, der dann einmal meine Seele umschlossen hielt, findet. Ich habe gehört, dass Hängen ein langsamer Tod ist, wenn einem dabei nicht das Genick gebrochen wird. Nun, der Fall wird kaum ausreichen, dies zu bewerkstelligen, aber es ist durchaus in Ordnung, wenn ich nicht schnell sterbe. Denn auch ich muss Buße tun. Immerhin habe ich es nicht geschafft, meine Liebe für mich zu gewinnen. Ich war eben nicht stark genug, und für diese Schwäche muss ich büßen. Es heißt allerdings, dass man in seinem Todeskampf eine Erektion bekommt, ja, dass man sich im Tode sogar noch einmal ergießt. Das ist, so hoffe ich, nur ein dummes Gerücht, denn es möchte die Uniform schön aussehen, wenn sich just an einer solchen Stelle ein derartiger Fleck zeigte. Aber bei dem vielen Pech, das mein Leben so nachhaltig kennzeichnete, wäre es wohl nicht zu viel verlangt, einmal auch Glück zu haben. Ich hoffe also, mich bei dieser letzten Reise nirgendwo selbst zu beflecken. Wahrscheinlich ist das eine Frage der Disziplin, und an dieser hat es bei mir ja nie gemangelt. Ich überprüfe noch einmal die Schlinge und befinde sie für in Ordnung. Ein letztes Mal sehe ich mich in diesem meinem Zimmer um. Es ist schon recht, dass hier alles endet, da hier nichts begonnen hat, obwohl ich so sehr darauf gehofft habe. Mit Schrecken denke ich an jenen einen Abend zurück, an dem mir unmissverständlich vor Augen geführt wurde, wie töricht mein Ansinnen sei. Von diesem anderen war da die Rede, von diesem Krösus, der sich all das leisten könne, was ich niemals würde mein Eigen nennen. Vergeblich war da all mein Bitten und Flehen, ungehört blieben meine Warnungen, dass dieser Schurke nur Spielchen spiele, dass er sich nur von einer momentanen Laune leiten lasse, während meine Gefühle zutiefst aufrichtig, ehrlich und durch und durch lauter seien. Dieses Lachen werde ich nie mehr aus meinen Ohren bekommen, es wird mich in meinen einsamen Tod begleiten. Was für ein Dummkopf ich doch sei! Ja, ein Dummkopf war ich gewiss. Wie glaubte ich, mit Empfindungen konkurrieren zu können gegen Geld, Wohlstand und Aufmerksamkeit? Ein Mann von Welt, der einem ebendiese zu Füßen legt – was zählen da die Liebesschwüre eines Habenichts aus der Provinz?
Ich war eben nicht zum Leben bestimmt. Ein Irrtum der Natur, wie er allenthalben einmal vorkommt. In der freien Wildbahn findet eine solche Existenz ihr rasches Ende, in der menschlichen Zivilisation muss man diesem eben ein wenig nachhelfen. Und ich steige auf den Stuhl.
Ich bin das oft genug durchgegangen. Ich muss nur kurz hochspringen und dabei gegen die Lehne des Sessels schlagen. Dieser kippt um, und mein Körper pendelt in der Luft. Der Tisch ist weit genug entfernt, ich werde also nicht in Versuchung kommen, im allerletzten Moment doch um eine Rettung zu ringen. Alles ist generalstabsmäßig – welche Ironie! – vorbereitet. Der letzte Akt kann beginnen, auf dass der Vorhang bald für immer falle.
Merkwürdig. Wenigstens jetzt, ein paar Augenblicke vor dem unausweichlichen Tode, sollte mich die Angst überkommen. Doch ich empfinde nichts. Nein. Gar nichts. Da ist keine Furcht, keine Neugier, keine andere Sinnenregung. Ich sehe dem, was kommt, mit demselben Gleichmut entgegen, wie ich meine Morgentoilette zu verrichten pflege.
Kein Zaudern jetzt. Kein ewiges Philosophieren. Jetzt ist die Stunde gekommen, sich von dieser unglücksbeladenen Existenz zu befreien. Ich lege mir die Schlinge um den Hals und ziehe sie zu. Schon ist meine Atemmöglichkeit ein wenig eingeschränkt, doch das hilft mir, nur noch klarer zu denken. Mein Blick fixiert mein Bett, das ganz gegen mein Wollen so jungfräulich geblieben ist. Wahrscheinlich werde ich im Augenblick des Sprungs instinktiv meine Augen schließen, doch das wäre gegen meinen Willen. Ich will sehenden Auges in die nächste Welt gehen. Auch das ist wohl eine Frage der Disziplin.
Eigenartig. Ich hole tief Luft, so als gelte es, einen Tauchgang zu absolvieren. Wie widersinnig. Genug gedacht, genug getrödelt. Ich spanne meinen Körper, gehe leicht in die Knie, was den Strick um meinen Hals schon einmal spannt. Meine Arme nehmen ihre sprungtypische Ausgangsposition ein, und schon stoße ich mich ab. Für einen Moment befinde ich mich in der Luft, dann setzt die Schwerkraft ein, und es geht abwärts. Doch meine Beine geraten an ein Hindernis. Der Sessel! Es ist mir nicht gelungen, ihn umzuwerfen. Merkwürdig, eigentlich sollte das eine ganz leichte Übung sein, und doch zögere ich. Ich spüre einen unerträglichen Druck in meinem Kopf, ein wildes Zucken in meinen Schläfen. Dieses Pochen, dieses Pochen.
I.
Montag, 10. Februar 1913
Stalin. So nennt sich jener Verdächtige, den zu überwachen wir beauftragt sind. Er ist vor einigen Tagen aus Galizien, wo er sich bei dem bekannten Umstürzler Uljanow, der unter dem Tarnnamen Lenin agiert, aufgehalten hatte, mit dem Zug nach Wien gekommen und hat in der Schönbrunner Schlossstraße Quartier genommen. Dort logiert ein Alexander Trojanowski, der, wie uns von der zuständigen Abteilung versichert wird, gleichfalls dem linken exilrussischen Netzwerk zuzurechnen ist. Die Überwachung wurde am 5. dieses Monats angeordnet, da seitens des k. k. Kundschafterdienstes die Meldung überbracht wurde, genannter Stalin gehöre dem innersten Zirkel der russischen Umstürzler an, weshalb ihm äußerste Aufmerksamkeit zuteil werden solle.
Nach fünf Tagen muss allerdings festgestellt werden, dass die Beschattung des Verdächtigen bislang keine Ergebnisse gezeitigt hat. Der Mann verlässt die Wohnung bis zum frühen Abend nicht, dann spaziert er den Wienfluss entlang in Richtung kaiserliches Schloss, um sich sodann wieder zu seiner Wohnung zu begeben. Außerhalb dieser hat er sich mit niemandem getroffen oder auch nur jemanden gesprochen. Es scheint, als bliebe der Mann völlig für sich.
Die Beschreibung, die unten unterfertigte Dienststelle über den Mann erhalten hat, ist im Übrigen vollkommen korrekt. Der Verdächtige ist knapp einen Meter sechzig groß, hat auffallende Pockennarben und dunkelschwarzes Haupthaar, das ihm meist ungekämmt vom Kopfe steht. Als besonderes Kennzeichen ist der große Schnurrbart zu nennen, ebenso eine leichte Behinderung des linken Arms.
Wie wir von unseren Konfidenten im russischen Milieu in Erfahrung bringen konnten, nennt sich der Verdächtige auch „Koba“, was mit seiner georgischen Herkunft zu tun haben dürfte. Angeblich handelt es sich dabei um einen Helden einer kaukasischen Sage, in dessen Fußstapfen der zu Beobachtende offensichtlich zu treten gewillt ist. Seinen wirklichen Namen wussten auch unsere Konfidenten nicht mit Gewissheit zu sagen, doch gibt es Hinweise darauf, dass besagter Stalin oder Koba mit dem ehemaligen Priesterschüler Josef Dschugaschwili identisch ist, der im Zarenreich wegen mehrerer Banküberfälle gesucht wird und bereits mehrfach inhaftiert war.
Bronstein unterdrückte einen Fluch und warf die Feder in weitem Bogen über den Schreibtisch. Nicht nur, dass dieser Überwachungsauftrag überaus fade war, darüber auch noch einen Bericht verfassen zu müssen war die Krönung der ganzen Angelegenheit. Warum konnte man sich nicht auf eine Art Datenstammblatt verständigen, in dem man einfach nur das Wesentliche eintrug: Name, Tarnname(n), Zeitraum der Überwachung, Ergebnis? Es gab doch in der Monarchie für jeden Leibeswind ein eigenes Formular, warum musste man da ausgerechnet in solchen Dingen zum Karl May befähigt sein?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!