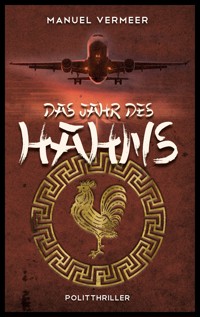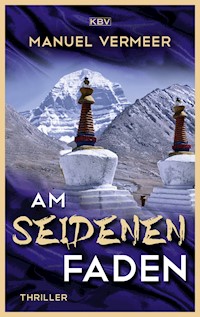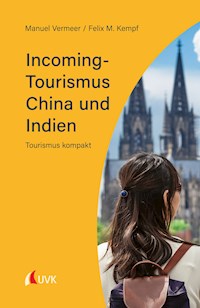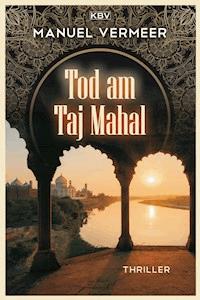
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cora Remy
- Sprache: Deutsch
Atemlose Jagd durch Indien Eigentlich wollte die deutsche Ingenieurin Cora Remy nur ihren Freund Ganesh in Indien besuchen, doch der ist spurlos verschwunden, offenbar entführt von der skrupellosen indischen Sandmafia. Hat er sich zu sehr in deren kriminelle Machenschaften eingemischt? Sand ist eine ungemein kostbare und zunehmend knapper werdende Ressource der weltweiten Bauwirtschaft, ein Handelsgut von unschätzbarem Wert. Der üppig vorhandene Wüstensand ist zum Bauen nicht geeignet, selbst die Araber importieren Sand. Cora macht sich auf die verzweifelte Suche nach Ganesh. Vom weltberühmten Taj Mahal führt die Spur sie quer durch Indien, bis an die gefährliche pakistanische Grenze, hinunter in das Zentrum der deutschen Indienaktivitäten nach Pune und schließlich nach Mumbai. Dort hält sich der Sandlord auf, der bei seinem kriminellen Handel vor nichts zurückzuschrecken scheint. Als Cora sich mit ihm anlegt und in Dharavi, dem größten Slum Asiens, in Gefangenschaft gerät, scheint ihr Leben wie feiner Sand in einer Sanduhr zu zerrinnen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Mit dem Wasser kommt der Tod
Dr. Manuel Vermeer, Sohn einer indischen Mutter und eines deutschen Vaters, studierte klassische und moderne Sinologie in Heidelberg, Shanghai und Mainz. Er ist Dozent am Ostasieninstitut der HS Ludwigshafen und Inhaber der Dr. Vermeer-Consult (Unternehmensberatung für China, Indien und Südostasien). Seit über 30 Jahren bereist er Indien, China und andere asiatische Länder. Er ist Autor von Sachbüchern zu Indien und China und gab dazu bereits zahlreiche Interviews in Radio und TV. In »Mit dem Wasser kommt der Tod« verarbeitete er sein Fachwissen zum ersten Mal in einem packenden Thriller.
MANUEL VERMEER
Tod amTaj Mahal
Originalausgabe
© 2018 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von © inigocia
und © Marta Jonina - Fotolia.de
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-431-4
E-Book-ISBN 978-3-95441-441-3
Für einen trägen Geist ist aucheine Weltausstellung kein Anreiz.Ein reger Geist interessiert sich auch für ein Sandkörnchen.
(Raymond Hull)
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Und dann noch …
1. Kapitel
Angst. Von Indogermanisch anghu, beengend. Wird unbestimmt wahrgenommen, ohne eindeutige Ursache, im Gegensatz zur Furcht, bei der der Auslöser bekannt ist. Dunkelheit, Spinnen, Kakerlaken, je nachdem. Er aber verstand nicht, wo er war, warum er hier war, warum es so kalt war. Also Angst. Warum war er verzweifelt, warum fühlte er Schmerz? Kälte, Durst, Einsamkeit. Angst. Etwas berührte seinen Fuß, dann ein leises Geräusch, ein Scharren, ein Huschen. Etwas rannte um ihn herum, winzige Füße trippelten, etwas Weiches, Fellartiges strich an seinem Oberschenkel entlang. Er sah nichts, die Dunkelheit war vollkommen. Er war allein. Nein, nicht ganz, etwas lebte offensichtlich hier mit ihm. Kein anderes Geräusch drang an sein Ohr, und obwohl es kalt war, eiskalt, schwitzte er. Oder warum lief ihm sonst der Schweiß in den Nacken? Kein Schweiß, eine Flüssigkeit tropfte ihm aus den Haaren und rann den Hals entlang hinab in sein Hemd. Wasser? Er bewegte sich; er saß auf dem Boden. Mit beiden Händen strich er vorsichtig darüber; Stein, eben, kalt. Langsam hob er beide Hände, um zu tasten, ob er aufstehen könnte. Nichts, also keine niedrige Decke. Vorsichtig drehte er sich, stützte sich mit der linken Hand ab und versuchte sich zu erheben. Die rechte Hand streckte er nach oben aus, über den Kopf, um sich nicht zu stoßen. Erst das linke Bein, gut. Jetzt das rechte. Und brach mit einem lauten Schrei zusammen, fiel auf den kalten, feuchten Stein. Ein Schmerz durchfuhr seinen Knöchel wie ein Messerstich, unmöglich aufzustehen. Er lag, er fror. Ahnungslos. Angst. Unwillkürlich kam ihm eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe in den Sinn, die er in der Schule gelesen hatte: Die Grube und das Pendel. Ein dunkler, feuchter Raum, Ratten … die beginnende Panik.
Er riss sich zusammen. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, dass er sein Hotelzimmer verlassen hatte und zu seinem Wagen gegangen war. Dann – Blackout.
Als er erneut versuchte, sich vorsichtig aufzustützen, kam mit dem schneidenden Schmerz auch die Erinnerung zurück. Sie würden wiederkommen. Das hatten sie gesagt. Sie waren zu zweit, und sie wechselten sich ab; erst schlug der eine, der kleine, dickliche, dann kam der andere, größer, schwerer. Er hatte das Messer. Ein Schlag, ein Stich. Und sie schwiegen dabei. Jetzt wusste er auch wieder, was die Flüssigkeit war, die ihm den Kopf entlangrann. Seine Augen waren verklebt von Blut, und erst als er jeden Widerstand aufgegeben hatte, waren sie gegangen. Nicht ohne das Versprechen, nach dem Essen zurückzukommen. Gleich. Gleich war es wieder so weit. Hörte er Schritte? Oder bildete er sich das ein? Panik! Das erklärte sein Gefühl. Nicht mehr Angst, sondern Furcht. Der auslösende Stimulus war bekannt.
2. Kapitel
Ladies and Gentlemen, soon we will be landing at Tribhuvan International Airport.«
Cora sah auf ihre Uhr. Pünktlich! Der Blick aus dem Fenster half nicht viel; es regnete in Strömen, und der Wind trieb die Schlieren im Landeanflug die Fensterscheiben entlang. Kathmandu schien nachts nicht sehr belebt zu sein. Bis auf wenige Lichter, deren Widerschein sich in den Tropfen am Fenster brach, war alles dunkel. Morgen, wenn sie zu ihrem Staudammprojekt aufbrechen musste, konnte sie hoffentlich etwas von der Stadt sehen. Es war erst zweiundzwanzig Uhr. Cora kam aus Hongkong und musste nun ihre Uhr wieder umstellen. Aus unerfindlichen Gründen hatte Nepal nicht die gleiche Zeitzone wie das südlich angrenzende Indien, sondern noch eine Viertelstunde mehr Differenz, also jetzt drei Stunden und fünfundvierzig Minuten zu Deutschland. Wer hatte sich denn das ausgedacht? Dann fiel ihr ein, dass sie irgendwo gelesen hatte, dass noch im 19. Jahrhundert auch im Deutschen Reich jedes Dorf seine eigene Zeit hatte; na ja, und dass im rheinland-pfälzischen Westerwald, ihrer Heimat, die Zeit noch heute anders verging als in den Metropolen dieser Welt, war ja bekannt …
Kurz darauf stand sie müde, ihre blonden Locken leicht zerzaust nach dem Flug, an Gepäckband Nummer zwei (leicht zu finden, das einzige andere Band war Nummer eins) und betrachtete amüsiert das Chaos um sie herum. Nach der perfekten Sauberkeit und Ruhe Hongkongs, der ehemals britischen Kronkolonie an der Südspitze Chinas, war dieses Gewusel von einheimischen Geschäftsleuten wohl der stärkste Kontrast, der vorstellbar war. Schwer mit Geschenken (Monstertrucks und Transformer-Spielzeug für die Kids) beladene, aus dem Ausland heimkehrende Nepali stolperten über gelegentliche Ausländer, alles lief durcheinander, telefonierte laut und versuchte gleichzeitig, einen Platz direkt am Laufband zu ergattern. Cora stellte sich etwas abseits – sie würde auch so sehen, wenn ihr Gepäck vorbeikam – und prüfte nochmals den Namen des Fahrers, der sie abholen sollte. Fischer, der Chef ihres heimatlichen Ingenieurbüros, hatte wie immer alles perfekt organisieren lassen, und in spätestens einer Stunde sollte sie in einem schönen und hoffentlich sauberen Bett liegen.
Da kam auch schon ihre abgewetzte, braune Ledertasche; sie reiste immer mit leichtem Gepäck. Alles Nötige konnte man unterwegs kaufen, und sie war, was Kleidung und sonstige Utensilien anbelangte, unkompliziert. Kein Fön, kein Lockenstab, kein Beautycase. Cora schnappte sich ihre Tasche vom Band, lächelte entschuldigend einem älteren Herrn zu, den sie angerempelt hatte, und folgte zielsicher dem Schild mit der Aufschrift Immigration. Auf dem Weg nach draußen gab es wieder einen Stau, als alle ihr Gepäck nochmals an einem wenig vertrauenerweckenden Gerät durchleuchten lassen mussten. Ein gelangweilter Mitarbeiter des Flughafens saß daneben und schaute auf einen Bildschirm, wenn er nicht gerade mit seiner Kollegin flirtete. Konnte man das nicht umgehen? Cora lief, ihre Reisetasche fest im Griff, starr geradeaus blickend an der Kontrolle vorbei und entschwand durch den grünen Ausgang, da sie nichts zu verzollen hatte. Keiner der diensthabenden Mitarbeiter des Bodenpersonals wagte, die attraktive Ausländerin mit den kurzen, lockigen und noch dazu blonden Haaren, die mit schnellen Schritten dem Ausgang zustrebte, aufzuhalten. Einen Blick auf die engen Jeans konnte man dennoch riskieren …
Vor dem Eingang umfing sie warme, feuchte Luft. Cora sah sich einem Absperrband gegenüber, hinter welchem Dutzende von jungen Männern und wenige Frauen mit den üblichen Schildern warteten, auf denen die Namen der Reisenden in teils fantasievoller Schreibweise geschrieben standen; die besseren Hotels und manche Firmen entsandten Abholer, die die Ankommenden vor dem Einfallsreichtum nepalesischer Taxifahrer bewahren sollten. Suchend schweifte ihr Blick die Reihe entlang, als sie auf ein Schild mit dem Namen Dr. Cora stieß. Der dazugehörige junge Mann, schwarzes T-Shirt und lässige Jeans, nickte ihr erst fragend, dann begeistert zu und machte ihr ein Zeichen, sie solle die Absperrung entlanggehen und ihn an ihrem Ende treffen. Stolz sah er sich um, ob auch seine Kollegen alle sahen, was für einen besonderen Fang er da gemacht hatte! Eine schöne blonde Ausländerin, Hauptgewinn. Schnell lief er auf Cora zu, nahm ihr galant das Gepäck ab, obwohl er kleiner war als sie, und führte sie über die regennasse Straße zu einem uralten japanischen Van undefinierbarer Farbe. Cora stieg hinten rechts ein, merkte dann, dass sie hinter dem Fahrer saß, und rutschte nach links rüber. Linksverkehr wie in Hongkong auch hier; die Briten hatten in Asien ihre Spuren hinterlassen. Sie ließ sich in den Sitz sinken und versuchte etwas zu entspannen.
Neugierig blickte sie aus dem Fenster. Der Regen hatte nachgelassen, schemenhaft konnte sie Gebäude und Menschen erkennen. Gleich nach Verlassen des Flughafengeländes verschlechterte sich der Zustand der Straße; übersät mit Schlaglöchern und immer enger werdend, verlor sie sich vor ihnen im Dunkel. Unbeeindruckt davon brauste ihr Fahrer davon, wich in letzter Sekunde einem auf der Straße schlafenden Hund aus und schaffte es, gleichzeitig ein entgegenkommendes Motorrad mit Fernlicht zu blenden. Während er immer zwischen Hupen und Blinken abwechselte, telefonierte er fröhlich mit seinem Handy; aus seinen stolzen Blicken in den Rückspiegel schloss Cora, dass er seinen Freunden berichtete, wen er da gerade durchs nächtliche Kathmandu fuhr.
Knapp zwanzig Minuten später, Cora war in dem warmen Wagen gerade eingeschlafen, hielten sie in einer stockdunklen Gasse vor einem großen eisernen Tor. Ein junger Mann trat heraus; der Fahrer stellte ihre Tasche auf die Straße, dann fuhr er mit quietschenden Reifen, was sie wohl beeindrucken sollte, wortlos davon. Der Junge nahm Coras Tasche, lächelte sie verlegen an und ging voran, ohne ein Wort zu sagen. Offensichtlich traute er sich nicht, eine Ausländerin anzusprechen. Oder sprach er kein Englisch? Er schob das Tor auf, und sie betraten einen großen, gepflasterten Innenhof, an dessen Ende Cora ein vierstöckiges Gebäude erblickte, ihr Hotel wohl. Es sah ordentlich aus, wenn auch nicht sehr einladend, da hinter keinem Fenster Licht brannte. Schliefen alle oder war sie der einzige Gast? Auch in den angrenzenden Gebäuden war kein Licht mehr zu sehen. Sie spürte ein mulmiges Gefühl im Magen. Der junge Mann, das weiße Hemd über der Jeans hängend, schlurfte in seinen braunen Sandalen vor ihr ins Gebäude, und Cora konnte gerade noch die Tür festhalten, bevor sie vor ihr ins Schloss fiel. Sie aufzuhalten, war dem Nepali nicht in den Sinn gekommen. Er stieg vor ihr eine knarrende Holztreppe hinauf, die von einem kleinen, dunklen Flur aus in die oberen Stockwerke führte. Im zweiten Stock angekommen, öffnete der Mann eine Zimmertür, lächelte schüchtern, stellte ihre Tasche ab und ging; immerhin grüßte er sie zum Abschied mit vor der Brust gefalteten Händen und deutete eine Verbeugung an.
Als Cora unten die Tür ins Schloss fallen hörte, wusste sie, dass sie allein war. Das Hotel schien sonst nicht belegt zu sein. Na gut. Sie sah sich um. Weiß getünchte Wände, Holzfußboden. Gleich links befand sich das Bad, ein kurzer Blick hinein, sah sauber aus. Eine Dusche, sogar eine westliche Toilette gab es, was wollte sie mehr? Wenn sie da an die tibetischen Varianten dachte, die sie letztes Jahr hatte erleben dürfen … Cora ging hinüber zu dem großen Bett, daneben stand ein Schreibtisch mit einem klapprig anmutenden Holzstuhl; in die Wand rechts war ein Regal eingelassen. Zwei kleine Fenster führten auf den Innenhof hinaus. Alles sehr einfach, aber hübsch. Und sauber!
Cora zog sich rasch aus. Sie hatte Hunger, aber sich jetzt allein auf die Suche nach einem Restaurant zu machen, war keine verlockende Aussicht. Sie überlegte kurz, ob sie noch duschen sollte, war aber eigentlich auch dazu zu müde. Sie öffnete beide Fenster, um frische Luft hereinzulassen, und kroch unter die Bettdecke. Irgendwo lief ein Fernseher mit indischer Bollywood-Musik, ein Motorroller brauste draußen auf der Straße vorbei. Sie schlief sofort ein.
Als ihr Handy klingelte, schrak sie hoch. Um diese Uhrzeit? Sicher wieder ihr Chef, Fischer, was war ihm jetzt wieder eingefallen? Die Sache mit dem Zeitunterschied hatte er vermutlich schon wieder vergessen, das sah ihm ähnlich! Ein Blick aufs Display aber ließ ihr Herz schneller schlagen. Seit dem Abenteuer in Tibet hatte sie Ganeshs Telefonnummer eingespeichert, und nun stand sein Name dort! Ganesh! Ihr indischer Kommilitone aus Studientagen, einst sehr in sie verliebt, bis sie seinen Heiratsantrag, der für sie völlig überraschend gekommen war, zurückgewiesen hatte und er enttäuscht nach Indien zurückgekehrt war. Aber letztes Jahr in Tibet hatte er ihr, wenn auch nur aus der Ferne, aus seiner indischen Heimat heraus, geholfen, einen Anschlag zu vereiteln. Und jetzt rief er an, gerade als sie in Nepal war! Sicher würde er wieder sagen, das sei kein Zufall, Zufall gab es nicht in seiner Welt des Hinduismus, alles war vorherbestimmt und hatte seinen Zweck.
»Ganesh? Wie schön! Wo bist du?«
»Cora!« Nur dieses Wort. War nicht für jeden Menschen der eigene Name das schönste Wort? Cora hörte seinen leichten indischen Akzent, obwohl er perfekt Deutsch sprach, und sofort war alles wieder da: die Nächte, in denen sie stundenlang diskutiert und Musik gehört hatten, die Party am Drachenstein im Westerwald, als er um ihre Hand angehalten hatte. Und seine tiefschwarzen Augen … Seine ruhige, feste Stimme brachte sie in die Wirklichkeit zurück.
»Cora. Namaste. Ich bin gar nicht so weit weg von dir, Luftlinie jedenfalls. In Indien natürlich, Dehradun. Liegt im Himalaya, ist übrigens der Ort, von dem …«
»Jaja«, unterbrach sie ihn fröhlich. »Ich weiß, wo Dehradun liegt, auch wenn ich noch nie in Indien war. Da war doch das Internierungslager, aus dem dieser Österreicher, Harrer, im Krieg ausbrach und dann zu Fuß nach Tibet lief, nach Lhasa, und dort der Lehrer des Dalai Lama wurde, nicht wahr? Was machst du denn da? Willst du auch nach Tibet laufen?«
»Nein, heute nicht!«, hörte sie ihn lachen. »Ich bin beruflich hier; du weißt ja, die indischen Pläne, neue Verbindungen zwischen bestehenden Flüssen zu schaffen, nehmen langsam Gestalt an. Ein absoluter Wahnsinn, völlig unsinnige Megaprojekte. Statt gezielt Flüsse umzuleiten und zu verbinden, um die Bewässerung für die Bauern zu optimieren, werden gigantische Projekte verwirklicht, die mehr schaden als nutzen. Unter anderem deswegen muss ich morgen nach Agra, rein beruflich, willst du nicht rüberkommen? Ich hatte heute Abend ein Telefonat mit Herrn Fischer wegen einer technischen Frage, und als er mir erzählte, dass du gerade in Nepal bist, dachte ich, ich rufe mal an. Also, kommst du? Rein beruflich, natürlich.«
Cora musste schmunzeln. »Rein beruflich, klar. Weil ich in Agra auch so viel zu tun habe. Das liegt doch in der Nähe von Delhi, richtig?«
»Genau, ungefähr drei Autostunden südlich. Dort steht ja auch der Taj Mahal, das schönste Bauwerk der Menschheit. Musst du gesehen haben. Und ja, beruflich ist es, weil es auch um unsere Erfahrung mit Wasser geht, ich habe da ein Projekt, sehr interessant. Vordergründig geht es um Wasser, wir müssen verhindern, dass der Taj Mahal einstürzt. Kein Witz. Aber da ist noch etwas, viel spannender, bin da einer Sache auf der Spur … Du wirst staunen. Aber das erkläre ich dir lieber persönlich, nicht am Telefon. Und dann fliegen wir nach Mumbai, zu meiner Familie, wenn du schon mal hier bist. Also, was ist?«
»Moment, ich kann nicht einfach nach Indien fliegen, ich muss erst mal mit Fischer …«, versuchte Cora Ganeshs Euphorie zu bremsen.
»Mit dem habe ich schon geredet. Alles klar, du darfst. Er hat dir den Urlaub genehmigt, den ich für dich beantragt habe. In Nepal brauchst du nur einen halben Tag, und zu Hause liegt nichts Dringendes vor. Los, buch um und komm her. Morgen Nachmittag geht eine Maschine nach Delhi, ich hole dich ab, und dann siehst du das Schönste, was du je gesehen hast!«
»Sprichst du von dir?«
»Witzig, ich meinte natürlich den Taj Mahal. Andererseits …« Sie sah sein Grinsen geradezu vor sich. »Hm. Also, alles klar. Das Visum kriegst du am Flughafen. Ich freue mich!« Und weg war er.
Kopfschüttelnd betrachtete Cora das Display. Nach Agra fliegen? Der Taj Mahal sollte einstürzen? Wie kam er denn auf den Unsinn? Und was war das andere, über das er am Telefon nicht hatte sprechen wollen? Spannender als ein umstürzendes Weltkulturerbe konnte es ja kaum sein. Ach Ganesh, dachte sie. Das war wieder typisch. Aus dem Nichts tauchte er auf, und dann warf er alle ihre Pläne durcheinander und erwartete, dass sie folgte. Niemand sonst hätte sich das bei ihr getraut. Die Männer hatten alle Respekt vor ihr, gehorchten. Oder liefen gleich weg. Bekamen Angst vor dieser selbstbewussten, intelligenten und furchtlosen Frau. Die auch noch attraktiv war; offenbar überforderte diese Kombination die meisten Männer. Und genau das gefiel ihr an Ganesh, dachte sie. Sie freute sich unbändig auf ihn. Rief einfach an und wollte sie sehen! Und beruflich war es ja auch, redete sie sich ein, also war es ja okay. Mit dem Gedanken an sein strahlendes Lächeln, das den Kontrast zwischen seinen perlweißen Zähnen und dem dichten, schwarz gelockten Haar noch unterstrich, schlief sie glücklich wieder ein.
3. Kapitel
Seine Augen hatten sich ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt, vage nahm er Umrisse seiner Umgebung wahr. Keine Höhle, nein, ein gemauerter Raum, so schien es. Glatte Wände, Stein. Ganesh zwang sich, ruhig und logisch zu denken. Irgendwie musste er vom Hotel hierhergebracht worden sein. Er war verletzt, schwer, aber es würde sicher noch schlimmer kommen. Sein Hemd war zerrissen, die dünne Baumwollhose von Blut durchtränkt. Er strich sich vorsichtig durch seine Haare; die Locken klebten zusammen. Seine Brille hatte er verloren. Aber wer hatte ihn entführt? Und warum? Wichtiger aber noch, wie kam er hier heraus? Wo war der Ausgang? Es musste ja eine Öffnung geben. Er beschloss, den Schmerz zu ignorieren, und kroch langsam, stöhnend vorwärts, bis er nach wenigen Metern die Wand erreichte. Er versuchte erneut, sich aufzurichten, verlagerte sein ganzes Gewicht auf sein linkes Bein und zog sich an der glatten Wand hoch. Keine Ziegel, keine Mauer, glatter Stein auch hier, wie auf dem Boden. Auf seinem linken Bein stehend, ruhte er sich aus. Wenn er sich an der Wand entlangbewegte, musste er auf die Tür stoßen. Vielleicht konnte er rufen. Millionen von Touristen kamen jedes Jahr nach Agra, Tausende jeden Tag. Eine Chance bestand, dass er gehört wurde, wo immer er auch war. Es musste eine Chance geben.
Ganesh hüpfte langsam die Wand entlang, immer wieder musste er ausruhen. Er presste sich an die Steine und hielt das rechte Bein tapfer in die Luft. Der Boden schien feucht zu werden, mehrfach rutschte er beinahe aus. Langsam ließ er sich an der Wand herabgleiten, es wurde zu gefährlich, auf einem Bein auf diesem unsicheren und völlig glatten Untergrund zu stehen. Er hatte jetzt drei Ecken passiert, es blieb nur eine Möglichkeit, wo die Öffnung sein konnte. Als er die vierte Ecke erreicht hatte, ohne auch nur ein Anzeichen einer Tür gefunden zu haben, sank er in sich zusammen. Was nun? Keine Tür, keine Öffnung. Aber die Luft war trotz der hohen Feuchtigkeit klar, von irgendwoher kam offensichtlich Frischluftzufuhr. Und irgendwie musste er ja hier hineingekommen sein. Man konnte ihn ja nicht einfach hineingeworfen haben, ohne … geworfen? Unwillkürlich blickte er nach oben. Die Decke! Ob es da eine Öffnung gab? Die Dunkelheit war undurchdringlich; er konnte nichts erkennen. Vielleicht war es Nacht, und bei Tagesanbruch würde er besser sehen können? Er tastete schnell nach seiner Armbanduhr, aber man hatte sie ihm abgenommen oder er hatte sie im Kampf verloren. Keine Chance. Selbst wenn es in der Decke ein Loch gab, wie sollte er hinaufgelangen? Wo war er? Es gab keine felsigen Verliese in dieser Stadt. Es konnte nicht eiskalt und dunkel und feucht sein. Heiß und trocken war es, jedenfalls außerhalb der Monsunzeit. Agra. Die alte Hauptstadt der Mogulherrscher. Am Bogen des Yamuna-Flusses, weltberühmt durch das schönste Gebäude, das je von Menschenhand errichtet worden war. Ganesh weitete unwillkürlich die Augen. Es gab eine Möglichkeit. Aber das konnte nicht sein! Er strich mit der Hand über die Wand, ebenfalls kalter und glatter Stein, wie an den anderen Seiten. Es konnte nicht sein, und dennoch war es die einzige logische Erklärung. Ockhams Rasiermesser – wenn man alle komplizierten Lösungen ausschloss, war die einfachste Lösung die richtige. Oder so ähnlich. Wenn er in einem Raum war, einem Verlies, einer Kammer, dann war er dort. In diesem Mausoleum. Genau genommen darunter! Nur dort war es kalt und feucht. Er war gefangen, in den unerforschten, geheimnisvollen Kammern des Taj Mahal, die seit Jahrhunderten zugemauert waren. Gefangen unter mindestens zwölftausend Tonnen weißem Marmor und rotem Sandstein, verziert mit Hunderttausenden von Edelsteinen, ein Weltwunder an Schönheit und Baukunst. Der bengalische Dichter und Nobelpreisträger Tagore hatte das Bauwerk eine »Träne auf der Wange der Zeit« genannt. Tränen liefen jetzt auch Ganeshs Wangen hinunter. Er war gefangen unter dem Taj Mahal. Es würde sein Mausoleum werden.
Schritte waren jetzt direkt vor der Mauer zu hören. Die Männer waren zurück.
4. Kapitel
Endlich stand Cora vor der Abflughalle des Flughafens von Kathmandu. Ein irgendwie unbefriedigender Tag lag hinter ihr; die Fahrt zum Staudamm, die ergebnislos geblieben war; die Rückfahrt, der traurige Anblick der Ruinen Kathmandus … sie freute sich darauf, bald Ganesh zu sehen. Wie würde das Wiedersehen werden? Ob er sich sehr verändert hatte? Sie bildete sich ein, die Gleiche wie früher zu sein, aber das dachte wohl jeder von sich. Sie war unruhig, so kannte sie sich nicht. Vorfreude oder Angst? Von beidem etwas, dachte sie.
Ein Soldat, die Maschinenpistole um die Schulter gehängt, fragte sie nach einem Papierausdruck ihres Flugtickets. Das hatte ihr niemand gesagt; sie besaß nur ein E-Ticket und zeigte den QR-Code auf ihrem Smartphone vor, aber der stoische Offizielle am Eingang wiederholte immer wieder seine Forderung nach einem Ausdruck. Nicht mal ihre blonden Locken zeigten ihre übliche Wirkung! Wo sollte sie denn jetzt einen Ausdruck ihres Tickets herbekommen? Nach langen Verhandlungen gelang es ihr, ihn zu bewegen, bei der Airline am Check-in-Schalter anzurufen und ihre Buchung bestätigt zu bekommen. Das mit dem Papierausdruck musste sie sich merken, das galt ja vielleicht auch für Indien.
Nach dem Einchecken ging sie zur Sicherheitskontrolle; ein schläfriger Polizist drückte einen Aufkleber »Security checked« auf ihre Tasche, ohne einmal hineingesehen zu haben, dann ging es die Rolltreppe hoch zur Immigration. Im winzigen Souvenirshop des Wartesaals kaufte sie sich noch ein Heftchen über den Taj Mahal. Dort erstand sie auch einen kleinen Ganesh aus Holz. Der elefantenköpfige indische Gott, der für gute Geschäfte und allgemein Glück zuständig war. Die Verkäuferin, froh, endlich etwas zu tun zu haben, erklärte ihr eifrig die Herkunft des Ganesh. Es gab so viele indische Götter, und niemand könne Indien verstehen, der sich nicht mit ihnen beschäftigte. Götter waren allgegenwärtig, sie waren nicht fern wie der christliche Gott, sondern bei den Menschen, sie waren gut und böse, liebten und töteten, kurz: Indien war ohne Götter nicht vorstellbar. Die Verkäuferin strich zärtlich über den dicken Bauch des Ganesh, während sie Cora die Geschichte dazu erzählte. Viele indische Eltern benannten ihre Söhne nach ihm, um ihnen ein glückliches Leben zu bescheren. Er war der Sohn der Parvati und des Shiva, und gemäß der Legende war Shiva auf Reisen und ließ seinen Sohn bei seiner Frau zurück. Als er zurückkam, erkannten Vater und Sohn einander nicht, und Ganesh weigerte sich, Shiva zu seiner badenden Mutter ins Haus zu lassen. Daraufhin schlug Shiva ihm den Kopf ab. Als er sah, was er angerichtet hatte, schwor er seiner Frau, dem Sohn einen neuen Kopf zu geben. Zufällig kam ein Elefant des Weges, und Shiva setzte seinem Sohn den Kopf des Elefanten auf.
Nun, dachte die promovierte Ingenieurin Cora, wissenschaftlich betrachtet auch nicht unwahrscheinlicher als eine Jungfrauengeburt oder die Auferstehung Christi. Jede Religion hatte ihre Mythen, und warum sollte ein Abbild des Ganesh weniger helfen als ein Madonnenbild? Sie hatte nie verstanden, warum Mythen anderer Religionen als lächerlich und abergläubisch galten, während die eigenen unantastbar waren. Mit welchem Recht glaubten die Kreationisten in den USA wörtlich an das Wort der Bibel und lachten über Indiens heilige Kühe? Muslimische Muftis belegten Autoren wie Salman Rushdie mit einer Fatwa, und die katholische Kirche verfolgte jahrhundertelang Menschen, die nicht an die Existenz einer göttlichen Dreieinigkeit glauben wollten (vom Teufel mit den rot glühenden Hörnern ganz zu schweigen).
Jetzt hatte sie Ganesh schon mal aus Holz bei sich, bis sie den wahren aus Fleisch und Blut in die Arme nehmen konnte. Und darauf freute sie sich jetzt wirklich, merkte sie. Ich vermisse ihn, dachte sie erstaunt. Als sie in Tibet gewesen war, hatte der Himalaya noch zwischen ihr und Ganesh gestanden, und auch bei ihrem Kurzausflug nach Shanghai im letzten Jahr, als sie den Skandal um den Verkauf des Flughafens Hahn an die Chinesen aufgeklärt hatte, war Ganesh weit weg gewesen. Aber in wenigen Stunden würde es so weit sein! Endlich würde sie wieder in seine tiefdunklen Augen schauen, wie damals zu Studienzeiten. Lächelnd betrachtete sie die Holzfigur in ihrer Hand. Shiva, Ganeshs mythischer Vater, war stark und hatte ihn wieder zum Leben erweckt. So sagte es die Legende, so hatte es die Verkäuferin erklärt.
Wie sehr der echte Ganesh der Hilfe Shivas bedurfte, hätte sie sich nicht einmal ansatzweise vorstellen können.
Da Agra keinen eigenen zivilen Flughafen besaß, flog Cora nach Delhi, wo Ganesh auf sie warten wollte. Sie hatte kein Visum für Indien, aber das konnte sie bei der Einreise als Visum on Demand erhalten. Sie wollte ja nicht lange bleiben. Den Taj Mahal anschauen, dann ein Tag Mumbai, dann zurück nach Deutschland. Ewig konnte sie hier nicht durch die Welt reisen und Freunde besuchen. Und den Bezug zu ihrer Tätigkeit als Hydroingenieurin, den Ganesh erwähnt hatte, hielt sie nur für einen Vorwand. Sie hatte in Kathmandu noch etwas im Netz gesurft, aber keinen Hinweis auf eine bauliche Gefährdung des Taj Mahal welcher Art auch immer gelesen. Anschläge irgendwelcher Fanatiker, ja, die waren immer eine Gefahr. Aber um- oder einstürzen? Warum auch? Und wie? Tausende Tonnen Marmor fielen nicht einfach zusammen, nachdem sie vierhundert Jahre gestanden hatten. Auch Ganesh war promovierter Wasserbauingenieur, aber da hatte er wohl übertrieben.
Kaum hatte Cora sich auf ihren Platz in der Maschine gesetzt, musste sie wieder aufstehen, um einen weiteren Fluggast durchzulassen. Sie saß immer am Gang, da hatte man mehr Beinfreiheit, konnte aufstehen, ohne andere zu belästigen, und sie fühlte sich an den Fensterplätzen, trotz ihrer zierlichen Figur, ohnehin einfach zu eingeengt. Ein älterer, weißhaariger Herr setzte sich neben sie; er musste über siebzig Jahre alt sein, trug aber einen perfekt sitzenden blauen Anzug, die rote Fliege war offensichtlich mit der Hand gebunden, ganz Gentleman alter Schule. Amüsiert betrachtet Cora die völlig unpassenden weißen Turnschuhe, die er dazu trug. Er grüßte freundlich, schnallte sich umständlich an und vertiefte sich sofort in ein dickes Buch, das er aus einem sportlichen Rucksack gezogen hatte. Nachdem sie ihre Reiseflughöhe erreicht hatten, wie die Stewardess verkündete, versuchte Cora, neugierig wie immer, herauszufinden, was er da las, konnte aber nichts entziffern. Sie rutschte unauffällig in ihrem Sitz herum, aber die von indischen Schriftzeichen unterbrochenen englischen Sätze ergaben überhaupt keinen Sinn. Plötzlich klappte der weißhaarige Herr das Buch sanft, geradezu zärtlich zu, wandte sich ihr zu und lächelte sie breit an. »Bhagavad Gita«, sagte er in britisch klingendem Englisch. »Das wollten Sie doch wissen, oder?«
»Ich, äh, tut mir leid, ich meine …«, wand sich Cora vor Verlegenheit. »Ich wollte nicht unhöflich sein.«
Ihr Nachbar holte, etwas umständlich in der Innentasche seines Jacketts kramend, eine Visitenkarte hervor. »Erst darf ich mich Ihnen vorstellen, Miss. Mein Name ist Captain Ramakrishna Tagore. Sehr erfreut.«
Cora lächelte ihn an, als sie die Karte entgegennahm. Mit beiden Händen, so hatte sie das in China gelernt, das konnte hier ja nicht falsch sein. »Remy mein Name, Cora Remy. Freut mich auch. Ich bin aus Deutschland. Wie, sagten Sie, heißt das Buch?«
Der alte Herr zeigte auf den schweren blauen Ledereinband, auf dem in goldenen Buchstaben der Titel geschrieben stand. »Bhagavad Gita«, wiederholte er langsam. »Schwer zu sprechen. Wir reden daher nur von der ›Gita‹. Das vielleicht berühmteste Werk der indischen Literatur. Kennen Sie es nicht?«
»Ehrlich gesagt nein. Worum geht es?«
»Tja, worum geht es?«, sinnierte der Professor und strich sich durch seinen weißen Bart. »Es ist eine Mischung aus Geschichtsunterricht und Morallehre, aus Kriegskunst und Philosophie. Die Gita ist nur ein Teil eines viel umfassenderen Werkes, des ›Mahabharata‹. Man weiß nicht, wer es verfasst hat. Das Buch gilt als das längste Versepos der Weltliteratur, umfasst etwa hunderttausend Verse, vermutlich ist es weit über zweitausend Jahre alt. Die Gita ist also ein Teil davon, es geht um den Krieg zwischen verfeindeten Clans, um Macht und große Schlachten. Aber ich möchte Sie nicht langweilen …« Er lächelte freundlich, aber Cora hatte den Eindruck, dass es nicht nur Höflichkeit war. Vielleicht war es ihm wirklich lästig, der Ausländerin all das zu erklären? In diesem Moment kann die Stewardess und bot Getränke an, und Cora nahm dankend an, um die plötzliche Gesprächspause nicht peinlich werden zu lassen. Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und dachte an Ganesh. Ob er sich verändert hatte? Sie hatte ihn seit Jahren nicht gesehen. Wie sollte sie ihn begrüßen? Sie waren sich so vertraut gewesen, aber nach all dieser Zeit …
»Hier jetzt steht eine große Schlacht zwischen zwei verfeindeten Familienzweigen bevor«, riss der Professor neben ihr sie unvermittelt aus ihren Gedanken, als ob er das Gespräch nie beendet hätte. »Und der Anführer der einen Seite lässt sich von seinem Wagenlenker in die Mitte zwischen die beiden Heere fahren. Ihm kommen Zweifel, ob er gegen seine eigene Familie kämpfen soll, und es entwickelt sich ein Gespräch zwischen ihm, Arjuna, und dem Wagenlenker, dem Gott Krishna. Sie unterhalten sich über das Leben, über Ethik und Moral, über Menschenführung und vieles mehr. Ein Werk voll tiefer Weisheit, nur schwer zu verstehen.«
Cora musste sich erst wieder in seine Gedankengänge einfinden, sie war schließlich eben noch bei Ganesh gewesen, und jetzt ging es offensichtlich wieder um dieses Buch, die Gita …
Tagore fuhr indessen unbekümmert fort zu erzählen. »Wussten Sie, dass Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, die Zündung der ersten Atombombe in Los Alamos 1945 in einem späteren Interview mit einem Zitat aus der Gita kommentierte? Er sagte: Wenn das Licht von tausend Sonnen/am Himmel plötzlich bräch’ hervor/das wäre gleich dem Glanze dieses Herrlichen, und ich bin der Tod geworden, Zertrümmerer der Welten. Er hatte sogar Sanskrit gelernt, um die Gita im Original lesen zu können … Nun ja. Inzwischen gibt es sicher schon ein Handbuch für Manager; ›Gita für Manager‹ oder so …« Er lächelte milde. »Ich bin in Pune Professor für Religionsgeschichte, und ich verstehe auch nicht alles. Aber jedes Kind kennt das in Indien! Kein anderer Text der hinduistischen Literatur wird so oft zitiert, auswendig gelernt, gelesen. Wir haben ja keine Bibel oder einen Koran oder sonst ein heiliges Buch. Kein Anfang, kein Ende. Hinduismus ist keine Religion mit einem Gründer, wie bei Ihnen im Westen. Es ist eine Lebenseinstellung, eine Haltung. Selbst Gandhi suchte Trost in der Gita, Albert Schweitzer las sie … Und es gibt eine Filmversion mit Will Smith.«
Cora schaute ihn belustigt an. »Sie kennen Will Smith? Das hätte ich ja nicht … Entschuldigung, ich wollte damit nicht sagen, dass …« Sie fing an zu stottern, sie wollte den Professor ja nicht beleidigen, aber ein Religionsgelehrter, der Will-Smith-Filme schaute …
Der Professor grinste spitzbübisch. »Die Legende von Bagger Vance. So heißt der Film von Robert Redford. Es spielen übrigens auch Matt Damon und die wunderschöne Charlize Theron mit … Es geht wie in der Gita um den Kampf gegen sich selbst, darum, die eigenen Stärken zu erkennen. Da staunen Sie, was? Dachten Sie, ich lebe hinter dem Mond, nur weil ich mich für Religionen interessiere? Ich habe den Film auf meinem I-Pad!«
Jetzt musste Cora herzhaft lachen. Was für ein wunderbarer Mensch! Hochgebildet und voller Humor. Und nein, keineswegs hinter dem Mond, sondern sehr diesseitig. Dann schüttelte sie den Kopf. »Die indische Götterwelt ist ganz schön verworren. Ich kenne den Ganesh, seinen Vater Shiva, der ihn rettet, glaube ich, und in irgendeinem Film habe ich mal von der Göttin Kali gehört … und es gibt ja noch viele andere … Für uns Ausländer kaum zu durchschauen! Wieso gibt es so viele Götter in Indien? Und in der Gita ist ein Gott ein Wagenlenker?«
Nachdenklich nickte ihr der Professor zu. »Kompliziert, ja. Ganesh ist mein Lieblingsgott, den würde ich gern mal kennenlernen. Tausende von Göttern haben wir, manche sagen, Millionen. Flexibilität ist alles hier in Indien. Sogar bei der Anzahl der Götter. Warum? Na ja, jeder hat eine spezielle Aufgabe, wissen Sie? Ihr habt nur einen, der sich um alles kümmern muss. Dann doch lieber Arbeitsteilung …« Verschmitzt grinste er in sich hinein. »Aber im Grunde gibt es nur einen Gott. Alles andere sind Erscheinungsformen dieses einen Gottes. Wissen Sie, was ein Avatar ist?« Interessiert blickte er sie an. Er schien in seinem Element zu sein. Cora wollte schon mit dem amerikanischen Film antworten, aber das kam ihr dann doch zu schlicht vor. Er meinte doch sicher etwas anderes?
»Nein, nicht der Film«, warf der Professor ein, als könne er ihre Gedanken lesen. Dann lächelte er. »Avatare nennt man im Sanskrit Erscheinungsformen von Gott. Fragen Sie einfach, jeder Inder kann Ihnen Geschichten von den Göttern erzählen. Man muss nicht versuchen, das zu sortieren, das tun nur Ausländer. Wissen Sie«, sein Blick wurde nachdenklich, »ihr Christen habt nur einen Gott, aber der ist weit weg, oben im Himmel, und wenn man mit ihm reden will, sind da Priester dazwischen, die Ihnen die Beichte abnehmen, dann Bischöfe, Kardinäle … es gibt sogar einen Menschen, der von sich behauptet, der Stellvertreter Gottes zu sein! Wie kann ein einzelner Mensch die ganze Macht Gottes repräsentieren? Das verstehen wir nicht. Wir haben viele Götter, gewiss, aber sie sind nah bei uns. Sie sind wie die Menschen, lieben sich, streiten, sterben … irgendwie sympathisch. Wie auch immer. Tauchen Sie ein, lassen Sie zu, dass die Götter mit Ihnen sprechen und leben. Akzeptieren Sie einfach, dass wir hier mit Göttern leben, mit heiligen Tieren, an Wiedergeburt und Gurus glauben, an das Verschwimmen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft … Ist das nicht wunderbar? Keine Dogmen, keine Inquisition, keine Scharia. Keine Häretiker, denn wenn es keine festgeschriebenen Grundsätze gibt, kann man auch nicht dagegen verstoßen.«
Versonnen wandte er sich wieder seinem Buch zu und war augenblicklich darin vertieft. Cora ließ ihn lesen, obwohl sie tausend Fragen gehabt hätte. Je mehr sie über Indien lernte, desto mehr merkte sie, wie wenig sie wusste.
Kurz bevor sie in Delhi landeten, wandte sich der Professor ihr plötzlich zu. »Wissen Sie«, sagte er nachdenklich, »denn etwas über das Verhältnis von Ihren Religionen und Indien? Das ist doch auch interessant.«
Cora war in Gedanken schon wieder bei Ganesh gewesen und musste erst wieder zurück in die Wirklichkeit finden. »Was meinen Sie?«, fragte sie zurück. »Entschuldigung, ich habe nicht ganz verstanden. Unsere Religionen? Welche meinen Sie?«
Er blickte sie an. »Nun, die abrahamitischen, das Christentum, das Judentum, der Islam. Stammen doch alle aus Jerusalem, nicht wahr? Berufen sich alle auf Abraham. In Indien gab es eine der ältesten jüdischen Gemeinden der Welt; vermutlich kamen die ersten Juden zu Zeiten von König Salomon, aber dann, nach der Zerstörung des Tempels durch die Römer, so etwa im Jahre 70 Ihrer Zeitrechnung, flohen viele nach Kerala. Das ist ein im äußersten Südwesten Indiens gelegener Bundesstaat. Der Apostel Thomas soll dort auch gelandet sein, nach der Kreuzigung Christi reiste er angeblich nach Indien. Die Nachkommen seiner Anhänger leben heute als syrische christliche Gemeinschaft dort. Sie haben 1500 Jahre lang den Dialekt Syriac gepflegt, ein Dialekt des Aramäischen. Das war die Sprache Jesu. Erst die Portugiesen haben ihnen das verboten und die Sprache ausgetrieben.«
Cora konnte nur stumm den Kopf schütteln. Was dieser Professor alles wusste! Der Apostel Thomas war nach Indien gefahren? Davon hatte sie noch nie gehört.
Der Professor fuhr fort: »Die sogenannte Zivilisation ist nur eine dünne Kruste, darunter brodelt die Lava. Vergessen Sie das nie.« Ebenso unvermittelt, wie er sie eben angesprochen hatte, schloss er sodann seine Augen und lehnte sich zurück. Cora entschied, ihn nicht weiter zu stören, da sie ohnehin zur Landung ansetzten.
Als sie die Gangway verließen, verabschiedete sich Cora freundlich von dem Professor. Er winkte ihr zu und empfahl ihr, unbedingt die Gita zu lesen. »Gibt’s auch als MP3-Datei zum Hören oder als Download auf Ihr I-Pad«, fügte er hinzu, was Cora in Anbetracht seines Alters ziemlich erstaunlich fand. »Bis zum nächsten Mal lesen Sie nach, was es mit Nataraja auf sich hat. Sie werden es brauchen. Wir sehen uns ja bald wieder!«, sagte er zu ihr, als sie gemeinsam zur Immigration liefen.
»Wiedersehen? Wie kommen Sie darauf? Und was meinen Sie mit Nata…«, fragte Cora erstaunt.
»Nataraja. Shivas Tanz. Quantenphysik. Alles hängt zusammen, alles baut aufeinander auf. Nichts geschieht zufällig«, lächelte der Inder sie an und versuchte mühsam, sich niederzubeugen, um seine Turnschuhe zuzubinden.
»Moment, ich mache das«, sagte Cora hilfsbereit. Sie bückte sich und band ihm den losen Schnürsenkel fest. Als sie sich wieder aufrichtete, lächelte der Professor sie dankbar an. »Sie haben mich getroffen, um etwas über Indien zu lernen. Ich habe Sie getroffen, um etwas anderes zu erfahren. Was es ist, weiß ich noch nicht. Also müssen wir uns noch einmal sehen.« Und weg war er.
Cora blickte ihm verwundert nach, dann schüttelte sie den Kopf. Hochinteressanter Typ. Sicher wäre es spannend, länger mit ihm zu sprechen. Wie oft traf man Menschen, mit denen man spontan tiefgreifende Gespräche führen konnte? Nicht das übliche belanglose Geplänkel, sondern ein Austausch, von dem etwas zurückblieb. Sätze, die im Herzen blieben. Oder im Kopf. Wissen. Weisheit. Was hatte sie neulich gelesen? When you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Mit diesem Professor war sie sicher im richtigen Raum gewesen.
Cora kämpfte sich durch die endlosen Gänge des Flughafens zu dem Schalter für ein Visum on Demand. Dort ließ sie das umständliche Prozedere und die Formulare über sich ergehen. Sie musste ihren Zeigefinger auf ein kleines Gerät drücken, das ihren Fingerabdruck scannte. Scannen sollte, denn genau das tat es nicht. Erst nach zahlreichen Versuchen, schließlich mit einem zweiten Gerät, war der durchaus desinteressierte Beamte, bequem in seiner hellbraunen Uniform auf seinem Stuhl sitzend, zufrieden. Es dauerte dann doch fast eine Stunde, bis sie durch alle Kontrollen durch war. Als sie die Haupthalle des Indira Gandhi International Airport verließ, ihre Ledertasche sicherheitshalber fest an sich gedrückt, atmete sie erst mal tief durch. Indien! Endlich! Trotz der späten Abendstunde war es tropisch heiß; eine Anzeigetafel zeigte 36 Grad! Sofort umfing sie eine unbeschreibliche Mischung aus Gerüchen und Hitze, aus unbekannten Tierstimmen und Autohupen, aus Chaos und der erstaunlichen Tatsache, dass alles nicht nur dennoch, sondern vielleicht gerade deswegen funktionierte, kurz, all das Unbeschreibliche, das sie bald als typisch für dieses Land, diesen Subkontinent empfinden würde. Der Lärmpegel war erstaunlich hoch, Hunderte von Menschen riefen durcheinander, drängelten, schimpften; der erste bildliche Eindruck war der von Zombies, die sich vor einem Kaufhaus drängelten, um hineinzugelangen, aber dann sah sie, wie viele lachten, dass alles dennoch irgendwie freundlich, entspannt war, es war keine Aggression zu spüren. Indien. Es umfing sie mit allen Sinnen, man konnte ihm nicht entkommen. Sich wehren, ja, dann wurde es ein ewiger Kampf; sich ergeben, hingeben, fallen lassen – besser. Sie mochte es sofort.
Coras Augen glitten suchend über die Menge schwarzhaariger Abholer, die dicht gedrängt hinter einer Absperrung standen. Wo war er? Ganesh hatte lange genug in Deutschland gelebt, um immer pünktlich zu sein. Zu seinem Leidwesen, sagte er manchmal lächelnd, das machte ihm das Leben in Indien schwer. Aber sie konnte ihn nirgends erblicken. Hm. Was sollte sie jetzt tun? Wohin? Am besten rief sie ihn erst mal an. Sie hatte gerade ihre Tasche abgestellt und sich mehrerer hilfsbereiter Hände erwehrt, die sich von einer offensichtlich unerfahrenen Ausländerin ein gutes Geschäft versprachen, als sie jemand an der Schulter berührte. Zu sanft, um ein aufdringlicher Portier zu sein.
»Miss Cora?«
Sie blickte von ihrem Handy auf. Tiefschwarze, besorgte Augen sahen sie freundlich an; ein Inder in beiger Stoffhose, hellen Stoffschuhen und offenem, blauem Leinenhemd stand vor ihr und musterte sie, die schlanke, sportlich wirkende Ausländerin, die in ihren bei der Hitze völlig ungeeigneten Jeans und der lässigen Lederjacke gleich auffiel.
»Yes, that’s me. Why?«, wunderte sich Cora. Sie kannte hier niemanden, und vor allem kannte niemand sie.
»Ich bin ein Freund von Ganesh. That’s about all the German I know. Sorry.«
Jetzt wurde Cora unruhig. Ein Freund von Ganesh? Er hätte es sich nie nehmen lassen, sie selbst vom Flughafen abzuholen. Nicht nach so langer Zeit, die sie sich nicht gesehen hatten.
»Wo ist Ganesh? Was ist los?«
»Ich weiß es nicht. Kommen Sie, ich bringe Sie zu meinem Wagen, dann können wir in Ruhe reden.« Er griff nach ihrer Tasche, aber Cora hob sie schnell selbst auf. Langsam folgte sie ihm durch das Gewimmel vor dem Ankunftsgebäude zu den Parkplätzen. Sehr seltsam. Er wusste auch nicht, wo Ganesh war? Wieso war er denn dann hier? Wie auch immer, sie hatte schnell beschlossen, diesem Mann erst mal zu vertrauen. Ihr Bauchgefühl trog sie selten, und er sah einfach ehrlich aus. Ohne dass sie gewusst hätte, wie sie bei einer völlig fremden Kultur darauf kam.
Sie stieg in den weißen Landrover, dessen linke Vordertür er für sie öffnete, und setzte sich auf den Beifahrersitz. Linksverkehr, klar. Als er vorsichtig aus dem Parkhaus fuhr und, souverän das Chaos durchkreuzend, auf eine breite Schnellstraße einbog, betrachtete sie ihn aufmerksam von der Seite. Etwa Anfang dreißig, vermutete sie, obwohl schon graue Strähnen sein schwarzes Haar durchzogen. Sehr attraktiv. Und nervös. Ständig blickte er in den Rückspiegel, fuhr schnell, wechselte die Spur. Schließlich brach Cora das Schweigen. »Also, was ist los? Wo ist Ganesh? Und wer sind Sie überhaupt? Wo fahren wir hin? Wieso holen Sie mich ab?«
Er blickte zu ihr herüber, als sei er erstaunt, dass da noch jemand im Wagen saß. »Entschuldigung«, fand er dann doch seine Stimme wieder. »Ich bin Anshu, Ganeshs bester Freund. Na ja, das würde er nie sagen, aber so ist es. Ich bin kein Ingenieur, ich habe nichts mit Wasser zu tun und verstehe nichts davon, mir gehört eine Baufirma. Hoch- und Tiefbau, in Delhi vor allem. Wir fahren jetzt erst mal in ein Hotel, da sind Sie sicher. Ganesh hat so viel von Ihnen erzählt, da konnte ich Sie am Flughafen gar nicht verpassen.« Sein Englisch war ausgezeichnet und nicht mit dem schweren Akzent durchsetzt, den sie in Nepal so oft gehört hatte. Er musste eine sehr gute Ausbildung genossen haben.
Er lächelte zum ersten Mal etwas, als habe er jetzt alles Nötige erklärt. Cora sah ihn ungeduldig an und wartete auf die Fortsetzung.
»Ganesh sagte mir gestern, dass Sie heute ankommen. Eigentlich sprach er von nichts anderem mehr … und dann bat er mich mitzukommen, sein Auto ist mal wieder kaputt, also sollte ich ihn fahren, und dann ist er nicht aufgetaucht! Nicht erst heute, nein, wir waren für gestern Abend auf einen Drink verabredet, und er kam nicht. Das ist ungewöhnlich, er ist zuverlässig. Wir nennen ihn nur ›den Deutschen‹! Jedenfalls rief ich ihn mehrfach an, aber er ging nicht an sein Handy. Auch heute Morgen nicht, und als er nicht wie verabredet zu mir kam, um Sie abzuholen, bin ich einfach allein losgefahren, damit Sie nicht am Flughafen stehen und es ist niemand da. Aber ich mache mir große Sorgen, Ganesh ist nicht der Typ, der einfach nicht auftaucht. Und da ist noch etwas, das Sie wissen müssen … Er wird bedroht. Aber Sie kennen Ganesh, er nimmt so etwas nicht ernst, macht einfach weiter. Aber letzte Woche erhielt er eine Nachricht, die sogar ihn nervös machte. Er solle seine Arbeiten sofort einstellen. Und vor seiner Haustür lag etwas …«
Cora blickte ihn mit aufgerissenen Augen an. »Was denn? Nun sagen Sie schon, was lag da?«
Anshu zögerte, dann sagte er: »Ein kleiner Taj Mahal aus Marmor, wie man ihn überall kaufen kann. Nur wenige Zentimeter hoch. Aber darunter, zerbrochen, ein Elefantengott, ein Ganesh. Aus Holz, mit zerquetschtem Gesicht.«
5. Kapitel
Kuala Lumpur, Malaysia
Der Rauch, der von den brennenden indonesischen Wäldern über die Straße von Sumatra herüberzog, brachte wieder einmal Teile des öffentlichen Lebens zum Stillstand. Schulen wurden zeitweise geschlossen, die Menschen trugen Atemmasken, der Marathonlauf wurde abgesagt. Die Sonne schien, aber außer einem gelblichen Fleck am Himmel war nichts zu sehen. Wer nicht unbedingt hinausmusste, blieb zu Hause.
Khan musste. Er saß im Fond seines Bentley Continental und verfolgte die aktuellen Nachrichten auf seinem Tablet. Einen Monat ging das jetzt schon so mit dieser Mischung aus Smog durch die Luftverschmutzung und dem Rauch aus dem Süden, und es war kein Ende abzusehen. Um das begehrte Palmöl zu gewinnen, musste der Urwald weichen, und dies geschah, meist illegal, durch Brandrodung. Millionen Hektar Wald waren bereits gerodet worden, weitere würden folgen, um Platz zu schaffen für den Anbau der lukrativen Palme, aus deren Früchten das Öl gewonnen wurde. Riesige Flächen auf der indonesischen Insel Borneo brannten, damit das für Nahrungsmittel aller Art, aber auch für die Reinigungsindustrie und sogar für die Beimischung zu Dieselkraftstoff unerlässliche Produkt angebaut werden konnte. Die Rauchwolken zogen Hunderte von Kilometern weit, und es wurde jedes Jahr schlimmer. Auch in Malaysia wurden die ersten Flüge mangels ausreichender Sicht gestrichen; Khan musste zusehen, dass er die Stadt verließ. Das fehlte noch, dass er nicht abfliegen konnte. Aber seine Privatmaschine flog auf eigenes Risiko, notfalls musste man bei der Flugsicherheitsbehörde etwas nachhelfen. Er kannte den zuständigen Leiter, und er wusste, dass dessen Tochter gern Reitunterricht gehabt hätte. Für einen Beamten unerschwinglich. Gut, dass Khan so ein großes Herz für Kinder hatte. Er grinste in sich hinein.
Die Gespräche, die er in seinem Lieblingshotel hier in Kuala Lumpur, dem Majestic, geführt hatte, waren gut gelaufen, ein erfolgreicher Tag lag hinter ihm. Er mochte die neuen Glasbauten nicht, diese weltweit austauschbaren Luxushotels, er präferierte die alten, stilvollen Gebäude aus der Kolonialzeit. Das Majestic hier in Kuala Lumpur war so ein Hotel, wundervoll restauriert, und wie das Raffles in Singapur, das Strand in Yangon oder das Taj in Mumbai ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Er wohnte immer dort, wenn er in Kuala Lumpur war. Auch das Colonial Café war ganz nach seinem Geschmack, edel, holzvertäfelt, man fühlte sich in die Zeiten der Kolonialherren zurückversetzt, die hier über ihre Kautschukplantagen sprachen, während die Bediensteten eifrig den Tee servierten, wobei ihre weißen Uniformen sehr hübsch mit den kaffeebraunen Gesichtern kontrastierten. Nur dass heute die Gesichter der Gäste überwiegend kaffeebraun waren, während die Angestellten oft weiß waren. Zeichen des Wandels auch hier. Und es gab ein Nebenzimmer für die Raucher, in dem man ungestört war. Er hatte heute seine Geschäftspartner aus Südostasien hierhergebeten, um die weiteren Schritte für dieses Jahr zu besprechen. Das Geschäft lief blendend, aber man musste dafür sorgen, dass es auch so blieb. Er war nicht aus Dharavi, wo er aufgewachsen war, so weit gekommen, um je wieder hinabzufallen. Er war Khan, er war mächtig, und so würde es bleiben. Nie hätte er es sich träumen lassen, als er in Dharavi, dem vielleicht größten Slum Asiens, mitten in Mumbai, das erste Mal im Sand gespielt hatte, dass er mit diesem Sand einst reich werden würde. Unfassbar reich. Er besaß Geld wie Sand am Meer, war sein liebstes Wortspiel. Khan musste laut lachen, sodass sein Fahrer erstaunt in den Rückspiegel blickte.
Sand war unbegrenzt verfügbar, das wusste jeder. Er erinnerte sich wieder an jenes Buch, das ihm vor vielen Jahren ein deutscher Freund geschenkt hatte, weil es sein Lieblingsthema betraf. Soweit er sich erinnerte, wurde in dem Buch das Land Fantasia zerstört, und es blieb nur ein Sandkorn übrig. Aber dieses eine Sandkorn ermöglichte die Wiedergeburt der Welt. Ein Junge erhielt das kleinste und unspektakulärste Geschenk, das man sich vorstellen konnte: ein Sandkorn. Daraus schuf er Städte, Kontinente, ein ganzes Universum. Die Unendliche Geschichte, ja genau, so hieß das Buch. Aus Sand war die ganze Welt gebaut. Und selbst wenn alles irgendwann zur Neige ging, vom Sand würde immer etwas übrig bleiben.
Khan lehnte sich zurück, strich sein makelloses weißes Hemd glatt und bewunderte wieder einmal seine neuen Manschettenknöpfe, die er sich bei Shanghai Tang in Singapur hatte anfertigen lassen: Das chinesische Schriftzeichen für Sand in 24-karätigem Gold. Symbol seines Lebens. Sha sprach man es aus, hatte er sich erklären lassen. Erst vor Kurzem hatte ein chinesischer Freund ihm erzählt, dass man sha, genauso ausgesprochen, auch anders schreiben konnte: mit dem Zeichen für Tod.
6. Kapitel
Bevor ich Ihnen alles erzähle«, sagte Anshu, während er die Schnellstraße vom Flughafen hinein nach Delhi verließ und nach Gurgaon abbog, den südlich gelegenen Vorort von Delhi, »muss ich Sie fragen: Was wissen Sie über den Taj Mahal? Oder was wissen Sie über Indien?«
»Hören Sie«, sagte Cora energisch. »Ich mache mir wirklich große Sorgen um Ganesh, und Sie wollen mit mir jetzt ein Quiz über Indien veranstalten? Bitte sagen Sie mir jetzt genau, was mit Ganesh los ist, sonst steige ich aus.« Noch während sie es sagte, merkte sie, wie kindisch das klang. Aussteigen? Und dann? Wo sollte sie hin? Sie benahm sich wie ein kleines Mädchen, das sein Spielzeug nicht bekam. Ob er jetzt sauer war? Schließlich war er auf eigene Faust an den Flughafen gekommen, ihretwegen. Cora blickte Anshu von der Seite an, aber dieser blieb völlig ruhig und sagte nur: »Es tut mir leid, ich werde Ihnen alles erzählen, was ich weiß. Das ist auch nicht viel. Aber ich weiß nicht, was Sie schon über Indien wissen.« Also gut, dachte Cora, der braucht wohl etwas länger. Aber er war ja nett, und sie brauchte ihn. »Indien? Laut. Lebendig. Chaotisch. Unglaublich schmutzig. Aber sehr nette Leute, alle sehr freundlich. Man liest bei uns ja nur über Gewalt gegen Frauen; ich bin bisher nicht einmal auch nur angemacht worden. Na ja. Hm. War ja auch nicht allein bisher. Was mich betrifft, ich fühle mich überhaupt nicht gefährdet. Oder bedroht.« Cora machte eine Pause. »Kein klares Bild also, nur spontane Eindrücke. Ich war ja nur am Flughafen bisher, also ist es zu früh, um Eindrücke zu schildern. So. Was noch? Die größte Demokratie der Erde, Slums, Bollywood, Elefanten, Software. Nach zehn Minuten Indienerfahrung auf dem Flughafen ist das doch schon viel.«
Nachdenklich betrachtete Anshu sie von der Seite. »Okay. Klischees über Klischees also … Das wisst ihr in Deutschland über uns? Viele Menschen? Wow. Ich hatte mehr erwartet. Aber gut, ich werde Ihnen viel erklären müssen. Und der Taj? Hatten Sie schon mal davon gehört?«
»Natürlich, das haben die meisten Menschen bei uns. Aber viele wissen sicher nicht genau, was das ist, außer, dass es sehr schön sein soll, riesig, ein Denkmal der Liebe oder so. Ungefähr 400 Jahre alt, kann das sein? Aus Marmor, ganz weiß. Aber Entschuldigung, ich möchte erst mal wissen, wo Ganesh ist, das ist doch viel wichtiger, wir müssen ihn suchen!«
»Hören Sie, Cora«, sagte Anshu, während er wieder einen unruhigen Blick in den Rückspiegel warf. »Ich weiß nicht, wo er ist. Wir können jetzt gar nichts tun, aber ich habe ein paar Ideen, wen ich fragen kann. Aber das mache ich allein. Vielleicht ist er auch morgen wieder da. Erst muss ich Sie in Sicherheit bringen, okay?«
Da kannte er Cora schlecht. »Ich bin nicht aus Zucker, und ich muss auch nicht ins Bett! Hat Ganesh Ihnen nicht von den Sprengungen in Tibet erzählt? Von meinem Kampf mit den chinesischen Soldaten? Ich werde Ganesh suchen, ich werde ihn jetzt nicht im Stich lassen! Vielleicht ist er verletzt oder wird irgendwo gefangen gehalten! Und Sie wollen hier über Touristenziele reden und mir die Geschichte des Taj erklären?«
Anshu blickte zu ihr hinüber, zum ersten Mal schien er sie richtig zu sehen. Er sah sie zweifelnd an, dann musste er lachen. »Ja, so hat er Sie mir beschrieben … ziemlich Feuer unterm … äh, ich meine, sehr temperamentvoll! Gut. Sie können mir helfen, ihn zu suchen. Aber Sie kennen sich hier nicht aus, Indien ist gefährlich für unerfahrene Ausländer! Und dann noch eine Frau! Sie können hier nicht einfach wie in China allein durch die Gegend reisen! Sie tun, was ich sage, ist das klar? Und trotzdem bringe ich Sie jetzt erst irgendwo unter, dann sehen wir weiter.«
Cora sah ein, dass er recht hatte. Sie hätte auch gar nicht gewusst, wo sie anfangen sollte, sie brauchte Anshu. Aber sie ließ sich nicht wie ein kleines Mädchen behandeln. Sein Frauenbild war ja vielleicht üblich in Indien, aber sie war keine Inderin, sie war Deutsche, Westerwälderin, Jägerin, Kämpferin!
»Okay«, sagte sie. »Wir machen das zusammen. Und, was wollten Sie mir über den Taj erzählen?«
»Nicht viel. Sie haben sicher schon von den Mogulherrschern gehört?«
Cora zögerte, schüttelte aber dann den Kopf. »Nicht wirklich, also gehört schon, aber ich kann das nicht einordnen.«
Anshu wich wenig elegant in letzter Sekunde einem Bus aus, der ihnen bedenklich nahe gekommen war. »Kann nichts schaden, das zu wissen. Sie kennen ja die Mongolen, Dschingis Khan und Kublai Khan, und einer der Nachfahren eroberte im 14. Jahrhundert Delhi. Aus dem Wort Mongole wurde Mogul, und sie regierten mit unglaublicher Macht, Pracht und Grausamkeit bis ins 18. Jahrhundert über große Teile Indiens … und einer der Nachfahren, eben Shah Jahan, war der Erbauer des Taj. Deswegen diese Mischung aus persisch-islamischen und auch hinduistischen Einflüssen. Die Mogulherrscher waren unglaublich reich. Haben Sie schon einmal vom Kohinoor gehört? Dem größten und schönsten Diamanten der Welt? Gehört heute zu den britischen Kronjuwelen. Gestohlen in Indien. Verständlich, bei 110 Karat!«
Sie hatten das Crowne Plaza Hotel passiert. Trotz der späten Stunde herrschte dichter Verkehr, immer wieder standen sie in einem Stau. Zwischen den nun allgegenwärtigen Hochhäusern sah Cora einige ungewöhnlich geformte Gebäude. »Da war früher das German Centre, Anlaufstelle der deutschen Wirtschaft in Indien«, sagte Anshu und deutete mit dem Kopf hinüber, als er Coras fragenden Blick bemerkte. »Hier in Gurgaon haben sich viele deutsche Firmen niedergelassen, und das German Centre unterstützte sie in der ersten Zeit in vielerlei Hinsicht. Indien ist auch für welterfahrene Deutsche ein schwieriges Pflaster. Das Investitionsumfeld ist durch die Korruption, die Religionen, das allgegenwärtige Chaos nicht gerade einladend.« Das hatte Cora schon von Freunden gehört, die in Indien investierten, vorrangig in der Automobilindustrie. Das Land war für viele deutlich schwieriger zu bearbeiten als China, das mit seiner Diktatur doch immerhin für Ordnung und ein inzwischen geregeltes Investitionsklima sorgte.
»Gut, wo war ich?« Anshu fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Ach ja, die Mogulherrscher. Die Kaiserwürde vererbte sich immer vom Vater auf den Sohn. Das ging natürlich nicht ohne Mord und Totschlag ab, Intrigen, schöne Frauen, Reichtümer – das ganze Programm. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts jedenfalls herrschte Shah Jahan, und seine natürlich unglaublich schöne Frau hieß Mumtaz Mahal. Also, das war nur ihr Ehrenname, ›Exzellenz des Palastes‹ oder so. Die Sprache am Hofe der Moguln war Persisch. Sie hatten zusammen angeblich vierzehn Kinder, und da er ständig in den Krieg ziehen musste, um sein Reich zusammenzuhalten und zu erweitern, ging sie mit. Irgendwann müssen die Kinder ja auch entstanden sein …«
Cora sah ihn zweifelnd von der Seite an. Er schien das alles zu glauben, das waren doch sicher die üblichen Geschichten, wie die Historiker sie verbreiteten. Aber wenn sie ihn jetzt unterbrach, würde er noch länger reden. Also schwieg sie und betrachtete nachdenklich das Straßenbild.