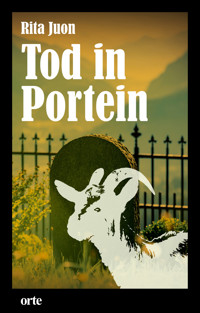
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Orte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf drei Friedhöfen wird je ein Grabstein mit gelber Farbe markiert. Röbi Dillinger war es nicht. Aber er ist einer der wenigen, der weiss, was die drei Toten verbindet. Und es ist für ihn essenziell, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Als die sonderbaren Vorfälle unangenehm viel Aufmerksamkeit erregen, schreitet Röbi deshalb zur Tat. Doch dann wird in Portein, einem kleinen Weiler in Graubünden, eine Frau tot aufgefunden – unweit eines der betroffenen Friedhöfe. Röbi ist entsetzt, als er eine Nachricht erhält, die ihn mit den Ereignissen in Zusammenhang bringt. Nun rächt sich, dass er einst lieber von einem Verbrechen profitierte, anstatt es anzuzeigen. Um seine Haut zu retten, sieht er sich zu aussergewöhnlichen Schritten gezwungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rita Juon
Tod in Portein
Rita Juon
Tod in Portein
Kriminalroman
orte Verlag
Dieses Projekt wird unterstützt durch den GKB BEITRAGSFONDS
© 2024 by orte Verlag, CH-9103 Schwellbrunn
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Brigitte Knöpfel
Umschlagbild: Andreas Butz
Gesetzt in Times New Roman
Herstellung: Verlagshaus Schwellbrunn
ISBN: 978-3-85830-333-2
ISBN e-Book: 978-3-85830-333-2
www.orteverlag.ch
In Erinnerung an «Tantele» Agnes, Karl und Volker.
Inhalt
Erster Teil
Kapitel 1
Einige Wochen vorher
Kapitel 2
Einige Wochen vorher
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Zweiter Teil
Kapitel 6
Zweieinhalb Wochen vorher
Kapitel 7
Zwei Wochen vorher
Kapitel 8
Eineinhalb Wochen vorher
Kapitel 9
Eine halbe Woche vorher
Kapitel 10
Dritter Teil
Kapitel 11
Wenige Tage vorher
Kapitel 12
Wenige Tage vorher
Kapitel 13
Wenige Tage vorher
Vierter Teil
Kapitel 14
Kurz vorher
Kapitel 15
Kurz vorher
Kapitel 16
Kurz vorher
Kapitel 17
Kurz vorher
Kapitel 18
Kurz vorher
Fünfter Teil
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Sechster Teil
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Letzter Teil
Dank
Weitere Krimis aus dem orte Verlag
Erster Teil
Sofern die Verstorbenen, auf welche Weise auch immer, mitbekommen, wo sie begraben sind, können sich jene in Portein glücklich schätzen. Der Friedhof liegt idyllisch etwas ausserhalb des Weilers am Heinzenberg, steil am Hang. Die Aussicht auf den fünfhundert Meter tiefer gelegenen Talboden und auf die tausend Meter höheren Gipfel ringsum gefällt.
Möglicherweise ist den Verblichenen der Weitblick allerdings egal. Vielleicht nehmen sie eher die Atmosphäre des Ortes wahr, und auch da sind sie gut bedient. Das umzäunte Gräberfeld, überdacht von einem riesigen Ahorn, strahlt eine Ruhe und Geborgenheit aus, der man sich nicht entziehen kann. Sicher nicht als lebende Person, vermutlich genauso wenig als körperlose Seele.
Sechs Gräber befinden sich auf dem Friedhof. Weil es üblich ist, diese nach der vorgeschriebenen Grabesruhe aufzuheben, stammt nur eines aus dem letzten Jahrtausend. Das jüngste ist einige Jahre alt, denn bei der geringen Bevölkerungszahl stirbt nur selten jemand.
Fünf der sechs Gräber sind traditionell gestaltet und ähneln sich alle: ein aufrechter Grabstein, eine rechteckige Grabeinfassung, eine der Saison entsprechende Bepflanzung.
Das sechste Grab unterscheidet sich in jeder Hinsicht von den übrigen: Eine flache Grabplatte bedeckt das Rechteck vollständig, Blumen gibt es nicht. Der Stein ist keiner aus den nahen Steinbrüchen in Andeer, Ferrera oder San Bernardino, sondern ein aus dem Ausland importierter. Der Name ist keiner, der am Heinzenberg seit Jahrhunderten heimisch ist, sondern einer aus dem Unterland.
Hans Georg Luginbühl, 1945–2018.
Der in das Grabmal gemeisselte Schriftzug müsste sich hell im sanft rötlichen Stein abzeichnen. Aber an diesem Sonntag im Mai leuchten sowohl die Inschrift als auch die Fläche ringsum in einem ebenmässigen, kräftigen Gelb.
1
Röbi
Es war an einem Tag im April. Der Frühling versuchte, sich in Graubünden auszubreiten. Das Churer Rheintal hatte er bereits fest im Griff, während sich die Leute in Davos erst über die blühenden Krokusse freuten und im Engadin noch die Skigebiete in Betrieb waren. Zu dieser Zeit hielt ich mich in Chur auf, wo meine Tante Agathe ein Mehrfamilienhaus besitzt. Warum sie sich einst einen Wohnblock in der Stadt angeschafft hat, ist mir nie klar geworden. Sie ist in Bayern geboren, in einer kleinen Stadt an der ebenfalls kleinen Donau, und sie ist heute noch dort zu Hause. Als mein Vater – ihr Bruder – noch lebte, kam sie regelmässig zu uns zu Besuch. Wahrscheinlich erkannte sie dabei, dass ihr Geld in einer Immobilie in Graubünden gut angelegt wäre, und schritt zur Tat. Nachdem mein Vater gestorben war, kam sie immer seltener in die Schweiz. Meine Mutter lebt auch nicht mehr, und ich bin wenig geeignet, meine bayerische Verwandte tagelang zu unterhalten. Sie geht mir bald einmal auf die Nerven, und ich ihr wahrscheinlich auch, weshalb sie sich bereits innert kurzer Zeit nach ihren Rosis und Seppis in der Heimat sehnt und über das Bündner Bier jammert, das ihr nicht schmeckt.
Trotzdem ist sie froh, dass ich mich in Chur um ihre Immobilie kümmere. Darüber bin auch ich froh. Einerseits, weil ich die Hauswartarbeiten gerne mache, andererseits, weil ich dafür entschädigt werde. Ich darf nämlich ihre Zweizimmerwohnung benutzen, wenn sie nicht selbst da ist oder die Räumlichkeiten Bekannten überlässt, was beides selten genug vorkommt. Diese Unterkunft ist vor allem im Winter und bei länger anhaltendem Schlechtwetter angenehm, denn mein zweiter Wohnsitz ist ein Camper. Ein komfortables Wohnmobil. Gross genug, um bequem darin leben zu können, klein genug, um damit unterwegs zu sein.
Was es ausserdem über mich zu sagen gibt? Röbi Dillinger. Dreiundvierzig Jahre alt. Sowohl Deutscher als auch Schweizer. Wohnhaft: einmal hier, einmal dort. Dasselbe gilt für Frauenbekanntschaften und für Arbeitsstellen.
Aber zurück zur Sache: Es war also an einem Tag im April. Die Mieterwechsel per Ende März waren vorüber. Ich hatte die Wohnungen abgenommen und instand gestellt, was nötig war, bevor ich sie den neuen Parteien übergab. Aus zwei Einheiten waren langjährige Mieter ausgezogen, dort waren grössere Renovierungsarbeiten nötig, wozu ich Handwerker aufbot und selbst tatkräftig mithalf. Weiter standen grössere Umgebungsarbeiten an, weil das Nachbargebäude verändert worden und der bestehende Sichtschutz in Form einer Hecke nun ungenügend war. Tante Agathe schilderte mir ihre Wünsche bis ins Detail. Ich pflanzte die Sträucher, die sie haben wollte, an die Stellen, an denen sie sie haben wollte, platzierte Steine und Blumen dazwischen und rapportierte jeden Abend, wie die Arbeiten vorangingen. Das war der strengste Teil des Tages. So viel Tante Agathe ist nur mit viel Bier zu ertragen. Damit mir von meinem Lohn überhaupt etwas blieb, musste ich das Bier als Spesen verrechnen. Freilich nicht offensichtlich – ich erfand die eine oder andere Unterhaltsarbeit, die sie nie überprüfen würde.
Diese ausgefüllte Zeit neigte sich ihrem Ende zu. Die Pflanzen wuchsen von selbst, die neuen Mieter waren, soweit es mich betraf, wunschlos glücklich, und meine Arbeit wurde immer weniger. In meiner Herzgegend machte sich das bekannte Ziehen bemerkbar, das sich jeden Frühling einstellt. Ich hatte genug vom Leben in der Stadt. Meinen Camper auf Vordermann zu bringen, war keine grosse Sache, aber sie erfüllte mich mit fiebriger Vorfreude. Die Passstrassen waren teilweise noch geschlossen, und der Mai ist in den alpinen Tourismusgebieten die ödeste Zeit des ganzen Jahres. Besser also würde ich mich an die Alpennordseite halten. Während ich die Möblierung des Gefährts staubsaugte, zog ich den Bodensee in Betracht. Die Zeltplätze dort sind zahlreich und komfortabel und die Stammtische in den Dörfern ähnlich angenehm wie die in Graubünden. Beim Beziehen des Betts verwarf ich diese Pläne und erwog, das Berner Seeland und den Jura anzusteuern. Diese Gegend kenne ich weniger, angeblich soll sie lieblich sein, und die Apérogewohnheiten der Welschen machen sie mir sympathisch. Allerdings sprechen sie Französisch, und ich bezweifle, dass ich mit meinen Kenntnissen aus der Schulzeit dem Gespräch einer Tischrunde folgen könnte. Also doch die Ostschweiz?, fragte ich mich beim Putzen der Küchenschränke, als mir die Entscheidung abgenommen wurde. Ein Zimmermann aus dem Oberengadin rief an und erkundigte sich, ob ich einige Wochen bei ihm einspringen wolle. Ich hatte schon öfter in seinem Betrieb ausgeholfen, wenn er und seine beiden Festangestellten die Arbeit nicht allein bewältigen konnten. Die Tätigkeit gefiel mir, und ich sagte sofort zu. Obwohl es im Engadin noch schweinekalt war, und obwohl dort bereits jetzt, spätestens aber ab Mai, Zwischensaison herrschen würde und alles geschlossen wäre. Da soll noch jemand sagen, ich scheue die Arbeit.
In den ersten Wochen parkierte ich meinen Camper auf dem Gelände der Firma. Einen kürzeren Arbeitsweg kann nur haben, wer zum Homeoffice verurteilt ist, was den Zimmerleuten zum Glück erspart bleibt. Die Nähe zum Arbeitsplatz war angenehm, aber damit hatte es sich auch schon. Vor allem war es stinklangweilig. Nicht nur, weil die Zimmerei etwas ausserhalb lag, sondern auch, weil die Feriengäste das Tal allesamt verlassen hatten, dicht gefolgt von den Einheimischen, die im Tourismus tätig sind. Ich sah mich gezwungen, mich mit Zeitungen und Onlinemedien zu beschäftigen. Und so erfuhr ich vom Vorfall, der den Auftakt zu den nachfolgenden Ereignissen bildete.
Auf dem Friedhof bei der Kirche San Gian in Celerina sei ein Grab geschändet worden, berichtete die «Engadiner Post» an einem Montag Mitte Mai. Ein einzelner Grabstein sei leuchtend gelb bemalt worden. Von der Täterschaft fehle jede Spur.
Das fand ich aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. Zum einen, weil das Tal wie immer im Mai im Dornröschenschlaf lag; sollte eine einheimische Person auf dem Friedhof tätig gewesen sein, war sie jetzt wohl zehnmal leichter zu finden als während der Hochsaison. Zum andern, weil ein einzelner, gelb bemalter Grabstein nicht so recht auf Vandalismus hindeutete. Vor allem aber machte mich die Meldung wohl stutzig, weil mir die Langeweile allmählich zusetzte. Kurz entschlossen fuhr ich mit dem Camper zur Kirche San Gian.
An einem schöneren Ort kann eine Kirche nicht gebaut sein. Das Engadin ist zwischen Samedan und Celerina breit und flach, vielleicht befand sich hier einst ein weiterer See, der sich vor Tausenden von Jahren entleerte. Der Talgrund ist topfeben und wurde mit einem Flug- und einem Golfplatz teilweise verbaut. Über den mehrheitlich unberührten Rest erhebt sich ein kleiner Hügel, der der Erosion standhalten konnte und jetzt wie ein vorwitziger Schössling über die Ebene ragt. Auf dem Hügel wurde eine Kirche errichtet, ein in jeder Hinsicht weiser Entscheid. Vom Standpunkt der Geistlichkeit aus ist er weise, weil das Gebäude weit herum sichtbar ist, die Blicke auf sich zieht und so fortwährend an Gottes Allmacht erinnert. Weise aber auch, weil ebendiese Geistlichkeit dadurch den Reichen und Schönen zuvorkam, die das Tal ein paar hundert Jahre später mit ihren Villen verbauten. Sowohl den Einheimischen als auch den Feriengästen dürfte ein gekreuzigter Jesus auf dem Hügel lieber sein als ein russischer Oligarch.
Tausendmal habe ich die Kirche auf Bildern gesehen, die sich durch den markanten Turm ohne Dach von allen anderen unterscheidet und ein beliebtes Fotosujet darstellt. Trotzdem war mir bisher nie aufgefallen, dass sie zwei Türme hat. Erst als ich über die weite Talebene auf den Hügel zufuhr, bemerkte ich, dass sich auch am anderen Ende des Kirchenschiffs ein Turm erhebt. Er ist bedeutend kleiner als sein berühmter Kollege, aber im Gegensatz zu diesem ist er intakt. Während ich den Camper auf dem Parkplatz abstellte, überlegte ich, welcher der Türme der sympathischere ist: Der mächtige, auffällige, dem das Schicksal übel mitgespielt hat, der sich aber trotz der sichtbaren Narben in ungebeugtem Stolz über das Tal erhebt? Oder der behäbige, unauffällige, der bisher jeder Unbill von Mensch und Natur standhalten konnte und verlässlich über Volk und Kirche wacht?
Die lange Treppe zur Kirche hinauf umging ich auf dem stufenlosen Weg daneben, der direkt zum Friedhof führt. Langsam schritt ich die Reihen ab. Die Grabmale waren grösstenteils mit Namen alteingesessener Familien beschriftet. In schnurgeraden Linien reihte sich Grab an Grab, jedes mit einem aufrechten Stein und einer passenden Einfassung. Es gab kaum gestalterische Ausreisser, die grosse Masse war sich ähnlich und mehr oder weniger liebevoll bepflanzt. Das sonnengelb bemalte Exemplar fiel mir von Weitem auf, trotzdem liess ich mir Zeit und studierte die Inschriften auf den Grabsteinen, die meinen Weg säumten.
Als ich schliesslich zum Ziel kam, hatte ich zunächst Mühe, den Anblick einzuordnen. Die Schändung war irgendwie seltsam, fast schon originell. Der Stein war weder besprayt noch mit unschönen Motiven verschandelt, sondern sorgsam von oben bis unten gelb bemalt worden. Wahrscheinlich mit einem breiten Pinsel, wie ihn Flächenmaler verwenden; an einigen Stellen glaubte ich Spuren davon zu erkennen. Auch die Gravur war überstrichen worden, wodurch sie nicht leicht zu entziffern war. Als es mir gelang, blieb mir der Mund offen stehen. Den Namen kannte ich sehr wohl. Alles andere als wohl war mir hingegen beim Gedanken, was das zu bedeuten hatte.
Immerhin war ich noch so weit bei Verstand, dass ich ein Foto schoss und dieses nicht sofort verschickte. Auch verbat ich mir, überstürzt zu telefonieren. Stattdessen bewahrte ich Ruhe und ging zurück zu meinem Camper. Den öden Standplatz bei der Zimmerei hätte ich allerdings nicht ertragen, weshalb ich zu einem Parkplatz eingangs von Samedan fuhr und ein Stück dem Inn entlangging.
Günther Grabowski. Damals hatte ich über den Nachnamen gespottet, weil er mich an das Kinderbuch mit Maulwurf Grabowski erinnerte. Und über den Vornamen, weil er so Deutsch war wie der von Tante Agathe. Jedenfalls hatte sich mir der Name eingeprägt, obwohl er nur einer von vielen war, die in den Vorkommnissen jener Zeit eine Rolle spielten. Ich setzte mich auf eine Bank am Inn und griff nach den Zigaretten. Tief inhalierte ich Zug um Zug, bemüht, den Schreck zu verdauen. Es gelang.
Jemand hatte Günther Grabowskis Grabstein gelb bemalt. Jemand wollte ein Zeichen setzen und auf ihn aufmerksam machen. War das negativ zu werten, hatte irgendwer eine Rechnung mit Günther Grabowski offen? Oder war es ein Akt der Gerechtigkeit? Sollte der Tote als Opfer markiert werden, dem eine bisher unerkannte Ungerechtigkeit widerfahren war? Träfe Letzteres zu, könnte mir durchaus eine Bedeutung im Geschehen zukommen. Allerdings war es sehr weit hergeholt, dass jemand nach all den Jahren ausgerechnet jetzt und ausgerechnet auf diese Weise tätig geworden sein sollte.
Ich kam zum Schluss, dass zwar nicht gar kein Grund zur Besorgnis vorlag, dass dieser aber vorderhand vernachlässigbar war. Mit anderen Worten: Eine Überreaktion war nicht angebracht. Mulmig wurde mir allerdings, wenn ich an Lukas dachte. Zum Glück hatte ich ihn nicht sofort angerufen. Immerhin stand der Name des Toten nicht in der «Engadiner Post», und Lukas las das Blatt wahrscheinlich gar nicht. Die anderen Zeitungen würden diesen marginalen Vorfall wohl kaum aufgreifen.
Diese Hoffnung musste ich schon kurze Zeit später begraben. Wie immer verbrachte ich das Wochenende in Chur. Zu Beginn meines Engadin-Aufenthalts hatte ich meistens den Zug in die Stadt genommen, um meinem Camper die Fahrt über die Pässe bei immer noch winterlichen Verhältnissen zu ersparen. In Chur stand mir Tante Agathes Wohnung zur Verfügung, wo ich meine Wäsche wusch, in der Liegenschaft zum Rechten sah und meine Bekanntschaften pflegte. An diesem dritten Freitag im Mai musste sich mein Camper aber wohl oder übel über den Julier quälen, denn Tante Agathe überliess ihre Wohnung in der Auffahrtswoche bayerischen Bekannten und zwang mich damit, auf den Campingplatz auszuweichen. Ich entschied mich für jenen in Landquart. Er liegt idyllisch etwas abseits am Eingang ins Prättigau und verfügt über eine Pizzeria, die nicht nur Platzgäste anzieht. So kam es, dass ich mich bereits am Freitagabend in einer geselligen Runde aus Einheimischen wiederfand, dank der ich erfuhr, dass auf dem Waldfriedhof in Davos ein einzelner Grabstein bemalt worden war und kurz darauf gleich mehrere auf dem Daleu-Friedhof in Chur.
Ich schluckte nicht leer, weil mir das nicht liegt. Vielmehr nahm ich einen grossen Schluck von meinem Bier, und noch einen. Nach dem dritten war ich so weit, dass ich nicht sofort aufsprang und Lukas anrief. Zuerst musste ich mir selbst ein Bild von der Lage machen.
Einige Wochen vorher
Bettina
An einem frühlingshaften Tag im März betrat Bettina Arpagaus pünktlich wie immer die Filiale der Graubündner Kantonalbank in Thusis durch den Personaleingang. Deren ehrwürdige Atmosphäre hüllte sie ein, sobald sich die Tür hinter ihr schloss. Wie immer straffte sie die Schultern, als sie den Empfangsbereich durchschritt. Sie wusste, dass sie mit ihrer diskret eleganten Kleidung und der gepflegten Frisur perfekt in diesen Raum passte. Das Tüpfelchen auf dem i war die dunkle Hornbrille, hinter der sie mit ernsten braunen Augen ihre Umgebung musterte. Das Gerücht, sie sei aus Fensterglas und diene nur zur Vervollständigung ihres seriösen Auftretens, hätte sie widerlegen können, wenn sie davon gewusst hätte. Ihre Mitarbeitenden hüteten sich jedoch, sie offen darauf anzusprechen. Allzu bekannt war ihr fehlender Sinn für Humor oder auch nur seichte Unterhaltung. Bettina war eine ernste Person, ihre Arbeit eine ernste Angelegenheit. Folgerichtig machte ihr die Arbeit keinen Spass, denn Spass hatte bei ihren Aufgaben nichts zu suchen. Es erfüllte sie mit Befriedigung, wenn sie kompetent beriet, freundlich unterstützte oder auch bedauernd ablehnte, das schon. Ihre grosse Leidenschaft war und blieb aber das Rechnungswesen. Wenn alles bis auf die letzte Kommastelle genau aufging und durch das Vieraugenprinzip doppelt abgesichert war, fühlte sie sich im Gleichgewicht. Aus diesem Grund war sie nach einem Vierteljahrhundert so überzeugt wie am ersten Tag ihrer Lehre, dass sie den richtigen Beruf an der richtigen Stelle bei der richtigen Arbeitgeberin ausübte.
Um Punkt neun Uhr öffnete sich die Tür der Bank für die Kundschaft, und als Erste trippelte Madame Catillaz in den Schalterraum. Wie immer wirkte sie trotz ihres leichten Buckels elegant. Dass sie Wert auf die französische Anrede legte, wussten nicht nur alle Angestellten, sondern alle, die je mit ihr zu tun gehabt hatten. Zielsicher steuerte sie den offenen Schalter an, wo sie von Bettina Arpagaus begrüsst wurde.
«Ich habe eine Überweisung gemacht, die offenbar nicht angekommen ist», erläuterte die Kundin und wühlte in ihrer Handtasche nach dem Beleg. «Hier!» Triumphierend schob sie Bettina einen Zettel zu. «Das sind die Firma und die Kontonummer. Das Geld muss doch angekommen sein.»
Bettina wandte sich Tastatur und Bildschirm zu. Sie sah, dass das Unternehmen, ein Handwerksbetrieb im Unterengadin, bei der Bank ein Konto besass, aber die Kontonummer war eine andere als die, die Madame Catillaz notiert hatte. Auch Bettinas Suche nach der Kontonummer war erfolgreich: Sie gehörte dem Verein Pro Pfauenziege. Da Fantasie nicht zu ihren herausragenden Qualitäten gehörte, fragte sie sich nicht, was die Kundin mit einem Interessenverband für Ziegen zu tun haben mochte. Es ging sie nichts an. Ihre Aufgabe war es, Madame Catillaz auf den Irrtum aufmerksam zu machen.
«Offenbar wurde eine falsche Kontonummer verwendet», erläuterte Bettina. «Das Geld …»
«Wie soll das möglich sein?», empörte sich die alte Dame. «Die Kontonummern sind sich doch nie so ähnlich, dass man durch einen Verschreiber eine falsche erwischt.»
Das stimmte, gab ihr Bettina insgeheim recht. Ein flüchtiger Schreibfehler war kaum möglich, weil die Kontonummer eine Prüfziffer enthielt. Sie bemühte sich, Madame Catillaz zu beschwichtigen.
«Hören Sie, junge Dame!» Die Kundin hob mahnend ihren Zeigefinger. «Dieser Schreiner hat vor zwölf Jahren mein Haus im Unterengadin umgebaut. Das war ein grosser Auftrag. Jetzt hatte er eine kleine Reparatur zu erledigen. Ich habe dieselbe Kontonummer verwendet wie damals. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Ihre Bank dieselbe Kontonummer für verschiedene Kunden verwendet?»
«Nein, das ist ausgeschlossen», beschwichtigte Bettina.
«Aber irgendwie ist es passiert.» Madame Catillaz rümpfte die Nase. «Mein Vertrauen in Ihre Bank leidet.»
«Ich versichere Ihnen, dass der Auftrag korrekt ausgeführt wurde», erklärte Bettina ruhig. «Das Geld gelangte zum angegebenen Empfänger. Aber …»
«Versuchen Sie nicht, sich herauszureden.» Ein böser Blick traf die Kundenberaterin. «Das Geld wurde vor zwölf Jahren an diese Kontonummer überwiesen und kam beim richtigen Empfänger an. Jetzt wurde es an dieselbe Kontonummer überwiesen und kam am falschen Ort an. Das ist eine Tatsache, und es ist ein Skandal!»
Bettinas Versuche, Madame zu besänftigen, schlugen fehl. Sie verweigerte sich den Argumenten der Angestellten und rauschte erhobenen Hauptes hinaus.
In der Mittagspause ging Bettina wie gewohnt nach Hause. Ihre Zweizimmerwohnung mit grossem Balkon erreichte sie in weniger als zehn Minuten zu Fuss. Bereits auf dem Heimweg drängte sich Madame Catillaz in ihre Gedanken, und sie liess sich weder beim Salat rüsten noch beim Aufwärmen der am Vorabend zubereiteten Gemüsewähe daraus vertreiben.
Madame hatte ihr zwei Organisationen präsentiert, die nichts miteinander zu tun, aber dieselbe Kontonummer hatten. Was natürlich nicht möglich war. Dass sich Madame irrte, war indessen auch nicht möglich. Sicher nicht in Madames Selbsteinschätzung, und Bettina neigte dazu, ihr recht zu geben.
Vielleicht gab es trotz allem einen Zusammenhang zwischen den beiden Konten? Was, wenn der Schreiner nebenbei Ziegen züchtete? Das konnte durchaus sein, aber sie fand keinen Grund, der ihn veranlasst haben könnte, die Kontonummer von seinem Betrieb auf Pro Pfauenziege zu übertragen. Was, wenn er den Verein über sein Geschäft laufen liess? Das schloss sie aus. Keine Revisionsstelle würde das gutheissen. Wenn schon, würde er dazu sein privates Konto benutzen.
Das Essen, die Nachrichten im Radio und die Post, die sie aus dem Briefkasten genommen hatte, lenkten Bettina eine Weile ab, ebenso der Kaffee und das Abräumen des Geschirrs. Als sie sich bereit machte, wieder in die Bank zu gehen, kehrten ihre Gedanken zu Madame Catillaz’ Beschwerde zurück. Sie wollte der Sache nachgehen, auch wenn sie weder dringlich noch wichtig war.
Zeit für Nachforschungen fand Bettina am nächsten Nachmittag. Während der Lernende im zweiten Lehrjahr den Schalter bediente, sass sie an ihrem Schreibtisch im etwas erhöhten hinteren Teil der Schalterhalle. Nach wie vor ertappte sie sich dabei, den Raum in Gedanken so zu nennen, obschon er längst in einen offenen Beratungsbereich umgewandelt worden war. Sie war zuständig, falls der Lernende fachliche Unterstützung benötigte oder der Andrang der Kundschaft zu gross wurde, doch im Moment schien er allein zurechtzukommen.
Nacheinander rief sie zuerst die Daten des Handwerksbetriebs im Unterengadin auf, dann jene des Vereins Pro Pfauenziege. Sie schaute konzentriert auf den Bildschirm und wurde immer ratloser.
Bei der Schreinerei handelte es sich um einen Betrieb, der seit Jahrzehnten existierte. Die Lohnsumme hatte sich in den letzten zehn Jahren veranderthalbfacht, was darauf schliessen liess, dass das Geschäft gut lief und wachsen konnte. Die Aktiengesellschaft beschäftigte über zwanzig Mitarbeitende und gehörte damit nicht zu den kleinsten Holzwerkstätten im Tal. Die Firma schien gesund zu sein.
Auch der Verein Pro Pfauenziege existierte seit weit mehr als zehn Jahren. Bevollmächtigt war ein Herr, der abgesehen von diesem Konto keine Beziehungen zur Bank unterhielt. Der Verein schien kaum Mitglieder zu haben, denn die typischen Bewegungen auf Konten dieser Art – eine gehäufte Anzahl Einzahlungen gleicher Beträge zu einer bestimmten Zeit des Jahres – fehlten. Missbilligend runzelte Bettina die Stirn. Der Verein schien nicht gut geführt zu sein, aber das war nicht ihr Problem.
Ihr Problem war Madame Catillaz’ Feststellung. Diese hatte sie nun überprüft, ohne irgendeinen Zusammenhang zwischen den beiden Konten zu finden. Die alte Dame musste sich geirrt haben.
Madame Catillaz sah das allerdings anders. Als Bettina ihr ein paar Tage später geduldig darlegte, dass eine Verwechslung auf Seiten der Kundin die naheliegendste Erklärung für die fehlgeleitete Überweisung sei, ereiferte sie sich immer mehr. Ihr dünner Zeigefinger mit dunkelrot lackiertem Nagel tippte entweder aufgebracht auf die Tischplatte zwischen ihr und der Kundenberaterin, oder er schob die Brille zurück, die immer wieder zur Nasenspitze rutschte.
«Junge Dame, das akzeptiere ich nicht», betonte Madame Catillaz energisch. «Hier ist ein Fehler passiert. Und zwar liegt dieser nicht bei mir, sondern bei Ihrer Bank.» Ein Tippen mit dem Fingernagel. «Ich verlange eine Erklärung. So etwas darf nicht geschehen. Es ist Ihre Pflicht herauszufinden, wie das passieren konnte.» Ein Zurückschieben der Brille. «Mein Vertrauen in Ihre Bank ist zerstört», ein Tippen, «wenn sie diesen Vorfall nicht aufklären.» Mit dem Zurückschieben der Brille schien sie ein paar Zentimeter zu wachsen.
Bettina kapitulierte. Sie versprach Madame Catillaz, der Sache im Archiv nachzugehen. Das war geflunkert, ein Archiv in diesem Sinn gab es nicht. Aber es hörte sich glaubwürdig nach vertiefter Nachforschung an und bewirkte, dass Madame sich etwas beruhigte.
Siegreich straffte die Kundin die Schultern. «Ich komme wieder. Dann erwarte ich eine Erklärung.» Entschlossen griff sie nach ihrer Handtasche und wandte sich grusslos dem Ausgang zu.
Als Madame Catillaz das nächste Mal in der Bank erschien, hatte Bettina eine Erklärung parat. Ruhig und selbstsicher zeigte sie der Kundin auf, wie es zu der fehlerhaften Überweisung hatte kommen können. Das Konto, das sie vor zwölf Jahren benutzt hatte, sei in der Zwischenzeit vom Geschäft stillgelegt, aber auf der Bank nicht saldiert worden. Vielmehr sei es durch finanz- und steuertechnisch angeratene Transaktionen anderweitig übertragen worden.
«Und das Geld, das ich überwiesen habe?», fragte Madame.
«Der Betrag wurde gestern auf Ihr eigenes Konto zurücküberwiesen.»
Die Kundin nickte gnädig. «Wenigstens das. Allerdings hat es viel zu lange gedauert, den Fehler zu korrigieren. Wollte der Kontoinhaber den Betrag etwa nicht zurückzahlen?»
«Madame Catillaz, wir haben die Rückerstattung des Betrags veranlasst, was einwandfrei ausgeführt wurde. Seit gestern ist das Geld wieder auf Ihrem Konto.» Dass sie dazu nicht verpflichtet gewesen wären, erwähnte Bettina nicht. Madame war eine zu gute Kundin, um ihr auf die Nase zu binden, dass die Bankdienstleistung an ihre Grenzen stiess, wenn der Fehler eindeutig nicht bei der Bank lag.
«Somit dürfte die Angelegenheit erledigt sein», sagte Madame Catillaz. «Aber ich werde wachsam bleiben.»
«Selbstverständlich, Madame Catillaz.» Bettina verbat sich, erleichtert aufzuatmen, als sich Madame zum Gehen wandte. Sie konnte nur hoffen, dass bald etwas anderes die Aufmerksamkeit der alten Dame fesseln und sie von der irrtümlichen Kontonummer ablenken würde. Denn ihre Erklärung, wie die falsche Überweisung habe passieren können, würde weiteren Nachfragen nicht lange standhalten.
Tatsache war: Jemand hatte vor zwölf Jahren absichtlich veranlasst, dass der Betrag auf das Konto von Pro Pfauenziege überwiesen wurde statt auf jenes der Schreinerei. Was Fragen aufwarf, die Bettina nicht beantworten konnte. Was wiederum ihrem zahlenaffinen Wesen widersprach und deshalb bedeutete, dass sie der Sache auf den Grund gehen musste.
Der März neigte sich inzwischen dem Ende zu, als Bettina einige Tage später Zeit für Nachforschungen hatte. Nachdenklich liess sie den Blick über die Zahlen auf dem Bildschirm gleiten.
Ausser der Einzahlung von Madame Catillaz und der Rückerstattung in gleicher Höhe war in diesem Jahr nicht viel passiert. Der Kontostand war mit ein paar Hundert Franken nicht der Rede wert.
In früheren Jahren waren allerdings weitere Transaktionen erfolgt, und zwar jeweils die Einzahlung eines hohen Betrags und unmittelbar darauf ein Zahlungsauftrag mit einem etwas tieferen Betrag. Bettina fand zunächst nur vereinzelte Vorgänge dieser Art. Deutlich mehr waren es von 2012 bis 2014. Ältere Daten standen ihr nicht zur Verfügung.
Was war mit dem Verein Pro Pfauenziege geschehen, dass vor zehn Jahren noch ein Umsatz im tiefen sechsstelligen Bereich erzielt wurde, später aber kaum mehr Kontobewegungen stattfanden? Wie kam der Verein zu einzelnen Einzahlungen in Höhe von mehreren zehntausend Franken? Und zu Überweisungen in fast gleicher Höhe?
Das ging Bettina grundsätzlich nichts an. Die Banken waren angehalten, wachsam zu sein, um mutmassliche Geldwäscherei zu entdecken. Hinter dem Verein eine mafiöse Vereinigung zu vermuten, schien ihr indes weit hergeholt, und auch die Kontobewegungen wiesen nicht auf eine derartige Straftat hin. Somit hätte sie die Sache als erledigt betrachten können.
Aber das ging nicht. Das Rätsel um die Kontonummer blieb ungelöst, und ungelöste Rätsel hatten im Rechnungswesen nichts zu suchen. Sie waren der krasse Gegensatz zum Prinzip von Soll und Haben, bei dem letztlich immer alles aufgehen musste. Immer. Alles. Ausnahmen gab es weder für Pfauenziegen noch für exzentrische alte Damen. Differenzen mussten gefunden werden. Immer. Alle. Welcher Art auch immer.
2
Röbi
Am nächsten Morgen, es war der dritte Samstag im Mai, kümmerte ich mich zeitig und zügig um Tante Agathes Liegenschaft. Sobald ich konnte, brach ich auf nach Davos. Eine ganze Weile irrte ich durch die Gegend, bis ich endlich auf die Abzweigung zum Waldfriedhof stiess. Ich parkierte auf dem kleinen Parkplatz und ging ewig lange der Mauer entlang zum Eingang. Dann aber – du meine Güte! So ein spezielles Gräberfeld hatte ich noch nie gesehen. Wie um alles in der Welt sollte ich auf dem weitläufigen Grundstück ein einzelnes Grab finden? Alles in allem mussten es ein paar Tausend sein. Diese Expedition dürfte zu einer Weitwanderung ausarten, fürchtete ich etwas mutlos.
Je weiter ich in die Anlage vordrang, desto klarer wurde mir, dass das Unterfangen doch nicht so hoffnungslos war, denn ein Grossteil der Gräber war in Bogen angelegt, die sich kreis- oder eher ellipsenförmig durch den Wald zogen. Und diese Gräber besassen alle ein hölzernes Kreuz. Da im Zeitungsbericht von einem Grabstein die Rede gewesen war, schied somit die Mehrheit der Gräber aus, und die Weitwanderung wurde zu einem Spaziergang. Zu einem angenehmen noch dazu. Ich war die einzige lebende Person weit und breit, roch den Duft der Bäume, lauschte dem Vogelgezwitscher und genoss den Wechsel von Sonne und Schatten im Lärchenwald.
Der gelbe Stein stach wieder leuchtend aus den anderen heraus. Bange trat ich näher, hoffend, einen mir fremden Namen anzutreffen. Doch es war mir nicht vergönnt. Die Inschrift Ercole Fiorucci war trotz der Farbe gut lesbar, und wie hätte ich diesen Mann vergessen können. Ercole, französisch Hercule wie der berühmte Detektiv von Agatha Christie, die ausser dem Vornamen wohl nichts mit meiner bayerischen Tante gemein hatte. Der melodische Name des gebürtigen Italieners war mir im Gedächtnis geblieben, und nachdem nun in kurzer Zeit zwei gelbe Grabsteine aufgetaucht waren, die in direktem Zusammenhang zu mir oder vielmehr zu Lukas standen, konnte ich nicht mehr an einen Zufall glauben.
Mit Müh und Not zwang ich mich, ihn nicht anzurufen. Zuerst wollte ich mir ein Bild von der Lage in Chur machen.
Der Daleu-Friedhof liegt nahe bei Zentrum und Bahnhof. Etwas verwunschen verbirgt er sich hinter einer hohen Mauer, die ihm die Stadt vom Leibe hält. Alteingesessene Familien und Mitglieder des ehemaligen Bündner Adels, allen voran die von Planta und die von Salis, belegen mit üppigen Grabmalen ganze Reihen. Übermütige Vögel übertönen den entfernten Strassenlärm, und hohe Bäume verdecken die Sicht auf die Häuser ausserhalb der Anlage. Offenbar haben hier die Gärtner das Sagen, denn ausser auf den Gehwegen wuchern überall immergrüne Pflanzen.
Als ich das Eingangstor durchschritten hatte, stellte ich unschwer fest, dass ich nicht der einzige Besucher war. Einige der Leute dürften Trauernde gewesen sein, andere waren eindeutig Neugierige. Wie ich, aber wohl aus weniger triftigem Grund.
Die gefärbten Grabsteine zu entdecken, war ein Leichtes, denn sie waren mit rot-weissem Flatterband abgesperrt. Bereits aus ein paar Metern Distanz sah ich, dass sich hier eine andere Szenerie bot. Die Grabsteine waren nicht sorgfältig bemalt worden, sondern besprayt. Nicht ebenmässig sonnengelb, sondern neongelb, -orange und -pink. Auf einem Grab war die Bepflanzung herausgerissen worden, auf einem anderen lag ein Porzellanengel am Boden, der wohl in der Erde gesteckt hatte. Das hier war böswilliger Vandalismus, ein Akt voller Verachtung für die Verstorbenen und die Hinterbliebenen. In Celerina und Davos war die malende Person achtsam zu Werke gegangen. Die Aussage dieser Taten war eine völlig andere.
Allerdings machte das die Sache für mich nicht einfacher, im Gegenteil. Zwar waren mir die Namen der Verstorbenen allesamt unbekannt, der Daleu-Friedhof hatte weder mit mir noch mit den anderen beiden Toten etwas zu tun. Aber das Geschmiere in Chur, das vor zwei Tagen angebracht worden war, hatte die Polizei auf den Plan gerufen, und das gefiel mir überhaupt nicht. An diesem Samstagabend brauchte ich auf dem Zeltplatz in Landquart ein paar Biere mehr als üblich, um zur Ruhe zu kommen. Trotzdem schlief ich schlecht.
Wenn es nur dabei geblieben wäre, dann hätte immer noch alles gut ausgehen können. Lukas hatte nämlich bisher nicht mitbekommen, um wessen Gräber es sich handelte. Er ahnte nichts vom drohenden Unheil und schlummerte, wie ich annahm, friedlich an der Seite seiner Jannine. Doch schon zwei Tage später war es um seinen Seelenfrieden geschehen.
Am Montag brachte die «Südostschweiz» die gelben Grabsteine auf der Titelseite. Ein übereifriger Praktikant, eine unterbeschäftigte Redaktorin oder sonst irgendein verfluchter Trottel hatte Stunden seiner Arbeitszeit investiert, um die Sache gross aufzumachen. Aktueller Anlass war die Entdeckung eines dritten gelben Grabsteins. Er befand sich auf dem Friedhof von Portein am Heinzenberg. Im Artikel wurden die Toten beim abgekürzten Namen genannt. Günther G., Celerina. Ercole F., Davos. Hans Georg L., Portein.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es in Portein zwei Hans Georg L. gab, tot oder lebendig, war gleich null. Portein ist ein winziger Weiler am Heinzenberg. In seinen letzten Jahren als eigenständige Gemeinde hatten die Abstimmungsresultate jeweils jenen beim Fussball geähnelt: 3:1 oder 2:3. Mobilisierte eine Vorlage etwas mehr Stimmberechtigte, erinnerten sie eher ans Eishockey: 7:5 oder 9:2. Handballergebnisse waren ausgeschlossen, selbst für die Spielstände bei Halbzeit reichte die Bevölkerungsgrösse nicht aus. Seit die Gemeinde mit Cazis fusioniert ist, sind diese Zahlen Geschichte.
Das alles dürfte Lukas egal gewesen sein, als er mich an jenem Morgen anrief.
«Röbi, hast du die Zeitung gelesen?» Kein Gruss, keine Floskeln. Alarmstufe Rot.
«Erst die Schlagzeile.»
«Was zum Teufel geht hier vor? Wer weiss von diesen drei Männern?»
«Wahrscheinlich viele», versuchte ich zu beschwichtigen. «Keiner von ihnen war ein Einsiedler.»
«Stell dich nicht dumm.» Alarmstufe Dunkelrot. «Nur du und ich kennen die Verbindung zwischen den Dreien. Ich male keine Grabsteine an. Warst du das?»
«Natürlich nicht», beeilte ich mich zu erwidern. «Vielleicht ist es ein Zufall?»
«Das glaubst du doch selbst nicht!»
Nein, das glaubte ich wirklich nicht.
«Jemand muss von der Sache erfahren haben. Wie ist das möglich?»
«Ich habe keine Ahnung, wie dir jemand auf die Schliche gekommen sein könnte», begann ich, wurde aber unterbrochen.
«Mir?», rief Lukas. «Du hängst genauso mit drin!»
Das stimmte nur zum Teil. Wer Lukas’ Vergehen kannte, musste nicht zwingend von meinem Anteil daran wissen. Allerdings schien es mir geraten, ihn nicht darauf hinzuweisen, dass seine Lage prekärer war als meine. «Ich habe keine Ahnung, wer dahinterstecken könnte», sagte ich. «Aber da sich der Maler bisher weder bei dir noch bei mir gemeldet hat, vermute ich, dass er das auch nicht im Sinn hat.»
«Er?»
«Der malende Mensch, meinetwegen.» Die Vermutung, dieser habe keine schädlichen Absichten, war übertrieben, eher hoffte ich, dass es so war. «Was er im Sinn hat, weiss ich nicht, aber es sieht bisher nicht so aus, als würden wir irgendwie hineingezogen.»
Lukas schnaubte durch den Hörer. «Deinen Optimismus möchte ich haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns der Polizei ausliefert.»
«Das hätte er längst tun können», wandte ich ein. «Dass es bis jetzt nicht passiert ist, deutet darauf hin, dass er es auch nicht tun wird.»
«Träum weiter.» Lukas schimpfte und jammerte noch etwas, bevor ich ihn davon überzeugen konnte, dass ich auf der Baustelle gebraucht wurde.
Einige Wochen vorher
Bettina
Als Bettina im Pausenraum sass, gesellte sich Luana, ihre jüngere Arbeitskollegin, zu ihr.
«Madame Catillaz scheint einen Narren an dir gefressen zu haben», bemerkte sie.
«Ja, es scheint so», stimmte Bettina zu. Tatsächlich hatte Madame seit der Rückerstattung der irrtümlichen Überweisung auf das Konto von Pro Pfauenziege immer nach ihr persönlich verlangt. Mittlerweile war der April angebrochen, Madames besondere Vorliebe jedoch unverändert geblieben.
«Womit beschäftigt sie sich denn jetzt?» Luana schaute sie neugierig an. Die hartnäckige Kundin war nicht nur auf der Bank bekannt, auch manche Geschäfte oder Amtsstellen hatten einschlägige Erfahrungen gemacht.
Bettina runzelte die Stirn. «Diesmal hatte sie in der Tat ein seltsames Problem.»
«Erzähl!», forderte die Kollegin sie auf.
Die beiden Frauen sassen allein am Tisch. Bettina zögerte, entschied dann aber, der Mitarbeiterin von der Sache zu berichten.
Luana war sofort Feuer und Flamme. «Eigenartig. Sehr eigenartig!», fand sie. «Wir müssen herausfinden, wie das möglich ist. Das will ich wissen!» Eilig trank sie ihren Kaffee aus. «Komm!»
«Jetzt?» Bettina bereute es bereits, nicht den Mund gehalten zu haben. «Meine Pause ist fast vorbei, in drei Minuten muss ich wieder nach oben.»
«Du hast doch keinen Schalterdienst», meinte Luana ungeduldig. «Zehn Minuten liegen drin, um ein wenig zu recherchieren. Das ist im Interesse der Bank», fügte sie hinzu, was Bettina schliesslich überzeugte.
Sie blieb nicht zehn Minuten, sondern eine halbe Stunde an Luanas Schreibtisch sitzen. Deren Finger flogen über die Tastatur, riefen Kundendaten, Kontodaten und immer wieder Google auf. Schliesslich lehnte sie sich zurück, nur um sofort aufzuspringen und die Tür zuzuziehen, bevor sie sich wieder in den Bürostuhl fallen liess.
«Wenn du mich fragst», begann sie, «wurde das Konto von Pro Pfauenziege für andere Zwecke als jene des Vereins verwendet. Hohe Beträge wurden auf das Konto überwiesen und umgehend an verschiedene Bau- und Handwerksbetriebe weitergeleitet. Allerdings nicht die ganzen Beträge. Ein Teil davon blieb auf dem Konto.»
Bettina weigerte sich zu glauben, was die Nachforschungen nahelegten. Sie war weder fähig, den Blick vom Bildschirm abzuwenden, noch dazu, etwas zu sagen.
«Meiner Ansicht nach ist das ein Betrugsfall. Jemand hat von der Kundschaft höhere Beträge kassiert als die Firmen verlangten und diesen nur die geschuldeten Summen weitergeleitet. Das, was zu viel eingenommen wurde, überwies diese Person auf das Konto eines Kulturclubs, geführt von einer Regionalbank im Unterland.» Luana musterte die ältere Kollegin. «Oder hast du eine andere Erklärung?»
Langsam schüttelte Bettina den Kopf.
«Hallo!» Luana wedelte mit der Hand vor Bettinas Augen. «Hörst du mich? Stehst du unter Schock?» Sie lachte. «Ist doch spannend, was du hier entdeckt hast.»
«Spannend?», fragte Bettina verständnislos. «Diese Entdeckung ist eine Katastrophe.»
«Das nun nicht gerade», widersprach Luana. «Aber wir müssen genau überlegen, was wir jetzt tun.»
«Wir müssen das selbstverständlich melden. Der Ablauf ist in den internen Richtlinien genau geregelt.»
«Immer mit der Ruhe.» Luana schloss die Seiten, die sie aufgerufen hatte, und wandte sich vom Bildschirm ab. «Zuerst müssen wir einiges mehr wissen. Erst dann können wir entscheiden, wie wir vorgehen.»
«Für die Nachforschungen ist der Rechtsdienst zuständig», belehrte sie Bettina. «Wir müssen den Verdacht melden. Alles Weitere liegt in der Verantwortung spezieller Stellen auf der Bank.»
«Ein vager Verdacht ist zu wenig. Da braucht es etwas mehr Fleisch am Knochen.»
«Ein Verdacht reicht. Die Nachforschungen überlassen wir anderen.»
Luana rang ungeduldig die Hände. «Du hörst dich an wie ein ‹Rätschbäsa› im Kindergarten! Willst du die Person hinter dem Konto unbedingt anschwärzen, oder was?»
Bettina musterte sie streng.
«Ist ja gut», beeilte sich Luana zu beschwichtigen. «Im Ernst: Wir müssen mehr wissen. Gib mir etwas Zeit zum Recherchieren, die Angelegenheit eilt ja nicht. Erst, wenn ich mehr weiss, bin ich bereit, die Hebel in Bewegung zu setzen.» Demonstrativ verschränkte sie die Arme.
Bettina gab sich geschlagen. Eile war wirklich nicht geboten, soweit musste sie Luana recht geben.
Es dauerte fast drei Wochen, bis Luana auf Bettina zukam und sie auf das sonderbare Konto ansprach. «Wir sollten das nicht hier besprechen», meinte sie. «Besser treffen wir uns am Abend nach der Arbeit.»
Bettina zögerte. «Aber ein Restaurant ist auch ungeeignet. Kommst du mit zu mir?»
«Ja, klar», stimmte Luana sofort zu. «Wir nehmen auf dem Weg einen Döner mit, einverstanden?» Die Antwort wartete sie nicht ab, und Bettinas wenig begeisterte Miene ignorierte sie.
Der Nachmittag verlief ruhig, sie konnten pünktlich Feierabend machen. Im winzigen Imbisstreff entschied sich Bettina für Falafel, weil ihr das nicht allzu fettig erschien. Luana hingegen wollte einen Döner mit allem, scherzte mit der Bedienung und freute sich den ganzen Weg zu Bettinas Wohnung auf ihr Abendessen.
«Hübsch hier», sagte sie, als sie sich dort umschaute. Der Raum war behaglich eingerichtet, üppig mit Pflanzen ausgestattet und verfügte über einen grossen Balkon mit Sicht über die Dächer der tiefer am Hang gelegenen Häuser und zu den Bergketten auf der anderen Talseite.
«Danke.» Bettina bedeutete Luana, Platz zu nehmen. Während ihr Gast die Speisen auspackte, holte sie zwei Gläser und einen Krug Wasser.
«Was hast du entdeckt?», fragte sie, nachdem sie sich an den Tisch gesetzt hatte.
«Pfauenziegen gibt es tatsächlich», antwortete Luana grinsend.
Bettina blickte sie irritiert an.
«Sie sind ziemlich gross, schwarz-weiss, robust und sogenannte Gebirgsziegen. Früher wurden sie recht zahlreich gehalten, später waren es allerdings nur noch wenige.»
«Spielt das eine Rolle?»





























