
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Susan Ryeland ermittelt
- Sprache: Deutsch
Susan Ryeland, Lektorin außer Dienst ist nach London zurückgekehrt. Sie arbeitet jetzt für einen kleinen Verlag, und auf ihrem Tisch ist das Manuskript eines jungen Autors namens Eliot Crace gelandet: Atticus Pünds letzter Fall. Die Geschichte handelt vom überraschenden Tod der schwerreichen Lady Chalfont, die anscheinend von einem Familienmitglied vergiftet wurde.
Zu Susans Überraschung stellt sich heraus, dass Eliot Crace der Enkel der weltberühmten Kinderbuchautorin Miriam Crace ist, die 15 Jahre zuvor verstarb – ermordet, vergiftet, wie Eliot behauptet. Je weiter Susan in die Story eintaucht, desto klarer wird ihr, dass Eliot in Atticus Pünds letzter Fall die Geschichte seiner eigenen Familie und des Todes seiner Großmutter erzählt. Zugleich verhält er sich immer merkwürdiger, wird zunehmend aggressiv – und dann wird er bei einem Unfall mit Fahrerflucht getötet. War es Mord? Plötzlich ist Susan die Hauptverdächtige, und erschrocken wird ihr klar, dass sie das selber aufklären muss, um nicht das nächste Opfer zu werden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Anthony Horowitz
Tod zur Teestunde
Roman
Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Marble Hall Murders bei Penguin Random House UK, London.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
Erste Auflage 2025Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025Copyright © Anthony Horowitz 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung des Originalumschlags von Penguin House UK, Illustration : Sinem Erkas, London
eISBN 978-3-458-78449-4
www.insel-verlag.de
Widmung
Für Leander und Cosima. Ich hoffe, eines Tages werdet ihr dieses Buch lesen.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Ein neuer Anfang
Fortsetzung folgt
Gedanken
von Eliot Crace
:
PÜNDS LETZTER FALL
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
Das erste Anagramm
Eliot Crace
Alte Freunde
Parsons Green
Großmutter
Marble Hall
Doktor Lambert
Der Miriam-Crace-Estate
Roland Crace
TEIL ZWEI
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
Das zweite Anagramm
Boon’s
Front Row
Die Party
Der Morgen danach
Causton Books
Der Mann mit dem weißen Haar
Neue Beweise
Leylah Crace
Hellmarsh
Killer
DI
Blakeney
Die Uhr
Alexandra Palace
Special Delivery
DAS LETZTE KAPITEL
Das dritte Anagramm
Ein freundlicher Rat
Erklärungen
Zurück nach Marble Hall
Ein Jahr später
Danksagung
Informationen zum Buch
Tod zur Teestunde
Ein neuer Anfang
Ein Happy End? Gibt es das überhaupt?
Wenn ich an die Bücher denke, die ich in meinem Leben so richtig geliebt habe, dann war es immer das letzte Kapitel, das die Geschichte für mich abgerundet hat. Ich erinnere mich noch gut an die Erleichterung, die ich als junges Mädchen empfunden habe, wenn Black Beauty endlich in Birtwick Park in Sicherheit war, oder wenn Mary und Colin fröhlich in ihrem geheimen Garten gespielt haben. Später habe ich heftig mitgefiebert, bis Emma schließlich gemerkt hat, dass sie Mr Knightley liebt, und genauso ging es mir, als Jane Eyre ihren erstgeborenen Sohn von Mr Rochester in den Armen hielt.
Glücklich bis an ihr Lebensende? Aber natürlich waren sie das! Das war doch gar keine Frage. Es war diese Gewissheit, was meine Liebe zur Literatur nährte. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass Mary und Colin womöglich erwachsen werden, sich streiten oder gar trennen könnten. Und schon gar nicht, dass Black Beauty am Ende genauso beim Abdecker landen würde wie Boxer in Animal Farm. Wie lange hatte es wohl gedauert, bis Emma wieder in ihre alten Gewohnheiten zurückfiel oder Mr Rochester frustriert war, weil er als Behinderter von Jane gepflegt werden musste?
Das Schöne an der Erzählkunst ist, dass die Handlung, ganz unabhängig von all den vielen Verwicklungen am Ende so sicher ihr Ziel findet. Selbst wenn die Hauptfigur stirbt, begreift man, dass es genau so kommen musste, und findet Trost darin. »Es lässt sich nicht ändern – und deshalb muss es so sein«, hätte Hardy gesagt.
Das wirkliche Leben, mit all seinen Problemen, Zwischentönen und krummen Wegen, verläuft nie so, und im 21. Jahrhundert schon gar nicht. Üble Typen florieren. Gute Leute gehen pleite. Wenn man die Zeitungen liest oder sich in den sozialen Medien umsieht, gewinnt man den Eindruck, dass es keinerlei Gerechtigkeit auf der Welt gibt und kein Mensch je glücklich wird.
Ich hatte gedacht, Andreas und ich würden für immer zusammen sein. Ich liebte ihn, und obwohl ich ihn manchmal hätte erwürgen können, dachte ich wirklich, dass ich mit Kreta klarkommen würde und mich der Ägäis, den Olivenhainen, dem Bimmeln der Ziegenglöckchen, den herrlichen Sonnenuntergängen und den festlichen Abendmahlzeiten an langen Tischen unter der Bougainvillea ganz hingeben könnte. Das war mein persönliches Happy End – oder wäre es gewesen, wenn mein Leben ein Buch wäre.
Aber irgendwie war Kreta nie richtig meins. Ich hätte es da eine Woche, einen Monat oder ein Jahr sehr gut ausgehalten … aber mein ganzes Leben? Ich sah die alten, schwarz gekleideten Frauen vor ihren Häusern sitzen und fragte mich: Soll ich irgendwann auch so werden? Mittwochs der Markttag, die Olivenernte Ende Oktober, die Namenstage mit Keksen und Kuchen und immer dem gleichen Feuerwerk. Das war ich nun mal nicht. Es gab Tage, an denen ich die Landschaft geradezu hasste, weil sie mich gefangen hielt, und ich fragte mich, wie viel Leben ich auf der anderen Seite Europas verpasste. Ich war auf einer Insel. Jeden Morgen ging ich schwimmen im glitzernden blauen Meer, aber wenn ich zurückkam, hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass ich nicht weit genug geschwommen war.
Allen Krisen zum Trotz war das Hotel Polydoros, das Andreas gekauft und ich mit zum Laufen gebracht hatte, ein Riesenerfolg geworden. Wir waren die ganze Saison hindurch ausgebucht, die schattige Terrasse mit Meerblick war Tag und Nacht rappelvoll, und Andreas überlegte schon, ob er nicht am Ammoudi Beach auf der anderen Seite von Agios Nikolaos ein zweites Objekt kaufen sollte. Das interessierte auch seinen Cousin und Geschäftspartner Yannis sehr, und die beiden waren seitdem unzertrennlich … was ebenfalls dazu führte, dass ich mich als Außenseiterin fühlte. Ich arbeitete jetzt als freie Lektorin für einen neuen Verlag, Causton Books, und betreute eine Serie von sehr guten skandinavischen Kriminalromanen. Machte es wirklich Sinn, hier auf dem Balkon meines Schlafzimmers zu sitzen, Korrekturen und Kommentare per E-Mail zu schicken und Gespräche per Zoom zu führen? Was sollte das? Mein Kopf war in London, und mein Herz war auch nicht länger auf Kreta.
Oje! Das alles klingt wie ein Klagelied, aber das soll es gar nicht sein. Ich will bloß erklären, warum ich ein bisschen genug vom Strand und vom Sonnenschein hatte und wieder nach Hause wollte. Andreas fuhr mich zum Flughafen, und obwohl wir uns vor der Abflughalle noch einmal innig umarmten, wussten wir beide, dass die Entscheidung richtig war. Wir würden immer Freunde sein, aber wir waren nicht länger verliebt. Jedenfalls nicht ineinander. Während der Flieger auf die vorgesehene Höhe von zehntausend Metern stieg, dachte ich an die gute Zeit, die wir zusammen gehabt hatten. Und als die Erinnerung an all die schönen Dinge, die wir miteinander erlebt hatten, zurückblieb wie ein Kondensstreifen, zerriss es mir beinah das Herz. Aber ich wusste, es musste sein. Ich war fünfundfünfzig und musste von vorne anfangen.
Natürlich ging ich wieder zurück nach Crouch End, im Norden von London. Dort hatte ich gewohnt, als wir uns kennengelernt hatten, und ich habe mich dort immer wohlgefühlt. Ich kannte eine Menge Leute da, und wenn ich meine Schwester Katie in Suffolk besuchen wollte, war es nicht weit zur A 12. Meine alte Wohnung hatte ich verkauft, um Andreas zu helfen, als er das Hotel übernahm, aber er hatte mir alles mit Zinsen zurückgezahlt. Meine Ersparnisse packte ich obendrauf, und dieses Eigenkapital überzeugte die Bank, mir eine halbwegs günstige Hypothek zu geben, als ich mir eine neue Wohnung ausgesucht hatte. Sie lag ein Stück weiter unten am Hang als meine alte Wohnung, im Souterrain, aber sie war gar nicht übel. Sie hatte zwei Zimmer, von denen ich eins als Arbeitszimmer nutzen konnte. Das Bad war winzig, aber die Wohnküche war gemütlich und recht groß. Das Beste aber war der kleine Garten. Die Natursteinplatten auf der Terrasse, eine efeubewachsene Mauer und der idyllische Rasenfleck mit den seitlichen Büschen gaben einem das Gefühl, irgendwie auf dem Lande zu leben. Eine wacklige alte Brettertür in der Mauer schloss meinen geheimen Garten von der Straße ab. Es gab sogar einen kleinen Teich mit zwei Goldfischen, die ich Hero und Leander taufte.
Die nächsten drei Monate zischten vorbei. Ich war gerade rechtzeitig zum Frühjahrsschlussverkauf eingetroffen und ging erst mal auf Shoppingtour. Dazu gehörten auch ein paar Möbel und Einrichtungsgegenstände, Geschirr, Töpfe, Gläser, Pfannen – einschließlich einer neuen Spüle. Ich fand sogar ein paar Handwerker, die mir die Wände strichen und ein komplett neues Bad einbauten. Für mich selbst kaufte ich eine neue Garderobe, denn von den Sachen, die ich auf Kreta getragen hatte, konnte ich in London nichts brauchen. Anschließend verliebte ich mich in einen antiken Kleiderschrank, in den ich das alles hineinhängen konnte. Ich rangelte mit Elektrikern und Spenglern und musste stundenlang am Telefon warten, bis ein Versicherungsagent oder Internetanbieter geruhte, mit mir zu reden. Das Schönste war, dass ich meinen alten MGB-Roadster retten konnte, den zu verkaufen ich mich nie hatte entschließen können, weil ich schon ahnte, dass ich ihn irgendwann noch mal brauchen würde. Aber erst als ich ihn aus seiner absurd teuren Unterkunft in King’s Cross geholt hatte und am Highgate Hill fröhlich an einem Streifenwagen vorbeisauste, wurde mir klar, wie vernünftig es gewesen war, dass ich ihn behalten hatte. Er gehörte ganz einfach zu meinem Leben.
Ich besuchte alte Freunde, ging zu ein paar Buchpremieren und erklärte aller Welt, dass ich jetzt für immer in London sei. Ich fuhr nach Suffolk raus und besuchte Katie, die inzwischen geschieden war und in einem neuen, kleineren Haus wohnte. Ihr derzeitiger Freund war ein Typ aus dem Gartencenter, wo sie arbeitete, und ich hatte sie schon lange nicht mehr so zuversichtlich und glücklich erlebt. Sie hatte mich überredet, einen Kater zu adoptieren, obwohl ich eigentlich keinen wollte. Ich habe ihn auch bloß genommen, weil die Leute im Tierheim gesagt haben, er würde die Goldfische in meinem Garten nicht fressen. Ich fing an, James Joyce zu lesen, was ich schon immer tun wollte, seit ich die Uni verlassen hatte. Aber vor allem redigierte ich fleißig. Ein paar Absätze mit entscheidenden Informationen musste ich umstellen, aber ansonsten war auch der dritte Fall von Politisjefinspectør Heidi Gundersen von der norwegischen Kriminalpolizei ein absoluter Triumph.
An einem Montagmorgen im Juni wachte ich auf, weil die Sonne ins Zimmer strahlte und Hugo (der Kater) mich von dem Sessel in der Ecke aus streng beäugte, den er zu seinem Daueraufenthaltsort gemacht hatte. Ich las erst einmal zwanzig Seiten von den Dubliners, überflog die Schlagzeilen der Zeitungen auf meinem iPad, dann duschte ich gemütlich und frühstückte. Das war die Tageszeit, zu der ich Andreas immer vermisste. Allein aufzustehen war eigenartigerweise viel deprimierender, als allein schlafen zu gehen. Ich setzte Wasser auf und griff gerade nach den Kaffeebohnen, als mein Handy sich meldete.
Es war Michael Flynn, der Verleger von Causton Books, also genau genommen mein Chef. Ich kannte ihn bloß von unseren Gesprächen auf Zoom, aber ich hatte eine klare Vorstellung von seinem runden Gesicht, seinem dünnen Haar und der Brille, die an einer Schnur um seinen Hals hing, weil er sie ständig verlegte, wie er mir erklärt hatte. Meistens trug er ein Jackett und eine Krawatte, aber untenrum hätte er ohne Weiteres nackt sein können, wenn wir zoomten. Das konnte ich ja nicht sehen. Ich wusste nicht mal, ob er Beine hatte.
»Wie geht’s Ihnen?«, fragte er. Ich hatte ihm gesagt, dass ich wieder in London war, aber wir hatten seit meiner Rückkehr nur ein paar Mal telefoniert.
»Danke, sehr gut«, sagte ich.
»Und was macht das neue Haus?«
»Es ist nur eine Wohnung. Aber ich bin sehr zufrieden.«
»Freut mich zu hören. Ja, also – ich weiß, das kommt etwas plötzlich, aber könnten Sie heute reinkommen?«
»Haben Sie das Gundersen-Manuskript gekriegt, das ich Ihnen geschickt habe?«
»Ja, alles in Ordnung. Sehr schön. Aber da ist etwas anderes aufgetaucht, und dafür sind Sie genau die Richtige.«
»Können Sie es mir schicken?«
Am anderen Ende entstand eine Pause. »So einfach ist das nicht. Ich glaube, wir müssen reden. Wenn Sie gegen Mittag da sind, können wir zusammen essen gehen.«
»Das klingt ja spannend, Michael. Ich bin um zwölf bei Ihnen. Wollen Sie mir nicht einen kleinen Tipp geben, worum es geht?«
Eine weitere kleine Pause.
»Atticus Pünd«, sagte er und legte auf.
Fortsetzung folgt
Die Büros von Causton Books lagen in einem modernen Hochhaus am Rand von Victoria, einer Gegend, die keine unmittelbar literarischen Assoziationen weckt. Der Verlag verfügte dort über vier Stockwerke. Der Eingang erinnerte an einen Flughafen, im Erdgeschoss gab es eine Cafeteria, und die Aufzüge verlangten eine Schlüsselkarte. Auf der Glaswand hinter dem Empfangsbereich flackerten wechselnde Buchcover, aber die Bücher selbst waren nirgends zu sehen. Wieder einmal wurde mir bewusst, dass die besten Zeiten meiner Karriere schon eine Weile zurücklagen. Die Zeiten der unabhängigen Verleger in alten, gediegenen Stadthäusern mit geschwungenen Erkerfenstern und einer soliden schwarzgestrichenen Holztür waren dahin. Elf Jahre hatte ich bei Cloverleaf gearbeitet und hatte mich an die schmalen Korridore mit schlechter Beleuchtung und die versteckten Büros gewöhnt, die umso schwerer zu finden waren, je höher der Bewohner in der Hierarchie des Verlags stand. Erst als ich hilflos am Boden gelegen hatte, während die Flammen alles verschlangen, war mir klar geworden, dass Holzpaneele, staubige Teppiche und dicke Vorhänge, so schön sie auch waren, ein gewisses Risiko für Menschen darstellten, die mit Manuskripten und Büchern umgingen. Großraumbüros mit feuerfesten Schreibtischen, gläsernen Raumteilern und stimmungsaufhellenden Lampen wären für T.S. Eliot oder Somerset Maugham wohl schwer erträglich gewesen, aber zumindest brachten sie einen nicht um.
Wie auch immer, was Verlage unterscheidet sind nicht die Büromöbel, sondern die Menschen. Und als ich kurz vor zwölf an den Empfangstisch von Causton Books trat, begrüßte mich Jeanette, die mich noch nie gesehen hatte, aber offenbar wusste, dass ich erwartet wurde, wie eine alte Freundin. Ich fühlte mich augenblicklich zu Hause. Sie versorgte mich mit dem unvermeidlichen Besucherausweis, öffnete die Sicherheitsschleuse und programmierte den Aufzug, damit er mich zum richtigen Stockwerk brachte.
Michael Flynn erwartete mich im vierten Stock. Er trug diesmal keine Krawatte, aber er hatte Beine und die steckten in langen Hosen. Obwohl wir uns noch nie persönlich begegnet waren, waren wir ja gut miteinander bekannt. Wir schwankten also zwischen einem Händedruck und der etwas moderneren Umarmung mit Küsschen und entschlossen uns schließlich zur letzteren. Als wir das hinter uns hatten, führte er mich einen Gang hinunter, der auf der linken Seite mit Bücherregalen geschmückt war. Rechts saßen zahlreiche Menschen mit Jeans, T-Shirts und abgewinkelten weißen Stöpseln in beiden Ohren. Sie waren alle mindestens zwanzig Jahre jünger als ich.
Er hatte ein Besprechungszimmer für uns reserviert, und wir saßen uns, umgeben von etlichen leeren Stühlen, an einem Tisch gegenüber, der für zwei viel zu groß war. Ich sah sofort, dass er ein dickes Manuskript vor sich liegen hatte. Der Titel und der Name des Autors waren von einem Notizblock verdeckt, wahrscheinlich absichtlich, wie ich vermutete. Das war also der Grund, weshalb er mich sehen wollte.
»Schön, dass Sie kommen konnten, Susan«, begann er. »Mögen Sie eine Tasse Kaffee?«
»Ja, gern.«
Die Kanne hatte vielleicht schon eine Stunde lang da gestanden, aber der Kaffee dampfte, als wäre er gerade erst aufgebrüht worden. Der richtige Michael Flynn gefiel mir noch besser als die Person auf dem Bildschirm. Er hatte eine gewisse stählerne Qualität, schließlich stand er weit oben in der Hierarchie in einem Unternehmen mit über hundert Mitarbeitern. Aber gleichzeitig war er zurückhaltender und vielleicht auch menschlicher, als er bei unseren Gesprächen erschienen war. Das ist das Blöde an Zoom: Es schickt einem Bilder und Töne, aber alles andere wird irgendwie abgesaugt.
»Wie ist es so, wieder in London zu sein?«, fragte er. Sein Tonfall war so knapp wie der eines Nachrichtensprechers der BBC im Krieg.
»Merkwürdig.«
»Ist das jetzt ein dauerhaftes Arrangement?«
»Ich glaube, ja.«
»Das wäre schön für den Verlag. Sie haben das toll gemacht, da unten auf Kreta. Aber wenn Sie jetzt hier sind, können wir noch mehr zusammen machen.«
»Heißt das, ich könnte Vollzeit bei Ihnen arbeiten?«, fragte ich. Als Freiberuflerin wurde ich nach Stunden oder nach Seiten bezahlt, aber es gab keinen Urlaub und keine Sozial- oder Krankenversicherung.
Michaels Augen verengten sich, und ich fragte mich, ob ich ihn mit meiner direkten Frage verärgert hatte. »Ich fürchte, eine feste Stelle gibt es derzeit nicht«, sagte er. »Aber wie ich am Telefon sagte, haben wir da ein Projekt – und wenn das gut läuft, können wir über alles reden.«
»Atticus Pünd«, sagte ich.
»Ja, genau.« Er hatte klargestellt, dass er hier das Sagen hatte und bestimmen würde, wie die Zusammenarbeit laufen sollte. »Wie Sie wissen, hat Orion die neun Romane übernommen, die Alan Conway geschrieben hat, und sie neu herausgebracht. Sie haben sich sehr gut verkauft, wenn man bedenkt, dass Conway öffentlich zugegeben hat, dass er weder seine Hauptfigur noch sein Publikum sonderlich schätzte.«
»Das ist milde ausgedrückt.«
»Nun ja.« Er warf mir einen mitfühlenden Blick zu. »Ich weiß, dass die Zusammenarbeit mit ihm gelegentlich etwas mühselig für Sie war.«
»Sie war noch schlimmer als das. Aber ich habe mich gefreut, dass die Bücher so ein großer Erfolg waren.«
Es war tatsächlich eigenartig, dass eine zufällige Begegnung vor über dreißig Jahren zu etwas geführt hatte, was nach allen buchhändlerischen Maßstäben eine Sensation war. Alan Conway war Englischlehrer an einer Schule gewesen, die mein Neffe und meine Nichte besuchten. Er war schon damals nicht sehr beliebt gewesen, was mich hätte warnen sollen. Zehnjährige wissen sehr gut, woher der Wind weht. Manchmal glaube ich, dass ihn Katie mir in der Hoffnung vorgestellt hat, ich würde ihn dazu bringen, den Lehrberuf aufzugeben.
Und das geschah ja auch. Ich habe sein Manuskript gelesen, und obwohl noch einiges daran zu tun war, wurde Atticus Pünd ermittelt vom Start weg ein Bestseller. Der Roman wurde zum Ausgangspunkt einer Serie, von der weltweit achtzehn Millionen Exemplare verkauft wurden, was Alan Conway zum reichen Mann machte. Die Übersetzungen in dreißig Sprachen waren dabei noch gar nicht mitgerechnet. Er erhielt verschiedene literarische Auszeichnungen, eine Silbermedaille und wurde Ehrenbürger von Heidelberg. Die Schule in Woodbridge hatte er verlassen und sich ein Herrenhaus in der Nähe von Framlingham gekauft, das er in Abbey Grange umbenannte. Das ist der Titel einer Sherlock-Holmes-Geschichte, was einiges über sein Selbstbewusstsein aussagte. Die BBC stand kurz davor, eine Serie mit dem Arbeitstitel Die Atticus-Abenteuer zu drehen, und Mads Mikkelsen sollte angeblich die Hauptrolle spielen – aber das war alles gecancelt worden, als Alan Conway plötzlich gestorben war, weil ihn jemand vom Aussichtsturm seines teuren Herrenhauses gestoßen hatte.
Alan hatte mich nie nach Abbey Grange eingeladen, aber wir waren ohnehin nicht die besten Freunde gewesen. Ich kenne genug Autoren, die ihren Lektoren nicht trauen, aber ich hatte noch nie einen kennengelernt, der so verbohrt war wie Alan. Jeder Vorschlag, den ich gemacht hatte, jede Streichung, jede Frage hatte sofort zum Streit geführt, aber ich bin erst später dahintergekommen, dass gar nicht ich es war, an der es lag. Es waren die Bücher. Er hatte das Gefühl, Bücher schreiben zu müssen, die er verachtete. Einfach gesagt: Er wollte Salman Rushdie sein und nicht Agatha Christie. Aber das hätte er niemals geschafft. Er war nun einmal der, der er war.
»Wie auch immer«, fuhr Michael fort. »Wir stehlen Orion gerade die Schau. Jemand hier im Haus hatte die Idee, einen neuen Atticus-Pünd-Roman schreiben zu lassen.«
»Ohne Alan«, sagte ich.
»Genau. Ein Sequel.« Er verhinderte, dass ich ihn unterbrach, indem er rasch weiterredete. »Bei James Bond und Sebastian Faulks hat das sehr gut funktioniert. Sie wissen ja sicher, dass The Devil May Care der schnellstverkaufte Roman damals war. Jedenfalls gleich nach Harry Potter … und solange Richard Osman noch nicht auf dem Markt war. Außerdem gibt’s ja auch die neuen Hercule-Poirot-Krimis, Sherlock-Holmes-Romane, Jeeves und Wooster, Per Anhalter durch die Galaxis …« Er lächelte. »Es ist doch so: Kein Mensch interessiert sich für Alan Conway, Atticus Pünd kommt sehr gut ohne ihn aus.«
Er hatte es ein bisschen schnöde formuliert, aber er hatte recht. Es ist erstaunlich, dass manche Figuren weit über ihre Autoren hinauswachsen, aber gerade die populäre Literatur ist voll von ihnen. Das war einer der Gründe, warum Conan Doyle sich entschlossen hat, Sherlock Holmes in die Reichenbachfälle zu schmeißen. Er hatte das Gefühl, dass seine wahren Talente von dem populären Privatdetektiv in den Schatten gestellt wurden. Sowohl A.A. Milne als auch sein Sohn Christopher Robin haben Pu den Bären gehasst, und Peter Pan hatte eine Spur hinterlassen, die von Leichen gepflastert war. Was haben Dracula, Mary Poppins, der Zauberer von Oz und Tarzan gemeinsam? Die halbe Welt kennt sie, aber nur die wenigsten kennen die Namen der Autoren, die sie erfunden haben.
»Wir haben uns vor einem halben Jahr an James Taylor gewandt«, sagte Michael. »Ich glaube, Sie kennen ihn. Er hat mit Alan zusammengelebt und das Haus, das Geld und die Rechte an seinen Büchern geerbt. Wir haben ihm ein Angebot für das Recht gemacht, drei neue Atticus-Pünd-Romane schreiben zu lassen. Ich wundere mich ein bisschen, dass Orion nicht darauf gekommen ist, aber wir konnten James überzeugen, dass wir es sowieso besser machen. Haben Sie die Umschläge für die Neuausgabe gesehen, die sie veranstaltet haben? So was von öde und langweilig! James ist das alles egal. Die Aufmachung und der Stil interessieren ihn nicht. Er interessiert sich nur dafür, was unter dem Strich für ihn bleibt. Wir haben ihm ein sehr großzügiges Angebot gemacht, und er ist auch als Berater an Bord. Er findet das alles großartig.«
Dass ich besonders überrascht gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Ich kannte James recht gut. Ich hatte ihn kennengelernt, als ich in Suffolk nach dem letzten Kapitel der Morde von Pye Hall suchte. Später hatte ich ihn noch mal getroffen, als ich nach Hinweisen auf einen Mord suchte, die angeblich in Atticus unterwegs versteckt waren. Mit zwanzig hatte James als Stricher in London gearbeitet. Er war Alan vorgestellt worden, der damals noch gar nicht wusste, dass er homoerotische Neigungen hatte. Er hatte Alan verführt und ihm geholfen, seine Sexualität zu akzeptieren. Für Alan war das bestimmt gut gewesen. Und für ihn selbst hatte es sich erst recht gelohnt. Er hatte in Abbey Grange gelebt und am Ende alles geerbt. James war frech, egoistisch, untreu, obszön und geschmacklos, aber ich muss zugeben, dass ich ihn mochte. Bei unserem letzten Treffen haben wir im Le Caprice gegessen, und er hat nicht nur die gesalzene Rechnung bezahlt, sondern mir auch noch den entscheidenden Hinweis auf den Mörder von Frank Parris und den Verbleib von Cecily Treherne gegeben. Ich hatte große Lust, ihn mal wieder zu sehen.
»Wir brauchen Alan Conway gar nicht«, beendete Michael seine Ausführungen über das neue Projekt.
»Das kann schon sein«, sagte ich. »Ich hätte sowieso nicht noch mal mit ihm arbeiten mögen. Aber trotzdem ist es nicht so einfach, seine Erfolge zu wiederholen. Seine Fälle waren schlau ausgedacht. Er hatte ein gutes Ohr für den Dialog, und seine Figuren haben mir auch gut gefallen. Ich gebe es nur ungern zu, aber er war ein fantastischer Schriftsteller … solange er nicht versuchte, in Literatur zu machen.« Ich warf einen Blick auf das Manuskript. Der Titel und der Name des Autors waren noch immer verdeckt. »Ich nehme an, das ist das neue Buch?«, sagte ich.
»Nur die ersten dreißigtausend Wörter. Wir sind noch am Anfang.«
»Aber Sie haben es für mich ausgedruckt.«
Das war so eine Art Witz zwischen uns. Ich bin ein bisschen altmodisch, und Michael wusste, dass ich gern auf Papier redigiere. Heutzutage wird ja alles am Bildschirm bearbeitet, aber ich finde, dass ein Ausdruck dem fertigen Buch nähersteht, ich mag den körperlichen Kontakt mit dem Manuskript, wenn ich Korrekturen und Vorschläge mache. Auch auf Kreta hatte ich mir einen klapprigen Drucker gekauft, der stundenlang brauchte, um einen Roman auszudrucken, ehe ich anfangen konnte zu arbeiten.
Michael lächelte. »Ja. Alles gut vorbereitet für Ihren Rotstift.«
»Verraten Sie mir jetzt auch noch, wer der Autor ist?«
»Ja, allerdings muss ich Sie bitten, das alles bis auf Weiteres vertraulich zu behandeln. Sie kennen ihn übrigens.« Er machte eine Pause. »Eliot Crace.«
Einen Moment lang war ich absolut sprachlos. Das war der letzte Name, den ich erwartet hätte.
»Sie haben ihn verlegt, als Sie bei Cloverleaf waren«, erinnerte Michael mich.
»Das stimmt nicht so ganz«, sagte ich. »Ich habe ihn höchstens zwei Mal gesehen. Charles hat ihn vorgeschlagen und auch persönlich betreut. Ich habe gar nicht mit ihm gearbeitet.«
»Haben Sie ihn gemocht?«
»Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, war er betrunken. Das zweite Mal war er mit Blut bedeckt. Er sei vom Bus gefallen, hat er gesagt.«
»Ja. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es eine gute Idee war, ihm den Auftrag zu geben. Aber er hat einen guten Namen. Ein Teil Ihrer Aufgabe wird sein, den Mann an der kurzen Leine zu führen. Das Buch ist in vielerlei Hinsicht sehr wichtig für uns, und wir wollen nicht, dass er von der Piste abkommt. Aber ich hoffe ohnehin, dass seine Tage als bad boy inzwischen vorbei sind. Er war ja gerade mal zwanzig, als Sie ihn kennengelernt haben, oder? Inzwischen ist er verheiratet, und ich denke, er ist jetzt ein bisschen gesetzter.«
»Wie schreibt er denn so?«
»Ja, genau das möchte ich gerne von Ihnen hören.« Er schenkte sich noch einen Kaffee ein. »Sie verstehen viel mehr von Krimis als ich. Was ich bisher gelesen habe, hat mir gefallen. Es klingt fast genau wie das Original. Ich glaube, das hat er gut hingekriegt.«
»Wann spielt der Roman denn?« Im letzten Buch hatte man bei Atticus Pünd einen Gehirntumor festgestellt, und er hatte nicht mehr lange zu leben.
»Er setzt dort an, wo Die Morde von Pye Hall enden.«
»Dann darf die Lücke aber nicht groß sein.«
»Ist sie nicht. Atticus Pünd trifft eine alte Bekannte, die ihn nach Südfrankreich einlädt. Sie heißt Lady Chalfont …«
Der Name war mir vertraut. Sie war eine Figur aus Gin & Zyankali, dem vierten Buch in der Serie.
»Sie erzählt ihm, sie habe von einem finsteren Plan gehört und habe große Angst um ihr Leben. Dann wird sie tatsächlich ermordet. Ihre Familie ist ziemlich grässlich, aber der Hauptverdächtige ist ihr zweiter Ehemann. Ich dachte mir, Sie lesen sich alles mal durch und dann helfen Sie Eliot, die Sache zu Ende zu schreiben. Das Buch soll ins nächste Frühjahrsprogramm, gleich Anfang des Jahres.«
Es gehört zu den Grundprinzipien unseres Gewerbes, dass die Termine immer zu eng sind und man nie genug Zeit hat. Ich rechnete. »Das ist knapp«, sagte ich.
»Eliot hat ein bisschen spät angefangen.«
Ich muss wohl etwas verzweifelt geschaut haben, denn er fügte hastig hinzu: »Es war nicht seine Schuld. Wir hatten bestimmte Vorstellungen, und er hat ein bisschen gebraucht, das alles zu ordnen.« Wieder lächelte er, und ich hatte das Gefühl, dass er sein Lächeln an- und ausknipste wie eine Glühbirne. »Als ich gehört habe, dass Sie nach London zurückkommen, dachte ich, das ist die ideale Paarung. Sie haben Alan Conway ja schließlich entdeckt, Susan. Sie sind mit seinem Stil bestens vertraut und kennen die Tricks, die er benutzt hat. Ich sage nicht, dass dieses Manuskript schon perfekt ist, aber mit Ihrem Input könnte es ein schöner Erfolg werden. Jeder liebt Atticus Pünd, und Eliot hat einen klangvollen Namen … Ich glaube wirklich, das könnte ein Bestseller werden.«
»Die beiden Bücher, die Eliot bei Cloverleaf hatte, haben nicht so richtig funktioniert«, erklärte ich vorsichtig. Normalerweise sage ich so etwas nicht, aber ich hatte gute Gründe, mich von diesem Projekt fernzuhalten.
»Ich habe sie sehr gern gelesen«, behauptete Michael. »Vielleicht war das Marketing nicht so optimal.«
»Wir haben getan, was wir konnten.« Ich ärgerte mich über seine Kritik, aber ich versuchte es nicht zu zeigen. »In Ordnung«, sagte ich. »Ich werde es lesen und melde mich dann. Wo wohnt Eliot jetzt?«
»West London. Notting Hill. Übrigens hab ich ihm gesagt, dass ich mit Ihnen reden will, und er hat sich sehr gefreut. Er erinnert sich noch, dass er Sie von Cloverleaf kennt, und er weiß auch, was Sie für Alan Conway getan haben.«
»Das ist sehr nett von ihm.« Ich warf einen weiteren Blick auf das Manuskript. »Darf ich den Titel sehen?«, fragte ich.
»Ja, natürlich.« Er drehte den Papierstapel zu mir herum und nahm den Notizblock weg. Da stand es, schwarz auf weiß.
PÜNDS LETZTER FALL Von Eliot Crace
Das zehnte Buch in einer Neun-Buch-Serie. »Ein Anagrammp«, sagte ich.
»Wie bitte?«
Das war ein privater Witz, und ich hatte keine Lust, es ihm zu erklären.
Gedanken
Alan Conway hatte es gehasst, Kriminalromane zu schreiben, deshalb hatte er Spielchen mit seinen Leserinnen und Lesern getrieben: Er versteckte Rätsel in seinen Büchern. Die Erwähnung von Lady Chalfont hatte mich daran erinnert, dass alle Figuren in Gin & Zyankali nach Londoner U-Bahn-Stationen benannt waren. Lady Chalfont kam von der Metropolitan Line, aber es hatte auch einen Butler namens Hillingdon, Adam und Artemis Perivale und einen Kriminalbeamten gegeben, der Stockwell hieß. Fehlte bloß noch Lord Edgware.
Und dann diese Buchstabenspiele: Anagramme, Akrosticha, Kryptogramme und Codes. Damit dekonstruierte er seine Bücher. Statt sich an der Handlung und den Figuren zu freuen, musste sich der Leser mit den Bausteinen befassen, aus denen sie zusammengesetzt waren: den Buchstaben. Das war eine der Ursachen, die meine Arbeit als Alans Lektorin so lästig gemacht hatte. Wenn man ihn bat, irgendein irrelevantes Detail zu entfernen oder einen Satz umzustellen, weil er sich komisch anhörte, schrie er Zeter und Mordio. Erst allmählich kam ich dahinter, dass es »Geheimnisse« in den Büchern gab, die zwar kein Leser je finden oder vermissen würde, die aber für den Autor der Hauptspaß waren.
So hatte Alan ein Riesentheater gemacht, weil der Verleger von Cloverleaf sein erstes Buch Die Morde von Pye Hall genannt hat. Erst später sind wir dahintergekommen, dass die Anfangsbuchstaben der Titel das Wort ANAGRAMM ergeben sollten, und da passte das »D« überhaupt nicht. Alan würde sich im Grab herumdrehen, wenn er wüsste, dass jetzt Pünds letzter Fall kommen sollte. Denn ein »P« passte genauso wenig zu seinem Humor.
Nach meiner Besprechung mit Michael Flynn fuhr ich auf dem schnellsten Weg nach Crouch End zurück. Er hatte noch angeboten, mit mir zum Lunch zu gehen, aber ich hatte ihm nichts weiter zu sagen, und ich wollte längst in Ruhe nachdenken. Das Manuskript hatte ich bei mir, aber ich war noch nicht so weit, es zu lesen. Im Grunde wollte ich den Job gar nicht machen, so sehr ich das Geld auch brauchte.
Es fing schon mal damit an, dass ich Sequels nicht mochte. Schon der Name war mir zuwider. Ich mag historische Romane, Liebesromane und Science-Fiction. Alle enthalten sie etwas vom Wesen der Autorin oder des Autors und zeigen, was sie bewegt. Aber wer will schon einfach die Ideen von jemand anderem fortsetzen? Was hat das für einen Sinn?
Ich erinnere mich noch daran, wie das anfing. Sebastian Faulks hat die Lunte in Brand gesetzt. Sein James-Bond-Roman war ein großer Erfolg, und plötzlich wollte jeder Verleger einen bekannten Autor mit einer beliebten Figur verkuppeln und damit schnelles Geld machen. Ich erinnere mich noch, wie mir jemand vorschlug, Val McDermid ein Sequel zu Jekyll und Hyde schreiben zu lassen. Niemand hatte sie je auf so etwas angesprochen. Wenn sie Ja gesagt hätte, wäre ich begeistert gewesen, aber sie war nicht interessiert. Und das bestärkte mich in meiner Skepsis gegenüber dem Genre. Wenn man die Originalität wegnimmt, was bleibt dann noch von einem Roman?
Aber meine Ablehnung gegen das Projekt saß noch tiefer. Alan Conway hatte mir vom ersten Tag an bloß Ärger gemacht. Ich hatte gedacht, seine Romane dienten der Unterhaltung, aber wie sich herausstellte, waren sie eher Granaten, gespickt voll mit Bösartigkeit und in der Absicht abgefeuert, so viel Schaden anzurichten wie möglich.
Das fing damit an, dass er Leute, die er kannte, in seinen Romanen verarbeitete. Das machen viele Autoren. Charles Dickens bezog einige seiner berühmtesten Figuren aus dem wirklichen Leben – Bill Sikes, Mr Micawber, Fagin, Scrooge und noch andere. Aber Alan karikierte und verzerrte Menschen, die ihm sehr nahestanden. Seine Schwester wurde eine eifersüchtige alte Jungfer, sein Liebhaber war plötzlich ein völliger Dummkopf und einer seiner Schüler ein pädophiler Gärtner. Es war eine hässliche Sache und führte sogar zum Tod einer jungen Frau, die in einer seiner Figuren einen wirklichen Mörder erkannt hatte. Zweimal war ich herangezogen worden, um die Scherben einzusammeln, und beide Male war ich dem Tod nur um Haaresbreite entkommen. Ich hatte keine Lust, mein Glück noch ein drittes Mal zu versuchen.
Ich war aus alledem ja nicht unbeschädigt hervorgegangen. Ich hatte meinen Arbeitsplatz verloren, als der Verlag abbrannte und ich mittendrin war. Mein Augenlicht hatte gelitten, sodass ich nur noch stundenweise lesen konnte, was nicht nur mein Beruf, sondern auch mein größtes Vergnügen war. Was fast noch schlimmer war: Sämtliche wohlanständigen Londoner Verlage hatten mir den Rücken zugekehrt, weil sie dachten, ich sei an allem schuld. Niemand wollte mir eine feste Anstellung geben und mir war gar nichts anderes übrig geblieben, als meine Wohnung zu verkaufen und nach Kreta zu gehen, ein Abenteuer, das auch nicht so glücklich geendet hatte.
Insgesamt wäre ich besser dran gewesen, wenn ich nie mit Alan Conway zu tun gehabt hätte. Auch jetzt sollte ich besser die Finger von diesem Projekt lassen. Es war eigentlich unglaublich, dass Michael Flynn sich diesen neuen Roman in den Kopf gesetzt hatte und mich in die Sache verwickeln wollte. Es war wie diese endlosen Horror-Serien, bei denen jeder Film eine neue Ziffer hinter dem Titel hatte, fünf, sechs oder sieben, aber die unglückliche Heldin, obwohl sie ihren Namen geändert und eine Therapie durchgemacht hat, am anderen Ende der Welt immer noch von demselben Irren mit dem langen Messer durch düstere Korridore gejagt wird.
Warum lag dann dieses Manuskript trotzdem bei mir auf dem Küchentisch? Warum hatte ich es aus dem Verlag mitgenommen? Die Antwort befand sich direkt vor meinen Augen. Ich hatte eine Hypothek aufgenommen, die monatlich abgezahlt werden musste, und sogar der Stuhl, auf dem ich saß, belastete noch meine Kreditkarte. Ich brauchte das Geld, so einfach war das. Und Causton Books war der einzige Verlag in ganz London, der mir eine Festanstellung zumindest vage in Aussicht gestellt hatte. Michael Flynn hatte gesagt, nach diesem Projekt würde man weitersehen. Wenn ich es abgelehnt hätte, wäre da nichts mehr zu sehen gewesen.
Ich hatte das Manuskript nicht mal aus meiner Tasche genommen, als ich damit in der U-Bahn saß. Jetzt starrte ich auf das Deckblatt, und dachte: Der Titel muss anders werden. Die Hauptperson hieß Atticus Pünd oder Atticus. Pünd allein – das war viel zu abrupt. Ich war mir auch nicht sicher, ob ihm seine Fans gern nach Südfrankreich folgen würden, wenn er kurz vor dem Exitus stand. Unheilbarer Krebs ist kein wirklicher Publikumsliebling. Außerdem hatte Michael gesagt, dass er drei neue Bücher bestellt habe, und das hieß, dass Eliot Crace sich mindestens noch zwei weitere Fälle ausdenken musste. Im letzten Band würde der arme Atticus nur noch im Bett liegen und hilflos am Tropf hängen.
Es war zwei Uhr nachmittags, noch viel zu früh für Alkohol, aber ich ging zum Kühlschrank und schenkte mir ein Glas Wein ein. Dann nahm ich mir noch ein bisschen Grünzeug und Hüttenkäse, um klarzustellen, dass es sich bloß um ein spätes Mittagessen handelte. Sobald die Kühlschranktür aufging, war auch der Kater erschienen und hatte sich, sehr zu meinem Missbehagen, an meinen Beinen gerieben. Eine Frau in den Fünfzigern, die nachmittags allein in ihrer Wohnung im Erdgeschoss hockt, geht noch in Ordnung, aber sobald man eine Katze dazutut, wird es ein Klischee. Ich biss in eine Stange Sellerie und streckte dem Kater die Zunge raus.
Ich musste zugeben, dass es ein kluger Schachzug von Michael war, dass er sich Eliot Crace für den Job geholt hatte. Eliot war der Enkel einer sehr bekannten englischen Autorin von Weltgeltung, neben der sich sogar Alan Conway bescheiden ausnahm. Miriam Crace hatte nie Kriminalromane geschrieben, aber das war genau das, worauf Michael abzielte: ein berühmter Name ohne den direkten Vergleich. Niemand sollte sagen: »Die Großmutter schreibt aber besser!«
Miriam hatte dreiundsechzig Kinderbücher in dreiundsechzig Jahren geschrieben. Sie war die Verfasserin der heißgeliebten Little People, einer fast unendlichen Serie über eine Familie von Gutmenschen, die leider nur zwei Zoll groß waren (in späteren Ausgaben waren daraus sehr zum Ärger der Autorin »fünf Zentimeter« geworden). Vor einigen Jahren hatte eine Befragung ergeben, dass in ungefähr 95 Prozent aller britischen Haushalte mindestens eins ihrer Bücher vorhanden war und vierzig Prozent sogar zehn oder mehr hatten. Weltweit hatte sie eine Milliarde Bücher verkauft. Damit war sie zwar nicht ins Guinness Buch der Rekorde gekommen, aber auflagenmäßig hatte sie es übertroffen. Das Wort little war jetzt in 47 Sprachen geläufig. Miriam hatte nämlich durchgesetzt, dass der Familienname nicht übersetzt werden durfte. Es gab also keine Petits Gens oder Små Menneskene, sondern immer nur Little People. Die Hälfte aller Kinder auf dem Planeten war mit Opa Little, Oma Little, Herrn und Frau Little, Harry, Jack, Jasmine und Rose Little aufgewachsen, die in den Neunzigerjahren noch durch Karim und Njinga Little ergänzt wurden, die natürlich nur adoptiert worden waren.
Obwohl sie unendlich beliebt und weltweit bekannt war, wusste niemand etwas über das Privatleben von Miriam Crace. Sie war Gegenstand von zwei Biografien geworden, aber sie hatte mit den Autorinnen eng zusammengearbeitet, und war dementsprechend zur Heiligen deklariert worden. Es hatte jemand auch noch eine dritte, unautorisierte Biografie in Auftrag gegeben, die angeblich einige dunkle Geheimnisse enthalten sollte, aber der Crace-Estate hatte ein Team von knallharten Anwälten, die mit Strafandrohungen dafür gesorgt hatten, dass dieses Machwerk nie erschienen war.
Interviews hatte Miriam nur sehr widerwillig gegeben, und nur wenn es darum ging, ein neues Buch vorzustellen oder Spenden für das St-Ambrose-Waisenhaus in Salisbury oder den Miriam-Crace- Libraries-Trust einzuwerben. Sie kam aus einer religiösen Familie – ihr Vater war katholischer Diakon gewesen – und hatte sich immer zum Glauben bekannt. Das war auch der Grund, weshalb sie sich von ihrem Mann, Kenneth Rivers, nie hatte scheiden lassen. (Ähnlich wie Lady Chalfont hatte sie nie den Namen ihres Gemahls angenommen und auch ihren Kindern bedeutet, dass sie das unterlassen sollten.) Es hatte Gerüchte gegeben, dass ihre Ehe nicht sonderlich glücklich gewesen war, und tatsächlich hatte sich das Paar mal ein Jahr getrennt. 1955 hatte sie – aufgrund von Überarbeitung, wie ihre Biografinnen versichern – einen Nervenzusammenbruch erlitten und sich sechs Monate lang in einer privaten Klinik in Lausanne erholt, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Nach ihrer Rückkehr im selben Jahr hatte sie Marble Hall gekauft, einen Herrensitz in Wiltshire, zu dem fünfzig Morgen Land gehörten. Zum Zeitpunkt ihres Todes, achtundvierzig Jahre später, hatte sie immer noch dort gewohnt, zusammen mit Kenneth, ihren beiden Söhnen und deren Frauen und vier Enkelkindern. Heute war Marble Hall ein Museum und Sitz der Miriam-Crace-Stiftung.
Im Buchhandel war sie immer noch eine sehr begehrte Autorin, von der jedes Jahr ein paar Millionen Bücher verkauft wurden. Sehr zum Ärger zeitgenössischer Autorinnen und Autoren, die fanden, dass sie allmählich genug Erfolg gehabt hatte. Der von ihrem älteren Sohn Jonathan geleitete Miriam-Crace-Estate war jedenfalls ein größeres Unternehmen, in dem es immer etwas zu tun gab. So waren die Little People seit Neuestem auch als Graphic Novels zu haben, ITV hatte eine Zeichentrick-Fernsehserie daraus gemacht, im Bridge Theatre lief seit Jahren ein Little People-Musical, die Geschichten waren schon dreimal fürs Kino verfilmt worden, die Universal Studios hatten sich ihrer angenommen, und es gab ein Riesenangebot von Fan-Artikeln, zu dem Little People-Briefpapier, Puppen, Plüschtiere, Keksdosen, Brettspiele, Computerspiele, Uhren, Kalender und Kinderkleidung gehörten. Kürzlich war bekannt geworden, dass Netflix zweihundert Millionen Dollar für die Fernsehrechte geboten hatte und eine neue Serie mit fünf Staffeln drehen wollte. Den Deal hatte Jonathan Crace abgeschlossen, der Onkel meines künftigen Autors.
Eliot Crace hatte ich ein paarmal gesehen, wenn er zu Cloverleaf Books kam. Ich erinnerte mich an einen sehr gutaussehenden jungen Mann mit langen Haaren und einem Elfengesicht. Seine Erscheinung war die eines Engels. Er hatte den ganzen Charme und das Selbstvertrauen, die ein reiches Elternhaus und eine Privatschulerziehung hervorbringen, obwohl sie leider auch ein bisschen Arroganz mit sich gebracht hatten. Er schien es immer irgendwie eilig zu haben, redete etwas zu schnell und wechselte ständig das Thema, ehe er aufsprang, zum nächsten offenen Fenster rannte und sich eine Zigarette ansteckte.
Wie ich Michael gesagt hatte, war es Charles Clover, der ihn als Autor entdeckt und die beiden Kriminalromane betreut hatte, die bei uns erschienen waren. Allerdings war es eine Untertreibung, als ich sagte, sie seien kein großer Erfolg gewesen. Sie hatten im Lager gelegen wie Blei. Eliot war kein schlechter Stilist, aber bei der Wahl der Hauptfigur hatte er keine glückliche Hand gezeigt: Sein Ermittler war ein zeitreisender Alchemist aus dem elisabethanischen Zeitalter, der ins 21. Jahrhundert versetzt worden war. Seine Bücher waren zwischen zu viele Stühle gefallen. Man wusste nicht, ob sie für Erwachsene oder für Teenager waren, real oder Fantasy, und ob man lachen oder weinen sollte. Das Publikum war genauso unentschlossen wie die beiden Romane. Charles kannte Eliot seit seiner Kindheit. Er war deshalb sehr empört, als ich erklärte, wir sollten keinen dritten Doctor-Gee-Roman machen, aber schließlich musste er einsehen, dass es keinen Sinn hatte, Bücher zu drucken, die niemand lesen wollte. Außerdem war Eliot ein Risikofaktor: ständig high, betrunken oder von Antidepressiva beflügelt hing er auf Partys herum, und man wusste nie, was er anstellen würde. Charles war fest überzeugt, dass er ein erfolgreicher Schriftsteller werden würde, sobald er erwachsen wurde, und sagte ihm, dass die Tür bei Cloverleaf Books immer offen sein würde. Aber Eliot kam nie zurück.
Und jetzt tauchte er wieder auf. Ich fragte mich, wo ihn Michael Flynn aufgespürt hatte, und wie er überhaupt auf die Idee gekommen war, nach ihm zu suchen. Plötzlich bedauerte ich, dass ich nicht mit ihm zum Essen gegangen war.
Stattdessen trug ich jetzt meinen Teller und das Glas Wein zum Tisch und setzte mich vor das Manuskript. Ich würde es also lesen. Ich hatte an diesem Nachmittag sowieso nichts anderes zu tun, und vielleicht war es ja ganz interessant, wie sich Atticus Pünd bei einem anderen Autor entwickelte.
Was konnte es letzten Endes schon schaden?
PÜNDS LETZTER FALL
von Eliot Crace
PERSONEN
Atticus PündDer Detektiv
James FraserSein Assistent
DIE FAMILIE
Lady Margaret ChalfontDie reiche Witwe von Henry Chalfont, dem 6ten Earl Chalfont
Jeffrey ChalfontSohn von Henry und Margaret Chalfont, jetzt 7er Earl Chalfont
Lola ChalfontSängerin und Schauspielerin, mit Jeffrey Chalfont verheiratet
Cedric ChalfontJeffrey und Lolas achtjähriger Sohn
Judith LyttletonTochter von Henry und Margaret Chalfont
Harry LyttletonMit Judith verheiratet. Bauunternehmer
Robert WaysmithEinziger Sohn von Elmer Waysmith aus erster Ehe
ANDERE
Frédéric VoltairePolizeibeamter der Sûreté
Béatrice LaurentHaushälterin im Château Belmar in Cap Ferrat
Estelle DuboisDirectrice der Werner-Waysmith Kunstgalerie
Jean LambertRechtsanwalt mit einer Kanzlei in Saint-Paul-de-Vence
Alice CarlingSeine Assistentin
Harlan ScottPrivatdetektiv
Hector BrunelleApotheker in Nizza
Dr. BensonArzt in der Harley Street
EINS
London, 1955
Der Regen peitschte herab, kalter grauer Regen, der die Bürgersteige glitschig machte, gegen die Fenster hämmerte und in immer größer werdende Pfützen spuckte. Regen tropfte aus den Dachrinnen und drang in das Mauerwerk ein. Es fühlte sich an, als hätte es den ganzen Mai geregnet, und obwohl der Juni vor der Tür stand, gab es kein Entkommen. Alle waren schlecht gelaunt, wenn sie, noch in ihren Wintermänteln, auf dem Bürgersteig an einem vorbeihuschten. Eigentlich sollte der Sommer längst da sein, aber es war, als hätte ihn der Regen vertrieben.
Atticus Pünd ging die Harley Street hinunter, die Hände in den Taschen, zog den Trenchcoat näher an seinen Körper heran und versuchte, den Regen abzuhalten. Er hatte diesen Weg seit dem Schock der schlimmen Diagnose vor sechs Wochen schon mehrmals zurückgelegt, und er war überrascht, wie schnell ihm alles vertraut geworden war, sogar die Gewissheit des eigenen Todes.
Er hatte einen Gehirntumor. Dagegen war nichts zu machen, und in nur wenigen Monaten würde die Geschwulst ihn töten. Der Besuch beim Arzt war kaum mehr als eine Formalität. Dr. Benson würde ihn untersuchen, ein paar Fragen über sein körperliches Befinden, seinen Schlaf, seinen Appetit und seinen Gemütszustand stellen und ihn dann mit einem Lächeln und ein paar Worten des Trostes wieder nach Hause schicken. Die beiden hatten eine eigenartige Beziehung entwickelt, eine Art Einverständnis zwischen Arzt und Patient. Sie waren Partner in einem Prozess, an dem weder der eine noch der andere etwas zu ändern vermochte, der universell war, jenseits ihres Verstehens.
Dr. Bensons Praxis befand sich im Hochparterre eines mehrstöckigen, schmalen Gebäudes, das genauso aussah wie seine Nachbarn auf beiden Seiten. Vor fünfzehn Jahren hatte es noch ein Gitter gegeben, das es vom Bürgersteig trennte, aber das war zusammen mit anderem altem Eisen als Schrott in die Rüstung gewandert. Pünd erinnerte sich nur allzu gut an die Zeiten, als die Welt zerrissen wurde und Millionen Menschen gestorben waren. Er selbst hatte damals in einem KZ gesessen, und es war nicht geplant, ihn überleben zu lassen. Selbst als Dr. Benson ihm die Krebs-Diagnose gestellt hatte, betrachtete Pünd sich noch immer als einen glücklichen Menschen. Er hatte nie erwartet, überhaupt so lange zu leben.
Er erreichte die Haustür und klingelte. Fast sofort wurde sie von einer jungen Frau geöffnet, deren Gesicht ihm inzwischen vertraut war, deren Namen ihm aber niemand gesagt hatte. Sie war die Rezeptionistin. Sie kannte jeden Patienten, der mal in der Praxis gewesen war, und erinnerte sich auch an diejenigen, die nicht wiederkamen.
»Mr Pünd«, sagte sie mit einem Lächeln, das vermuten ließ, dass sie beide entzückt waren, dass er vor der Tür stand. »Ist das nicht ein scheußlicher Sommer? Kommen Sie rein!«
Sie führte ihn in das Wartezimmer mit seinen Flocktapeten, antiken Stehlampen und dem Mahagonitisch, auf dem die üblichen Zeitschriften lagen: Country Life, Reader’s Digest und Punch, von denen allerdings keine ganz aktuell war. Vier Ärzte teilten sich das Gebäude und alle hatten Patienten, die zur gleichen Zeit eintrafen. Pünd erkannte einen ausländisch aussehenden Mann, der in der Ecke saß. Seiner aufrechten Haltung nach musste er ein ehemaliger Offizier sein. Und richtig, einen Augenblick später kam eine Sprechstundenhilfe im weißen Kittel und rief: »Major Alcázar …«
Der Mann erhob sich steif und folgte ihr hinaus. Pünd setzte sich auf ein Sofa und griff nach einer der Zeitschriften, nicht weil er sie lesen wollte, sondern weil er die beiden anderen Anwesenden daran hindern wollte, ein Gespräch anzufangen. Wahllos schlug er die Illustrierte auf und warf einen Blick auf das Bild eines Herrenhauses in Wiltshire. Es erinnerte ihn an den Fall, den er gerade in Saxby-on-Avon gelöst hatte. Wahrscheinlich sein letzter Fall.
Draußen, im Korridor, hörte er eine Frau sprechen, schrill und jederzeit bereit, einen Streit anzufangen – eine Stimme, die es gewohnt war, dass man ihr gehorchte.
»Ich glaube, ich hab ihn im Wartezimmer gelassen. Er ist mir wohl aus der Handtasche gefallen.«
Pünd hatte die Stimme schon erkannt, bevor Lady Chalfont im Türrahmen stand. Sie war einfach nicht zu verkennen. Sie sprach so, wie sie ihr Leben lebte: gebieterisch und fest entschlossen, auf keinen Fall übersehen zu werden. Die Person, die jetzt vor ihm stand, war ein winziger Vogel von einer Frau, die sogar noch zu schrumpfen schien, als sie hereinkam, aber mit jedem Zentimeter ihres Wesens dagegen ankämpfte. Sie war Mitte sechzig, aber ihre Krankheit hatte sie um zehn Jahre älter gemacht. Ihr silbern und bläulich gefärbtes Haar war sorgfältig frisiert, damit man nicht sah, wie dünn es geworden war, und sie hatte sich bewusst in leuchtende Farben gekleidet, mit einer grünen Jacke, einer kastanienbraunen Pluderhose und einem exotischen Stirnband, dem nur noch die Feder fehlte, aber das alles konnte nicht ihren schlechten Gesundheitszustand verbergen. In der einen Hand hielt sie eine Gucci-Clutch, in der anderen einen einzelnen Handschuh.
Als sie das Wartezimmer betrat, suchte sie bereits aufmerksam nach dem anderen. Dabei huschte ihr Blick zu dem Sofa, auf das Pünd sich gesetzt hatte, und man sah, wie sich ihr Gesichtsausdruck veränderte, als sie ihn bemerkte.
»Mein lieber Mr Pünd! Was für eine Überraschung. Sie wären der Letzte gewesen, den zu treffen ich hier erwartet hätte. Sind Sie krank?«
Diese Direktheit war typisch für sie. Pünd erhob sich. »Ich warte hier auf den Arzt«, sagte er unverbindlich.
»Ach, die haben doch keine Ahnung!« Lady Chalfont stieß einen Seufzer aus. »Sie schauen einem in die Augen und sagen, nehmen Sie diese und jene Pille, dann werden Sie wieder gesund, aber das stimmt nicht. Richtig gesund wird man nie. Wenn der Sensenmann kommt, sitzen die Ärzte bloß da und verstecken sich hinter ihren Fremdworten, Krankenakten und Röntgenbildern. Alles bloß Quacksalber!«
»Sie scheinen genauso munter wie immer zu sein, Lady Chalfont.«
»Das täuscht, Mr Pünd. Wie auch immer. Nichts ist höher zu schätzen als der Wert des Tages, sagt Goethe. Und nichts hat diesen Tag mehr aufgeheitert, als Sie hier zu treffen.«
Pünd lächelte. Margaret Chalfont hatte er vor neun Jahren in Salisbury kennengelernt, wo sie eine der Hauptverdächtigen im Mordfall Colindale gewesen war. George Colindale war auf einer Silvesterparty vergiftet worden, zu der sie beide eingeladen waren. Damals war sie seit einem Jahr Witwe gewesen. Ihr Ehemann – Henry Chalfont, der 6te Earl Chalfont – war in den letzten Kriegsmonaten beim Einschlag einer V-2-Rakete von herabfallenden Trümmern getroffen worden. Pünd erinnerte sich, dass es einen Sohn und eine Tochter gegeben hatte, die beide verheiratet waren, und später hatte er in der Times gelesen, dass es inzwischen auch einen Enkel gab. Er hatte Lady Chalfont auf Anhieb gemocht. Sie konnte laut und direkt sein, aber sie war auch kultiviert und meinte es gut. Außerdem war sie die Einzige, die auf der Party etwas gesehen hatte, was Pünd zur Lösung des Falles verhalf.
Dass sie sich gerade jetzt und hier getroffen hatten, schien ihm auf eigenartige Weise bedeutsam, und er fragte sich verlegen, was er als Nächstes sagen sollte, als sein Blick auf etwas fiel, das er sofort bemerkt hatte, als er das Zimmer betrat, aber bisher ignoriert hatte. Er bückte sich abrupt und zog einen einzelnen Kalbslederhandschuh unter dem Sofa hervor, auf dem er gesessen hatte. Nur die Fingerspitzen waren zu sehen gewesen.
»Ist es das, was Sie gesucht haben?«, fragte er.
Lady Chalfont nahm ihn mit einem strahlenden Lächeln entgegen. »Sie sind wirklich ein Schatz, Mr Pünd. Ihnen entgeht nie etwas, oder?«
Sie wollte gerade weiterreden, als sich die Tür hinter ihr öffnete und eine junge Frau in den Raum kam. Sie war keine Sprechstundenhilfe und wohl auch keine Patientin. Sie schien mit der Situation nicht sehr glücklich zu sein und hatte es offenbar eilig, schnell wieder wegzukommen. Sie war deutlich substanzieller als Lady Chalfont und hatte das Gesicht einer Frau, die sich sehr ernst nahm. Ihr nahezu farbloses Haar war zu einem Knoten zusammengebunden, und sie trug eine dicke Brille. Ihre Kleidung war, wie auch ihr Benehmen, sehr praktisch und sachlich. Sie hätte Gefängniswärterin sein können, wie sie da in ihren klobigen Schuhen stand.
»Hast du ihn gefunden, Mutter?«, fragte sie ungeduldig und hielt plötzlich inne, als sie merkte, dass ihre Mutter im Gespräch mit jemandem war. Pünd verneigte sich leicht. Die beiden waren also verwandt! Man sagte, dass Lady Chalfont in ihrer Jugend eine große Schönheit gewesen war, aber ihre Tochter sah ihr kein bisschen ähnlich.
»Nein, Judith. Dieser Herr hat ihn für mich gefunden. Wir sind alte Freunde. Das ist Atticus Pünd. Ich bin sicher, du hast schon von ihm gehört. Ich habe oft genug von ihm erzählt. Er ist der beste Detektiv der Welt.« Sie drehte sich zu Pünd um und sagte ohne Atem zu holen: »Darf ich Ihnen meine Tochter vorstellen? Judith Lyttleton heißt sie jetzt. Sie hat mich herbegleitet.«
»Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Mrs Lyttleton«, sagte Pünd.
»Eigentlich Doktor Lyttleton«, erwiderte Judith, weniger beleidigt als ungeduldig, weil sie das offenbar ständig klarstellen musste. »Ich habe am University College in London Ethnologie studiert und eine ganze Reihe von Artikeln über Peru geschrieben. Vielleicht haben Sie sie gelesen?«
»Ich fürchte, nein.«
Judith nickte enttäuscht, aber nicht überrascht. »Wir sollten uns jetzt wirklich auf den Weg machen, Mutter. Wir müssen noch die Koffer abholen, bevor wir zum Flughafen fahren.«
»Wir fliegen nach Südfrankreich«, erklärte mir Lady Chalfont. »Ich verbringe jeden Sommer dort. Mein erster Mann hat vor vielen Jahren ein Haus da gekauft, und ich liebe die Côte d’Azur. Wissen Sie eigentlich, dass ich wieder geheiratet habe?«
»Nein«, sagte Pünd.
»Technisch gesehen bin ich jetzt Margaret Waysmith, aber ich habe meinen alten Namen behalten. Ich mag es, Lady Chalfont zu sein. Warum sollte ich meinen Titel aufgeben?«
Sie hatte jetzt beide Handschuhe an, und ihre Tochter wartete. Aber irgendetwas hielt Lady Chalfont zurück. »Eigenartig, dass ich Ihnen heute begegnet bin«, sagte sie plötzlich. »Es ist etwas passiert, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde.«
»Mutter …«, rief Judith ungeduldig.
»Du brauchst mich gar nicht zu hetzen, Schatz. Wir haben jede Menge Zeit. Der Flieger geht erst in drei Stunden.« Sie musterte Pünd mit hellen und wachen Augen. Man sah förmlich, wie ihr Verstand arbeitete, als sie ihre Entscheidung traf. »Ich möchte mich mit Ihnen in einer Angelegenheit von größter Dringlichkeit beraten«, sagte sie. »Sind Sie immer noch an derselben Adresse zu finden?«
»Ich fürchte, dass ich keine neuen Fälle mehr annehmen kann, Lady Chalfont.«
»Egal. Ich werde Ihnen trotzdem schreiben. Ich glaube, alles, was passiert, hat einen Sinn, und der Himmel oder sonst irgendwer hat Sie aus einem bestimmten Grund hergeschickt. Wir sollten uns treffen. Tatsache ist, dass mir in der Not niemand so helfen könnte wie Sie. Sind Sie so nett und geben mir Ihre Karte?«
Pünd zögerte, dann zog er eine Visitenkarte heraus und überreichte sie ihr. Sie warf einen Blick darauf und steckte sie in ihre Handtasche. »Vielen Dank, Mr Pünd. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gut es mir tut, dass es jemanden gibt, dem ich vertrauen und an den ich glauben kann. Selbst wenn Sie sonst nichts mehr für mich tun können, wäre ich sehr dankbar für Ihren Rat.«
Judith Lyttleton sah irritierter aus denn je. Sie warf ihrer Mutter einen Blick zu, und für einen Moment schienen ihre Blicke sich zu verhaken. War es eine unausgesprochene Warnung? Dann stürmten beide hinaus. Pünd hörte, wie sich die Haustür öffnete und dann ins Schloss fiel.
Die Sprechstundenhilfe erschien wieder. »Herr Doktor Benson lässt bitten«, sagte sie zu Pünd.
Sie führte ihn durch den Korridor, der ihm sehr vertraut war, und durch die Tür am anderen Ende. Dr. Benson wartete schon. Er saß hinter dem Ordinationstisch in seinem Sprechzimmer, dessen Heizkörper wie immer viel zu hoch aufgedreht waren. Die Untersuchung mit dem fatalen Ergebnis lag jetzt sechs Wochen zurück, und das Treffen verlief routinemäßig und sachlich. Dr. Benson zählte die Pulsschläge seines Patienten, maß den Blutdruck, hörte sein Herz ab und untersuchte die Augen.
Dann kamen die Fragen. »Wie geht es den Kopfschmerzen?«
»Sie kommen zwar immer wieder, aber nicht zu oft. Die Tabletten, die Sie mir verschrieben haben, wirken sehr gut.«
»Können Sie schlafen?«
»Ja, danke.«
»Appetit?«
»Ich esse weniger. Aber ich glaube, das tue ich freiwillig. Mein Assistent hat mir sogar ein Kompliment gemacht. Er sagt, ich sei viel schlanker geworden.«
»Haben Sie es ihm schon gesagt?«
Pünd schüttelte den Kopf. »Er weiß, dass es mir nicht gut geht. Er hat auch die Medikamente gesehen. Aber vom ganzen Ernst der Lage habe ich ihm nichts gesagt.«
»Haben Sie Angst, dass er kündigt?«
»Nein, gar nicht. Aber James ist ein sensibler junger Mann. Ich glaube, es ist besser, ihm das Schlimmste zu ersparen. Er hilft mir ja auch bei dem Buch, das ich schreibe. Ich hoffe sehr, dass The Landscape of Criminal Investigation eines Tages seinen Platz in der British Library, im Criminal Records Office und überall sonst finden wird, wo es bei künftigen Ermittlungen helfen kann.«
Dr. Benson nickte und griff nach seiner Pfeife. Er zündete sie aber nicht an. »Nun, Mr Pünd, Sie machen das alles sehr gut. Viel besser, als ich erwartet hatte. Sie können mich jederzeit anrufen, aber ich glaube nicht, dass wir uns vor dem nächsten Monat wieder treffen müssen.«
Pünd lächelte. Er wusste, was es bedeutete, wenn Dr. Benson nach seiner Pfeife griff. Es war seine Art, das Gespräch zu beenden. Und der Griff nach der Pfeife sollte wohl Optimismus verbreiten. Nächste Woche. Nächsten Monat. Hauptsache, es gab eine Zukunft.
Aber Pünd rührte sich nicht von der Stelle. »Ich überlege gerade, ob ich Sie etwas fragen darf«, sagte er schließlich. »Vorhin, bevor ich in Ihr Sprechzimmer kam, habe ich eine alte Freundin getroffen, Lady Margaret Chalfont.«
»Die kennen Sie?«
»Ja. Wir haben uns vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit einem meiner Fälle kennengelernt. Es tat mir leid, sie hier zu sehen, und ich frage mich, ob Sie mir sagen können, wie es ihr geht.«
»Ich weiß nicht, ob ich Ihnen über den Zustand meiner Patienten Auskünfte geben soll, Mr Pünd. Warum fragen Sie?«
»Weil mich Lady Chalfont um Hilfe gebeten hat. Sie hat gesagt, es sei dringend. Und obwohl wir nur kurz gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, dass sie Angst hatte.«
»Angst zu sterben?«
»Vielleicht. Aber nicht wegen ihrer Erkrankung.«
Dr. Benson überlegte. »Nun, da Sie es sind, Mr Pünd, gehe ich davon aus, dass es nicht weiter schaden kann, wenn ich Ihnen sage, dass Lady Chalfont an einer Mitralstenose leidet. Dabei handelt es sich um eine Verengung der Klappe, die den Blutfluss zum Herzen regelt. Leider musste ich ihr heute mitteilen, dass ich angesichts ihres fortgeschrittenen Alters nicht glaube, dass eine Operation das Risiko wert ist. Ich fürchte, sie hat nur noch eine begrenzte Zeit.«
»Wie begrenzt ungefähr?«
»Schwer zu sagen. Eher Monate als Jahre.«
Pünd nickte. Es war typisch für Lady Chalfont, so auf die Ärzte zu schimpfen und die Medizin. Besonders, wenn man ihr gerade gesagt hatte, man könne nichts mehr für sie tun. »Danke, Dr. Benson.«
Pünd stand auf.
»Hat sie gefragt, ob Sie zu ihr nach Südfrankreich kommen?« fragte Benson.
»So weit ist sie nicht gegangen.«
»Schade. Ich habe gehört, dass sie eine sehr schöne Villa in Saint-Jean hat. Ich glaube, eine Woche in der Sonne würde Ihnen sehr guttun. Selbst den Gesündesten macht das schlechte Wetter hier zu schaffen.« Er blickte zum Fenster und zeigte auf das Wasser, das an den Scheiben herunterlief. »Ich habe noch nie so viel Regen gesehen. Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken!«
Pünd überlegte. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass er noch einmal reisen könnte, wenigstens nicht weiter als nach Saxby-on-Avon, wohin ihn sein letzter Fall geführt hatte. Aber warum nicht? Es wäre schön, noch einmal den warmen Sonnenschein auf der Haut zu spüren. Und da war noch etwas. Er dachte daran, wie sich Mutter und Tochter angeschaut hatten, bevor sie die Praxis verließen. Lady Chalfont hatte davon gesprochen, wie dringend sie Hilfe brauchte, aber es war ihre Tochter gewesen, die Pünds Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Von dem Augenblick an, als sie begriffen hatte, wer er war, hatte Judith zum Aufbruch gedrängt und versucht, ihre Mutter von ihm loszureißen. Sie hatte gehört, wie Lady Chalfont ihn um Hilfe bat, aber sie selbst hatte nichts dazu gesagt, so als ob es nichts mit ihr zu tun hätte. Der promovierten Ethnologin war das Zusammentreffen nicht nur unangenehm gewesen. Sie hatte Angst vor etwas gehabt.
ZWEI
Vier Tage waren vergangen, seit Atticus Pünd die Praxis in der Harley Street besucht hatte. In aller Frühe saß er in seinem Büro am Clerkenwell Square, um die letzten Seiten des Manuskripts durchzulesen, die James für ihn abgetippt hatte. Die Arbeit an seinem Buch, The Landscape of Criminal Investigations, war jetzt zum Hauptinhalt seiner Tage geworden, und da seine Krankheit langsamer fortschritt, als er zunächst befürchtet hatte, begann er zu glauben, dass es eine Chance gab, das Manuskript zu beenden, auch wenn er vielleicht nicht die Zeit haben würde, alle Tipp- und Rechtschreibfehler seines Assistenten zu korrigieren. Darum konnte sich schließlich auch der Verlag kümmern. Es war der Inhalt, der zählte.


![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
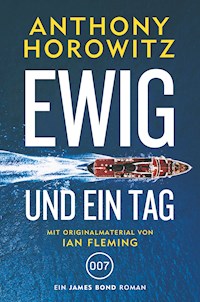
![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Mord stand nicht im Drehbuch. Hawthorne ermittelt [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/048a0a8d746eaaf2e78653d44c492732/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)









