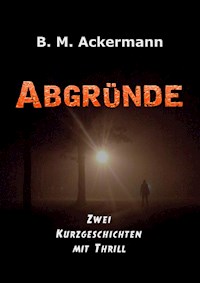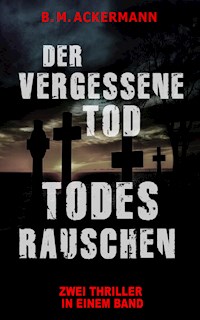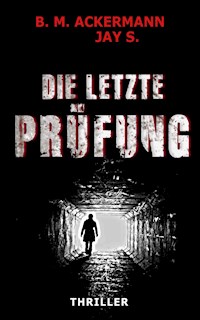Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ich weiß jetzt, was damals passiert ist. Bitte ruf mich an, bevor es zu spät ist!«, sind die letzten Worte, die Edward MacCarty an seinen Sohn Matt richtet. Danach bringt er sich um ... Doch Matt glaubt nicht an einen Selbstmord, denn sein Vater war etwas auf der Spur. Etwas tödlichem, etwas geheimnisvollem, etwas, das ihn womöglich das Leben gekostet hat. Aber was ist damals passiert? Hat es mit den blutigen Bildern zu tun, mit dem Mord, an den Matt sich zwar erinnert, den er sich selbst gegenüber jedoch leugnet und immer wieder verdrängt? Und was ist mit seinem Freund Paul passiert? Matt muss die Geheimnisse lüften und folgt den Spuren seines Vaters. Doch er hat nicht viel Zeit, denn der unbekannte Mörder könnte noch immer auf der Suche sein, auf der Suche nach neuen Opfern in den Wäldern über der amerikanischen Kleinstadt Coldmont.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
B. M. Ackermann
Todesrauschen
Thriller
Hinweis
Handlung und Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. Manche Städte und Orte in diesem Buch existieren tatsächlich, aber die Kleinstadt Coldmont ist der Fantasie des Autors entsprungen und sollte auf keiner Landkarte zu finden sein. Aber wer weiß ...
EINS
Ich stand an der Kante eines Daches und starrte in die Tiefe. Vierzehn Stockwerke unter mir blinkten blaue und rote Lichter wild durcheinander. Die hell erleuchtete Skyline von Pittsburgh ragte steil in den dunkelblauen Himmel, und zwischen den Wolkenkratzern schwebte der Vollmond, der an diesem Abend aussah wie ein Kürbiskopf an Halloween. Sein Grinsen entblößte schiefe Zähne mit Lücken dazwischen, und seine schräg stehenden Augen blickten vorwurfsvoll auf mich herab. Sie passten nicht zu der Knollennase, die sein Gesicht dominierte und doch erinnerte mich diese Fratze an jemanden aus meiner Vergangenheit. Oder bildete ich mir das nur ein?
»Matt, es ist nicht deine Schuld«, riss eine tiefe Stimme mich aus meinen Gedanken. Sie gehörte meinem väterlichen Freund und Boss Robert Stone, der plötzlich hinter mir stand. »Mach dir bitte keine Vorwürfe.«
Ich sagte nichts, fragte mich stattdessen, wie es sich wohl anfühlte, in diese Tiefe zu fallen. Spürte man den Schmerz, wenn man unten aufschlug?
»Hey, Matt, hörst du mir überhaupt zu?«, fragte Robert. »Du kannst nicht alle retten, das weißt du doch, oder?«
Natürlich wusste ich das, konnte mich aber trotzdem nicht damit abfinden. Als Sozialarbeiter schlug ich mich tagtäglich mit Jugendlichen herum, die auf der Straße lebten und Drogen konsumierten. Ihnen zu helfen war eine große Herausforderung, und normalerweise war ich gut in meinem Job. Dieses Mal allerdings hatte ich kläglich versagt.
Vor nicht einmal dreißig Minuten war einer meiner Schützlinge von diesem Dach gesprungen, weil er keinen anderen Ausweg sah. Nach einem heftigen Streit mit seinem Vater war der sechzehnjährige Junge von Zuhause ausgerissen, hatte ein paar Monate auf der Straße gelebt und mit Drogen herumexperimentiert. Ich führte lange Gespräche mit ihm, und er gab mir zu verstehen, dass er aus der Szene raus und wieder nach Hause wollte. Sein Vater jedoch schlug ihm die Tür vor der Nase zu, als der Junge ihn um Verzeihung bat. Ich fragte mich, ob der Mann sein Verhalten bereuen würde, wenn er seinen Sohn zu Grabe trug.
Wie auch immer. Der Junge war etwas Besonderes gewesen. In ihm hatte ich mich selbst wiedererkannt, weil ich in meiner Jugend Ähnliches durchgemacht hatte. Wäre Robert Stone nicht gewesen, würde ich heute nicht mehr leben. Robert hatte mir zu einem neuen Leben verholfen, ich diesem Jungen nicht. Und genau dieser Gedanke machte mir zu schaffen.
»Du solltest jetzt endlich von diesem Dach runter. Über die Treppe natürlich«, sagte Robert. »Sonst kriegst du Ärger mit den Cops. Oder meinst du, die wollen noch wen vom Bürgersteig kratzen?«
Seine Worte klangen härter als er sie normalerweise wählte, aber ich wusste, was er damit bezweckte. Sie sollten mich wachrütteln, verfehlten jedoch zunächst ihre Wirkung. Erst, als mir kurz schwindelig wurde, ich ins Wanken geriet und beinahe mit dem Kopf voran über die Brüstung stürzte, kam ich zur Besinnung.
Zum Glück reagierte Robert sofort. Er packte meinen Arm und zog mich vom Rand des Daches weg.
»Verdammte Scheiße, das war knapp«, fluchte er lautstark. »Bist du denn total übergeschnappt? Oder vielleicht lebensmüde?«
Ich gab ihm keine Antwort.
»Jetzt rede doch endlich mit mir, Matt. Oder führe ich hier Selbstgespräche? Komm zu dir, es ist vorbei, du kannst es nicht mehr ändern. Der Junge ist tot.«
Das saß. Endlich fand ich meine Sprache wieder. »Es tut mir leid, Rob. Ich habe versagt.«
Robert schüttelte den Kopf. »Nein, Matt, du hast nicht versagt, du hast dein Bestes gegeben, konntest dem Jungen aber nicht helfen. Er hat die Entscheidung getroffen, ganz egal, ob sie richtig war oder nicht. Verstehst du mich?«
Ich verstand ihn, abfinden konnte ich mich mit dem Selbstmord meines Schützlings aber trotzdem nicht.
»Komm schon, Matt, lass uns gehen, bevor die Cops das Dach stürmen und dich festnehmen«, drängte Robert. »Und das nur, weil du sie geärgert hast.«
Ich gab mich geschlagen und verließ von Robert gefolgt das Dach.
Nachdem der Lift uns nach unten gefahren, und wir ihn verlassen hatten, kamen uns im Erdgeschoss zwei Polizisten entgegen. Einer davon stellte mir ein paar Fragen, die ich ihm beantwortete, so gut es ging. Dann ließen sie mich gehen.
Als ich hinter Robert ins Freie trat, fuhr gerade der Leichenwagen davon. Die Polizei packte zusammen, die letzten Schaulustigen zogen ihrer Wege und gaben die Sicht frei auf eine dunkelrote Pfütze, die sich auf dem ansonsten trockenen Bürgersteig abzeichnete. Ich fühlte, wie mein Herz sich verkrampfte, und konnte den Blick kaum von der Stelle abwenden. Doch Robert packte meinen Arm und zerrte mich in die andere Richtung zu seinem Wagen, in den ich widerwillig einstieg.
Nach zwanzig Minuten Fahrt, in der wir kaum miteinander geredet hatten, parkte Robert sein Auto in zweiter Reihe vor einem vierstöckigen Backsteingebäude, das genauso aussah, wie alle anderen in diesem Wohnviertel, irgendwie abgewohnt und unpersönlich. Meine Wohnung befand sich in der dritten Etage, die einzige, in der noch kein Licht brannte.
Ein schrilles Hupen ließ mich aufschrecken, und ein Wagen raste mit quietschenden Reifen an uns vorbei. Der Fahrer streckte den Mittelfinger in die Höhe, doch Robert beachtete ihn nicht weiter und wandte sich stattdessen mir zu.
ZWEI
Am nächsten Morgen erzählte ich Amy, dass ich mich dazu entschlossen hätte, zur Beerdigung meines Vaters nach Coldmont zu fahren.
Sie sah mich skeptisch an. »Willst du das wirklich tun?«
»Ja. Wieso?«
»Ich frage mich, was du dir davon versprichst.« Sie strich Erdnussbutter aufs Brot, so dick wie Pappe und biss genüsslich hinein. Dabei ließ sie mich nicht aus den Augen.
»Ich verspreche mir gar nichts davon«, sagte ich. »Ich will es einfach tun. Würdest du es denn nicht tun wollen, wenn es dein Vater wäre?«
Sie warf mir einen gekränkten Blick zu, ließ ihr Brot auf den Teller fallen und stand ruckartig auf. »Das war jetzt nicht fair.« Sie drehte sich um und stapfte davon.
Sie hatte recht, das war alles andere als fair gewesen. Ich folgte ihr ins Schlafzimmer. »Tut mir leid. Manchmal bin ich ein Vollidiot.«
Sie drehte sich zu mir um und bedachte mich mit einem grimmigen Blick. »Nicht nur manchmal.«
»Gut, dass wir das geklärt haben.« Ich lächelte. »Und warum kommst du nicht einfach mit?«
Sie entspannte sich ein wenig und erwiderte mein Lächeln. »Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich habe heute Nachmittag einen wichtigen Termin vor Gericht. Sonst wäre ich liebend gerne mitgefahren.« Sie gab mir einen Kuss auf den Mund und verschwand im Badezimmer.
Ich seufzte. Amy war Rechtsanwältin und der Fall, an dem sie gerade arbeitete, war kurz vor dem Abschluss. Den Gerichtstermin durfte sie nicht verpassen. Das verstand ich, trotzdem hätte ich sie gerne dabei gehabt.
Wenig später verließen wir gemeinsam das Haus. Ich begleitete sie noch zur nächsten U-Bahn-Station wie jeden Morgen. Pendler strömten an uns vorbei, nahmen aber keinerlei Notiz von uns, als ich Amy mitten im Getümmel umarmte und küsste.
Minuten später löste sie sich zaghaft aus meiner Umklammerung und sah mich eine Weile an. Dann sagte sie: »Und du willst das wirklich durchziehen, Matt?«
»Ob ich es will? Weiß nicht. Ich muss es einfach tun. Wir haben das doch jetzt lange genug durchgekaut.« Ich musterte ihr Gesicht, blickte tief in ihre dunklen Augen, die mich sorgenvoll ansahen, und lächelte. »Du musst dir keine Sorgen machen. Außerdem komme ich so schnell wie möglich zurück. Du hast mich ruckzuck wieder an der Backe.«
Sie kaute auf ihrer Unterlippe, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Pass gut auf dich auf, ja?« Dann küsste sie mich, wand sich endgültig aus meinen Armen und ging winkend davon.
Ich sah ihr grübelnd nach und fragte mich, wie ich es die nächsten Tage ohne sie aushalten sollte, und warum sie so extrem besorgt war. Obwohl das vermutlich gar nichts zu bedeuten hatte. Wir benahmen uns manchmal wie Teenager, die das erste Mal verliebt waren. Die Schmetterlinge im Bauch wollten einfach keine Ruhe geben. Sie flogen auf und ab, immer wenn Amy in meiner Nähe war. Die Liebe zu ihr überwältigte mich jeden Tag aufs Neue.
Seufzend drehte ich mich um und machte mich auf den Weg zu meinem dunkelblauen Honda Civic. Der Wagen war beinahe zehn Jahre alt, hatte ein paar größere Kratzer, war aber ansonsten gut in Schuss. Ich stieg ein, ließ den Motor an und fuhr los.
***
Eine halbe Stunde später erreichte ich das Jugendwohnheim, das Robert Stone seit Jahren leitete, und betrat sein Büro. Ich zeigte ihm den Brief meines Vaters und erzählte ihm von dem Selbstmord. Daraufhin versank Robert noch tiefer in seinem Bürosessel als gewöhnlich. Jegliche Farbe wich aus seinem Gesicht. Er rieb sich über die Augen und senkte den Blick.
Ich saß ihm gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches und wunderte mich über seine heftige Reaktion. »Alles in Ordnung mit dir, Rob?«
Er sah auf. »Dein Vater ist tot? Das ist ja furchtbar.«
»Allerdings. Du wirst ein paar Tage auf mich verzichten müssen. Die Beerdigung ist Morgen, und ich will dabei sein.«
»Du willst nach Coldmont? Bist du verrückt?«, fuhr Robert mich an.
»Ja, ich will nach Coldmont. Und nein, ich bin nicht verrückt.« Ich besann mich einen Moment. »Ich weiß, dass ich geschworen habe, nie wieder in meine Heimat zurückzukehren. Aber da wusste ich ja noch nicht, dass mein Vater sich bei mir melden würde. Jetzt habe ich das Bedürfnis, mich von ihm zu verabschieden. Verstehst du das nicht?«
Robert beugte sich vor und sagte etwas ruhiger: »Es tut mir sehr leid, dass dein Vater gestorben ist, Matt. Und natürlich verstehe ich, dass du zu seiner Beerdigung willst.« Kurze Pause. »Und wie fühlst du dich jetzt?«
Ich zuckte die Achseln. »Es ist irgendwie seltsam. Ich habe meinen Vater in den letzten Jahren oft vermisst. Jetzt ist er tot, und ich fühle irgendwie gar nichts. Jedenfalls keine Trauer oder so. Ich bin eher schockiert darüber, dass er mir geschrieben hat. Meinst du, das ist normal? Hätte ich mich nicht darüber freuen sollen? Also, dass er mir schreibt, nicht, dass er tot ist.«
Seine Mundwinkel hoben sich ein wenig. »Du bist völlig normal, Matt, mach dir deswegen mal keine Sorgen. Was dein Vater getan hat, war nicht normal. Aber ich denke, er hatte seine Gründe.« Er erhob sich und blickte von oben auf mich herab. »Glaub mir, Väter tun manchmal die verrücktesten Dinge für ihre Kinder.«
Grübelnd stand ich auf und beobachtete Robert dabei, wie er seine Jacke vom Garderobenständer nahm und anzog. »Was willst du mir damit sagen, Rob? Dass es in Ordnung war, mich zu hassen?«
»Nein, um Himmels willen. Er hat dich bestimmt nicht gehasst, das kann ich mir nicht vorstellen.« Er seufzte und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat, nicht mehr mit dir zu reden. Vielleicht findest du die Antwort auf diese Frage in deiner Heimat, schon möglich. So wie ich seinen Brief deute, war es ihm sehr wichtig, dass du Kontakt mit ihm aufnimmst.«
»Genau so sehe ich das auch.«
»Du solltest gut auf dich aufpassen, wenn du in Coldmont angekommen bist«, fügte er hinzu.
»Machst du dir Sorgen um mich?«
Er kam auf mich zu und legte seine Hände auf meine Schultern.
»Ich sorge mich um alle meine Schützlinge. Um dich jedoch besonders. Du warst ein harter Brocken. Eine echte Herausforderung. Erinnerst du dich?«
»Oh ja, jeden Tag.«
Ich dachte daran, wie ich ihn kennenlernte. Weil mein Vater nichts mehr von mir wissen wollte, konnte ich nicht nach Hause zurück, bekam aber wenigstens diesen Platz in Roberts Wohnheim. Rob half mir dabei, meine inneren Dämonen zu bekämpfen und zu besiegen.
Er lächelte. »Und weil du schon ganz unten warst, kannst du mit den Kids besser umgehen als alle anderen hier. Du verstehst sie einfach. Und deswegen will ich dich auf gar keinen Fall verlieren. Weder als Mitarbeiter noch als Freund.«
Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte.
Robert sah mich mit ernster Miene an. »Versprich mir, dass du keine Dummheiten machst.«
»Versprechen kann ich dir das nicht, aber ich kann es zumindest versuchen.«
Damit gab er sich zufrieden.
Wir verließen das Gebäude und traten in einen sonnigen Frühlingstag ohne eine einzige Wolke am Himmel. Nur der übliche Smog trübte die Luft. Das Wohnheim lag direkt an einer stark befahrenen Hauptstraße, die in die Innenstadt führte, und wie jeden Morgen war ein langer Stau vor der nächsten Ampel. Die Autoschlange setzte sich gerade in Bewegung, die Motoren dröhnten, Auspuffe qualmten, irgendwo krachte ein Getriebe. Nach all den Jahren hätte ich mich längst daran gewöhnt haben sollen, und doch vermisste ich hin und wieder die Ruhe auf dem Land. Und die sehr viel reinere Luft in den Wäldern meiner Heimat.
Als Robert mich zum Abschied in die Arme nahm und an sich drückte, wurde mir schwer ums Herz.
»Komm gesund zurück«, murmelte er, sah mich einen Moment lang an und wandte sich schließlich ab.
Ich sah zu, wie er mit hängenden Schultern davonging, und fragte mich, ob ich wirklich das Richtige tat. Einen Moment zweifelte ich an meinem Entschluss, dann machte ich mich aber doch auf den Weg nach Coldmont.
***
Am späten Nachmittag befand ich mich zweihundertachtzig Meilen nordöstlich von Pittsburgh und auf feindlichem Gebiet. Zumindest kam mir der Gedanke, als ich nur noch dreißig Meilen von meinem Ziel entfernt über die Route 6 im Norden Pennsylvanias fuhr. Irgendwo rechts von mir strömte der Pine Creek. Ich konnte den Fluss von der Straße aus zwar nicht sehen, wusste aber, dass er sich demnächst mit dem Marsh Creek vereinigen und eine Rechtskurve gen Süden einschlagen würde. Die Kleinstadt Coldmont allerdings lag nördlich von hier.
Ich verließ den Highway, fuhr durch Greensbury, die fünfzehn Meilen südlich gelegene Nachbarstadt von Coldmont, und anschließend auf einer Nebenstraße weiter, die sich über mehrere Kehren aufwärts durch den Wald schlängelte. Bevor sie sich wieder abwärts neigte, konnte ich in der Ferne bereits einzelne Häuser meines Geburtsortes erspähen, was mir ein unangenehmes Ziehen in der Magengegend bescherte. Ich war noch nicht bereit, musste mich noch einen Augenblick sammeln, ehe ich den Schritt über die Stadtgrenze riskieren würde.
Ich lenkte meinen Wagen an den Straßenrand, stieg aus und sah mich um. Pure Wildnis. Die hohen Fichten wuchsen so dicht, dass nur wenige Sonnenstrahlen den Boden erreichten. Die Luft jedoch war so frisch, es fühlte sich einfach nur großartig an, sie einzuatmen. Und diese Stille. Kein Großstadtlärm. Nur das Gezwitscher der Vögel zwischen den Bäumen.
Mein Blick fiel auf einen Trampelpfad, der zwischen einigen wild wuchernden Sträuchern und Felsbrocken hindurch aufwärts führte. Ich wusste, wohin der Weg führte und folgte ihm kurz entschlossen zu jenem Ort, der mich schon in meiner Jugend fasziniert hatte.
Nach zehn Minuten Aufstieg lag er vor mir, der tödliche Schlund. Ich gab ihm diesen Namen, als Steve – ja genau, mein ehemals bester Freund Steve, der Verräter – behauptete, dieser Schlund fresse Menschen, das sei aber ein Geheimnis, und deshalb dürfe ich niemandem davon erzählen. Ich hielt ihn für einen Spinner.
Die Felsspalte war von hohen Rottannen und schroffen Felsen umrahmt und hatte die Größe eines ausgewachsenen weißen Hais. Ich hörte das Rauschen von Wasser und erinnerte mich an den Wasserfall, der ganz in der Nähe über mehrere Stufen hinab in einen Bach stürzte. Ein lauer Wind streifte meine Wangen, der Geruch nach Nadelbäumen und Heimat hing in der Luft. Eine sehr verträumte, ja vertraute Gegend, beinahe entspannend.
Aber jetzt, während ich so in diesen Schlund blickte und an Steves Worte zurückdachte, begann mein Herz zu rasen, meine Hände wurden feucht. Ganz in der Nähe raschelte es in einem Gebüsch. Eine unerklärliche Panik packte mich. Ich sah mich um. Doch abgesehen von einem Grauhörnchen, das einen Baum hinaufhuschte, und mehreren Vögeln, die sich in die Lüfte erhoben, war ich hier ganz und gar alleine. Trotzdem machte ich mich eilig auf den Rückweg zu meinem Wagen und atmete auf, als ich den Honda unbehelligt erreichte.
Bevor ich einstieg, spähte ich noch einmal zurück in den Wald und erstarrte. Zwischen den Bäumen lauerte eine dunkle Gestalt oder ein Schatten, der sich ebenso schnell wieder in Luft auflöste, wie er mir erschienen war. Doch nur ein Hirngespinst, meine lebhafte Fantasie? Ich schüttelte den Kopf und stieg endgültig in mein Auto.
Ich kurvte die enge Straße hinab und passierte kurz darauf die Stadtgrenze von Coldmont. Die Main Street führte kerzengerade durch das Zentrum der Kleinstadt. Im Vorüberfahren betrachtete ich die Häuser, die rechts und links die Straße säumten. Ein Lebensmittelladen, ein Coffeeshop, das Diner an der Ecke und schräg gegenüber eine Burgerbude. Jedes der Gebäude war in einer anderen Farbe gestrichen. Sehr bunt, auf eine besondere Art einladend und sehr vertraut. Überhaupt nicht beängstigend, wie ich es eigentlich erwartet hatte.
Erst als das Polizeirevier in mein Blickfeld rückte, fing meine Haut an zu kribbeln. Ich hielt unbewusst die Luft an, gleichzeitig schlug mein Magen einen Purzelbaum. Der Polizei gegenüber stand das aus roten Ziegeln erbaute Rathaus mit dem nach oben spitz zulaufenden Dach, das alle anderen Häuser überragte. Ich weiß nicht warum, aber mein Blick heftete sich auf die über den Flügeltüren hängende Uhr mit den römischen Zahlen auf dem weißen Ziffernblatt. Ich bildete mir ein, sie ticken zu hören, obwohl sie vor ewigen Zeiten kaputt gegangen war. Offensichtlich war sie bis heute nicht repariert worden, beide Zeiger standen auf der Zwölf.
Ich fragte mich noch einmal, ob es wirklich die richtige Entscheidung gewesen war, hierher zu kommen und einen Trip in die Vergangenheit zu unternehmen. Die Frage beantwortete ich mir selbst mit einem zögernden Ja. Schließlich war mein Vater gestorben. Wenn ich ihm auch sonst nichts schuldete, hatte ich doch das Bedürfnis, mich von ihm zu verabschieden. Also riss ich mich zusammen, atmete tief ein und wieder aus, fuhr weiter und machte mich auf die Suche nach einer Unterkunft, die ich mir leisten konnte.
Am nördlichen Stadtrand fand ich ein Motel. Ein zweistöckiges Haus mit zehn Fenstern an der Vorderfront, von der schon der Verputz bröckelte, und einem Holzzaun drum herum, der aussah, als würde er jeden Augenblick auseinanderfallen. So wirklich vertrauenerweckend sah das Haus nicht aus, aber ich hatte auch keine Lust, ewig durch die Gegend zu kurven, und das Hotel in der Innenstadt überstieg mein Budget. Ich beschloss, zumindest mal reinzuschauen. Gehen konnte ich immer noch.
Skeptisch betrat ich das Gebäude und wurde angenehm überrascht. Der Empfangsraum war wohl erst vor Kurzem renoviert worden. An den weiß gestrichenen Wänden hingen farbige Landschaftsaufnahmen. Eine davon zeigte die Berge mit den Bäumen darauf und einem hellblauen Bilderbuchhimmel darüber. Nett.
Eine junge Blondine trat hinter die Theke. Sie begrüßte mich mit einem zauberhaften Lächeln in einem hübschen Gesicht. Ihre blauen Augen musterten mich von oben bis unten und wieder zurück.
»Hi. Wie kann ich Ihnen helfen?«, begrüßte sie mich mit einer zuckersüßen Stimme.
»Hi. Ich brauche ein Zimmer«, sagte ich. »Haben Sie was frei?«
»Klar.« Sie nahm einen Schlüssel von einem Haken und gab ihn mir. »Sie müssen die erste Nacht im Voraus bezahlen. Den Rest bei der Abreise. Wie lange wollen Sie denn bleiben?«
»Das weiß ich noch nicht.«
Ich reichte ihr meine Kreditkarte, die sie durch ihr Lesegerät zog. Ungläubig starrte sie auf das Display ihres Bildschirmes.
»Ist mit der Karte alles in Ordnung?«, fragte ich.
»Sie sind Matt MacCarty?« Sie starrte mich an, als wäre ich ein berühmter Rockstar oder zumindest mal im Fernsehen gewesen.
»Wenn das da steht?«, antwortete ich. »Kennen wir uns?«
»Der Name kommt mir bekannt vor. Ach ja, jetzt fällt’s mir ein, der Autounfall«, antwortete sie und verfiel schlagartig in einen vertrauten Plauderton. »Was treibt dich denn in die Gegend?«
Der Autounfall. Man erinnerte sich also doch noch daran. Ich versuchte, das zu ignorieren. »Mein Vater ist gestorben.«
»Stimmt. Hab davon gehört.«
»Ah ja? So etwas spricht sich schnell herum, oder?«
»Nein, nein.« Sie winkte ab. »Mein Ex ist bei der Polizei. Er hat’s mir erzählt.«
»Dein Ex?«
»Ja, Victor Hedges. Kennst du ihn?«
Ja, ich erinnerte mich an Hedges. Wir waren in dieselbe Klasse gegangen, befreundet waren wir nicht gewesen.
»Und der ist bei den Cops gelandet? Interessant«, murmelte ich.
»Dann bist du wegen der Beerdigung hier. Dein Vater hat sich echt in den Kopf geschossen?«
»Anscheinend.« Ich versuchte, das Thema zu wechseln. »Hast du auch einen Namen?«
»Linda.« Sie musterte mich noch intensiver. »Stimmt es, dass du mit dem Auto eines Freundes eine Frau überfahren hast?«
»Nein, das stimmt so nicht.« Ich hatte keine Lust, mir ihr darüber zu reden. »Krieg ich jetzt meine Karte zurück?«
Linda zuckte die Achseln und reichte mir meine Kreditkarte. »Das Zimmer liegt im oberen Stockwerk, ganz hinten links. Frühstück gibt‘s ab sieben Uhr.« Sie zeigte auf eine Tür. »Da hinten.«
»Gut zu wissen.« Ich wandte mich ab und machte mich auf den Weg zu meinem Zimmer.
Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, sah ich mich erst einmal um. In dem Raum stand ein Doppelbett, unter dem Fenster ein kleiner Tisch mit einem Stuhl davor, und in einer Nische links davon ein Schrank. Neben dem Bett stand ein Korbsessel. Alle Möbel waren weiß, die Wände ebenfalls, selbst die Bettwäsche. Die Einrichtung erinnerte mich an die eines Hospitals. Fehlten nur noch die piependen, lebenserhaltenden Geräte.
Ich schüttelte den Kopf, der wieder einmal unselige Bilder aus meinem Unterbewusstsein heraufbeschwor. Dieses Mal sah ich deutlich das Krankenhauszimmer vor mir, in dem ich nach dem Unfall erwacht war. In meinem Kopf hatte Chaos geherrscht, jede Bewegung war mir schwergefallen.
Und was tat meine Mutter? Sie stand neben meinem Bett und schüttelte die ganze Zeit den Kopf. Sie machte mir Vorhaltungen, weil ich den Wagen meines besten Freundes gestohlen hätte, um damit eine Frau anzufahren. Nun, wenigstens besuchte sie mich, mein Vater kam nicht ein einziges Mal ins Krankenhaus, um nach mir zu sehen.
Ich ging zum Fenster und betrachtete die bewaldeten Hügel. Der Himmel darüber glühte im Schein der untergehenden Sonne und sah aus, als würde er in Flammen stehen. Faszinierend und bedrohlich zugleich. Genau wie der tödliche Schlund, der sich so unscheinbar zwischen den Bäumen verbarg. In mir begann etwas zu bröckeln, aber ich verstand absolut nicht, was das zu bedeuten hatte.
Ich weiß jetzt, was damals passiert ist.
Die letzten Worte meines Vaters ließen mich nicht los, und mir wurde bewusst, sie würden solange an mir haften, bis das Geheimnis, auf das ich angeblich geschworen hatte, gelüftet war.
DREI
»Oh Mann, Jason, wie lange sollen wir hier noch herumirren?«, fragte Corinne ihren frisch gebackenen Ehemann, der auf die glorreiche Idee gekommen war, mitten in der Nacht auf Schatzsuche zu gehen. »Mir reicht’s jetzt dann.«
Sie befanden sich im Wald über dem verschrobenen Ort Coldmont, der seinem Namen alle Ehre machte. So dachte zumindest Corinne, die sich in diesem dunklen und kalten Wald nicht wohlfühlte. Sie war der Ansicht, es wäre besser, die Suche abzubrechen, Jason jedoch wollte nicht auf sie hören.
Er leuchtete die Umgebung mit seiner Taschenlampe ab. »Ach komm schon, Baby, die Hinweise sind bestimmt ganz in der Nähe.«
Erst vor zwei Wochen hatten sie geheiratet. Die Reise in die Berge von Pennsylvania sollte ihre Hochzeitsreise werden, Corinne hatte sich das allerdings anders vorgestellt. Jason war ständig auf der Suche nach Abenteuern und nach diesen versteckten Schätzen, die nicht mehr enthielten als dummes Zeug.
Corinne mochte dieses Geocaching nicht, schon gar nicht mitten in der Nacht und ausgerechnet bei Vollmond. Aber so lauteten die Regeln. Es musste Vollmond sein und man durfte nicht vor Mitternacht in den Wald. Corinne hatte keine Ahnung, was das sollte. Nur ihrem Ehemann zuliebe machte sie diese Schatzsuche mit, bereute aber schon längst, dass sie sich darauf eingelassen hatte.
Jason nahm ihre Hand. »Wir finden das Ding, ganz sicher, okay?«
Sie seufzte und zwang sich zu einem Lächeln. »Hoffentlich hast du recht. Ich finde es ziemlich unheimlich hier.«
»Na klar ist es hier unheimlich. Das soll es doch auch sein.« Jason blickte auf das Display seines Smartphones, auf dem ein Punkt blinkte. »Siehst du, Baby, dort muss der Cache versteckt sein. Ist nicht mehr weit.« Wieder ließ er das Licht seiner Lampe langsam umherstreifen. Und dann endlich blitzte ein Reflektor auf, danach ein zweiter und ein dritter.
»Da geht’s lang«, sagte Jason und marschierte los.
Corinne runzelte die Stirn, als sie den Trampelpfad begutachtete, der zwischen dicht wachsenden Sträuchern und Bäumen hindurch steil nach oben führte. Die Äste sahen aus wie Knochenhände, die nur darauf warteten, ihre Finger auszustrecken und zuzupacken. »Bist du sicher? Der Weg sieht gruselig aus und scheint im Nichts zu enden.«
Jason kicherte. »Oh ja, sehr gruselig. Und ich bin schon sehr darauf gespannt, wie ein Nichts aussieht.«
»Sehr witzig«, erwiderte Corinne und rollte mit den Augen. »Na dann, laufen wir eben ins Nichts.« Oder in unser Verderben, fügte sie in Gedanken hinzu.
Der Aufstieg war anstrengend, Corinne geriet außer Puste, was auch an ihrer inneren Anspannung liegen mochte. Dann, wenige Minuten später, erreichten sie das obere Ende des Weges und gelangten an eine Lichtung. Das Licht des Vollmonds kämpfte sich durch den schwachen Dunst, der in der feuchtkalten Luft schwebte. Die Wipfel der Tannen erhoben sich dunkel vor dem Nachthimmel. Inmitten dieser Lichtung klaffte ein schwarzes, leicht geöffnetes Maul, das von mehreren hohen und niedrigen Felsbrocken umrahmt war.
Irgendwo raschelte es im Gebüsch, Corinne zuckte zusammen und bekam eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ihre Furcht wurde größer, und trotzdem war sie fasziniert von diesem irgendwie gruseligen Anblick.
»Wow«, flüsterte Jason. »Das ist wahnsinnig spannend.« Er klang jetzt nicht mehr ganz so gelassen wie vorhin, ehe sie den Weg nach oben angetreten hatten. Aber er wollte weiter, das spürte Corinne deutlich. So war er nun einmal, nichts konnte ihn von seinen Plänen abbringen. Ein Sturkopf, dennoch oder gerade deswegen liebte sie ihn.
Wieder glitt der Schein der Taschenlampe durch die Nacht. Ein weiterer Reflektor, nur ein kleiner Punkt an einem Felsen, blinkte auf, als das Licht ihn streifte.
»Das muss es sein. Wir haben’s geschafft«, stellte Jason fest. Seine Zähne leuchteten weiß in der Dunkelheit, seine Augen glänzten vor Glück.
»Ja, toll, lass uns nachsehen, was dort ist, und dann hauen wir ab, okay?« Corinne wäre lieber sofort gegangen, behielt das aber für sich, um Jason nicht zu enttäuschen. »Es ist gruselig hier.«
»Da gebe ich dir ausnahmsweise einmal recht. Wir beeilen uns lieber.« Jason setzte sich in Bewegung und zog Corinne hinter sich her.
Außer dem Knirschen ihrer Schritte auf dem von kleinen Ästen und Laub übersäten Boden war es ruhig, beinahe zu ruhig. Corinne fühlte sich beobachtet, schob den Gedanken aber rasch beiseite. Wer sollte sich hier schon mitten in der Nacht herumtreiben? Vielleicht wilde Tiere, die nur auf ihre Chance warteten, ihre Opfer in der Luft zu zerreißen. Nein, sie konnte sich nicht vorstellen, dass jemand diese nächtliche Schatzsuche ausschrieb, obwohl es hier gefährlich war. Genau, warum also machte sie sich diese Sorgen? Sie würden sich das Zeug schnappen, den Weg zurückgehen, in ihr Auto steigen und ins Motel fahren. Sie freute sich schon darauf, sich in Jasons Arme zu kuscheln.
Schließlich standen sie vor dem Felsen, den Jason als Zielobjekt auserkoren hatte, und Corinne fühlte sich schon etwas besser. Zumindest solange, bis sie das Knacken der Äste hörte, das die Stille der Nacht zerschnitt, und sie zusammenfahren ließ.
»Oh mein Gott, Jason, hast du das auch gehört?«, fragte sie leise.
Jason lauschte, schüttelte dann den Kopf. »Was denn?«
»Ich glaube, hier treibt sich jemand herum.« Wieder hörte sie etwas. Ein Rascheln, ein Knirschen. »Vielleicht werden wir beobachtet. Bitte, Jason, lass uns gehen.« Sie stellte fest, dass der Nebel sich verzogen hatte, und der Mond jetzt so hell herunter schien, dass die Tannen bizarre Schatten auf den feucht glänzenden Boden warfen.
Corinne sah sich nervös um. War dort nicht gerade eben etwas umhergehuscht? Angst kroch durch Corinnes Körper und ließ sie erzittern.
»Ich hab’s gleich«, erwiderte Jason. Er ließ seine Hand in dem Felsen verschwinden, der offenbar innen hohl war. »Uh, ich hab was gefunden. Sieh dir das an.« Er zog eine schmale Schachtel heraus, die er gleich darauf vorsichtig öffnete.
Corinne schlug die Hand vor den Mund, um den Schrei zu unterdrücken, der sich aus ihrer Kehle nach oben bahnte, während sie fassungslos auf die Tarotkarte starrte. Ein grinsendes Skelett, das in der knochigen Hand eine Sense hielt.
»Das ist ein saublöder Witz«, stellte Jason fest.
»Oder auch nicht«, zischte eine Stimme direkt hinter ihnen.
Corinne machte einen Satz zur Seite, drehte sich um und sah, wie eine vermummte Gestalt auf Jason zustürzte und zu Boden warf. Er rollte sich auf den Rücken und versuchte, sich wieder aufzurichten.
Zu spät!
Ein Schlagstock sauste auf ihn herab und traf ihn seitlich am Kopf. Jason fiel zurück auf den Boden, wo er benommen liegen blieb. Doch das genügte dem Maskierten nicht. Er verpasste Jason noch weitere Schläge gegen die Arme, Hände und den Nacken. Laut stöhnend blieb er regungslos, aber bei Bewusstsein liegen.
Corinne löste sich endlich aus ihrer Starre und wollte weglaufen, kam aber nicht mehr dazu. Ein kräftiger Arm umfasste sie von hinten und hielt sie fest. Der Versuch, sich dem Griff zu entwinden, misslang. Auch ihre Tritte nach hinten blieben wirkungslos. Eine Schlinge legte sich um ihren Hals. Corinne wand sich, drehte den Kopf ein wenig und blickte in zwei schief zueinanderstehende Augen über einer riesigen Nase. Mehr konnte sie von dem Gesicht nicht erkennen, es erinnerte sie aber an eine Figur aus einem Zeichentrickfilm, den sie als Kind gesehen hatte.
Quasimodo, der Glöckner von Notre Dame.
Nur war dieser Mann keine Figur aus einem Film, sondern real, riesengroß und Furcht einflößend.
Corinne begann zu frösteln, als die Schlinge um ihren Hals enger wurde. Mit den Fingern versuchte sie, den Strick zu lockern. Keine Chance. Tränen schossen ihr in die Augen, sie schnappte nach Luft, versuchte zu schreien, doch nur ein jämmerliches Krächzen drang aus ihrer Kehle.
»Worauf wartest du noch, Wächter?«, hörte sie die eiskalte Stimme des maskierten Mannes. »Bring sie zum Schweigen.«
»Ja …, Meister«, antwortete Corinnes Peiniger.
Wächter, Meister?, dachte sie. Was treiben die beiden hier für ein krankes Spiel? Nein, ein tödliches Spiel.
Sie blinzelte die Tränen weg und riss die Augen auf. Keine zwei Meter von ihr entfernt versuchte Jason, sich mit den Händen nach oben zu stemmen, doch fehlte ihm offensichtlich die Kraft. Der Meister baute sich über ihm auf, packte sein Haar und riss Jasons Kopf nach hinten. In seiner freien Hand hielt der Mann ein Messer, die Klinge blitzte im Mondlicht auf.
Jason sah Corinne voller Angst an. Seine Lippen bewegten sich, als wollte er ihr etwas sagen. Vielleicht ein Abschiedsgruß, ein letztes »Ich liebe dich«, weil er wusste, sie waren verloren.
Ihre Augen blickten tief in die Augen ihres Ehemannes und seine in ihre, als der Maskierte das Messer über Jasons Kehle zog. Corinne schloss die Augen. Das Seil um ihren Hals wurde enger, zum Glück schwanden ihr jetzt schnell die Sinne. Dichter, schwarzer Nebel sank auf sie herab, der sie gleich darauf gnädig verschlang.
VIER
… blutüberströmt sackte der Mann auf den felsigen Boden. Sein Mund öffnete sich zu einem Schrei, aber aus seiner Kehle drang nur noch ein heißeres Gurgeln. Er starrte mich an. Und dann …
… riss ich die Augen auf.
Mein Atem rasselte, als ich die Luft hektisch in meine Lungen pumpte. Mein Herz raste so schnell, als wollte es einen Hundertmeterlauf gewinnen. Nicht nur im Traum hatte ich die Luft angehalten, sondern auch im Schlaf.
Ich setzte mich auf und sah mich um. Das trübe Licht des Morgens kämpfte sich durch die zugezogenen Vorhänge ins Innere des Raums. Ich erkannte die Silhouette eines Bettes, in dem ich saß, und die eines Tisches unter dem Fenster. In einer Ecke stand ein Kleiderschrank. Ich befand mich in einem Motelzimmer. Natürlich, wo denn sonst?
»Es war nur ein Traum«, redete ich mir gut zu und vergrub mein Gesicht in den Händen. »Ein Traum, verdammt, nur ein Traum.« Mein Herz und meine Atmung beruhigten sich, die Bilder in meinem Kopf verblassten. Ich entspannte mich etwas und sank zurück in die Kissen.
Dieser Traum war mir nicht neu. Während meiner Zeit im Knast hatte er mich regelmäßig heimgesucht, später dann seltener und irgendwann überhaupt nicht mehr. Trotzdem erinnerte ich mich an das Blut, an die Augen des sterbenden Mannes und ganz verschwommen an eine Frau, die laut kreischte.
Woher diese Bilder stammten, wusste ich nicht. Vielleicht aus einem schlechten Film oder so etwas in der Art. Jahrelang hatte ich nicht mehr an diesen Traum gedacht, hatte mir keine Gedanken mehr darüber gemacht. Jetzt war ich in Coldmont und der Traum kehrte zurück. Ich rieb mir mit beiden Händen übers Gesicht, wischte die elenden Gedanken fort und verließ das Bett, um mich für die Beerdigung meines Vaters fertigzumachen.
***
Nach einer langen Dusche und einem knappen Frühstück machte ich mich auf den Weg zum Trauergottesdienst. Der Himmel war bedeckt, einzelne schwere Tropfen fielen aus dunklen Wolken herab und zerplatzten auf der Windschutzscheibe meines Wagens wie die Träume meiner Kindheit. Ich beobachtete, wie die Scheibenwischer die Überreste der Regentropfen fortwischten, und fragte mich zum wiederholten Male, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, hierher zu kommen. Und wieder redete ich mir ein, dass ich das Richtige tat.
Ich parkte am Straßenrand gegenüber der Kirche und stieg mit heftig pochendem Herzen aus. Zum Glück regnete es nicht mehr und am grauen Himmel zeigten sich einzelne, blaue Lücken, die Sonne aber noch nicht.
Als ich meine Mutter entdeckte, erfasste mich ein tiefes Gefühl der Trauer. Tränen stiegen mir in die Augen, als ich ihr Gesicht betrachtete, das sich abgesehen von einigen Falten mehr, kaum verändert hatte. Ich erinnerte mich an ihren strengen Blick, wenn ich nicht das tat, was sie von mir verlangte, oder wenn ich abends zu spät nach Hause kam, weil ich mich zu lange mit Freunden herumtrieb. Und ich dachte an ihr Lächeln, wenn sie stolz auf mich gewesen war.
Ich wischte mir über die Augen, sammelte mich einen Moment und ging entschlossen auf meine Mutter zu.
Sie sah mich erstaunt, oder eher zutiefst erschüttert an. »Matt? Du bist tatsächlich gekommen.«
»So sieht’s aus.« Ich lockerte den Knoten meiner Krawatte, weil ich kaum mehr atmen konnte. Meine Nervosität steigerte sich noch mehr, als ich die vielen Leute betrachtete, die um uns herum standen und mich anstarrten, als wäre ich ein Zombie, der gerade eben aus seinem Grab gestiegen war. Ich sah weg und entdeckte meinen Cousin Billy, der geradewegs auf mich zukam.
Er war zwei Jahre jünger, etwas kleiner und dünner als ich. Eine halbe Portion. Bevor der Autounfall mich aus meinem gewohnten Leben riss, waren Billy und ich wie Brüder gewesen. Genau wie ich, hatte auch er keine Geschwister. Vermutlich deswegen hatte er den Kontakt zu mir niemals ganz abgebrochen. Erst vor wenigen Monaten hatte er mich in Pittsburgh besucht, einfach so. Ihn selbst hatte es nie in die Großstadt gezogen. Nach dem College wollte er freiwillig zurück nach Coldmont, um an der hiesigen Highschool Lehrer zu werden. In dem Punkt hatte er meinem Vater nachgeeifert, der ebenfalls Lehrer gewesen war.
»Mit dir habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Hättest du nicht wenigstens anrufen und Bescheid geben können?«, fuhr Billy mich an. Er schob seine in Richtung Nasenspitze verrutschte Brille zurück an ihren Platz, direkt vor die blauen Augen.
»Hätte ich tun können, habe aber nicht daran gedacht«, gab ich ebenso barsch zurück. »Und warum hast du mich nicht angerufen?«
Er betrachtete meine Mom, die sich eilig davonmachte, weil sie angeblich dringend zum Priester musste, um etwas mit ihm zu klären. Ich sah ihr nach und fragte mich, ob sie es Billy untersagt hatte, mich wegen meines Vaters anzurufen.
»Ehrlich gesagt habe ich drüber nachgedacht«, sagte er. »Aber dann … Tut mir leid, Mann, ich hab’s nicht so gemeint. Ich freu mich, dass du da bist, auch wenn ein anderer Anlass mir lieber gewesen wäre.« Billy umarmte mich kurz und blickte mich dann freundlicher an. »Wie geht's Amy? Ist sie hier?«
»Amy geht's gut, und nein, sie ist nicht mitgekommen.« Ich musterte ihn. »Und was ist mit dir? Du siehst blass aus.«
»Kein Wunder, oder?« Seine Augen wurden feucht, er schüttelte den Kopf. »Gott, ich vermisse ihn jetzt schon.«
Ein tiefes Räuspern hinter mir unterbrach unser Gespräch. Ich drehte mich um und blickte in zwei stahlblaue Augen, die einem Mann gehörten, den ich nie zuvor gesehen hatte.
»Sie sind Matt MacCarty, stimmt’s?«, sagte er und musterte mich von oben bis unten.
»Sieht man mir das an?«, fragte ich skeptisch.
Seine Augen blieben auf meinem Gesicht haften, er lächelte. »Allerdings. Sie sehen Ihrem Vater sehr ähnlich.«
»Da könnten Sie recht haben. Und Sie sind?«
»Mein Name ist Kane, Jack Kane. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er hat mir viel von Ihnen erzählt.«
Er reichte mir seine Hand, in die ich einschlug. Sein Händedruck war extrem fest und sein bohrender Blick machte mich nervös. Er war einen halben Kopf größer als ich und wirkte unter seinem schwarzen Anzug sehr athletisch. Sein braunes Haar war kurz geschnitten und an den Schläfen leicht ergraut. Ich schätzte ihn auf Ende vierzig, Anfang fünfzig.
»Sie sagten eben, mein Vater hat Ihnen von mir erzählt?« Das konnte ich kaum glauben.
»Ja, sehr oft«, behauptete er. »Es tut mir aufrichtig leid, was mit ihm geschehen ist.«
Was mit ihm geschehen ist?
»Er hat sich umgebracht«, stellte ich klar.
»Zumindest sagt man das so.«
»Zumindest sagt man das so?«, wiederholte ich. »Und was sagen Sie dazu?«
Bevor er mir antworten konnte, fingen die Kirchenglocken an zu läuten. Das Gemurmel um mich herum verstummte, die Leute setzten sich in Bewegung und strömten in die Kirche. Und mir wurde mulmig zumute. Einen Moment dachte ich darüber nach, die Flucht zu ergreifen, doch dann riss ich mich zusammen und machte mich auf den Weg, um meinem Vater die letzte Ehre zu erweisen.
Als ich so ziemlich als Letzter ins Innere trat, hakte meine Mutter sich wider Erwarten bei mir unter. Vielleicht brauchte sie eine Stütze, vielleicht wollte sie aber auch nur so tun, als hätten wir uns mittlerweile versöhnt. Oder um die Form zu wahren. Das jedenfalls hätte zu ihr gepasst. Ich tat ihr den Gefallen und spielte mit.
Andächtig marschierten wir auf den Sarg zu. Der Deckel stand offen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte meinen Vater nicht sehen, nicht so … tot. Die Anspannung in mir wuchs. Die Hand meiner Mutter verkrampfte sich an meinem Arm. Ihre Fingernägel bohrten sich durch mein Jackett schmerzhaft in meine Haut.
Schließlich kamen wir am Sarg an. Ich riskierte einen Blick auf meinen toten Vater und atmete auf, was absolut nicht angemessen war. Aber ich war erleichtert, weil der Leichenbestatter ganze Arbeit geleistet hatte. Ich fand keine Anzeichen einer Schussverletzung. Meine Mutter zerrte an meinem Arm, doch ich konnte mich nicht von dem Anblick lösen. Dads Gesicht sah so friedlich und auch ein wenig fremd aus. Natürlich war er sehr viel älter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Seine Hände lagen gefaltet auf seinem Bauch. Er trug einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte, als würde er auf eine festliche Veranstaltung gehen. Sein früher mal dunkelbraunes Haar war von grauen Strähnen durchzogen und licht geworden.
Viele Gedanken wirbelten durch meinen Kopf. All die Bilder meiner Kindheit und Jugend brachen über mich herein und machten mich bewegungsunfähig. In diesem Augenblick bedauerte ich zutiefst, dass ich nicht mehr mit meinem Vater reden und mit ihm ins Reine kommen konnte. Regungslos stand ich an seinem Sarg, blickte in sein totes Gesicht und vergab ihm.
Ich hoffte, dass er mir vor seinem Tod ebenfalls vergeben hatte, löste mich aus meiner Starre und verließ schweigend die Kirche. Die Blicke der Leute folgten mir und bohrten sich in meinen Rücken, doch ich konnte nicht länger bleiben. Zu schmerzhaft waren die Erinnerungen. Die Tränen, die ich vergoss, waren für meinen Dad und für mich, niemand sonst sollte sie mit uns teilen.
Draußen begrüßte mich eine kühle Brise. Vögel zwitscherten sich in den wunderbarsten Tonlagen Lieder zu, während sie zwischen den Bäumen und vor dem wolkenverhangenen Himmel auf und ab flogen. Ich setzte mich auf eine Bank unter einer stattlichen Eiche und kurz darauf ließ Billy sich neben mir nieder.
Ich betrachtete ihn aus den Augenwinkeln. Er sah besorgt aus.
»Was ist los?«, fragte ich.
»Du hättest nicht herkommen sollen.«
»Wieso? Wegen meiner Mutter? Oder den Leuten? Ah, ich weiß schon, die könnten sich über uns das Maul zerreißen.«
»Nein, darum geht’s nicht.« Billy sah sich nach allen Richtungen um. Seine Stimme war nur noch ein Flüstern, als er weiterredete. »Ich habe mich wirklich gefragt, warum du gekommen bist. Sechzehn Jahre lang habt ihr nicht mehr miteinander geredet, und jetzt plötzlich zieht es dich hierher?«
»Dad ist tot, ich wollte ihn noch einmal sehen«, sagte ich und blickte zur Kirche hinüber, wo mein Dad immer noch aufgebahrt war. Ich schauderte.
»Ach, nur deshalb?« Billy glaubte mir offenbar nicht. »Ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Deine Mom hat gesagt, er hätte dir geschrieben. Sie war außer sich, weil sie nichts davon wusste, bevor du angerufen hast.«
Ich öffnete den Mund, schloss ihn wieder und atmete tief durch.
»Was hat er dir denn überhaupt geschrieben, Matt?« Billy starrte mich eindringlich an.
»Nur, dass ich ihn anrufen soll. Und …« Ich stockte. »Als ich die Nummer angerufen habe, die in dem Brief stand, bin ich bei meiner Mom rausgekommen. Sie hat mir dann gesagt, was passiert ist. Und jetzt bin ich hier …, na ja, weil er mit mir reden wollte. Hast du eine Ahnung, worüber er mit mir reden wollte?«
»Keine Ahnung, das würde ich auch gerne wissen.« Billy stand laut seufzend auf und blickte auf mich herab. »Aber ganz egal, was er wollte, er ist tot und demnächst begraben. Du kannst also wieder nach Hause fahren.« Anschließend ging er zurück in die Kirche.
Ich blieb sitzen und grübelte. Vermutlich wäre es in der Tat das Beste gewesen, Coldmont zu verlassen, wäre Vaters Brief nicht gewesen, den ich nicht ignorieren konnte. Ich wollte, nein, ich musste einfach herausfinden, was dahintersteckte.
FÜNF
Als Letzter warf ich eine Handvoll Erde auf den Sarg meines Vaters, nachdem sie ihn in seinem Grab versenkt hatten. Ein Zittern durchfuhr mich, solange ich in das rechteckige Loch blickte und mir klar wurde, wie kostbar das Leben war, und dass es im Bruchteil einer Sekunde zu Ende sein konnte.
Der Friedhof befand sich außerhalb von Coldmont in nördlicher Richtung und bestand aus zwei Teilen. Im neueren, vorderen Teil befanden sich die Gräber der vergangenen zwanzig Jahre. Zwischen diesen und dem Wald lag der alte Teil, in dem sich auch die Gruften der ersten Siedler befanden, die vor über einhundert Jahren die Stadt Coldmont gründeten.
Vom Grab meines Vaters aus konnte ich einen Blick auf die uralte Kapelle werfen, die sich unter mehreren hohen Fichten zu verstecken versuchte, was mich nicht verwunderte, so vergammelt, wie die aussah. In einem Türmchen auf dem von Moos bewachsenen Dach hing die Glocke, die früher immer dann geläutet hatte, wenn ein Verstorbener zu Grabe getragen wurde. Das tat sie mittlerweile nicht mehr. Jedenfalls nicht an diesem Tag.
Die Trauergesellschaft löste sich langsam auf. Billy konnte ich nirgendwo mehr entdecken. Auch Jack Kane war bereits gegangen, nachdem er meiner Mutter und auch mir sein Beileid ausgesprochen hatte. Mom war ebenfalls verschwunden.
Ich machte mich auf die Suche nach ihr und fand sie schließlich auf einer Holzbank unter einer Buche. Sie sah mich nicht an, als ich mich neben sie setzte, aber ich bemerkte, wie sich ihre Mundwinkel ein klein wenig hoben.
Sie nahm meine Hand in ihre. »Ich kann mir vorstellen, dass es dir sehr schwer gefallen ist, herzukommen. Zuerst war ich entsetzt, aber jetzt bin ich doch froh, dass du es getan hast.«
Ich sagte nichts.
Sie ließ meine Hand los, damit sie ihre freihatte, um ihren schwarzen Rock glatt zu streichen. »Vielleicht wäre es damals doch besser gewesen, wenn du nach deiner Haftstrafe zurückgekommen wärst.«
»Darauf kommst du jetzt?«, fuhr ich sie an. »Kommt die Erkenntnis nicht etwas zu spät?«
»Würdest du bitte leiser reden?«, flüsterte sie und sah sich um, als hätte sie Angst davor, uns könnte jemand zuhören. So war sie schon immer gewesen. Bloß nicht auffallen. Ich wusste, dass sie an meiner angeblichen Schandtat zu knabbern hatte.
»Es ist nicht so, dass ich nicht wollte, und zum Glück hatte ich Robert Stone, als ich aus dem Jugendknast rauskam«, sagte ich. »Etwas Besseres hätte mir wahrscheinlich kaum passieren können.« Mal abgesehen davon, dass mein Dad auch nicht schlecht gewesen wäre, aber diesen Gedanken sprach ich lieber nicht laut aus.
Mom legte ihre Hand auf meinen Unterarm. »Dein Vater war sehr verbittert all die Jahre. Der Unfall und deine Verurteilung machten ihm zu schaffen. Und mir natürlich genauso. Trotzdem haben wir versucht, das Beste daraus zu machen.«
Das Beste daraus zu machen. War das ihr Ernst? Ich fand, sie redete sich nur etwas ein, aber wahrscheinlich war das ihre Art, mit der Situation umzugehen.
»Du hast am Telefon gesagt, dass er dir geschrieben hat«, wechselte meine Mutter das Thema. »Daran musste ich die ganze Zeit denken. Sagst du mir, was er von dir wollte?«
Ich klärte sie auf, doch auch sie konnte mir nichts dazu sagen. Offensichtlich hatte mein Dad sie nicht eingeweiht. Sehr merkwürdig, ich verstand immer weniger, was da vor sich ging.
»Wusstest du, dass ich Edward gefunden habe?«, fragte Mom unvermittelt.
Ich hatte das Gefühl, mein Herz wurde in einen Schraubstock geklemmt und langsam zusammengepresst, als ich mir vorstellte, was meine Mutter hatte durchmachen müssen. Mir fehlten die Worte, ich sagte nichts.
»In seinem Arbeitszimmer, als ich nach Hause kam«, fuhr sie fort. »Warum war ich nicht da, als er …« Sie brach ab und schüttelte den Kopf.
»Mach dir deswegen keine Vorwürfe, Mom.« Ich zögerte, dann fügte ich hinzu: »Vielleicht hat er es ja gar nicht selbst getan.«
Mom zuckte zusammen und riss die Augen auf. »Wie kommst du darauf, Matt?«
»Weil es nicht zu ihm passt, und weil er mir diesen Brief geschrieben hat. Denk doch mal nach, Mom. Warum hätte er sich umbringen sollen, wenn er vorgehabt hatte, sich mit mir zu versöhnen? Das ergibt keinen Sinn.«
»Ach, jetzt verstehe ich, warum Edward den hier«, sie kramte in ihrer Handtasche herum und zog einen Schlüssel heraus, »nach sechzehn Jahren wieder in den Schlüsselkasten im Flur gehängt hat. Ich habe ihn dort entdeckt, nachdem sie deinen Vater weggebracht haben.«
Eine Träne rollte über ihre Wange, weitere folgten, und ich hielt meine eigenen mit aller Kraft in mir zurück. Rasch nahm ich den Schlüssel, der an einem Anhänger mit einer schwarzen Fledermaus auf gelbem Grund befestigt war. Batman, das größte Idol meiner Jugend.
»Das ist mein Schlüssel«, stellte ich fest. »Und Dad hat ihn erst vor ein paar Tagen wieder in den Schlüsselkasten gehängt?«
»Davon gehe ich aus, ja. Vielleicht hat dein Vater tatsächlich damit gerechnet, dass du nach Hause kommst. Wenn du willst, kannst du ins Haus, aber mich wirst du dort nicht antreffen, ich wohne für eine Weile bei deiner Tante.« Sie versuchte ein Lächeln, das ihr nicht so recht gelingen wollte. Schließlich erhob sie sich und sah auf mich herab. »Danke, dass du gekommen bist, Matt.« Danach wandte sie sich ab und ging davon.
Ich blickte ihr nach, dachte daran, ihr zu folgen, ließ es aber sein. Dann betrachtete ich den Schlüssel in meiner Hand und wusste, was ich zu tun hatte.
***
Als ich in meinem Wagen in die Straße einbog, in der ich früher gelebt hatte, wurde mir mulmig zumute. Langsam fuhr ich an den Häusern vorbei, die mir so vertraut und doch so fremd vorkamen. Ich fragte mich, ob noch immer dieselben Menschen darin wohnten wie früher, was aus deren Kindern geworden war, und ob die schon eigene Kinder hatten.
Schließlich erreichte ich mein altes Zuhause und hatte das Gefühl, niemals fortgewesen zu sein. Zögernd verließ ich mein Auto und ging langsam auf das Haus zu. Irgendwo schlug ein Holzladen gegen ein Fenster, und die Blätter der Efeuranken, die an der Fassade emporkletterten, raschelten im Wind. Vom Verandadach zwitscherte mir eine Spottdrossel leise etwas zu, gerade so, als wollte sie mir ein Geheimnis verraten. Leider verstand ich kein Wort.
Ich fragte mich, ob ich wirklich bereit war, eine Reise in meine eigene Vergangenheit zu unternehmen, sprach mir selbst Mut zu und stieg die drei Stufen zur Veranda empor. Das alte Holz ächzte unter meinen Schritten, ich fühlte mich wie ein Eindringling, doch dann riss ich mich zusammen und betrat das Haus.
Zuerst ging ich ins Wohnzimmer. An der hinteren Wand befand sich der Kamin, der uns in kalten Winternächten gewärmt hatte. In der Luft hing noch ein Hauch von verbranntem Holz. Ich stellte mir vor, wie meine Eltern einträchtig nebeneinander auf dem altmodischen mit Blümchen und Rüschen verzierten Sofa saßen. Sie hielten sich an den Händen, sie lächelten. Ich sah mich zwischen ihnen, lachend, weinend, streitend, aber glücklich.
Die Szene verdunkelte sich. Sie saßen dort ohne mich, älter, betrübt, mein Vater sah auf, in seinem Blick lagen Enttäuschung, Vorwürfe und Bitterkeit. Erschrocken und von Schuldgefühlen übermannt wich ich zurück, und das Bild löste sich auf.
Links von mir befand sich eine altmodische Anrichte aus dunklem Holz. Auf ihr standen die gerahmten, zum Teil schon verblichenen Familienfotos. Schwarz-Weiß-Bilder meiner Großeltern, ein Hochzeitsfoto meiner Eltern, weitere Schnappschüsse aus der Vergangenheit. Und zwischen all diesen Lebensmomenten entdeckte ich einen von mir.
Auf dem Foto war ich so um die sieben Jahre alt. Ich trug dunkelblaue Shorts und ein knallrotes T-Shirt, meine Füße waren eingegraben im Sand. Im Hintergrund erkannte ich das Meer mit Schaumkronen auf den Wellen und die Möwen, die zwischen der See und dem Himmel auf und ab flogen. Ich nahm das Foto in die Hand und betrachtete mein Gesicht darauf. Zwei der oberen Schneidezähne fehlten in meinem breit grinsenden Mund. Meine Nase war übersät mit Sommersprossen, und meine Augen strahlten in die Kamera. War ich das wirklich gewesen? Vielleicht in einem anderen Leben.
Kopfschüttelnd stellte ich die Aufnahme zurück an ihren Platz neben das Hochzeitsbild meiner Eltern und wandelte weiter durch meine Vergangenheit.
Ich betrat die Küche. Auch hier hatte sich kaum etwas verändert. Dieselben Küchenmöbel aus hellem Holz, derselbe rechteckige Tisch, dieselben Stühle mit den Kunststoffsitzen, die ich schon damals entsetzlich unbequem fand.
Für einen Moment schloss ich meine Augen und sah meinen Vater an der kürzeren Seite des Tisches sitzen, mit dem Rücken zum Fenster, in den Händen die Tageszeitung. Hoch konzentriert studierte er die Schlagzeilen aus aller Welt. Immer mal wieder blickte er mich über den Rand der Zeitung hinweg an. Meistens lächelte er. Ganz selten warf er mir auch grimmige Blicke zu.
Ich sehnte mich nach diesen Momenten, die mir Geborgenheit geschenkt hatten, und zugleich war mir bewusst, dass ich sie nicht zurückholen konnte.
Ich verließ die Küche, durchquerte den Flur und gelangte an die Tür zu Dads Arbeitszimmer. Zögernd öffnete ich sie und schielte durch einen schmalen Spalt in den Raum. Unter meinen Füßen knarrten die altersschwachen Dielen, als ich das Zimmer betrat. Der Geruch nach Möbelpolitur und Desinfektionsmittel hing in der Luft. Und noch etwas anderes, vielleicht ein Hauch Tod?
Mein Blick fiel auf die dunklen Flecken am Boden, vermutlich Dads Blut, das in die winzigen Risse des Holzfußbodens gesickert war. Mir zog sich der Magen zusammen, als ich mir vorstellte, wie er da gelegen hatte, eine Blutlache unter seinem Kopf.
Ich verdrängte die Bilder, machte einen großen Bogen um das eingetrocknete Blut und ließ mich auf der anderen Seite des aus dunklem Mahagoniholz gefertigten Schreibtischs in Dads Sessel nieder. Er ächzte laut unter meinem Gewicht, und ich sah mich erschrocken um. Nichts passierte.
Meine Finger glitten über das raue Leder an der Unterseite der Sitzfläche und fanden die Stelle, wo ich als Achtjähriger mit meinem nagelneuen Taschenmesser eine Kerbe hineingeschnitten hatte, um das Innenleben dieses Sessels zu erforschen. Dad schaute mich nur mürrisch an, als er meine Schandtat entdeckte, und nähte den Schnitt notdürftig zu. Mittlerweile klaffte er aber wieder auseinander. Ich zog meine Hand zurück.
Mein Blick fiel auf den Laptop, der auf dem Tisch lag. Ich klappte ihn auf und schaltete ihn ein. Während er startete, zog ich die Schubladen des Schreibtisches auf und spähte in jede Einzelne hinein. Darin befanden sich Locher, Tacker, Taschenrechner, Blöcke und jede Menge Stifte in allen erdenklichen Farben. Nichts von Bedeutung.
Genau wie auf dem Laptop, stellte ich nach einem Blick auf den Bildschirm fest, als das Betriebssystem vollständig hochgefahren war. Ich klickte mit der Maus auf das Start-Icon unten links. Es zeigten sich nur die Namen der Standardprogramme von Windows. Die Festplatte war formatiert worden. Vergangenen Montag Nachmittag. Am Tag des Selbstmords. Eigenartig.
Mein Blick fiel auf den Köcher, in dem noch mehr Stifte steckten. Doch was war das zwischen den Kugelschreibern? Ein Schlüssel. Ich zog ihn heraus und betrachtete ihn. Das war nicht irgendein Schlüssel, das war mein Zimmerschlüssel. Einer der wenigen, die in diesem Haus existierten. Als ich klein war, hatte meine Mom mich ab und zu in mein Zimmer eingeschlossen, wenn ich frech geworden war. Mein Dad hatte mich jedes Mal befreit, wenn er es mitbekommen hatte. Später benutzte ich den Schlüssel, um mich einzuschließen, wenn ich ungestört sein wollte.
Aber warum hatte er hier zwischen den Stiften gesteckt? Ich machte den Laptop aus und klappte ihn zu. Danach verließ ich das Arbeitszimmer und stieg die Treppe hinauf in den ersten Stock. Die Tür zu meinem alten Zimmer war abgeschlossen. Ich öffnete sie mit meinem Schlüssel, betrat den Raum und hatte das Gefühl, als wäre ich sechzehn Jahre in der Zeit zurückgereist.
An den Wänden hingen ausgebleichte Poster von Rockbands und von Motorrädern. Über dem Bett ausgebreitet lag noch die Patchwork-Tagesdecke, sauber und ordentlich zurechtgezogen.
In einem Regal neben der Tür stand zwischen Actionfiguren, Automodellen und anderem Kram ein großer Pokal, der mich an meine Schulzeit erinnerte. Mein Vater hatte die Basketballmannschaft trainiert, in der ich gespielt hatte. Einmal konnten wir sogar die Meisterschaft gewinnen und bekamen diesen Pokal überreicht. Nur konnte ich mich nicht daran erinnern, dass er jemals in diesem Regal zwischen meinen Sachen gestanden hatte.
Neugierig nahm ich ihn in die Hand, und als ich den Deckel abnahm, entdeckte ich im Inneren des Potts einen weiteren Schlüssel. Ich fischte ihn heraus und betrachtete ihn nachdenklich. Dann drehte ich den Pokal um und fand an der Unterseite prompt einen nagelneuen Aufkleber.
Darauf stand: »Für Matt. Glückwunsch, Dad.«
Was sollte das nun wieder? Glückwunsch? Wozu? Aber natürlich, er wollte, dass ich den Schlüssel finde. Mein Vater spielte eine Art Schnitzeljagd mit mir.
Ich setzte mich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch und öffnete alle Schubladen. Die meisten waren leer, nur in einer davon entdeckte ich ein Sparbuch, besser gesagt mein Sparbuch. Ich schlug es auf, blätterte darin herum und stellte fest, dass mein Vater das Konto erst vor wenigen Tagen aufgelöst hatte, und zwar an seinem Todestag. Immerhin hatten sich über zweihundert Dollar darauf befunden.
Ich blickte auf den Schlüssel, den ich im Pokal gefunden hatte, und mir ging ein Licht auf. Vielleicht passte er in ein Bankschließfach, gut möglich, dass mein Vater dort etwas für mich deponiert hatte. Ich zog den Aufkleber von dem Pokal ab, klebte ihn auf die letzte Seite meines Sparbuchs und klappte es zu. Den Schlüssel schob ich in meine Hosentasche.
Mein Blick fiel durchs Fenster auf die andere Straßenseite. Dort stand ein Mann. Er trug Turnschuhe, ausgebeulte Jeans und darüber eine dunkelgraue Sweatjacke mit einer Kapuze, die ihm weit ins Gesicht fiel. Ich fühlte seine Blicke auf mir, obwohl er eine Sonnenbrille vor den Augen hatte. Rasch duckte ich mich hinter den Schreibtisch, als wäre ich ein Einbrecher, der gerade auf frischer Tat ertappt worden war.
Zeit zu verschwinden. Ich stopfte das Sparbuch in die Tasche meines Jacketts, hastete die Treppe hinunter und verließ das Haus durch die Hintertür. Doch als ich um die Hausecke spähte, sah ich, dass der Mann weg war. Ich atmete auf und machte mich auf den Weg zur einzigen Bankfiliale in Coldmont, die sich im Stadtzentrum gegenüber des Rathauses befand.
Das Gebäude war aus rotem Backstein erbaut und sah so ähnlich aus wie das Rathaus, nur kleiner und bescheidener. Auf zwei weiße Säulen stützte sich ein schmales Vordach, das viel zu klein ausgefallen war und deswegen zum Rest nicht richtig passte.
Mein Herz pochte wie verrückt, als ich die fünf Stufen zwischen den Säulen hinauf auf den Eingang des Gebäudes zustürmte. Meine Euphorie wurde jedoch schlagartig ausgebremst, als ich die Öffnungszeiten entdeckte. Die Bank hatte Freitag nachmittags geschlossen und würde erst am Montag um neun Uhr wieder die Pforten öffnen.
So ein Mist. Das bedeutete, ich hing hier fest, in diesem verhassten Ort, in Coldmont. Sollte ich mir das tatsächlich antun? Ich war nicht sicher, wusste aber eines, ich wollte unbedingt wissen, was mein Vater in diesem Schließfach versteckt hatte.
SECHS
Ich fuhr ziellos in der Stadt herum, um die Zeit totzuschlagen, und fragte mich, ob mein Leben besser verlaufen wäre, hätte ich an jenem Abend vor sechzehn Jahren nicht in Steves Wagen gesessen. Und ich ging noch weiter zurück. Hätte Steves Weg meinen nicht gekreuzt, und wir wären uns niemals begegnet, was wäre dann aus mir geworden? Vielleicht ein Supersportler oder ein Computerfreak. Möglicherweise hätte ich jetzt und hier in Coldmont, irgendwo am Stadtrand, ein schmuckes Häuschen, eine fürsorgliche Frau und zwei Kinder, die im Garten tobten und mich abends lautstark begrüßten, wenn ich von einem langweiligen Schreibtischjob nach Hause kam.
Aber war es das, was ich wollte? Nein, eher nicht. Ich hatte mir in Pittsburgh ein Leben aufgebaut, in das ich hineinpasste. Niemals hätte ich die Freundschaft zu Robert Stone missen wollen. Nicht einmal die verruchten Kids, die in den Straßen der Großstadt ohne mich verloren gingen. Na ja, zumindest ein Teil davon respektierte mich. Und Amy? Ohne Steve, ohne den Unfall, und ohne meine Haftstrafe hätte ich diese wunderbare Frau höchstwahrscheinlich niemals kennengelernt. Allein der Gedanke an sie machte mich überglücklich. Und zugleich tat es weh, weil sie nicht bei mir war.
Als ich an meiner alten Schule vorbeifuhr, legte ich erst einmal eine Pause ein und blickte von meinem Wagen aus auf das alte Gebäude. Mir wurde schwer ums Herz. Ich hatte die zehnte Klasse noch nicht ganz hinter mir gehabt, als der Unfall mich aus meinem gewohnten Leben riss. Meinen Abschluss machte ich erst nach meinem Gefängnisaufenthalt. Zwar etwas verspätet, aber Robert bestand darauf, dass ich es tat. Es war ihm sehr wichtig, und mittlerweile war ich ihm deswegen dankbar.
Durch die geöffnete Fensterscheibe meines Wagens drang lautes Gelächter. Auf dem Schulhof trieben sich ein paar Jungs herum, die schätzungsweise vierzehn oder fünfzehn waren. Sie spielten Basketball, lachten miteinander und schubsten sich gegenseitig herum. Einer fiel nach einem heftigen Bodycheck zu Boden, der Angreifer streckte ihm die Hand entgegen und half ihm wieder auf. Die Jungs klopften einander auf die Schultern und führten ihr Spiel fort.
Ich seufzte, startete den Motor und warf einen Blick in den Rückspiegel. Dabei entdeckte ich einen blauen Ford Kuga, der gut dreißig Meter von mir entfernt am Straßenrand parkte. Im selben Moment, als ich losfuhr, setzte sich auch der Ford in Bewegung. Mir fiel ein, dass ich so einen Wagen vorhin in der Nähe meines Elternhauses gesehen hatte. Um herauszufinden, ob der Wagen sich an meinen hängen würde, fuhr ich kreuz und quer durch die Stadt. Und tatsächlich, der Kuga folgte mir in sicherem Abstand.
Erst als ich auf den Parkplatz des Motels einbog, scherte der Wagen aus, fuhr rasant an mir vorbei und davon. Ich blickte ihm noch hinterher, bis er um die nächste Kurve fuhr, und fragte mich, was das Ganze sollte. Schließlich verließ ich meinen Honda und betrat das Motel.
Linda telefonierte gerade, als ich an die Rezeption trat.
»Du kennst den Preis«, sagte sie ins Telefon und strahlte mich dabei an. »Dann sind wir uns ja einig.« Sie legte auf und gab mir meinen Schlüssel. »Hey, Matt. Wie lange hast du eigentlich noch vor zu bleiben?«
»Weiß ich noch nicht«, erwiderte ich. »Wieso?«
»Nur so. Ich muss doch wissen, wie lange das Zimmer noch belegt ist.«