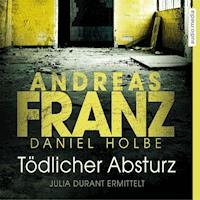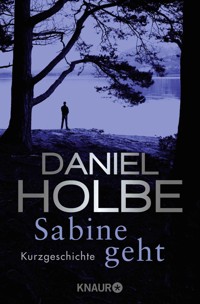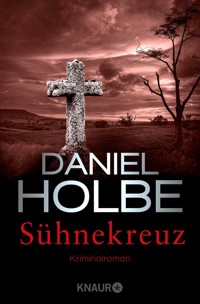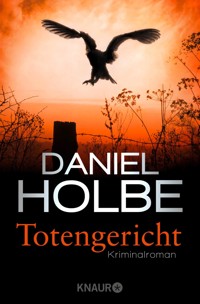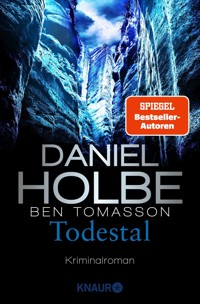
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der 10. Fall führt das beliebte hessische Ermittlerduo Sabine Kaufmann & Ralph Angersbach in die Tiefen des Taunus Ein ermordeter Journalist, ein toter Anwalt und ein Dorf, das schweigt ... Ein kleines Dorf im Taunus gerät in den Fokus von Ermittlungen: Ein Journalist wurde in einem Steinbruch tot aufgefunden. Eine Kneipenprügelei mit Folgen? Oder hat er womöglich zu viele unbequeme Fragen gestellt? Auch im Fall um einen toten Anwalt aus Wiesbaden – gestorben bei der Mensur einer Studentenverbindung: ein Unfall oder steckt doch mehr dahinter? – tun sich Verbindungen ins Dorf auf. Hochbrisant und abgründig Bei ihren Nachforschungen stoßen Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach auf ein wahres Wespennest aus alten Seilschaften, illegalen Geschäften und Geschichten, über die kollektives Stillschweigen herrscht. Mittendrin: die drei mächtigsten Familien des Dorfes – die Schwerdtfegers, die ihr Vermögen mit Sondermüllentsorgung gemacht haben; die Hegers, denen eine nahe Arzneimittelfabrik gehört; und die Witts, die ein Naturschutzprojekt vorantreiben wollen. Doch wer ist für die Todesfälle verantwortlich? Und was hat es mit dem Waldstück nahe des Dorfes auf sich, um das sich scheinbar alles dreht? Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach müssen einmal mehr ihre Kräfte bündeln, um das Netz aus Lügen, niederen Absichten und falschen Spuren zu entwirren und die Täter zu stellen ... Band 10 der Hessen-Krimi-Reihe der beiden SPIEGEL Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Ben Tomasson ist ein hochspannender und wendungsreicher Kriminalroman um die Macht loyaler Familienbande, alte Seilschaften und die tödlichen Konsequenzen unermesslicher Gier. »Raffinierte, hochspannende Krimireihe.« StadtRadio Göttingen Die erfolgreiche und beliebte Krimi-Reihe aus Hessen ist in folgender Reihenfolge erschienen: Giftspur Schwarzer Mann Sühnekreuz Totengericht Blutreigen Strahlentod Schlangengrube Glutstrom Totengold
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Daniel Holbe / Ben Tomasson
Todestal
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein ermordeter Journalist, ein toter Anwalt und ein Dorf, das schweigt
In einem Dorf im Taunus wird ein Journalist in einem Steinbruch tot aufgefunden. Eine Kneipenprügelei mit Folgen – oder stellte er zu viele unbequeme Fragen? Überraschend tun sich auch im Fall um einen toten Anwalt aus Wiesbaden Verbindungen zum Dorf auf. Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein wahres Wespennest aus alten Seilschaften, illegalen Geschäften und Geschichten, über die kollektives Stillschweigen herrscht. Mittendrin: die drei mächtigsten Familien des Dorfes. Doch wer ist für die Todesfälle verantwortlich? Und was hat es mit dem Waldstück nahe des Dorfes auf sich, um das sich anscheinend alles dreht?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Zehn Jahre zuvor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Jubiläums-Nachwort
Es war einfach nicht fair. Er hatte überhaupt nichts getan. Der andere hatte ihn provoziert. Linus, dieser blöde Penner. Felix hatte keine Ahnung, warum alle nach seiner Pfeife tanzten. Er machte dabei jedenfalls nicht mit. Deswegen wurde er gedisst, Linus immer vorneweg. Dieses Mal hatte er ihn so fies angemacht, dass Felix rotgesehen hatte. Er hatte das heimlich geübt, im Keller vor dem Regal, wo die Schlafsäcke lagen. Immer mit der Faust draufgehauen. Und genauso hatte er Linus in die Fresse geschlagen. Linus hatte aus der Nase geblutet, und ein Schneidezahn war abgebrochen.
Die Erwachsenen hatten ein Riesendrama daraus gemacht. Seine Klassenlehrerin, die Rektorin und dann seine Eltern. Angeblich hatte er, Felix, ein Problem damit, seine Aggressionen zu kontrollieren. Was totaler Quatsch war. Wenn Linus ihn nicht provoziert hätte, wäre überhaupt nichts passiert. Und überhaupt war es keine große Sache. Die taten alle so, als hätte er Linus zu Brei geschlagen. Dabei war die Nase nicht mal gebrochen. Es war bloß eine harmlose kleine Prügelei auf dem Schulhof gewesen.
Doch seine Eltern und die Schulleitung sahen das anders. Sechs Wochen Handyverbot. Hausarrest. Besuche beim Kinder- und Jugendlichenpsychologen und ein Antiaggressions-Training. Als wäre er ein Schwerverbrecher. Aber das Schlimmste waren die Sonntage. Während seine Klassenkameraden mit ihren Eltern im Vergnügungspark waren, auf dem Spielplatz abhingen oder zusammen zockten, fuhren seine Eltern mit ihm in den Wald, um spazieren zu gehen.
Felix konnte sich nichts vorstellen, was auch nur annähernd so öde gewesen wäre. Und dazu kamen die Vorträge, die seine Eltern ihm hielten. Über Anstand, Moral und Respekt. Dabei war es doch wohl Linus, dem jeder Respekt fehlte!
Heute hatte Felix die Schnauze endgültig voll gehabt. Als sein Vater wieder davon anfangen wollte, war er einfach losgerannt. Zwischen den Bäumen hindurch, mitten durch das dichte Unterholz. Bis er die Stimmen seiner Eltern, die hinter ihm herriefen, nicht mehr hörte.
Es war ein gutes Gefühl. Er war ganz allein hier. Der Wald war riesig, sie trafen fast nie andere Spaziergänger. Es gab jede Menge Büsche und Sträucher. Die Bäume hatten gewaltige Kronen. Jetzt, im Frühling, wucherte alles wie verrückt. Überall wuchs helles, frisches Grün, und von allen Seiten war Geraschel zu hören. Vogelgezwitscher und andere Tierstimmen. Ob es hier Wölfe gab?
Felix rannte immer weiter. Er fühlte sich wie ein großer Abenteurer. Ein Entdecker. Allein im Dschungel trat er furchtlos allen Gefahren entgegen. Er fand einen stabilen Ast, der genau die richtige Länge hatte. Das war sein Schwert. Er schlug sich damit den Weg durch das immer dichter werdende Unterholz und stieß wilde Triumphschreie aus. Bis er plötzlich ins Leere trat.
Der Boden gab unter ihm nach. Sein rechter Fuß rutschte weg. Felix kam aus dem Gleichgewicht und stürzte einen dicht bewachsenen Abhang hinunter. Er verlor sein Schwert und vergrub den Kopf in den Armen, während er immer schneller in die Tiefe purzelte. Sein Körper schlug auf harte Steine, irgendetwas Spitzes riss ihm die Hose auf. Dünne Zweige peitschten gegen die Arme, die aus der dicken Weste heraussahen.
Und dann war es plötzlich vorbei. Mit einem harten Knall landete er auf dem Boden. Ihm war ein wenig flau, aber nachdem er ein paarmal tief durchgeatmet hatte, wurde es besser. Seine Knochen schmerzten, doch immerhin schien er sich nichts gebrochen zu haben. Langsam nahm er die Arme herunter und blinzelte.
Er befand sich in einem tiefen Tal mit grauen Steinwänden. Oben an den Kanten war Wald. Klettergewächse hingen herunter. Sie sahen aus wie grüne Schlangen, die sich ihren Weg ins Tal suchten.
Felix begriff nun, wo er sich befand. Sein Vater hatte mal davon erzählt, von dem alten Steinbruch mitten im Wald. Längst stillgelegt und dem Verfall preisgegeben. Jetzt entdeckte er auch die riesigen Maschinen, die am anderen Ende der Schlucht standen. Stählerne Ungetüme, verrostet und von Unkraut überwuchert.
»Wow.« Felix rappelte sich auf und spähte zu den Geräten. Er hatte keine Ahnung, was man damit genau machte, aber es war auf jeden Fall cool. Zu blöd, dass ihm seine Eltern das Smartphone weggenommen hatten. Er hätte ein paar krasse Bilder posten können.
Neugierig durchquerte er den Steinbruch. Am anderen Ende befand sich ein seltsamer Berg, der nicht so aussah, als wäre er aus Stein. Felix suchte sich wieder einen Ast und fegte die Erde beiseite. Eine Reihe weißer Plastikfässer mit blauen Deckeln kam zum Vorschein, einige stehend, andere auf der Seite liegend. Auch davon hatte sein Vater gesprochen. Von den Lastwagen, die nachts in den Wald fuhren.
»Ich wette, der Schwerdtfeger vergräbt da heimlich seinen Müll«, hatte er gesagt.
Was wohl in den Fässern war?
Felix legte den Ast beiseite und versuchte, einen der blauen Deckel aufzudrehen. Das Ding saß fest, Felix musste seine gesamte Kraft aufbieten. Er dachte schon, er würde es nicht schaffen, doch dann gab der Deckel plötzlich nach und ließ sich abnehmen. Felix spähte in das Fass hinein.
»Hey, cool.«
In der Tonne befanden sich jede Menge Tüten mit bunten Bonbons. Ob die wohl noch gut waren? Aber die Tüten waren fest verschlossen. Und was sollte an Bonbons schon schlecht werden?
Felix stopfte sich so viele Tüten in die Taschen seiner Weste, wie er konnte. Die letzte riss er auf und steckte sich ein paar der bunten Bonbons in den Mund.
»Hm.« Felix kaute enttäuscht. Die Dinger schmeckten nach fast nichts. Nur ein kleines bisschen süß. Wahrscheinlich waren sie doch schon zu alt. Aber er hatte Hunger, und die Bonbons waren besser als nichts. Trotzig schob er sich noch eine Handvoll in den Mund. Die halb leere Tüte warf er zurück ins Fass.
Oben an der Kante der Schlucht versank die Sonne hinter den Bäumen.
Er sollte zurückgehen. Seine Eltern würden sich Sorgen machen. Auch wenn er gerade ganz furchtbar sauer auf sie war, liebte er sie. Und so ganz allein im Dunkeln würde ihm das Abenteuer auch keinen Spaß mehr machen.
Felix eilte zurück zu dem Abhang, den er hinuntergepurzelt war. Er war gar nicht so steil, Felix konnte einfach hinaufklettern. Auch den Weg, den er gerannt war, fand er wieder. Die Schneise, die er mit dem Schwert ins dichte Unterholz geschlagen hatte, war nicht zu übersehen.
Ein paar Minuten später stand er wieder auf dem Weg. Von hier musste er nur in Richtung der untergehenden Sonne gehen, dann kam er zum Parkplatz. Dort würden hoffentlich seine Eltern auf ihn warten.
Mit einem Mal war ihm komisch zumute. Heiß und kalt zugleich. Sein Mund war vollkommen trocken. Es rauschte in den Ohren, und seine Hände zitterten. Seine Knie fühlten sich weich wie Gummi an. Er konnte auch nicht mehr richtig sehen. Alles war irgendwie verschwommen. Die Bäume schienen zu schwanken, der Weg war wie ein Fluss, in dem das Wasser schwappte. Auch die Farben veränderten sich, wurden grell und dann wieder blass.
Er machte noch ein paar unsichere Schritte, wankte und verlor das Gleichgewicht. Während der Boden auf ihn zukam, hörte er die schrille Stimme seiner Mutter, die seinen Namen brüllte.
»Felix! Felix! Felix!«
Wie ein Echo, das von allen Seiten zurückgeworfen wurde, dabei waren überhaupt nirgendwo Wände.
Ganz kurz nur wunderte sich Felix darüber. Dann schlug er auf, und die Welt um ihn herum löste sich auf.
1
Der Tote lag am Fuß des Steilhangs. Um ihn herum hatte sich eine Blutlache gebildet, die nach und nach im staubigen Boden versickerte. Die Gliedmaßen des Mannes wirkten merkwürdig verdreht. Der Schädel sah aus, als sei er gesprungen. Die Augen des Toten waren geöffnet. Er starrte in den blauen Frühlingshimmel, mit einem Gesichtsausdruck, als wäre er überrascht, erstaunt über das, was ihm widerfahren war.
Kriminalkommissar Liam Burger wusste natürlich, dass das vollkommener Unsinn war. Gestik und Mimik entstanden zum Großteil willentlich. Das Gehirn sandte Signale an die vielen kleinen Muskeln in Gesicht und Händen. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz, die sogenannten Mikroexpressionen, wurden von einem Teil des Gehirns gesteuert, auf das man keinen Zugriff hatte. Seine Zwillingsschwester, die beim LKA arbeitete, hatte ihm das erklärt. Sie war ehrgeiziger, zielstrebiger und wahrscheinlich auch intelligenter als er. Deshalb strebte sie eine entsprechende Karriere an. Er selbst war eher der sportliche Typ. Das Mobile Einsatzkommando oder eine andere Spezialeinheit wäre das Richtige für ihn gewesen. Wenn er fit wäre. Aber das war er nicht. Für die Kriminalpolizei reichte es. Für mehr nicht.
Jedenfalls wusste er von seiner Schwester, dass man an der Miene eines Toten nicht viel ablesen konnte. Die Gefühle, die er im Moment des Sterbens empfunden hatte, bildeten sich nicht darin ab, weil die gesamte Muskulatur erschlaffte. Trotzdem, dachte Liam, war dieser Tote hier sicher erstaunt gewesen. Die Frage war nur, weshalb.
War er am Abhang entlang spaziert und unvermittelt ins Leere getreten? Oder hatte ihn jemand hinuntergestoßen?
Sein Vorgesetzter, Kriminalhauptkommissar Ansgar Spohr, hatte Rechtsmedizin und Spurensicherung angefordert, und nun standen sie hier im alten Steinbruch und warteten. Nachdem eine Spaziergängerin den Leichenfund gemeldet hatte, waren zunächst die Kollegen von der Schutzpolizei angerückt und hatten dann ihrerseits die Kriminalinspektion informiert. Es war ein ungeklärter Todesfall, der untersucht werden musste. Viel tun konnten sie allerdings nicht.
Der Tote hatte Brieftasche und Handy bei sich und war rasch identifiziert worden. Jan Karnath, ein Wiesbadener Journalist. Sie würden herausfinden müssen, was er hier im Wald gewollt hatte.
»Sich erholen«, hatte Spohr lapidar verkündet. »Er hat einen anstrengenden Beruf. Da sucht man am Wochenende nach Ruhe.«
Tatsächlich bot sich das riesige Waldgebiet mitten im Taunus dafür an. Trotzdem fand Liam, dass man genauer nachforschen sollte.
»Falls sich herausstellt, dass es kein Unfall war«, hatte sein Vorgesetzter ihn gebremst. »Wir müssen nicht nach einem Motiv für ein Verbrechen suchen, wenn keines vorliegt.«
Was natürlich nicht falsch war, doch Liam hatte trotzdem ein komisches Gefühl. Das nicht besser wurde, während er beobachtete, wie Spohr telefonierte. Er hatte sich ans andere Ende des Steinbruchs zurückgezogen, wo ein paar alte Abbaumaschinen vor sich hin rosteten. Sein Gesicht war gerötet. Das war es allerdings häufig. Liam hatte den Verdacht, dass sein Vorgesetzter oft und ausgiebig dem Alkohol zusprach.
Mit wem er telefonierte, wusste Liam nicht. Aber Spohr gestikulierte heftig, also ging es wohl nicht um irgendwelche Routinesachen.
Liam blickte am Abhang hinauf zu der Stelle, von der aus Jan Karnath abgestürzt sein musste. Sie war von frischem jungem Grün überwuchert. Man konnte sich gut vorstellen, dass man an die Kante geriet, ohne es zu bemerken. Jetzt, im Mai, schlugen die Büsche und Bäume aus, und die Triebe und Blätter versperrten die Sicht. Einen Zaun oder eine Absperrung gab es nicht. Der ganze Wald befand sich im Privatbesitz, das Betreten erfolgte auf eigene Gefahr, wie es große Schilder an den Wanderparkplätzen entlang der Straße verkündeten.
Liam fröstelte, obwohl es nicht besonders kalt war. Trotz des herrlichen Frühlingshimmels wirkte die Atmosphäre bedrückend. Der verlassene Steinbruch, die hohen Bäume, die drohend oben an der Kante aufragten, die vergessenen Maschinen. Das Gezwitscher der Vögel schien weit weg. Oben im Wald entfaltete sich das Leben. Hier unten im Steinbruch regierte der Tod.
Er wusste, dass er diese destruktiven Gedanken beiseiteschieben sollte. Sie störten ihn bei der Arbeit, beeinträchtigten seine Objektivität. Doch was sollte er sonst tun? Es gab keine Zeugen, keine Anwohner, die sich befragen ließen, niemanden, der etwas beobachtet hatte. Nur die Spaziergängerin, deren Hund in den Steinbruch hinuntergerannt war und so lange gebellt hatte, bis sein Frauchen den steilen Abstieg in Kauf genommen und zu ihrem Schrecken den Toten gefunden hatte.
Die Frau hatte einen Schock erlitten. Die Kollegen von der Schutzpolizei hatten ihre Personalien aufgenommen und sie von einem Rettungswagen wegbringen lassen, noch ehe Liam und Spohr eingetroffen waren. Wenn es nötig war, würden sie später mit ihr sprechen.
Spohr hatte endlich seine Telefonate erledigt und kam zurück zu Liam. Er wirkte unzufrieden, doch auch das war nichts Besonderes. Er stand kurz vor der Pensionierung, hatte tiefe Falten, die sich um Mund und Augen eingegraben hatten, einen wässrigen Blick und eine von einem Netz roter Adern überzogene Nase. Er war ein guter und erfolgreicher Ermittler, doch den Spaß an der Arbeit hatte er längst verloren. Knurrig und kurz angebunden hielt er sein Team auf Trab. Aber ein Ende war absehbar.
Noch zwei Jahre, dann würde Spohr in den Ruhestand gehen. Liam freute sich schon darauf. Doch bis dahin …
Von irgendwoher näherten sich Motorengeräusche, und gleich darauf fuhren die Busse der Spurensicherung in den Steinbruch, eingehüllt in graue Staubwolken, die von den Rädern aufgewirbelt wurden. Es sah dramatisch aus, unheilverkündend. Liam rief sich energisch zur Ordnung. Körperlich war er wiederhergestellt und für den Polizeidienst geeignet. Doch die Angst, die sich beständig heranschlich, durfte niemand sehen. Sonst würde man ihn vermutlich lebenslang in den Innendienst versetzen, und dort würde er eingehen wie eine Pflanze, die weder Licht noch Sauerstoff bekam.
Die Kollegen von der Spurensicherung stiegen aus ihren Fahrzeugen und zogen die weißen Schutzanzüge an. Ein Teil des Teams kletterte ein Stück abseits des Leichenfundorts den steilen Hang hinauf. Gleich darauf bewegten sich die weißen Gestalten oben an der Kante zwischen den Bäumen umher wie flüchtige Geister im Leichenwald.
Schluss jetzt, ermahnte sich Liam. Er brauchte dringend etwas zu tun. Herumzustehen und zu grübeln taten ihm nicht gut. Schon gar nicht, wenn er direkt vor einem Abhang stand. Natürlich hatte die Wand des Steinbruchs ansonsten wenig mit der schneebedeckten Piste zu tun, die ihm zum Verhängnis geworden war. Aber trotzdem.
Ein weiterer Wagen kam auf sie zu, in eine Staubwolke gehüllt. Ein uralter mattgrauer Golf, der beinahe mit der Umgebung verschmolz. Umso überraschter war Liam, als er die Frau sah, die aus dem Auto stieg. Sie war alles andere als farblos. Mitte dreißig vielleicht, schwarz, mit dunklen Augen und Haaren, die zu kleinen Zöpfen geflochten am Kopf anlagen. Wunderschön, dachte Liam. Der kurze Blick, den sie ihm zuwarf, und das angedeutete Lächeln trafen ihn direkt ins Herz.
Spohr marschierte auf die Frau zu. »Was haben Sie hier verloren?«, herrschte er sie an. »Das ist ein Tatort. Betreten verboten. Hat Ihnen das der Beamte oben an der Absperrung nicht gesagt? Wenn Sie von irgendeiner Zeitung sind, wenden Sie sich an die Pressestelle. Und wenn Sie bloß neugierig sind, sehen Sie besser zu, dass Sie Land gewinnen.«
Die Frau lächelte und entblößte zwei Reihen strahlend weißer Zähne. »Ich bin nicht von der Presse. Neugierig bin ich allerdings, von Berufs wegen.« Sie streckte die Hand aus. »Rose Endai, Rechtsmedizin Wiesbaden. Geschrieben N, Apostroph, groß D, klein i a y e. N’Diaye.«
Spohr kniff die Augen zusammen. »Schicken die uns jetzt schon die Praktikanten? Wo ist Ihr Vorgesetzter?«
Das Lächeln verblasste. »Doktor Rose N’Diaye. Ich bin die Vorgesetzte.«
Spohr musste sichtlich daran kauen. Dann ergriff er endlich die ausgestreckte Hand und schüttelte sie. »Ansgar Spohr.«
N’Diaye reichte auch Liam die Hand. Ihre war warm und fest und fühlte sich gut an. Liam blickte in die dunklen Augen der Ärztin und hätte darin versinken können. Zum Glück ließ sie seine Hand rasch wieder los. Sie ging zu den Kollegen der Spurensicherung, ließ sich von ihnen Schutzanzug, Latexhandschuhe, Mundschutz und Überzieher geben und kleidete sich ein. Liam folgte ihr und tat dasselbe.
Die Rechtsmedizinerin wartete, bis die Spurensicherer den Boden um den Leichnam herum abgesucht und Fotos gemacht hatten. Dann näherte sie sich dem Toten und kniete neben ihm nieder. Sie tastete ihn ab, blickte dann zu Liam auf. »Helfen Sie mir, ihn auszuziehen?«
»Klar.« Liam hatte einen furchtbar trockenen Mund, die Zunge schien ihm am Gaumen zu kleben. Wegen des Toten oder weil ihn die Nähe von Dr. N’Diaye nervös machte?
Behutsam entkleideten sie den Leichnam. Die Rechtsmedizinerin untersuchte den bleichen Körper.
»Und?«, fragte Spohr, der zu ihnen getreten war. Er hatte sich ebenfalls in einen Tyvek-Anzug gezwängt. Weil sein Pullover und seine Jacke hochgerutscht waren, sah er darin aus wie ein weißes Michelin-Männchen.
N’Diaye zeigte nacheinander auf die Abschürfungen an Armen und Beinen. »Ich erkenne drei Arten von Verletzungen.«
»Drei?«
»Diese Spuren hier stammen vom Absturz. Der Körper ist gegen die Steinwand geprallt, das Gestrüpp hat ihm die Haut aufgerissen. Der rechte Arm ist gebrochen, Steißbein und Knie sind geprellt.« Sie wies auf das Gesicht des Toten. »Das hier dagegen ist das Ergebnis von Schlägen.«
Liam nickte. Ein blaues Auge, eine rot verfärbte Wange, die Unterlippe aufgeplatzt, das Kinn verschorft.
»Also hat ihn jemand verprügelt, und deshalb ist er in den Steinbruch gestürzt«, folgerte Spohr.
Die Rechtsmedizinerin schüttelte den Kopf. »Nein. Die Verletzungen sind älter. Sie müssen dem Mann einige Stunden vor dem Sturz zugefügt worden sein. Mindestens zwölf, höchstens vierundzwanzig Stunden, grob geschätzt.« Sie zeigte auf die Nase des Toten, die ein wenig schief war. »Offenbar passiert ihm das öfter. Die Nase war gebrochen und ist gerichtet worden, schätzungsweise vor zwei bis drei Wochen.«
Spohr kratzte sich durch die Tyvek-Kapuze am Kopf. Das Material raschelte leise. »Dann war er benommen? Hatte vielleicht eine Gehirnerschütterung?«
»Möglich. Aber das ist nicht der Grund, weshalb er abgestürzt ist.« N’Diaye machte Liam ein Zeichen, und gemeinsam drehten sie den Toten auf die Seite. »Sehen Sie das?« Sie zeigte auf den Hinterkopf des Mannes. Die braunen Haare waren blutverklebt.
»Hm.« Spohr kniff die Augen zusammen. »Sind Sie sicher, dass das nicht vom Sturz stammt?«
»Ich halte es für unwahrscheinlich«, entgegnete die Rechtsmedizinerin. »Die Verletzung befindet sich oberhalb der gedachten Hutkrempe …«
»Ja, ja«, unterbrach Spohr sie ungeduldig. »Hutkrempenregel. Verletzung unterhalb der gedachten Hutkrempe gleich Sturz, Verletzung oberhalb gleich Schlag. Aber der Mann hier ist ja nicht einfach nur hingefallen, sondern einen Abhang hinuntergestürzt. Da könnte er doch auch mit dem oberen Schädel aufgeprallt sein, wie bei einem Kopfsprung ins Wasser.«
»Theoretisch ja«, entgegnete die Rechtsmedizinerin geduldig. »Aber die anderen Verletzungen deuten darauf hin, dass er den Kopf beim Sturz mit den Armen geschützt hat.«
Spohr betrachtete die aufgeschürften Unterarme und Ellbogen des Toten. »Also hat ihm jemand einen Knüppel über den Kopf gezogen.«
»Danach sieht es aus«, bestätigte N’Diaye. »Zur Art der Waffe kann ich allerdings noch nichts sagen. Vielleicht, wenn wir Materialspuren in der Wunde finden.«
Das durchdringende Klingeln eines Smartphones unterbrach sie. Spohr zog den Reißverschluss des Tyvek-Anzugs auf und fummelte es heraus. »Ja?«, bellte er. »Ah!« Seine Miene hellte sich auf. Er legte den Kopf in den Nacken und sah an der Steinwand hinauf. Liam und N’Diaye folgten seinem Blick.
Oben stand ein Beamter im weißen Schutzanzug und schwenkte einen länglichen Gegenstand, der in einem großen Tatortbeutel steckte.
»Sehr gut.« Spohr hob den Daumen, drückte das Gespräch weg und schob das Smartphone zurück in die Jacke. »Die Spurensicherung hat einen Ast gefunden, an dem Blutspuren haften. Vermutlich die Tatwaffe. Die Jungs schicken Ihnen eine Blutprobe in die Rechtsmedizin.«
N’Diaye hob die Augenbrauen, nickte aber. Liam zuckte mit den Schultern. Spohr war ein Beamter der alten Schule. Die Existenz von Frauen bei der Polizei nahm er hin, doch an seiner Sprechweise änderte sich nichts.
»Sie melden sich, wenn es eine Übereinstimmung gibt«, befahl Spohr und winkte Liam, ihm zu folgen. Liam schenkte der Rechtsmedizinerin ein entschuldigendes Lächeln und eilte hinter ihm her.
Sie verließen den Leichenfundort über den sogenannten Trampelpfad, den die Spurensicherung ausgewiesen hatte, damit die Beamten nicht kreuz und quer liefen und womöglich Spuren zerstörten. Spohr zerrte den Schutzanzug so ungeduldig herunter, dass er riss. Liam zog seinen mit größerer Sorgfalt aus, obwohl es letztlich gleichgültig war. Die Dinger landeten ohnehin im Müll.
»Also«, sagte Spohr, während sie alles in die Abfalltonne stopften, die von den Spurensicherern aufgestellt worden war. »Jan Karnath hatte offenbar mit jemandem Streit. Gestern haben sie sich geprügelt, heute hat ihn der andere in den Steinbruch gestoßen. Irgendjemand hier aus der Gegend vermutlich. Karnath würde sich wohl kaum in dieser Einöde mit einem Informanten verabreden. Der kennt hier jemanden, oder er wollte ein paar Tage ausspannen. Eine zufällige Begegnung. Eine Auseinandersetzung, die aus dem Ruder gelaufen ist.«
Liam murmelte etwas Unverständliches. Spohrs Theorie war durchaus plausibel, aber es war nur eine Möglichkeit. Es konnte sich auch alles ganz anders abgespielt haben. Bisher besaßen sie viel zu wenige Informationen.
Spohrs Telefon läutete erneut. »Ja?«, knurrte er in den Hörer. Dann blitzten seine Augen. »Sehr gut. Wir kommen.« Er grinste Liam an. »Wie ich es gesagt habe. Drüben im Dorf hat es gestern Abend eine Wirtshausschlägerei gegeben. Das haben die zuständigen Kollegen gerade berichtet. Karnath hat sich mit einem der Anwohner geprügelt. Blaues Auge und dicke Lippe wie bei dem Toten, dazu ein abgebrochener Schneidezahn. Sein Kontrahent hat Karnath wüst beschimpft, als er abgehauen ist. Dass er ihn findet und es ihm heimzahlt, hat er gebrüllt.« Spohr steckte das Handy mit zufriedener Miene in die Jackentasche. »Den Fall haben wir im Handumdrehen gelöst, Burger.«
Liam nickte ergeben. Auch wenn er das Gefühl hatte, dass Spohr die Sache einfach nur schnell vom Tisch haben wollte – es sah so aus, als hätte er recht.
Du musst aufhören, ihm zu misstrauen, ermahnte er sich. Spohr mag ein Säufer sein, aber er ist ein erfahrener Kriminalist. Während er selbst, Liam, ein Greenhorn war.
Das ungute Gefühl wollte trotzdem nicht weichen.
2
Der Frühling hatte eine Pause eingelegt. Über der Stadt hing grauer Nebel. Am Morgen war es so kalt gewesen, dass Lynn die Strickmütze, den Wollschal und die Handschuhe wieder hervorgeholt hatte. Auf dem Weg ins Büro war ihr auf dem Fahrrad fast die Nase abgefroren. Als sie dort war, hatte sie sich als Erstes eine Kanne grünen Tee gemacht.
Mittlerweile war der Tee leer. Lynn hatte eine frische Kanne gekocht, ihre mitgebrachte Bowl gegessen und sich weiter durch ihre To-do-Liste gearbeitet, die sie Anfang der Woche angelegt hatte. Irgendwann hatte sie das Deckenlicht eingeschaltet. Der Himmel war immer noch grau, und am späten Nachmittag hatte sich bereits wieder die Dämmerung über die Stadt gesenkt. Aber zumindest waren nun einige Punkte auf ihrer Liste abgehakt. Lauter Routinearbeiten. Berichte, Ablage, Koordination. Der letzte spannende Fall lag eine ganze Weile zurück.
Lynn lehnte sich auf ihrem ergonomischen Stuhl zurück und streckte sich. Sie dachte an den letzten Herbst, an die Goldsache am Edersee, die sie mit Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach bearbeitet hatte. Zwei tolle Kollegen. Sie hatte gehofft, man würde sich auch nach Abschluss des Falls öfter treffen, doch irgendwie war es dazu nicht gekommen. Sabine und sie hatten unterschiedliche Aufgaben zugeteilt bekommen, mit anderen Kollegen gearbeitet. Und Ralph Angersbach wollte sie nicht einfach so kontaktieren. Sie hatte schon letztes Jahr am Edersee gemerkt, dass Sabine eifersüchtig gewesen war. Grundlos. Vom Typ her war Ralph ein Mann, wie ihn sich Lynn als Partner vorstellen könnte, aber er war viel zu alt. Eigentlich müsste Sabine das wissen. Aber Ralph und sie hatten lange gebraucht, um zueinanderzufinden, und ganz sicher waren sie sich offenbar der Liebe des anderen immer noch nicht. Dabei sah jeder, dass für keinen von ihnen jemand anders infrage kam.
Lynn seufzte. Sie hatte eine ganze Reihe von Bekannten, doch was ihr fehlte, waren echte Freunde. Dabei hatte sie keine Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen. Aber man traf eben selten jemanden, bei dem die Wellenlänge stimmte.
Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Die Nummer war ihr unbekannt.
»Lynn Burger, Landeskriminalamt Wiesbaden«, meldete sie sich.
»Hi Lynn. Hier ist Liam«, sagte eine vertraute Stimme am anderen Ende.
»Liam!« Sie verspürte jähe Freude. Aber warum meldete er sich nicht per Messenger, so wie sonst?
»Ich weiß, komische Nummer«, meinte Liam lachend. »Aber mein Akku ist gerade verreckt – ich hab kurz das Handy von einem Kollegen geschnorrt. Und Handynummern, na ja, wer merkt die sich heutzutage noch? Also hab ich’s direkt auf dem Dienstweg probiert.«
Typisch. So war er. Improvisiert, spontan, aber immer präsent, wenn es zählte. Liam war ihr Zwillingsbruder, den sie allerdings erst vor ein paar Jahren richtig kennengelernt hatte. Liam war ein talentierter Skifahrer und schon als Zehnjähriger ins Skiinternat nach Oberstdorf gegangen. Als Kinder hatten sie zusammen gespielt und waren unzertrennlich gewesen. Deswegen gab es auch keine Freunde aus dieser Zeit, Liam und sie hatten immer ihr eigenes Ding gemacht. Und dann war er plötzlich weg gewesen und sie allein. Ihre ewig abwesenden Eltern hatten sie nicht auffangen können, die Großeltern, die oben im Haus wohnten, umso mehr. Es musste zu dieser Zeit gewesen sein, dass Lynn angefangen hatte, sich für Computer und Technik zu interessieren und sich völlig in der Materie zu vergraben. Andere Menschen hatte sie dabei irgendwie aus den Augen verloren.
Jetzt war Liam zurück. Neun Jahre im Internat, drei Jahre im Leistungszentrum. Zahlreiche gewonnene Wettbewerbe und fast eine Olympiamedaille. Und dann das Aus.
»Lynn? Hörst du mir zu?«
Lynn tauchte aus ihren Gedanken auf. »Entschuldige. Ich war gerade woanders. Was hast du gesagt?«
»Ich habe ein Problem mit meinem Chef.«
»Spohr, der Säufer?« Seit Liam vor fünf Jahren mit dem Sport aufgehört und die Polizeischule absolviert hatte, hatten sie regelmäßig Kontakt. Liam wäre gerne zu einer Spezialeinheit gegangen, doch das war nicht möglich. Der Sturz im letzten Rennen hatte seine Hüfte zertrümmert. Mit der neuen, künstlichen Hüfte konnte er im Alltag bestehen, und für die Anforderungen des normalen Polizeidienstes reichte es ebenfalls. Aber für mehr eben nicht. Weder für Leistungssport noch für ein Spezialkommando.
Liam hatte sich für die Kriminalpolizei entschieden. Er liebte die Außeneinsätze. Lynns Begeisterung für Technik, Daten und Recherchen konnte er nicht nachvollziehen. Das war schon immer so gewesen.
Nach der Polizeischule hatte er eine Stelle bei der Kriminalinspektion Wiesbaden angetreten. Der Job gefiel ihm. Wenn nur sein Vorgesetzter nicht gewesen wäre.
»Was hat er dieses Mal angestellt?«, erkundigte sich Lynn.
»Ich glaube, er mauschelt.«
»Wie bitte?« Lynn wusste, dass Spohr ein knurriger Typ war, der seine Kollegen schlecht behandelte und es insbesondere den Frauen gegenüber an Wertschätzung fehlen ließ. Trotzdem hatte Liam ihn bisher als korrekten Beamten geschildert. Kein angenehmer Partner, aber einer, der einen guten Job machte.
»Wir haben da einen Fall in Thaldorf«, erklärte Liam. »Ein Mann ist in einen Steinbruch gestürzt, nachdem ihm jemand einen Ast über den Schädel gezogen hat.«
»Warte, Moment«, unterbrach Lynn ihren Bruder. »Wo liegt denn Thaldorf? Das hab ich noch nie gehört.«
»Ach herrje, so ein kleines Kaff im Nirgendwo. Grob gesagt eine halbe Stunde Fahrt in Richtung Usingen. Aber viel wichtiger ist das Opfer. Es handelt sich um Jan Karnath, einen Wiesbadener Journalisten.«
Lynn griff nach der Maus und weckte den Rechner aus dem Ruhemodus. Sie tippte rasch auf der Tastatur und klickte ein paarmal mit der Maus. Dann hatte sie die Homepage des Toten vor sich.
Ein sympathisch aussehender Mann Ende dreißig. Freundliche, von einem goldfarbenen Metallgestell umrahmte braune Augen. Das ebenfalls braune Haar war ein wenig zu lang und kräuselte sich im Nacken.
Lynn überflog die Seite. Karnath war investigativer Journalist. Sein Schwerpunkt waren Umweltthemen. Ein paar Enthüllungsberichte in renommierten Blättern. Vor fünf Jahren hatte er einen Preis für eine Reportage über einen Schweinemastbetrieb mit skandalösen Haltungsbedingungen gewonnen.
»Karnath hat sich zwei Wochen vor seinem Tod im Wirtshaus in Thaldorf geprügelt«, berichtete Liam. »Und am Abend vor der Tat gab es einen weiteren Zusammenstoß. Sein Kontrahent war in beiden Fällen derselbe. Roman Birnbaum, ein Dorfbewohner. Er hat Karnath mit Vergeltung gedroht, nachdem der ihm bei der zweiten Prügelei den Schneidezahn abgebrochen hat. Spohr hat den Mann festnehmen lassen. Birnbaum sitzt in Untersuchungshaft, aber er bestreitet die Tat.«
Lynn schob die Maus beiseite. »Gibt es Beweise?«
»Birnbaums Wagen ist zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Nähe des Steinbruchs gesehen worden. Sein Handy war im nächstgelegenen Funkmast eingeloggt. Und auf der Kleidung des Opfers gibt es Spuren von ihm. Die könnten aber auch von der Schlägerei am Vorabend stammen. Den Zeugen zufolge hat Karnath dieselben Sachen getragen, Jeans, blauen Wollpullover, braune Lederjacke.«
»Wie erklärt Birnbaum seine Anwesenheit in der Nähe des Tatorts?«
»Er sagt, er war mit dem Hund dort. Das ist seine übliche Route, vom Parkplatz durch den Wald zum Steinbruch und wieder zurück. Der Hund ist ein Labrador, er braucht viel Auslauf.«
»Also hatte er Motiv, Mittel, Gelegenheit. Und er hat kein Alibi. Damit ist er zumindest dringend tatverdächtig.«
»Das bestreite ich nicht.«
»Aber?«
»Ich habe ein ungutes Gefühl. Nicht wegen Birnbaum, sondern wegen Spohr. Birnbaum könnte es gewesen sein, aber wir haben nur Indizien, keine stichhaltigen Beweise.«
»Ihr ermittelt doch weiter?«
»Ja. Es ist nur …«
»Was?«
»Karnath war investigativer Journalist. Er könnte an einer Sache dran gewesen sein, die irgendwer unbedingt unter dem Deckel halten will.«
»Gibt es dafür Anhaltspunkte?«
»Das ist es ja. Ich habe den Eindruck, wir suchen gar nicht richtig danach. Weil Spohr nicht will, dass irgendwas ans Licht kommt.«
»Welches Interesse sollte er daran haben?«
»Ich weiß es nicht.« Liam klang frustriert. »Aber er führt ständig heimliche Telefongespräche. Schon als wir im Steinbruch waren.«
»Bist du sicher, dass das etwas mit dem Fall zu tun hat?«
»Nein. Kann natürlich auch sein, dass er eine Geliebte hat, von der niemand etwas wissen soll. Aber ich glaube das nicht.«
Lynn dachte nach. Liam und sie waren grundverschieden. Sie selbst orientierte sich an Logik und Fakten, Liam an seinem Bauchgefühl.
»Was war denn Karnaths aktuelles Projekt? Habt ihr da Unterlagen gefunden? Wisst ihr, warum er in diesem … Thaldorf war?«
»Es ging wohl um den Wald und den Steinbruch. Der Wald gehört einem Wiesbadener Entsorgungsunternehmer, Lothar Schwerdtfeger.«
»Der mit dem albernen Logo?« Lynn hatte die Fahrzeuge sofort vor Augen, grün mit dem Schwerdtfeger-Wappen, einem Reiter, in der rechten Hand ein Schwert, in der linken einen Besen. Schwerdtfeger räumt auf, lautete der Slogan unter dem Wappen.
»Genau der. Er wohnt in der Nähe von Thaldorf. Wohnte, besser gesagt. Vor zwei Monaten ist er gestorben. Krebs. Seine beiden Söhne planen jetzt in dem Waldgebiet um den Steinbruch herum eine Ferienanlage. Luxushäuser, Schwimmbad, Golfplatz und so. Karnath hat das offenbar verhindern wollen. In seinen Unterlagen haben wir Korrespondenz mit der Umweltbehörde gefunden. Unter anderem ein Schreiben, in dem man ihm mitteilt, dass es Pläne gibt, das gesamte Gelände als Naturschutzgebiet auszuweisen.«
»Dann ist doch alles in Ordnung.«
»Eben nicht. Der zuständige Mitarbeiter ist plötzlich nach Frankfurt versetzt worden, und die Pläne scheinen vom Tisch zu sein.«
»So etwas kommt vor.«
»Klar. Aber zusammen mit dem Mord an Karnath … Vielleicht hat er in ein Wespennest gestochen?«
»Was sollte das sein?«
»Es gibt da so eine alte Geschichte. Ein Junge, der im Steinbruch irgendwelche bunten Pillen gefunden und geschluckt hat. Ungekennzeichnete Medikamente, starke Beruhigungsmittel und Opioide in viel zu hoher Dosierung, das haben die polizeilichen Ermittlungen damals ergeben. Der Junge ist daran gestorben. Die Eltern haben Schwerdtfeger verklagt, weil er angeblich illegal Müll im Steinbruch abgeladen habe. Das Verfahren ist aber im Sande verlaufen. Es gab eine gütliche Einigung, die Eltern haben ihre Anschuldigungen zurückgenommen.«
»Wie lange ist das her?«
»Zehn Jahre.«
Lynn stöhnte leise. »Das ist eine lange Zeit.«
»Aber Karnath hat jetzt in dieser Sache recherchiert. Ich habe Spohr das ganze Material vorgelegt, doch es interessiert ihn nicht.«
Lynn dachte nach. Konstruierte Liam eine wilde Verschwörungstheorie? Oder hatte er den richtigen Riecher?
»Was erwartest du von mir?«
»Wirtschaftskriminalität fällt doch in euer Ressort. Ich dachte, du könntest da ein bisschen recherchieren. Wenn es stimmt und Schwerdtfeger wirklich unsaubere Geschäfte gemacht hat …«
»Dann?«
»Ist Karnath vielleicht ermordet worden, weil er dabei war, einen Skandal aufzudecken.«
»Ich denke, Schwerdtfeger ist tot.«
»Ja. Aber so was macht man ja nicht allein. Da muss es Helfer geben und Mitwisser. Irgendjemanden, für den vielleicht die Karriere auf dem Spiel steht. Und für die Pläne der Söhne wäre es wahrscheinlich auch der K.o., wenn sich herausstellt, dass sie ihren Ferienpark auf einer geheimen Giftmülldeponie errichten wollen.«
Lynn schloss das Fenster mit Karnaths Homepage und blickte auf ihre To-do-Liste. Jede Menge langweiliges Zeug. Vielleicht hatte Liam ja recht, und hinter Karnaths Tod steckte mehr, als sein Vorgesetzter sehen wollte? Und falls nicht, wäre die Beschäftigung mit dem Fall zumindest eine Abwechslung. Lynn schaute aus dem Fenster auf das feuchte Grau hinter der Scheibe und öffnete dann ihre Wetter-App auf dem Rechner.
Heute würde sich der Nebel nicht mehr lichten, doch für den nächsten Tag war gutes Wetter angesagt. Fünf Grad wärmer als heute und nur leicht bewölkt. Lynn stellte sich vor, wie die Sonne Wiesen und Felder in ein weiches Licht tauchte. Der Taunus sah zu dieser Jahreszeit fantastisch aus.
Sie könnte Sabine fragen, ob sie Lust hätte, sie zu begleiten. Ein kleiner Ausflug, so wie letztes Jahr zum Edersee, nur mit Frühlingsgrün statt Schneeregen. Sie könnten unterwegs etwas essen, ein bisschen plaudern, an die Gespräche vom letzten Jahr anknüpfen. Lynn begann sich für den Gedanken zu erwärmen.
»Okay«, sagte sie. »Ich höre mich ein wenig um. Aber versprich dir nicht zu viel davon. Spohr mag ein unsympathischer Säufer sein, trotzdem ist er ein guter und erfahrener Ermittler, das hast du selbst gesagt.«
»Du machst es?« Sie konnte hören, wie Liam sich freute, und das hob ihre Stimmung. Nach dem Unfall war er in ein tiefes Loch gefallen. Wenn sie etwas unternehmen konnte, um ihm zu helfen, tat sie das gerne.
»Für dich«, sagte sie warm. »Auch wenn ich nicht glaube, dass etwas dabei herauskommt.«
»Danke, Schwesterherz«, entgegnete Liam ernst. »Das bedeutet mir viel, weißt du? Dass du an mich glaubst.«
Die dunkle Wolke senkte sich bereits wieder über ihn. Lynn wollte lieber nicht in den Strudel geraten. Dafür war seine Therapeutin zuständig.
»Ich melde mich, wenn ich etwas habe«, sagte sie und verabschiedete sich rasch. Wieder fiel ihr Blick auf die To-do-Liste.
Eigentlich konnte sie es sich nicht leisten, die Arbeit liegen zu lassen. Aber es war auch nicht gut, immer nur vernünftig zu sein. Man musste dem Leben eine Chance geben. Und das würde sie jetzt tun.
Sabine Kaufmann freute sich. In den letzten Tagen hatte sie sich mit Widerwillen ins Büro geschleppt und durch die liegen gebliebene Arbeit gekämpft. Ein umfangreicher Abschlussbericht, dazu die letzte Besprechung zu einem Fall, der nicht nur Energie gekostet hatte, sondern auch psychisch belastend gewesen war. Das LKA hatte gegen einen Mädchenhändlerring ermittelt, der junge Frauen aus dem osteuropäischen Raum nach Deutschland schleuste und sie hier in die Prostitution zwang. Die Frauen wurden mit Gewalt gefügig gemacht.
Kaufmann und ihre Kollegen hatten wochenlang Vernehmungen und Verhöre geführt – mit den Frauen, die vor ihren Peinigern zitterten und kaum zu einer Aussage zu bewegen waren, und den Männern, die widerlich selbstgefällig und frei von jedem Unrechtsbewusstsein und Schuldgefühl waren. Sabine hätte nicht zu sagen gewusst, was schlimmer zu ertragen war. So viel sich gesellschaftlich auch geändert hatte, in diesem Milieu herrschten noch immer unerträgliche patriarchale Strukturen. Gegessen hatte sie in dieser Zeit kaum etwas, weil ihr ständig schlecht gewesen war.
Mehr denn je hatte sie sich eine Freundin gewünscht, mit der sie ihre Freizeit verbringen und den Schrecken teilen könnte. Aber da war niemand. Ein paarmal hatte sie mit Julia Durant telefoniert, doch so sympathisch sie sich auch waren, Julia war zu fern, um eine echte Freundin werden zu können. Der einzige Lichtblick waren die abendlichen Videochats und die Wochenenden mit Ralph gewesen. Nicht nur einmal wäre sie am Sonntagabend am liebsten bei ihm in Gießen geblieben, statt nach Wiesbaden zu ihren unerquicklichen Ermittlungen zurückzukehren.
Die Kollegen, mit denen sie zusammengearbeitet hatte, waren nett und engagiert, standen aber für abendliche Aktivitäten nicht zur Verfügung. Sie hatten alle Familien, um die sie sich kümmern mussten. Keiner hatte Zeit für ein Feierabendbier, und vermutlich wollte auch niemand nach Dienstschluss weiter über den Morast reden, in dem sie herumstocherten.
Sabine hatte oft an ihren letzten Fall mit Ralph am Edersee gedacht, an die erste und bisher einzige Zusammenarbeit mit ihrer jungen Kollegin Lynn Burger. Sie hatte gehofft, sie könnten Freundinnen werden, doch dann waren sie verschiedenen Teams zugeteilt worden. Lynn hatte an der Aufklärung eines komplizierten Wirtschaftsbetrugs gearbeitet. Ihre technischen Fähigkeiten waren dort gebraucht worden. Sabine hatte sie des Öfteren auf dem Flur gesehen – stets umringt von anderen jungen Kolleginnen und Kollegen, in angeregte Gespräche vertieft, mit einem Lächeln auf den Lippen.
Das war eben eine andere Generation. Fünfzehn Jahre Altersunterschied ließen sich nicht so einfach wegdiskutieren. Lynn hatte ihre Peer-Group, Sabine musste sich in ihrer eigenen Generation umsehen. Nur dass sie dort eben niemanden fand.
Umso erfreuter war sie gewesen, als Lynn am Nachmittag zu ihr gekommen war, nicht zu einem der Kollegen aus ihrem Team. Sabine war sofort bereit gewesen, die bedrückenden Berichte beiseitezulegen und sich Lynns Geschichte anzuhören.
Jetzt stand sie in ihrer Wiesbadener Neubauwohnung und packte ein paar Sachen zusammen. Lynn und sie hatten beschlossen, früh am nächsten Morgen loszufahren und zumindest eine Nacht zu bleiben. Es war nicht unbedingt nötig, weil es von Wiesbaden nach Thaldorf nicht weit war, aber der zentrale Ort in dem Fall, den Lynns Bruder bearbeitete, war der Dorfgasthof. Dort hatte die Schlägerei stattgefunden, die nach Ansicht von Liams Chef das ganze Drama ausgelöst hatte. Ihrer Erfahrung nach fanden die interessanten Gespräche in einem Gasthaus meist am späteren Abend statt, und dann wären sie vermutlich froh, wenn sie anschließend nicht mehr zurückfahren mussten.
3
Ralph Angersbach saß auf dem Sofa, das brandneue Tablet auf den Knien. Draußen vor dem Fenster war es dunkel, nur das gelbliche Licht der Straßenlaternen fiel herein. Es war ein krasser Kontrast zu dem hellen Sonnenschein auf dem Bildschirm.
Das Chatfenster zeigte einen weißen Strand, auf den die Wellen rollten, davor eine glückliche Familie unter blauem Himmel. Ralphs Halbschwester Janine, ihr Mann Morten und der sechs Monate alte Wayne. In Australien war es gerade Mittag.
Janine war vor drei Jahren dorthin gezogen, nachdem sie ihr Studium der Sozialpädagogik abgeschlossen hatte. Seitdem lebte sie mit Morten auf dem kleinen Weingut seiner Eltern in Mornington Peninsula Shire im Südosten von Melbourne und arbeitete auch dort, im Resozialisierungsteam der Stadt. Im November hatte sie ihren Sohn bekommen.
Angersbach freute sich für sie, während er zugleich bedauerte, dass die drei so weit weg waren. Aber in drei Wochen wollten sie nach Deutschland kommen, und Ralph würde seinen Neffen zum ersten Mal auf den Arm nehmen können.
»Wie geht’s dir?«, fragte Janine. Sie sah entspannt aus, glücklich. Braun gebrannt, die Haare von der Sonne gebleicht. Von der rebellischen Teenagerin, die er damals kennengelernt hatte, nachdem er sie zusammen mit dem Haus ihrer gemeinsamen Mutter in Okarben geerbt hatte, war so gut wie nichts übrig geblieben. Sie hatte aufgehört zu rauchen und zu trinken. Mit ihrer schwierigen Kindheit mit der alleinerziehenden, alkoholkranken und promiskuitiven Mutter hatte sie sich in einer Therapie erfolgreich auseinandergesetzt und dieses Trauma offensichtlich gut überwunden. Nur der Kampfgeist war geblieben. Noch immer setzte sie sich vehement für die Bedürfnisse der Schwachen, Benachteiligten und Gestrauchelten ein. Angersbach war stolz auf sie. Janine, die gerade mal halb so alt war wie er, hatte nicht nur die Kurve gekriegt, sondern einiges aus ihrem Leben gemacht. Mehr als er? Er schüttelte den Gedanken ab und beantwortete stattdessen ihre Frage. »Ach, gut eigentlich.«
Ralph hatte in den Wintermonaten erfolgreich ein paar Fälle gelöst, und drei Wochen zuvor war er vom Oberkommissar zum Kriminalhauptkommissar befördert worden. Der höhere Dienstgrad war längst fällig gewesen. Dass es so lange gedauert hatte, hatte nichts mit seiner Leistung zu tun, seine Vorgesetzten waren zufrieden mit ihm. Es hatte einfach keine freie Planstelle gegeben.
»Habt ihr gefeiert, Sabine und du?« Janine wusste von der Beförderung, Ralph hatte ihr sofort eine Nachricht per Messenger geschickt und ein paar Emoticons zurückbekommen. Einen strahlenden Smiley, eine bunte Wundertüte, einen Blumenstrauß. Nach wie vor fand er es ein wenig befremdlich, dass die jungen Leute einfach nur ein paarmal auf die Icons klickten, anstatt einen Text zu schreiben, doch langsam gewöhnte er sich daran. Dass er all diese Dinge überhaupt benutzte – Videochats, Messenger, den elektronischen Kalender und gelegentlich sogar ein digitales Notizbuch –, verdankte er Lynn, die so lange auf ihn eingeredet hatte, dass ein moderner Mann ohne diese Dinge nicht leben könne, bis er sich schließlich darauf eingelassen hatte. Und sie hatte recht behalten. Er fand die digitalen Medien wirklich außerordentlich praktisch. Statt zu telefonieren, konnte er Janine und ihre Familie jetzt sehen. Das gefiel ihm.
»Nicht wirklich«, beantwortete er Janines Frage. »Sabine war nicht in der Stimmung. Sie hatte diesen Mädchenhändlerfall, der sie ziemlich mitgenommen hat. Ihr war ständig schlecht. Es hätte wenig Sinn gemacht, schick essen zu gehen. Sie hätte ohnehin nichts heruntergebracht.«
Janine legte den Kopf schief. »Wieso? Ist sie schwanger?«
»Was?« Ralph bekam einen Schreck. »Nein. Ich sage doch, der Fall hat ihr auf den Magen geschlagen.«
»Hast du sie mal gefragt, ob sie ihre Periode hat?«
Angersbach hatte plötzlich einen pelzigen Geschmack auf der Zunge.
»Nein.« Das war kein Thema, das er von sich aus anschneiden würde. Diese ganze Sache war ihm unangenehm. Schlimm genug, wenn Sabine ihn bat, ihr Tampons oder Binden aus dem Supermarkt mitzubringen.
»Aber ihr benutzt keine Kondome, oder?«
Ralph schluckte. Was war das denn plötzlich für ein komisches Gespräch?
»Äh … Nein«, sagte er.
Morten stieß Janine lachend an. »Hör mal. Das sind intime Details. Das geht uns nichts an.«
Janine wandte ihm den Kopf zu. »Ralph ist mein Bruder.«
»Aber wir erzählen ihm doch auch nichts über unser Liebesleben«, bemerkte Morten sanft.
»Das ist ja auch nicht nötig.« Janine schaukelte ihren Sohn auf dem Arm. »Man sieht am Ergebnis, dass wir eines haben. Und dass wir keine Kondome benutzen.«
Wayne wand sich auf ihrem Arm und krähte.
»Ja, mein Schatz«, sagte Janine auf Englisch. »Du bekommst gleich die Brust.«
Auch das wollte Ralph lieber nicht sehen. Er überlegte, wie er dem Gespräch entkommen könnte, das mit jedem Satz unangenehmer wurde.
Zum Glück klingelte sein Smartphone.
»Wartet mal kurz.« Ralph angelte das Gerät vom Couchtisch. Auf dem Display stand KDD, die Abkürzung für Kriminaldauerdienst. »Sorry«, sagte er zu Janine und Morten. »Das ist dienstlich. Ich muss Schluss machen.«
»Gib’s zu, du bist froh darüber«, spottete Janine freundlich. »Aber glaub nicht, dass das Thema damit vom Tisch ist. Ich komme darauf zurück. Und wenn du mir nichts sagst, dann frage ich halt Sabine. Die ist nicht so einsilbig wie du. Mach’s gut!« Morten und sie winkten in die Kamera, dann wurde das Display des Tablets schwarz.
Angersbach stöhnte und nahm den Anruf entgegen.
»Krüger, KDD«, meldete sich eine kernige Männerstimme am anderen Ende. »Tut mir leid, dich so spät am Abend zu stören, Kollege, aber wir haben einen Toten.«
»Na ja, Job ist Job«, entgegnete Ralph. »Wer und wo?«
»Der Tote heißt David Hoffmann. Vierundfünfzig Jahre alt, ledig. Meldeadresse in Wiesbaden. Keine Vorstrafen.«
»Todesursache?«
»Ein Dolchstoß.«
»Wie bitte?«
»Nein, kein Dolch«, korrigierte sich der Beamte. »Präzise gesagt war es ein Korbschläger.«
»Ein was?«
»Ein Korbschläger. Das ist ein schmaler Säbel, dessen Griff von einem Metallkorb geschützt wird. Es gibt auch Glockenschläger, da ist der Schutz eine Halbschale aus Metall.«
Ralph grunzte. Das alles klang so absurd, dass er Mühe hatte zu folgen.
»Der Tote war Mitglied einer Burschenschaft. Er ist bei der Mensur gestorben«, fügte der Beamte vom KDD hilfreich hinzu.
Angersbach musste kurz überlegen, dann fiel es ihm ein. Die Mensur war der traditionelle Fechtkampf in einer sogenannten schlagenden Verbindung. Studenten, die in einem auf Außenstehende recht antiquiert wirkenden Ritual ihre Kräfte maßen. Eventuelle Blessuren, meist Schnittwunden im Kopfbereich, trug man mit Stolz zur Schau. Aber ernsthafte Verletzungen?
»Gibt es da nicht feste Regeln und eine Schutzausrüstung, die so etwas verhindern sollen?«
»Normalerweise schon. Da ist wohl was schiefgegangen.«
»Also war es ein Unfall?«
»Das behaupten die Zeugen. So oder so muss sich das jemand ansehen. Der Exitus durch einen Hieb mit dem Korbschläger fällt ja auf keinen Fall unter die natürlichen Todesursachen.«
Angersbach ahnte, dass sich der Kollege die Sache am liebsten selbst angeschaut hätte. Vermutlich beneidete er die Beamten, die vor Ort waren, während er selbst Telefondienst schieben musste.
»Okay. Wie heißt die Verbindung? Und wo finde ich sie?«
»Corps Ludoviciana« Der Kollege nannte die Adresse. »Ein Team von der Spurensicherung und Professor Hack von der Rechtsmedizin sind schon unterwegs.«
»Bestens. Danke.« Ralph drückte das Gespräch weg. Er war froh, dass Wilhelm Hack noch immer seinen Dienst versah, obwohl er mittlerweile das Rentenalter erreicht hatte. Seinem Verlängerungsantrag hatte man sofort stattgegeben. Hack war eine Koryphäe. Obwohl er nur ein Auge hatte, sah er schärfer als jeder andere Kollege. Angersbach arbeitete gern mit ihm zusammen. Hack war auch einer seiner wenigen Freunde. Wenn man das überhaupt so nennen konnte. Ralph war nicht besonders gut darin, Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen.
Er öffnete den Messenger und schickte Sabine eine Nachricht, dass er sie heute nicht zur üblichen Zeit anrufen konnte, weil er einen Fall hatte. Dann machte er sich auf den Weg.
Eine halbe Stunde später parkte Ralph Angersbach seinen Lada Niva vor dem Verbindungshaus. Es war eine stattliche Villa mit weißer Stuckfassade. Auf dem Dach wehte eine Fahne mit den Farben der Burschenschaft, Grün, Weiß und Gold. Die Auffahrt war von gelb leuchtenden Laternen gesäumt, die aus der Zeit gefallen wirkten. Sie erinnerten Angersbach an Filme aus dem letzten Jahrhundert. Lili Marleen fiel ihm ein. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor …
Der Garten war gepflegt. Akkurat gestutzte Büsche flankierten wie Soldaten die Auffahrt. Ralph sah dichte junge Blätter und Blüten. Im Laternenlicht wirkten sie fahl. Bei Tag musste es eine bunte Farbenpracht sein.
Sämtliche Fenster waren erleuchtet. Vor der Eingangstreppe standen mehrere Fahrzeuge. Polizei, Rettungsdienst, der Wagen der Spurensicherung und der rote SUV, den Wilhelm Hack sich vor ein paar Jahren zugelegt hatte.
Angersbach stieg aus, lief die Stufen hinauf und zeigte dem uniformierten Kollegen, der den Eingang bewachte, seinen Ausweis.
»Ganz oben«, erklärte der Beamte. »Auf dem Paukboden.«
Wieder musste Ralph in seinem Gedächtnis kramen. Pauken hieß es, wenn mit stumpfen Waffen für die Mensur geübt wurde. Das Training fand meistens auf dem Dachboden statt, der deshalb Paukboden genannt wurde.
Er bedankte sich und trat ins Haus.
Der Anblick war, gelinde gesagt, überraschend.
Ralph fand sich in einer großen, hell erleuchteten Eingangshalle. Von der stuckverzierten Decke hing ein riesiger Kronleuchter. An den Wänden Urkunden, Säbel und grün-weiß-goldene Fahnen. Doch das war es nicht, was ihn verblüffte. Es war das Spalier, das die Anwesenden für ihn bildeten. Fünfzig, vielleicht auch sechzig Männer unterschiedlichen Alters mit ernsten, unbewegten Gesichtern. Alle im Anzug, mit farbigen Mützen auf dem Kopf und einer Binde in denselben Farben wie die Mützen quer über der Brust. Bei den Männern auf der rechten Seite waren die Mützen und Binden grün-weiß-golden, bei denen auf der linken Seite rot-blau-silbern. Die Männer standen stramm. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie bei seinem Eintreten salutierten. Hatten sie gewusst, dass er gerade jetzt eintreffen würde? Oder standen sie schon seit Stunden so?
Angersbach nickte abwechselnd zu beiden Seiten, weil er nicht wusste, was er sagen sollte. Rasch durchquerte er die Eingangshalle und eilte die weiße Marmortreppe hinauf.
In den beiden darüberliegenden Stockwerken traf er niemanden an. Auf dem Dachboden dagegen herrschte Gedränge.
Zwei Sanitäter tauschten mit einem uniformierten Kollegen Papiere aus und verabschiedeten sich dann. Der Mann, um den es ging, war tot, Rettungskräfte wurden nicht mehr gebraucht. Ralph spähte durch die offene Tür des Paukbodens. In dem riesigen Raum mit der hohen Decke tummelten sich etliche in weiße Schutzanzüge gehüllte Gestalten. Angersbach ließ sich von einem der Spurensicherer einen Anzug geben und kleidete sich ebenfalls ein. Dann betrat er den Paukboden.
Es war, als würde er eine Zeitreise antreten. Der ganze Raum war mit Holz vertäfelt, das im Licht der von der Decke hängenden Laternen golden glänzte. Es war sicher um die hundert Jahre alt und musste unzählige Male abgeschliffen, geölt und gewachst worden sein. Angersbach fühlte sich an das Innere eines historischen Segelschiffs erinnert.
Auf der einen Seite des Raums standen in einem hölzernen Ständer die Waffen, die ihm der Beamte vom KDD beschrieben hatte: schmale Säbel mit einem Metallkorb über dem Griff. Auf der anderen Seite befand sich die Garderobe, die ebenfalls aus altem, sorgfältig aufgearbeitetem Holz gezimmert war. An den Haken hingen dicke Armpolster, ähnlich wie bei einem Falkner oder Hundetrainer. Auf der Ablage darüber waren schwarze Metallhelme mit integrierten Gesichtsmasken aufgereiht, auf dem Regalbrett darunter lagen merkwürdig aussehende Schutzbrillen mit Metallplatten am Nasenbügel und dicke Handschuhe. An der Wand daneben gab es weitere Haken, an denen lange Kettenhemden auf Bügeln hingen. Wie die Rüstkammer eines Ritters, dachte Angersbach. Neben den Kettenhemden hatte jemand in weißer Kreide »Quält Euch« auf das Holz geschrieben und ein verschnörkeltes Symbol dazu gemalt, das Ralph nicht deuten konnte.
Er blickte sich weiter im Raum um und entdeckte endlich die Gestalt, die am Boden lag. Ein Mann, in gepolsterte Schutzkleidung und ein Kettenhemd gehüllt. Die Hände steckten in dicken Handschuhen. Nur der Kopf war frei. Die Brille mit der Metallplatte über der Nase, die er vermutlich getragen hatte, lag daneben. Das Gesicht des Mannes war von Blut bedeckt, die Nase, die seltsam schief aussah, mit Blut verkrustet.
Neben dem Toten kniete ein Mann im weißen Schutzanzug, der jetzt den Kopf hob. Es war Professor Wilhelm Hack, der Rechtsmediziner. Hackebeil, wie man ihn hinter vorgehaltener Hand nannte, wegen seines raubeinigen Charmes und der scheinbaren Ungerührtheit, mit der er seine Arbeit verrichtete.
Hackebeil musterte Ralph mit dem gesunden Auge. Das andere, unbewegte, war aus Glas. Das echte hatte er vor Jahren in irgendeinem Kriegsgebiet verloren, in Afrika oder im ehemaligen Jugoslawien, wo Hack lange Jahre gearbeitet hatte. Genau wusste Angersbach es nicht. Hack sprach nie über den Verlust des Auges. Nur über dessen Fehlen machte er gelegentlich Scherze. Ralph bewunderte ihn dafür. Er selbst hätte mit einer solchen Behinderung nicht so souverän umgehen können, dachte er.
»Angersbach«, tönte Hack. »Schön, dass Sie auch schon da sind. Haben wir Sie beim Feierabendbier gestört?«
»Nein. Beim Videochat mit Janine«, erwiderte Ralph abwesend, während er den Toten musterte.
»Wie geht es ihr denn?«, erkundigte sich Hack. »Alles im Lot mit dem Kleinen?«
»Alles bestens. Sie kommen in drei Wochen nach Deutschland und besuchen uns.«
»Dann sollten Sie zusehen, dass Sie bis dahin mit diesem Fall fertig sind«, knurrte der Rechtsmediziner.
Ralph nickte. Hack hatte recht. Es wäre gut, wenn er sich ein paar Tage Urlaub nehmen könnte. Er deutete auf den Toten. »Was ist da passiert?«
Der Rechtsmediziner stemmte sich hoch. »Der Korbschläger hat sich bei der Mensur unter dem Nasenblech verfangen und ist ins Gehirn eingedrungen.«
Angersbach griff sich unwillkürlich an die Nase und drückte sich dabei ungewollt die Schutzmaske vor die Atemwege. Rasch zupfte er die Maske wieder zurecht und atmete tief ein. Die Vorstellung, wie sich so ein Säbel zwischen den Augen in den Kopf bohrte und das Gehirn perforierte … Ralph war mit Leib und Seele Polizist, aber sich die Folgen brutaler körperlicher Gewalt anzusehen, schlug ihm noch immer auf den Magen. Deshalb machte er auch um die Obduktion einen großen Bogen, wann immer es möglich war. Meist war es das jedoch nicht.
»Kein schöner, aber vermutlich ein schneller Tod«, erklärte Hackebeil. »Ich erspare Ihnen die Details. Fakt ist, dass jede Hilfe zu spät kam. Der anwesende Arzt konnte nichts mehr ausrichten.«
Angersbach blinzelte. »Es war ein Arzt anwesend?«
Hack sah ihn nachsichtig an. Das gesunde Auge blitzte. »Bei der Mensur ist immer mindestens ein Arzt anwesend. In den meisten Fällen hat jeder Paukant seinen eigenen. Hier nicht, aber man hat das nicht als Problem betrachtet. Unter den Anwesenden ist eine ganze Reihe von Ärzten, und der Paukarzt hat reichlich Erfahrung.«