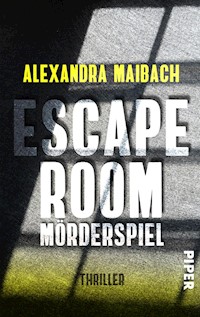2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die große Liebe: tot. Die Mentorin: verhaftet. Assistenzarzt Rob ermittelt. Für Fans der Medizin-Thriller von Tess Gerritsen und Ursula Poznanski »Klinischer Tod – das bedeutet einen Stillstand des Herz-Kreislauf-Systems. In der Medizin ist das kein endgültiger Zustand. Für Selina schon. Ihr Herz ist für immer stehen geblieben.« Als Kinderärztin Selina ihre erste Nachtschicht nicht überlebt, deutet zunächst alles auf Suizid hin – nur der junge Chirurg Rob, der in sie verliebt war, glaubt nicht daran. Kurz darauf gerät seine Oberärztin und Mentorin unter Mordverdacht und Rob droht, alles zu verlieren. Er beginnt, unangenehme Fragen zu stellen, und bald kommen Geheimnisse ans Licht, die besser im Verborgenen geblieben wären. Denn jeder im Krankenhaus hat etwas zu verbergen, und nicht alle waren Selina wohlgesonnen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder realen Personen sind rein zufällig.
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Tödliche Nachtschicht« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Michaela Retetzki
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für mein Teamund alle die, über die ich nicht schreibe.
1
Jetzt
Es ist kurz vor halb zwei, als ich aus dem OP komme. Ich habe mich vorschriftsgemäß umgezogen und die grüne Bereichskleidung, die wir in den Operationssälen tragen, wieder gegen die blaue Kluft der Notaufnahme eingetauscht.
Die Operation hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Obwohl wir vor mittlerweile über einer Stunde den letzten Schnitt genäht haben, fühle ich mich noch immer leicht und zufrieden – und wacher, als irgendjemand um diese Uhrzeit sein sollte.
Das Diensttelefon war glücklicherweise während der letzten drei Stunden still, sodass ich nicht vom OP-Tisch abtreten musste. Auch jetzt kündigt sich nichts an. Ich mache mich trotzdem auf den Weg zur Notaufnahme, um dort vorbeizusehen, bevor ich mich in mein Bereitschaftszimmer zurückziehe.
Das Licht im Stützpunkt ist gedämmt, und ich brauche nur einen kurzen Blick auf den Bildschirm, um zu wissen, dass ich mich hinlegen kann. Obwohl das Wartezimmer voll ist, habe ich keine Patienten. Was auf die anderen Fachrichtungen nicht zutrifft.
Ich runzle die Stirn. »Was ist denn bei euch los?«
Sarah, die unfallchirurgische Dienstärztin, die einen Sitzplatz weiter einen Bericht tippt, winkt ab und reibt sich die Stirn. Sie hat die dunkelbraunen Haare zu einem Knoten hochgebunden, der sich halb aufgelöst hat. »Frag nicht. Schlägerei in einer Kneipe. Das Übliche halt.«
Ich erinnere sie nicht daran, dass heute Dienstag ist. Schlägereien müssen keinen bestimmten Wochentag haben, aber am Wochenende häufen sie sich. Der Bildschirm verrät mir, dass zwei der Patienten bereits in Behandlung sind, während drei weitere im Wartebereich sitzen. »Soll ich dir helfen?« Ich tippe auf den Bildschirm. »Die Platzwunde könnte ich schnell für dich nähen.«
Sarah wirft mir einen raschen Seitenblick zu. »Das mache ich schon. Geh schlafen. Du kommst doch gerade aus dem OP, nicht wahr?«
Ich nicke. »Perforierte Divertikulitis.«
Sie verzieht das Gesicht. »Nein danke, das wäre nichts für mich. Wobei du ein echter Glückspilz bist, Rob. Es gibt nicht viele Leute, die in den Nächten operieren dürfen, wenn sie eigentlich Hausdienst haben. Wie machst du das?«
»Ich darf das, weil ich einfach unwiderstehlich bin«, sage ich mit einem Grinsen. »Das solltest du mittlerweile wissen.«
»Wie auch immer«, erwidert sie und verdreht die Augen, während sie darauf wartet, dass ihr Bericht gedruckt wird. »Gute Nacht.«
»Keine Platzwunde?«
»Keine Platzwunde. Geh schon schlafen. Falls du Selina siehst, kannst du sie von mir gegen das Schienbein treten. Ich hatte vorhin eine Vierzehnjährige, die sie hätte mitbeurteilen sollen. Leider habe ich sie nicht erreicht.«
Das ist seltsam. Selina hat heute ihren ersten Nachtdienst als Assistenzärztin der Kinderheilkunde und war so nervös wie kaum jemand, den ich kenne. Schwer vorzustellen, dass sie nicht an ihr Telefon geht. »Vermutlich gab es einen Notfall auf Station.«
»Vermutlich.« Sarah hebt die Schultern und geht los, um ihren Patienten zu entlassen.
Ich werfe einen letzten Blick auf den Bildschirm. Sonst gibt es nichts zu tun. Ich fühle mich zwar noch immer zu wach, um mich hinzulegen. Trotzdem kann es nicht schaden, zum Bereitschaftszimmer hochzugehen. Mein Abendessen ist vorhin ausgefallen, das könnte ich jetzt nachholen, auch wenn ich keinen Hunger habe.
Unsere Bereitschaftszimmer liegen im fünften Stock des Gebäudes, direkt unter dem Dach. Im Sommer wird es brütend heiß dort oben, im Winter dagegen viel zu kalt. Meine Kollegen beschweren sich häufiger über die schlechten Matratzen oder die unmöglichen Kissen. Ich spare mir meistens Beschwerden darüber. In Diensten schläft man nicht annähernd oft genug, als dass das wirklich ein Problem darstellen würde.
Mein Atem geht schneller, als ich im fünften Stock ankomme. Meine Gedanken sind wieder zu Selina gewandert. Sie hat mich vorhin noch gefragt, wie lange der Akku unserer Diensthandys hält. Selbst wenn sie Sarahs Anruf verpasst hat, zurückgerufen hätte sie in jedem Fall. Es sei denn, es hätte einen ernsthaften Notfall gegeben. Einen wirklich ernsthaften, den man niemandem wünscht. Schon gar nicht jemandem, der seinen ersten Dienst hat.
Die Bereitschaftszimmer befinden sich alle auf dem gleichen Flur. Bad mit Dusche gibt es nur eines, aber immerhin sind die Toiletten für Männer und Frauen getrennt.
Dafür, dass man ganz oben im Haus ist, erinnert der düstere Gang stark an einen Keller. Als hätte die Klinikleitung entschieden etwas dagegen, dass wir hier Zeit verbringen. Was vermutlich durchaus der Fall ist.
Mein Zimmer ist eines der vorderen, mit dem Schild Bereitschaft Allgemeinchirurgie versehen. Ich schiebe den Schlüssel ins Schloss, dann halte ich inne. Sehe ans Ende des Flurs, zu dem Zimmer, in dem Selina heute Nacht schläft. Falls sie überhaupt ein Auge zutun kann. Es ist so dämmrig, dass ich den breiten Lichtstreifen sehe, der an ihrer Tür nach draußen fällt.
Ich runzle die Stirn. Warum ist die Tür offen? Da kann etwas nicht stimmen. Ich mache einen Schritt darauf zu.
In diesem Moment schrillt ein Telefon, und ich zucke zusammen. Taste nach meiner Brusttasche. Doch es ist nicht mein Handy, das klingelt. Das Geräusch kommt aus Selinas Zimmer. Der Ton zerrt an meinen Nerven, während ich darauf warte, dass sie den Anruf annimmt. Doch es klingelt weiter. Noch einmal. Und noch einmal.
Dann bin ich bei Selinas Zimmer, stoße die Tür ganz auf. Meine angespannten Kiefermuskeln brauchen einen Moment, bis sie gehorchen. »Selina?«
Nur das Klingeln des Telefons antwortet.
Ich betrete das Zimmer. Es ist winzig, genauso wie meines. Ein Schrank, der quer steht und mir den Blick aufs Bett verstellt. Doch ich kann Selinas Füße auf der Matratze sehen, die dahinter hervorragen. Sie trägt ihre pinken Sneakers, hat sie nicht ausgezogen, bevor sie sich hingelegt hat.
Das Telefon klingelt erneut. Wieso geht sie nicht endlich dran?
Mit zwei Schritten bin ich beim Bett. Das Schrillen des Handys verblasst zu einem Hintergrundgeräusch.
Da ist Blut, das die Bereichskleidung durchtränkt. Viel Blut. Die Welle von Panik trifft mich vollkommen unerwartet, doch gleichzeitig schaltet mein Gehirn in den Notfall-Modus. Ich schnappe mir das Diensttelefon vom Nachttisch und nehme den Anruf an, ohne einen Blick auf den Bildschirm zu werfen.
»Dr. Wieck – wir versuchen schon …«
Ich schneide der Anruferin das Wort ab. »Hier Schlenker von der Chirurgie. Ich habe hier einen Notfall; bei den Dienstzimmern. Rufen Sie sofort die Rea-Hotline an. Ich brauche den diensthabenden Anästhesisten hier.«
»Aber …«
»Sofort.«
Das Handy klappert auf den Boden, als ich nach Selinas Puls suche. Doch da ist keiner. Da ist keiner.
Ich packe sie am Kasack und zerre sie auf den Boden, runter von der weichen Matratze. Ihr Körper ist leicht, noch leichter, als ich erwartet hatte. Mit der Schere aus meiner Tasche zerschneide ich mühelos den Stoff ihres Kasacks und wickele ihn notdürftig um Selinas linken Unterarm, an dem eine lange Wunde klafft. Ebenso wie an ihrem anderen Unterarm. Ich zerschneide auch das Top, das sie darunter trägt, um es um den rechten Schnitt zu wickeln.
Aus den Verletzungen rinnt noch immer Blut, doch es ist wenig. Zu wenig, wie mein Instinkt mir sagt. Ich bin zu spät. Für all das hier. Doch das ändert nichts.
Nachdem ich ihre Brust freigelegt habe, beginne ich mit der Herzdruckmassage. Versuche, nicht auf die hartnäckige Stimme in meinem Kopf zu hören, die nicht aufhört, mir zu sagen, dass zu viel Blut auf dem Bett und auf dem Boden ist, als dass ich einen anständigen Ersatzkreislauf zustande bekommen würde.
Als das Reanimationsteam ins Zimmer kommt, kann ich nicht sagen, ob Sekunden oder Minuten vergangen sind. Ich hätte Dankbarkeit empfinden müssen, dass sie hier sind, doch da ist nichts. Ich bin mittlerweile lang genug dabei, um zu erkennen, wann ein Patient verloren ist. Selbst wenn wir ihn noch nicht aufgegeben haben.
Ich mache weiter.
»Sie ist zentralisiert«, sage ich zu Peter, dem Anästhesisten. Gerade war er noch bei uns im OP, hat unsere Patientin aus der Narkose geholt. Hat mit den OP-Pflegern und mir Witze gerissen. »Sie braucht einen zentralen Zugang.«
Kurz begegnen sich unsere Blicke, und mir gefällt seiner nicht. »Intraossärer Zugang«, ordnet er mit beneidenswerter Gelassenheit an. Wahrscheinlich hat er Selina nicht gekannt. Er kann sie nicht gekannt haben. »Volumen. Defi.«
Danach dauert es nicht mehr lange, bis wir unsere Bemühungen aufgeben. Selinas Kreislauf ist nicht zurückgekommen. Sie ist nicht zurückgekommen.
Peter legt kurz die Hand auf meine Schulter, als es vorbei ist. Ich sollte ihm sagen, dass wir nicht aufhören dürfen. Ihn anschreien. Aber ich tue es nicht.
Ich bleibe einfach sitzen und halte Selina fest.
Versuche in den Kopf zu bekommen, dass sie tot ist.
Dass ich sie nicht retten konnte.
Vorher. Nacht des Todesfalls, 22:15 Uhr
Gegen zweiundzwanzig Uhr wurde es ruhiger. Ich hatte zwei Patienten mit entzündeten Gallenblasen aufgenommen und mit Antibiotikum versorgt, einen Abszess gespalten und einige Patienten mit Schmerzmittel versorgt und nach Hause geschickt. Ein paar davon würden sich morgen wieder zur Kontrolle vorstellen müssen. Glücklicherweise war das dann nicht mehr meine Aufgabe. Der Nachtdienst ging vom frühen Abend bis zum nächsten Morgen. Ich war nun gute fünf Stunden im Dienst und lief mich gerade erst warm.
Ich ließ mich auf einen der Stühle fallen und zückte mein Diensttelefon.
»Wieso siehst du aus, als wärst du im Urlaub?«, fragte Jenny, die mich heute pflegerisch unterstützte. Ihre Haare hatten neuerdings rosa Spitzen, was sie jünger wirken ließ als Anfang zwanzig, besonders, wenn sie ihre Haare so wie heute zu zwei Zöpfen geflochten hatte. Sie stieß die Lehne meines Stuhls an, sodass ich mich einmal um meine Achse drehte. »Das ist doch nicht normal.«
»Vermutlich nicht«, erwiderte ich mit einem Grinsen. »Aber ich habe nun mal den schönsten Beruf der Welt.«
Ich schaffte es nicht, den Satz gänzlich ohne Ironie auszusprechen, und Jenny antwortete mit einem Lachen. »Du Träumer.« Damit ging sie in Richtung Kabine, um den nächsten Patienten zu versorgen.
Nicht meinen Patienten, wohlgemerkt. Es gab nur noch einen allgemeinchirurgischen Notfall auf meiner Liste, und den hatte ich schon gesehen, untersucht und Blut abgenommen. Fehlte noch ein weiterer diagnostischer Schritt. Ich tippte auf die Schnellwahltaste meines Telefons.
»Ja?«, meldete sich eine tiefe Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Ich habe immer das Gefühl, in einer Höhle anzurufen, wenn ich diese Nummer wähle«, erwiderte ich. »Und darin sitzt ein blasses Wesen, das kein Sonnenlicht gewohnt ist und allen Eindringlingen feindselig gegenübersteht.«
Ein Schnauben. »Ich lege gleich wieder auf. Blass, du spinnst wohl, Rob. Außerdem arbeite ich.«
Genau diese Reaktion hatte ich erwartet. Finn Paoli, ein weiterer Assistenzarzt und guter Freund von mir, war heute als Diensthabender in der Radiologie zuständig. Wann immer ich eine CT-Untersuchung für einen Patienten wollte, musste ich das zunächst mit ihm besprechen. »Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Kriege ich ein CT Abdomen? Die Anforderung habe ich schon gestellt.«
Ein Brummen am anderen Ende der Leitung ertönte, als Finn im System nachsah, was ich angemeldet hatte. Ich vermutete bei meinem Patienten eine Entzündung des Darms, im schlimmsten Fall konnte sogar ein Durchbruch der Darmwand vorliegen. Um sicherzugehen, brauchte ich ein genaues Bild davon, dafür war Finn zuständig. In der Regel waren Radiologen zurückhaltend mit CT-Aufnahmen, die in der Nacht gemacht wurden. Ich wusste also bereits, was die nächste Frage sein würde.
»Und im Ultraschall hast du nichts gesehen?«
»Zu viel Luft im Bauch. Außerdem Adipositas.«
»Hm.«
»Komm schon«, sagte ich. »Der Patient hat eine starke Abwehrspannung, Punctum Maximum über dem linken Unterbauch, etwas geringer auch in den restlichen Quadranten. Gut möglich, dass der Darm perforiert ist. Das Labor spricht ebenfalls eine deutliche Sprache.«
»Ein guter Arzt könnte die Diagnose klinisch stellen.«
»Ein guter Radiologe macht einfach das Bild, bevor ein Oberarzt eingeschaltet werden muss.« Das Gespräch war scherzhaft, wir wussten beide, wie seine Entscheidung ausfallen würde. Finn und ich kannten uns seit dem ersten Jahr, im Gegensatz zu vielen Kollegen zogen wir nicht hinter dem Rücken des jeweils anderen übereinander her. Wir regelten das direkt – und stets mit einem Augenzwinkern.
»Gut. Du kriegst dein CT, Rob. Aber nur, wenn du lieb Danke sagst.«
»Danke, ich wusste, dass du kein blasser Höhlenmensch bist, Finn.«
Er antwortete mit einem unwirschen Ton. Ich hatte es nicht besser verdient. »Ich bringe dir später Kaffee vorbei.« Das würde ihn sicher versöhnen.
»Besser ist es.« Ich konnte seinem Tonfall anhören, dass er grinste. Dann war die Verbindung unterbrochen, ich schob mein Telefon zurück in die Tasche und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Bisher war der Dienst mehr als in Ordnung. Keine Fälle, die sich stapelten, keine Notfälle auf der Station und glücklicherweise auch keine Langeweile.
Ich schaltete zurück auf das Triage-Programm. Der letzte pädiatrische Patient war gerade entlassen worden. Aufmerksam sah ich mich um. Es dauerte nicht lange, bis ich diejenige entdeckte, nach der ich Ausschau gehalten hatte.
Selina Wieck kam aus Kabine 3, winkte ihrem kleinen Patienten zu, der die Hand seiner Mutter hielt. Mit einem Lächeln kam sie herüber zum Stützpunkt. Ihr dunkler Pferdeschwanz wippte bei jedem Schritt, und sie hatte sich ihr pinkes Stethoskop über die Schulter gehängt, selbst wenn das nicht gern gesehen wurde. Gerade das bisschen Rebellion, das man manchmal brauchte.
»Hi, Rob.«
Ich grinste sie an. »Hi. Du siehst ein wenig besser aus als vorhin. Und …«, ich sah demonstrativ auf die Wanduhr, »schon gute fünf Stunden überstanden. Habe ich es gesagt oder nicht?«
Sie gab mir einen Klaps auf den Oberarm, doch ich konnte sehen, dass sich ihre Wangen ein wenig dunkler gefärbt hatten. »Ja, du hast es gesagt, Herr Doktor. Willst du jetzt ein Lob?«
»Nein«, erwiderte ich. »Herr Doktor reicht vollkommen aus. Außerdem könntest du mich auf einen Kaffee einladen.«
Sie hob eine Augenbraue und pflückte sich das Stethoskop von der Schulter, um es mit einem Tuch zu desinfizieren. Es hatte den exakt gleichen Farbton wie das Shirt, das sie unter ihrem Kittel trug. »Jetzt sofort?«
»Vielleicht nicht gleich«, antwortete ich bedächtig. »Sagen wir – so in circa zwölf Stunden? Frühestens.«
Sie antwortete nicht sofort. Die Pause, die entstand, war gerade so lang, dass sie bedeutungsvoll war. »Ja, gern.«
»Ich hoffe, du hast etwas gegessen und getrunken.«
»Dazu bin ich noch nicht gekommen, um ehrlich zu sein, Herr Doktor.« Ihre Miene wurde schlagartig ernst. »Aber Rob …«
Das Klingeln meines Telefons schnitt ihr das Wort ab. Ich hob einen Zeigefinger, als ich die Nummer auf dem Bildschirm erkannte. »Eine Sekunde«, sagte ich zu Selina. »Die Chefin, da muss ich rangehen.«
Und ich beantwortete den Anruf. Obwohl ich nicht lange telefonierte, führten Selina und ich unser Gespräch nicht mehr zu Ende. Wir gingen niemals einen Kaffee trinken.
Erst später sollte mir auffallen, dass Selina ihren letzten Satz an mich nie vollendet hatte. Ich würde niemals wissen, was sie mir hatte sagen wollen.
2
Jetzt
Als Arzt ist man Blaulicht gewohnt. Nicht dass es etwas Angenehmes ist, meistens bedeutet es nämlich Arbeit. Als ich in der Von-Adelmann-Klinik anfing und meine ersten Schichten in der Notaufnahme ableistete, konnte ich keinen Krankenwagen sehen, ohne sofort an die Arbeit zu denken. Mich zu fragen, was auf die Kollegen zukommen würde, die gerade Dienst hatten.
Doch das Blaulicht, das in den frühen Morgenstunden den Vorplatz des Krankenhauses erleuchtet, ist keines, das uns Arbeit beschert. Keine orangen Neonfarben, auf denen die Lichtreflexe zucken, sondern Silber und Blau. Polizeiwagen.
Polizisten sind keine seltenen Gäste in der Notaufnahme. Doch diesmal sind sie nicht wegen einer Schlägerei hier oder um die Verletzten nach einem Unfall zu vernehmen. Diesmal sind sie wegen Selina hier.
Mein Diensthandy schrillt, und der Klang reißt mich brutal aus meinen Gedanken. Nach dem Fund der Leiche haben wir das Haus abgemeldet, was bedeutet, dass Krankenwagen uns nicht mehr ohne Weiteres anfahren können und eher die anderen Kliniken der Stadt ansteuern. Normalerweise geschieht so etwas nur, wenn man keine Betten mehr frei hat, um neue Patienten aufzunehmen. Heute, weil Selina Wieck tot ist. Selina, die ihren ersten Nachtdienst als Kinderärztin hatte.
Mit einer routinierten Bewegung nehme ich das Handy aus meiner Brusttasche und drücke auf den grünen Knopf. Selbst wenn die Notaufnahme abgemeldet ist, habe ich noch immer die Verantwortung für meine stationären Patienten. Zum ersten Mal, seit ich im Krankenhaus arbeite, wünsche ich mir, dass es ein Notfall ist. Akuter Bauchschmerz. Fieberanstieg bei einem unserer frisch operierten Patienten. Meinetwegen sogar eine Nachblutung. Mit all diesen Dingen komme ich klar.
Doch der Name, der auf dem Display erschienen ist, verheißt nichts Gutes. »Ja?«
»Rob«, sagt meine Oberärztin. Ihre Stimme klingt gepresst. So habe ich sie noch nie gehört. Auch nicht, wenn es im OP hart auf hart kommt. »Die Kollegen von der Polizei sind hier. Sie wollen dich vernehmen.«
Ich atme langsam und kontrolliert aus. Nachdem mich Peter aus Selinas Zimmer bugsiert hat, habe ich geduscht und mich umgezogen. Das schreckliche Gefühl hat sich jedoch nicht wegwaschen lassen. Zum wiederholten Mal versuche ich umzuschalten. Wieder professionell zu sein. Die Version von mir, die Angehörigen den Tod eines Patienten mitteilen kann, ohne mit ihnen zu weinen.
»Wohin muss ich?«
»Schaffst du das?«
Eine klare Frage, so wie ich es gewohnt bin. Es ist nicht lange her, dass sie mir zuletzt gestellt wurde. Rob, schaffst du das? Ich zögere kurz, bevor ich sie bejahe. Nur um mir ganz sicher zu sein. »Ja, ich schaffe das.«
Meine Antwort ist dieselbe wie die vorhin im OP. Doch diesmal ist sie eine Lüge.
»Gut. Wir sind in der Notaufnahme.«
Der Weg nach unten ist länger als sonst. Vielleicht liegt es daran, dass mit jedem Schritt mehr Details auf mich einströmen, die ich zuvor ausgeblendet habe. Selinas halb offen stehende Augen. Das blutbefleckte pinke Stethoskop auf dem Boden. Ihre kalte Haut.
Ich dränge eine Welle von Übelkeit zurück. Beschleunige meine Schritte und konzentriere mich auf meinen Atem. Konzentration ist das Wichtigste für einen Chirurgen, Rob. Alles Wissen und Fingerspitzengefühl bringt einem nichts, wenn man Flüchtigkeitsfehler begeht.
Anne wartet im Stützpunkt der Notaufnahme auf mich. Sie trägt Zivilkleidung, darüber ihren weißen Kittel. Diese Kombination habe ich noch nie an ihr gesehen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass ihre blonden Haare zu einem unordentlichen Zopf hochgebunden sind.
Dr. Anne Kittsteiner-Kochert ist nicht nur die jüngste Oberärztin des Klinikums, sie ist auch immer perfekt. Sowohl in ihrem Erscheinungsbild als auch im OP. Ich weiß, dass viele der anderen Assistenten sie fürchten und nicht ausstehen können, doch wir kamen von Anfang an gut klar. Seit ich im zweiten Jahr war, sind wir per Du.
Als sie mich sieht, kommt sie auf mich zu und legt mir eine Hand auf die Schulter. Sieht mir aufmerksam ins Gesicht. Nicht viel anders als vorhin, bevor sie mich fragte, ob ich operieren möchte. »Rob, geht es dir gut? Ich habe gehört, dass du sie gefunden hast.«
Ich nicke. »Ja.«
Ihr Griff an meiner Schulter verstärkt sich. »Schaffst du das?«
Diesmal fällt es mir nicht so leicht, zu lügen. »Und wenn nicht?«
»Dann rede ich mit ihnen.« Sie lässt keinen Zweifel daran.
»Wenn sie jetzt mit mir reden wollen, können sie das schon machen.« Mein Blick geht an ihr vorbei. Jenny steht mit einigen pflegerischen Kollegen beim Befundungsmonitor und sieht zu uns herüber. Auch Sarah ist bei ihnen.
Ich muss den Blick von ihnen abwenden.
»Sie wollten Peter, das Rea-Team und dich sogar auf dem Revier befragen«, fährt Anne ärgerlich fort. »Diese Polizisten haben keine Ahnung, wie ein Krankenhaus funktioniert. Was ein Dienstarzt ist.«
Beinahe hätte ich gelacht. Das kann ich niemandem vorwerfen. Ich könnte auch nicht sagen, wie der Nachtdienst der Polizei funktioniert. »Können wir das nicht hier machen?«
Der Bildschirm verrät, dass sich zwei neue Notfälle vorgestellt haben. Und diesmal betreffen sie mein Fach.
»Darum kümmere ich mich«, versichert Anne, die meinem Blick gefolgt ist. »Ich schaue mir die Patienten an, du sprichst mit der Polizei. Wenn das geht.«
Ich nicke. »Danke.«
Sie sieht mich streng an. »Am liebsten würde ich dich heimschicken, Rob. Nur würden die dann vermutlich auf die Idee kommen, morgen mit dir sprechen zu wollen. Am besten, du bringst es jetzt hinter dich.«
Ich nicke erneut und gehe in die Richtung, die sie mir gewiesen hat. Zwei nicht uniformierte Polizisten, ein Mann und eine Frau, die den Vorfall aufnehmen. Sie stellen sich als Kriminalpolizisten vor, doch ich bin momentan nicht in der Lage, mir ihre Namen zu merken. Zuerst gebe ich meine Personalien an, im Anschluss werde ich gebeten, den Vorfall zu schildern. Ich beschwöre mich einmal mehr, professionell zu sein. Meine Stimme klingt dünn, als ich schildere, wie ich Selina gefunden habe.
»Also haben Sie die Leiche gegen zwei Uhr gefunden?«, will der bärtige Polizist wissen.
»Nein«, erwidere ich. »Ich meine, ja. Sie war … es war keine …« Ich schaffe es nicht, das Wort Leiche auszusprechen. Lächerlich.
»Das Opfer hat noch gelebt, als Sie dazukamen?«
Ich lege meine Hände flach auf die Tischplatte. Heute sitze ich auf dem Stuhl, auf dem sonst der Patient Platz nimmt. Es fühlt sich vollkommen verschoben an. So wie dieses Gespräch. Wie können wir darüber sprechen, dass Selina tot ist?
»Sie war klinisch tot, das habe ich sofort überprüft«, erkläre ich. »Klinischer Tod – das bedeutet einen Stillstand des Herz-Kreislauf-Systems. In der Medizin ist das kein endgültiger Zustand.«
Der bärtige Polizist tauscht einen raschen Blick mit seiner Kollegin. Wahrscheinlich halten sie mich für irre, doch das macht mir nichts aus. Kein Detail an Selinas Tod darf unbedeutsam sein. »Ich habe versucht, sie zu reanimieren. Habe sofort den Rea-Alarm auslösen lassen.«
»Auslösen lassen?«
»Ja, ich habe dem Pflegedienst von Station fünf Bescheid gegeben.«
»Warum gerade dort?«
»Sie haben in dem Moment angerufen. Bei Selina.« Meine Stimme ist zu einem Flüstern geworden. Im Zimmer ist es kalt.
»Wir haben bereits von Herrn Dr. Seider genauere Informationen über den Verlauf der Reanimation.«
Von Peter also. Er muss ihnen gesagt haben, dass das ganze Unterfangen sinnlos war. Das war es nicht, aber meine persönliche Meinung spielt hier vermutlich keine Rolle. Es hat keinen Sinn, der professionellen Aussage eines Anästhesisten zu widersprechen.
»Sie kannten das Opfer näher?«
Ich hebe die Schultern. Nicht annähernd gut genug.
»Hat sie Ihnen gegenüber jemals lebensmüde Gedanken geäußert?«
Die Frage durchfährt mich wie ein elektrischer Schlag. Unwillkürlich richte ich mich auf. »Wie meinen Sie?«
Sie wechseln wieder einen Blick. »Wir haben … Grund zur Annahme, dass Frau Wieck Suizid begangen hat.«
Natürlich. Aufgeschnittene Handgelenke. Bisher habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, wie es geschehen ist. Als hätte die Tragödie, die Selinas Tod ist, alles andere ausgelöscht. Sogar das Warum. Vielleicht sogar gerade das Warum. Weil ich das momentan nicht aushalte.
Die Frage kann ich trotzdem beantworten. »Nein, sie hat mir gegenüber nie lebensmüde Gedanken geäußert. Weil sie keine hatte.«
Jetzt ist es die Polizistin, die die Augenbrauen hebt. »Und das wissen Sie, weil …«
Ich erwidere ihren Blick trotzig. »Ganz einfach. Sie hatte Angst.«
»Angst?«
Ich nickte. »Ja. Angst ist eine Form von Selbsterhaltungstrieb. Suizidale Personen haben einen solchen in der Regel nicht.«
Der Bärtige seufzt leise. »Gut, Herr Dr. Schlenker. Können Sie uns sagen, weshalb Selina Wieck Angst hatte? Und vor allem: wovor?«
Vorher. Tag des Todesfalls, 16:15 Uhr. Rob
Ich kam früh zu meiner Nachtschicht. In der Regel tat ich das. Obwohl ich tagsüber sozusagen freihatte, schaffte ich es nur selten, richtig abzuschalten. Deshalb versuchte ich auszuschlafen, was meistens nicht gelang, und plante in den Stunden bis zum Schichtbeginn so viele Termine wie möglich, die erledigt werden mussten. Der Tag nach dem Dienst war positiven Aktivitäten vorbehalten.
In den Minuten, die ich früher in der Klinik war, besuchte ich die Kollegen auf der Station und brachte mich auf den aktuellsten Stand. Außerdem hatte ich Zeit, meine Sachen in das Dienstzimmer zu bringen und das Bett zu beziehen. Es machte wenig Spaß, das mitten in der Nacht zu tun. Zudem die Zeit dann von den wertvollen Minuten abging, die man vielleicht schlafen konnte. Falls man so viel Glück hatte.
Unser Dienstzimmer war ein hässlicher kahler Raum mit einem uralten Fernseher und einer vollverglasten Wand, die einem im Sommer Hitze und im Winter Kälte bescherte. Die Vorhänge schirmten nicht einmal die Helligkeit der nächtlichen Stadt um die Klinik herum richtig ab, vom Lärm der Straße ganz zu schweigen. Trotzdem konnten wir uns mit diesem Dienstzimmer glücklich schätzen. Es war besser als das vieler Kollegen in anderen Häusern, von denen ich abenteuerliche Geschichten vom Schlafen im Keller auf ausrangierten Patientenbetten oder Isomatten auf dem Boden gehört hatte.
Ich war gerade fertig mit dem Beziehen des Betts, als ich eine Bewegung an der offenen Tür wahrnahm.
Selina war im Türrahmen aufgetaucht. Sie trug noch keine Krankenhauskleidung, ein seltsam ungewohnter Anblick. »Hi, Rob«, sagte sie. »Du hast heute Dienst?«
»Hi«, erwiderte ich. »Ja. Und du auch? Warte, es ist dein erster, oder?«
Ihr Lächeln verblasste. »Ja.«
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Noch eine gute halbe Stunde bis zum Dienstbeginn. »Willst du reinkommen? Mi casa es su casa und so?«
Sie nickte und trat über die Schwelle. Sah sich um. »Es ist kein schönes Haus, das du da hast.«
»Nein, nicht wirklich«, entgegnete ich mit einem Lachen. »Trotzdem wage ich zu behaupten, dass deines nicht wirklich besser ist. Oder bekommt ihr Kinderärzte irgendwelche Vorzüge? Ist euer Fach deswegen so beliebt?«
»Leider nicht«, erwiderte sie. »Wir haben genau das gleiche Zimmer. Nur dass es weiter hinten auf dem Gang ist.«
»Das ist schon ein Vorteil. So stapfen die Internisten nicht an deinem Zimmer vorbei. Ich habe mir sagen lassen, dass Marko heute Dienst hat. Der ist ein echtes Trampeltier.«
Diesmal lachte sie nicht, ihre Miene blieb angespannt, die Lippen ein schmaler Strich. Vielleicht war mein Ablenkungsmanöver etwas zu leicht zu durchschauen gewesen. Ich musste nicht fragen, was Selina belastete. Es war vollkommen offensichtlich. Sie hatte ihre Stelle seit knapp vier Monaten und trat nun ihren ersten Dienst an. Alle kinderärztlichen Patienten, die auf der Station lagen, waren in einer halben Stunde unter ihrer Obhut. Dazu kamen noch alle Patienten, die über die Notaufnahme hereinkamen. Sie hatte die Verantwortung für jeden einzelnen davon.
»Wie nervös bist du?« Sie antwortete nicht. Vielleicht hatte ich die Frage auch falsch gestellt. »Hast du etwas gegessen?«
»Heute Morgen«, murmelte sie.
Ich seufzte. »Ich hab was dabei. Es sind nur belegte Brote, aber du hättest was im Bauch. Später hast du keine Zeit mehr, etwas zu essen.«
Sie verschränkte die Arme. »Nein danke. Mir ist eher übel.«
Das konnte ich mir lebhaft vorstellen. Vor meinem ersten Dienst war es mir ebenfalls nicht besonders gut gegangen. Und ich hatte mir nichts zu essen mitgenommen, was ein echter Anfängerfehler gewesen war. Es war wichtig, die Grundversorgung dabeizuhaben. Manche Kollegen rückten an, als würden sie in einen Kurzurlaub fahren.
»Du kannst dir jederzeit was davon holen, wenn du willst«, sagte ich und nahm die Box aus meiner Tasche, um sie auf den Tisch zu stellen. »Ich könnte dir jetzt auch einfach sagen, dass du das locker schaffst. Dass du dir überhaupt keine Gedanken zu machen brauchst. Wirklich, das könnte ich.«
Das rang ihr ein kleines Lächeln ab. »Du hast es gerade.«
»Rein hypothetisch. Praktisch weiß ich, dass einem solche Floskeln nichts bringen. Aber ich weiß etwas, was dir etwas bringt.«
Jetzt sah sie mich an.
»Immer nur an das Hier und Jetzt denken. Wenn du an den ganzen Dienst denkst und daran, was alles passieren könnte, wirst du wahnsinnig.«
Selina nickte und blinzelte. »Danke, Rob. Ich gehe mal, um mein Zimmer herzurichten.«
»Klar«, erwiderte ich. Ihr war anzusehen, dass sie allein sein wollte. »Wenn was ist – gern auch später im Dienst –, ruf an.«
»Danke«, wiederholte sie, während sie mit eiligen Schritten aus dem Zimmer lief.
»Jederzeit«, setzte ich hinzu. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich gehört hatte. Vielleicht hatte sie zu schnell die Flucht ergriffen.
Jedoch nicht schnell genug, um ihre Tränen vor mir zu verbergen.
Jetzt
»Sie hat also geweint?«, fragt der bärtige Polizist.
»Ja.« Zuerst habe ich das als Zeichen von Nervosität gedeutet, jetzt bin ich mir plötzlich nicht mehr sicher. Gab es da mehr? Dinge, von denen ich nichts weiß?
Der Polizist errät meine Gedanken. »Gehen Sie davon aus, dass sie aus Anspannung geweint hat?«
Etwas in seinem Tonfall lässt mich aufsehen. Es ruft all die Befürchtungen in mir hervor, die ich nicht zu ahnen gewagt habe. Und jetzt muss ich sie aussprechen. »In dem Moment dachte ich das. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.«
Mein Gegenüber runzelt die Stirn, sieht mich auffordernd an.
»Hören Sie, Nachtdienste sind meistens voller stressiger Situationen. Gerade als Neuling ist man oft überfordert. Man muss auf einmal allein Entscheidungen treffen, die Folgen haben. Folgen für den Patienten und für einen selbst.«
»Gibt es dafür nicht einen sogenannten Hintergrunddienst? Der durch Oberärzte abgedeckt wird?« Die Polizistin steht noch immer ein Stück entfernt an den Schrank gelehnt, beobachtet mich jedoch genau. Wie es aussieht, haben sie sich schlaugemacht. Vielleicht sind sie auch nur von Anne ins Bild gesetzt worden.
Ich lehne mich zurück und verschränkte die Arme. »Ja, der Hintergrunddienst.« Ich kann mir ein ironisches Lächeln nicht verkneifen. »Lassen Sie mich Ihnen ein kleines Geheimnis verraten: Die meisten Oberärzte sind auch nur Menschen. Sie werden nicht besonders gern in der Nacht angerufen. Das ist eine … gewisse Hemmschwelle für Anfänger. Manche werden ungehalten, wenn man sie aus ihrer Sicht grundlos anruft. Manche gehen einfach nicht ans Telefon.«
Die beiden wechseln einen Blick. »Ist das nicht Vorschrift?«, fragt der Bärtige.
Ich hebe die Schultern. »Das sind Ruhezeiten ebenfalls. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass man manchmal ziemlich auf sich allein gestellt ist, wenn man Nachtdienst hat. Als Anfänger ist man schnell überfordert. Angst ist etwas Berechtigtes.«
»Dann denken Sie, dass Frau Wieck nicht qualifiziert für ihren Dienst war?«
Mein Körper ist zu erschöpft für den Ärger, den ich empfinden müsste. »Das habe ich nicht gesagt. Alles, was ich meinte, ist … Ihre Angst erschien mir in der Situation berechtigt.«
»Sie sagten, jetzt seien Sie sich nicht mehr sicher.«
Ich reibe mir die Stirn. Jetzt merke ich jede einzelne Stunde, die ich wach bin. »Ich kann Ihnen nicht sagen, ob etwas anderes dahintergesteckt hat. Aber ich kann es nicht ausschließen.«
»Etwas anderes? Wie der Wunsch zu sterben?«, schlägt die Polizistin vor.
»Nein. Selina war ein fröhlicher Mensch. Das hier war ihre Traumstelle, sie wollte sie unbedingt haben. Sie war glücklich.« Zumindest denke ich das. Ich hoffe es.
»Von außen betrachtet.«
Ich beiße die Zähne zusammen, balle die Hände zu Fäusten, um sie mühsam wieder zu lockern. Bedächtig lege ich sie dann auf den Tisch. Schön ordentlich, als würde ich im OP auf den Oberarzt warten. Zwinge mich zu einem Lächeln. »Von außen betrachtet.«
Es ist der Mann, der die Stille bricht. »Ich denke, wir haben genug gehört. Es war eine anstrengende Nacht für Sie, Herr Dr. Schlenker. Vielen Dank für Ihre Zeit.«
Er steht auf, doch ich bin noch nicht fertig. Da gibt es noch etwas, was ich sagen muss. Etwas, was ich lieber für mich behalten hätte, um es nicht aussprechen zu müssen. Weil die Polizistin mich danach vielleicht noch misstrauischer ansieht.
»Wir wollten uns heute auf einen Kaffee treffen.« Meine Stimme ist heiser.
Sie sehen mich stumm an.
»Selina und ich. Wir wollten heute einen Kaffee trinken gehen. Sie wollte nicht sterben.«
Zumindest hoffe ich das.
3
Jetzt
Die Trauerfeier findet am Freitag statt. Jemand hat bei der Planung mitgedacht und sie auf halb fünf gelegt, wenn die meisten von uns Feierabend haben und die planmäßigen Operationen durch sind.
Obwohl ich noch nicht einmal annähernd fertig mit der Stationsarbeit bin, komme ich nicht zu spät. Seit einer halben Stunde konnte ich mich nicht mehr konzentrieren und habe nervös auf die Uhr gesehen. Eigentlich war ich schon seit heute Morgen unkonzentriert. In den vergangenen Tagen habe ich mich auf die Arbeit gestürzt, immer froh, momentan auf der Station eingeteilt zu sein, wo es mehr als genug zu tun gibt.
Der erste Tag nach Selinas Tod war furchtbar gewesen. Das übliche erste High nach dem Dienst blieb aus, und die Stunden, die sonst rasch vorübergingen, zogen sich in die Länge, und jede einzelne setzte mir mehr zu als die vorangegangene. Trotz der schrecklichen Nacht sehnte ich mich nach der Klinik, nach der Arbeit. Doch heute ist Freitag, und zum ersten Mal seit Langem freue ich mich nicht auf das bevorstehende freie Wochenende.
Die Eingangshalle ist voller Stühle, vor der Glasfront ist ein Podium aufgebaut. Als ich ankomme, sind die meisten meiner Kollegen schon da. Wie üblich bleiben die Abteilungen unter sich. In der ersten Reihe entdecke ich die Kollegen der Kinderheilkunde, die sich um deren leitenden Oberarzt Dr. Ludger Kochert geschart haben. Der Chefarzt ist nirgendwo zu sehen. Wie erbärmlich.
Ich entdecke einige Kollegen meiner Abteilung im hinteren Abschnitt, direkt bei den Unfallchirurgen. Sarah hebt die Hand, als sie mich sieht. Sogar aus der Entfernung wirkt sie blass. Ich grüße zurück, mache aber keine Anstalten, zu ihnen zu gehen. Unmöglich kann ich so weit hinten Platz nehmen.
Direkt hinter den Kinderärzten sitzen einige Kollegen der Notaufnahme.
Jenny streckt die Hand nach mir aus, als ich näher komme. Ihre Augen sind rot und verweint, die Wimperntusche ist über ihr hageres Gesicht verschmiert.
»Habt ihr noch einen Platz frei?«
»Klar.« Sie hakt sich bei mir unter. Ich frage sie nicht, ob alles in Ordnung ist. Das wäre eine Farce. Jenny ist eine meiner Lieblingskolleginnen aus dem Notaufnahme-Team, sie ist immer für einen Witz zu haben, selbst wenn es noch so stressig ist. Es ist erschreckend, sie so zu sehen. Vermutlich gebe ich selbst ebenfalls kein besseres Bild ab.
Der Vorsitzende des Klinikvorstands tritt hinter das Mikrofon. »Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste«, beginnt er bedächtig. Jenny gräbt ihre Finger in meinen Arm und beginnt wieder zu weinen, und ich beiße die Zähne zusammen. Ich habe nicht vor, Tränen zu vergießen. Nicht hier. »Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Es sind Momente wie diese, in denen wir als Krankenhausfamilie enger zusammenrücken müssen.«
Ein Schnauben neben mir. Ich sehe mich um. Finn hat sich auf den freien Platz neben mir fallen lassen. Selbst er wirkt eigenartig fahl unter seinem dunklen Hautton. »Krankenhausfamilie, davon hast du viel Ahnung, du Anzugträger.« Er schenkt mir ein mattes Lächeln. »Sorry. Hey, Rob.«
»Hey«, erwidere ich, froh darüber, dass er gekommen ist. Als ich ihn gestern gefragt habe, war er nicht sicher, was ich verstehen kann. Immerhin hat er Selina kaum gekannt.
Der Klinikvorstand leiert eine Rede herunter, der ich nur abschnittsweise folgen kann. Man merkt ihm deutlich an, dass auch er Selina nicht gekannt hat. Als er durch den ärztlichen Direktor, den Chefarzt der Pathologie, abgelöst wird, stößt Finn ein kaum hörbares Seufzen aus.
»Geht das jetzt so weiter?«
Vermutlich. Ich hebe die Schultern. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Selina diese Veranstaltung gefallen hätte. Vielleicht hätte sie die Augen genauso verdreht wie Finn eben. Der Gedanke zaubert mir ein kleines Lächeln auf die Lippen. Nur so lange, bis mich die leeren Worthülsen des Redners wieder daran erinnern, warum wir hier sind.
Diesmal zwinge ich mich dazu, zuzuhören. Versuche, nicht auf die Neuankömmlinge zu achten, die noch immer hereinkommen und sich nun um die Sitzplätze herumgruppieren. Gerade betritt Anne den Raum, zusammen mit Dr. Hutter, einem anderen Oberarzt. Beide tragen ihren Kittel über der OP-Kleidung. Wir nicken einander kurz zu, dann richte ich den Blick wieder nach vorn.
Nach der Rede gibt eine ältere Frau am E-Piano ein Stück zum Besten, und ich beobachte, wie Anne in der ersten Reihe Platz nimmt, direkt neben Dr. Kochert, ihrem Mann, der den Stuhl neben sich frei gehalten hat. Sie sprechen kurz miteinander, bevor sie nach vorn sehen.
»Ich habe über sie gelästert«, sagt Jenny plötzlich. Sie hat die Stimme gesenkt, aber ich weiß nicht, ob die Umsitzenden uns trotzdem hören können. »An dem Abend, als … als sie sich umgebracht hat. Sarah und ich haben über sie gelästert, weil wir sie nicht erreicht haben.«
Sie beginnt wieder zu weinen, und ich klopfe ihr auf die Schulter. Was soll ich auch sonst tun? Mir liegt ein Widerspruch auf der Zunge. Es wäre richtig, ihr zu sagen, dass ich nicht an einen Suizid glaube. Dass Selina ihr Leben nicht selbst beendet hat. Doch am Ende würde das nichts bringen. Und es würde die Frage aufwerfen, was das bedeutet. Wenn sie sich nicht selbst getötet hat, hat es jemand anderes getan.
Ich schlucke und versuche mich auf die Musik zu konzentrieren. Jetzt lassen sich die Gedanken nicht mehr aufhalten, sie strömen ungefiltert auf mich ein. All das Gerede, das ich in den letzten Tagen überhört habe.
Eine halbe Ewigkeit später ist das Stück zu Ende und eine der Kinderärztinnen betritt das Podium. Ihr Name ist Louisa Homber. Die Sprecherin der pädiatrischen Assistenzärzte. Sie hat einen Zettel mit Stichworten dabei, ihren Kittel gegen einen Blazer getauscht. Sie streicht ihre perfekt sitzenden dunkelblonden Haare glatt und holt zittrig Luft. »Selina war nicht nur eine Kollegin«, sagt sie. »Sondern eine Freundin.«
Sie macht eine kleine Pause und sieht in die Runde. Mein Magen zieht sich zusammen. Louisa wirkt nicht wie eine trauernde Freundin, eher wie jemand, der genau diese Rolle spielt. Eine Schauspielerin, die vor dem Spiegel geübt hat. Ein klein wenig zu perfekt, um glaubwürdig zu sein.
»Jeder weiß, wie hart die erste Zeit hier ist. Wie allein man sich manchmal fühlt. Selina hat aus alldem das Beste gemacht. Sie hat sich nicht gescheut, unsere Hilfe anzunehmen.«
Jenny hat aufgehört zu weinen und starrt die Sprecherin an. Sie muss ähnlich denken wie ich. Ich würde sie gern fragen, doch das ist jetzt unpassend.
»Und gleichzeitig war sie immer für ihre Mitmenschen da. Hatte ein offenes Ohr für die Sorgen von anderen. Sie war eine empathische Ärztin. Beliebt nicht nur bei ihren Kollegen, sondern auch bei den Patienten. Ihr Tod …« Sie holt erneut tief und zittrig Luft, macht eine Pause, die sich unangenehm in die Länge zieht. »Ihr Tod ist eine Tragödie. Ein Verlust, nicht nur für das Krankenhaus, sondern ganz besonders für die Patienten. Für alle Menschen.«
Ein unterdrücktes Husten von Finn. Wir wechseln einen Blick.
»Selina, wir werden dich vermissen. Wir alle. Jeden Tag. Das hier ist für dich.«
Sie nickt und mehrere Kinder stehen auf. Sie stellen sich neben der Bühne auf und beginnen zu singen. Halleluja von Leonard Cohen. So unpassend die Rede war, noch schrecklicher ist das Lied. Ich beiße die Zähne zusammen und kämpfe mit den Tränen. Ein Seitenblick zu Finn verrät mir, dass es ihm ebenso geht. Jenny schluchzt längst wieder in ihr Taschentuch.
Danach hat noch eine Kinderkrankenschwester das Wort und im Anschluss eine der kinderärztlichen Oberärztinnen. Es ist eine junge Frau, die ich noch nie bewusst gesehen habe. Ihre Rede klingt genau wie die anderen, doch immerhin scheint sie von Herzen zu kommen.
Trotzdem bin ich enttäuscht. Ich brauche einen Moment, bevor ich weiß wieso. Keiner der Redner hat Selina gekannt. Niemand konnte etwas Persönliches sagen, weil niemand sie gekannt hat. Die Erkenntnis schnürt mir die Kehle zusammen.
Das Rücken von Stühlen auf dem Boden verrät, dass die Veranstaltung endgültig beendet ist. Ich stehe ebenfalls auf und strecke mich. Mein Blick fällt auf zwei dunkle Jacken inmitten der überwiegend weißen Dienstkleidung. Nicht nur die Farbe ist auffällig, sondern auch, dass sich die beiden Personen zielstrebig in Richtung Podium bewegen, anstatt wie die übrigen in Richtung Ausgang zu gehen.
»Ein paar von uns gehen heute etwas trinken«, sagt Finn gerade. »Wir wollen auf Selina anstoßen und ein bisschen reden. Wollt ihr mitkommen?«
Sein Blick gilt Jenny und mir, und ich muss mich dazu zwingen, ihn zu erwidern. Noch länger brauche ich, um zu antworten. »Keine Ahnung. Die Station macht sich nicht von allein.«
»Ich muss auch erst mal sehen, ob ich kann«, entgegnet Jenny.
»Ihr solltet kommen«, erwidert Finn, sieht dabei mich an. »Es werden einige Assistenten und wohl fast der ganze Pflegedienst von der Päd-Station da sein.«
»Hm«, sage ich. Mittlerweile habe ich die zwei Personen mit den dunklen Jacken identifiziert. Die beiden Kriminalpolizisten. Der Bärtige und seine Kollegin. Sie halten auf Dr. Kochert zu. Was könnten sie von ihm wollen?
Im nächsten Moment erkenne ich, dass sie nicht mit ihm sprechen.
»Wenn ich es schaffe, komme ich«, sage ich zu Finn und schiebe mich an ihm vorbei. »Bis später.«
»Rob«, ruft er mir hinterher. »Du weißt nicht mal, wo wir uns treffen.«
»Schick mir die Adresse.« Ich drehe mich nicht um. Meine Kehle ist noch immer wie zugeschnürt, doch diesmal hat es einen anderen Grund.