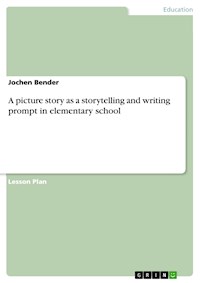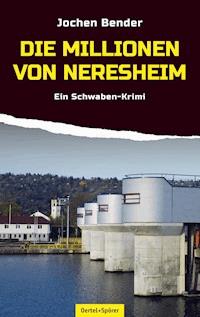Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel u. Spörer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vor einem Weinberghäusle im Cannstatter Zuckerle wird eine Leiche gefunden, die Todesumstände sind rätselhaft. Hurlebaus und Walter, die beiden Kommissarek, finden heraus, dass es sich bei dem Opfer um einen Lehrer handelt. Kurze Zeit später wird eine Schülerin aus seiner Klasse vermisst. Ist Kiara in der Gewalt von Kidnappern oder Kinderschändern? Die Kommissare ermitteln in verschiedene Richtungen, bis ein Kollege des toten Lehrers in Verdacht gerät. Weitere Spuren führen zu an Wiedergeburt glaubende Mittelalter-Fans, die am La-gerfeuer Geister beschwören. Bei der turbulenten Suche nach dem Täter tauchen Hurlebaus und Walter in eine andere Welt ein, die so gar nicht dem entspricht, was ihnen Tag für Tag begegnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jochen Bender
forschte als Psychologe bei den Kriminalisten, arbeitete im Knast und unterstützte die Polizei bei Amok-Übungen.
Mittlerweile sind von dem erfolgreichen Autor acht Krimis und zahlreiche Kurzkrimis veröffentlicht. Schreiben ist sein Weg, sich kreativ mit der Welt auseinander zu setzen. Seine Markenzeichen sind spannende Unterhaltung, ein flüssiger Schreibstil und kunstvoll ineinander verflochtene Erzählstränge.
Jochen Bender
Tödliches Cannstatter Zuckerle
Ein Schwabenkrimi
Oertel+Spörer
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden.Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel + Spörer Verlags-GmbH + Co. KG 2021Postfach 16 42 · 72706 ReutlingenAlle Rechte vorbehalten.Titelbild: © AdobeStock_maksymbondarenkoGestaltung: PMP Agentur für Kommunikation, ReutlingenLektorat: Bernd WeilerKorrektorat: Sabine Tochtermann Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-96555-090-2
Besuchen Sie unsere Homepage und informieren Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:www.oertel-spoerer.de
»A Zuckerle, a Zuckerle, des gibt mer doch koim Kend, denn kriagt des Kend a Zuckerle, ka’s sei, dass es verschwend.«
Stuttgarter Kinderspruch
Ich spüre seine Anwesenheit. Nach einer langen, nervenaufreibenden Jagd erfüllt mich seine Nähe mit Befriedigung. Bianca schlägt vor, das SEK zu rufen. Ich schüttele heftig den Kopf, woraufhin sie erneut den Mund öffnet. Um jegliche Diskussion zu stoppen, ziehe ich meine Waffe und entsichere sie. Die Wirtin bekommt große Augen, sackt in sich zusammen und kippt nach hinten. Mit beiden Händen klammert sie sich an der Theke der winzigen Rezeption fest. Ich nehme den Ersatzschlüssel und steige die Treppe hinauf. Um jeden Preis will ich eine Diskussion vermeiden, die ihn nur warnen würde.
Bianca flucht leise, zieht dann aber ebenfalls ihre Waffe und folgt mir. Ihre Hände zittern so stark, dass es sich auf ihre Pistole überträgt. Hoffentlich benötige ich keine Rückendeckung von ihr. Ohne den Vorfall wenige Stunden zuvor und ihre daraus resultierende Wut würde sie mir bestimmt nicht folgen. Ich schätze unser Risiko als gering ein, sind er und seine Begleitung doch die einzigen Gäste im Haus. Außerdem will ich die Sache hier und jetzt zu Ende bringen.
Die Stiege ist eng und dunkel. Ich versuche erst gar nicht, ein Knarzen der Stufen zu vermeiden, steige stattdessen lieber, als habe ich nichts zu verbergen, empor. Das Haus ist stilecht, die Zimmertüren sind uralt und besitzen keine Sicherheitsschlösser. Durch das Schlüsselloch spähe ich in den Raum. Nichts rührt sich. Vorsichtig stecke ich den Ersatzschlüssel hinein und drehe ihn behutsam um. Unwillkürlich halte ich die Luft an, aber das Schloss ist gut geölt und macht kaum ein Geräusch. Erst im letzten Moment ertönt ein leises Klicken. Sofort reiße ich die Tür auf. Mit der Waffe im Anschlag stürme ich in den Raum.
»Polizei! Sie sind verhaftet!«
Bianca folgt mir. Als ich unvermittelt stoppe, prallt sie auf meinen Rücken.
»Hey, warum …«, beginnt sie, ehe es ihr die Sprache verschlägt.
Im Bett liegt Händchen haltend ein Pärchen, ein Bär von einem Mann mit schwarzgrauem Bart, neben ihm eine schmale, deutlich jüngere Frau mit verhärmten Gesichtszügen. Er trägt einen schlichten, grob gewebten Kittel, sie ein grünes Samtkleid. In Kombination mit ihren altertümlich geflochtenen Haaren wirkt sie wie eine Zeitreisende aus einem anderen Jahrhundert. Bereits die Aufmachung der beiden ist auffällig, passt so gar nicht in unsere hektische Zeit. Noch viel weniger passen die in ihnen steckenden Pfeile. Aus beiden Körpern ragt auf Höhe des Herzens ein schwarzer Pfeil mit schwarz glänzenden Federn an den Schäften aus der Brust, gleichartige Pfeile sind durch ihre Augen in den Kopf eingedrungen.
»Was zum Teufel ist hier passiert!«
Bianca legt den Finger an die Lippen, zeigt mit den Augen auf eine nur angelehnte Tür, die vermutlich ins Bad führt. Mit der Pistole in ihrer Rechten zielt sie in Richtung der Tür. Vermutet sie, der Mörder versteckt sich dort?
Bianca steht näher an der Tür, ich bin der Mann. Also schreite ich an ihr vorbei in Richtung Badezimmer. Mit dem Fuß stoße ich die Tür auf, werfe einen raschen Blick in den Raum und gehe sofort wieder in Deckung. Kein schwarzer Pfeil zischt an mir vorbei, auch wenn ich eine schwarze, am Boden kauernde Gestalt gesehen habe. Erneut zeige ich mich, die Waffe im Anschlag.
»Polizei! Keine Bewegung!«, brülle ich.
Ich brauche einige Momente, um die Sinnlosigkeit meiner Worte zu begreifen. Dann stecke ich die Pistole in den Holster.
»Niemand drin?«, fragt Bianca, der ich den Blick ins Innere versperre.
»Doch.«
»Ist es …«
Ich höre ihre Stimme zittern, während sie es nicht übers Herz bringt, die Frage zu stellen.
»Nein!«
Sie schiebt mich beiseite, blickt an mir vorbei, reißt dann die Hände vor den Mund und stürmt Würggeräusche ausstoßend davon. Im Badezimmer kauert eine junge Frau, fast noch ein Kind, an die Wand gelehnt auf dem Boden. Ein schwarzer Pfeil drang zwischen Hals und Kinn in sie ein, aus ihrem Hinterkopf ragt die Spitze.
Begonnen hatte alles drei Wochen zuvor. Bianca und ich standen im Gewann Cannstatter Zuckerle in einem alten Weinberghäusle mit einem herrlichen Blick über rot und gelb gesprenkelte Reihen herbstlicher Rebstöcke auf steilen, mit Trockenmauern gebauten Terrassen, hinab auf den Neckar und den nur durch einen schmalen Damm von ihm getrennten Max-Eyth-See. Einzig der wenig erbauliche Anblick eines Toten hielt mich davon ab, die Aussicht zu genießen und mich fernab der Großstadt zu fühlen.
Im Inneren des historischen Gemäuers stand ein länglicher Tisch, rechts und links davon schmale Bänke, im Eck ein gusseiserner Ofen. Auch innen war das Fachwerk des Häusles sichtbar. Dunkelgrün gestrichene Balken unterteilten die weiß getünchten Wände in Rechtecke. In einem der Rechtecke, unter dem der Tote in sich zusammengesunken an der Wand lehnte, hatte jemand mit blauer Kreide »Cannstatter Zuckerle Wein ist ganz gewiss der Vorgeschmack zum Paradies« geschrieben. Ich wünschte der Seele des Toten, dass sie dort verweilte. Vor ihm auf dem Tisch standen eine halb leere Bierflasche und ein Becher.
»Klarer Fall von Selbstmord, lass uns gehen.«
»Ich weiß nicht«, entgegnete meine Kollegin, »etwas passt hier ganz und gar nicht.«
Ich seufzte still, hielt mich aber zurück. Bei unserem letzten Fall hatte ich ebenfalls den durch einen Wolf gerissenen Wanderer als klare Sache angesehen. Dank Biancas Beharrlichkeit hatten wir gründlich ermittelt und waren einer Riesenschweinerei auf die Spur gekommen.
»Was stört dich dieses Mal?«
»Warum hat er das Gift mit Bier getrunken und nicht mit Wein?«
Fassungslos starrte ich sie an.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst!«
»Doch!«
»Vielleicht, weil er lieber Bier mochte?«
»Aber warum suchte er sich dann zum Sterben ausgerechnet diesen Ort hier aus, ein historisches Weinberghäusle in einer der besten Weinlagen Stuttgarts?«
»Er kritzelte eine Abschiedsbotschaft über sich an die Wand …«
»Die könnte auch sein Mörder verfasst haben!«
»… und die Gerichtsmedizinerin fand bei ihrer ersten Leichenschau nichts, was auf einen Kampf oder Gewalteinwirkung hinweist!«
Bianca beachtete mich nicht. In die Betrachtung der Situation vertieft murmelte sie leise vor sich hin.
»Auch der Becher und die Flasche passen überhaupt nicht zueinander!«
»Der Becher passt nicht zur Flasche? Jetzt mach aber mal halblang! Im Angesicht es eigenen Todes verlieren Stilfragen schon einmal an Relevanz!«
»Der Becher ist handgetöpfert, dazu Bier aus einer Plastikflasche vom Discounter? Das ist keine Stilfrage, da prallen unterschiedliche Lebenswelten aufeinander! Der Becher passt zu ihm und zu seiner Kleidung, die Flasche hingegen ganz eindeutig nicht!«
Mir lag eine Erwiderung auf der Zunge, die ich jedoch hinunterschluckte. Sie drehte die halb leere Bierflasche auf, schnupperte mit geschlossenen Augen daran, nahm den Becher, der einen letzten Rest Bier enthielt, und schnupperte ebenfalls.
»Vorsicht, da ist höchstwahrscheinlich Gift drin!«
Ein triumphierendes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Erneut schnupperte sie erst an der Flasche, dann am Becher, ehe sie mir beides entgegenstreckte.
»Riech selbst, das Bier im Becher stammt nicht aus der Flasche!«
»Was …«
»Riech einfach!«
Sie würde keine Ruhe geben. Also schnupperte ich mehrmals an beidem und kam mir dabei ziemlich blöd vor.
»Zugegeben riecht beides leicht unterschiedlich …«
»Siehst du! Da will uns jemand glauben machen, es handele sich um einen Selbstmord!«
»… was aber auch an den unterschiedlichen Behältnissen liegen kann oder daran, dass sich nur im Becher Gift befindet!«
»Quatsch! Das Bier vom Discounter riecht hopfig und leicht säuerlich, im Becher befindet sich hingegen ein satt nach Malz duftendes Bier. Jede Wette, dass es sich um zwei verschiedene Biersorten handelt!«
Ich starrte sie an. Das konnte jetzt eine ziemlich lange und fruchtlose Diskussion werden.
»Okay, bringen wir beides zu Karl-Heinz in die Kriminaltechnik. Er wird die Frage klären.«
Jedes Wort, das Kiara auf dem Bildschirm las, stürzte sie in tiefere Verzweiflung. Wie konnte sich ein Mann nur so sehr für eine Frau interessieren? Der Typ hatte ja nichts außer der Angebeteten im Kopf! Eifersucht flammte heiß in ihr auf. Sie tat alles, um älter auszusehen, um von Männern endlich als Frau und nicht länger als Mädchen wahrgenommen zu werden. Leider funktionierte es nicht ganz wie gewünscht. Die interessanten Typen sahen über sie hinweg oder durch sie hindurch. Einzig … allein beim Gedanken an ihn schüttelte sie sich. Andererseits war er immerhin ein Mann, sogar einer, der sich für sie interessierte, ihr beinahe täglich Nachrichten aufs Handy schickte. Nur entsprach er so gar nicht ihren Vorstellungen eines süßen Typen, in den sie sich voll und ganz verknallen könnte. Alle Influencerinnen, denen sie bei Instagram folgte, besaßen einen Typen, der sie verwöhnte und beschützte. Erst mit einem Freund würde sie ernst genommen werden, also brauchte sie dringend einen. Was, wenn eine andere aus der Klasse vor ihr, … automatisch kam ihr Annika in den Sinn. Ob die schon einen hatte? Erneut kochte ihre Eifersucht auf. Egal, Annika war sie los, wenigstens etwas. An ihrer Mutter sah sie täglich, dass eine Frau ohne einen Mann eine Loserin war.
Ihre Mutter! Es tat so weh, ihren Eltern völlig egal zu sein. Beide interessierten sich einen Scheiß für sie. Nein, so ganz stimmte das nicht. Ihr Vater war halt, wie er war, der konnte nichts dafür. Umso bitterer brannte die Enttäuschung über ihre Mutter. Hier, im Chat, schleimte sie, bei ihr kam kein liebevolles Wort über die Lippen, nur hohle Phrasen, damit ihr einziges Kind sich selbst beschäftigte und seiner Mutter keine Sekunde ihrer ach so wertvollen Zeit stahl.
»Bist du online?«
Als die Nachricht im Chat aufpoppte, zuckte Kiara vor Schreck zusammen. Sie verspürte den Drang wegzulaufen, rang diesen jedoch nieder.
»Nicht mehr lange«, tippte sie ein.
»Schade, Lust auf ein Konzert?«
»Kommt darauf an.«
Kiara tippte ihre Antworten ein, er reagierte immer sofort, bemühte sich sichtlich, witzig und schlagfertig rüberzukommen. Er wollte ihr gefallen. Das sprach sie an, obwohl er nicht wirklich ihr gefallen wollte, sondern sie für eine andere hielt. Erneut kochte es bitter in ihr auf. Eine Welle aus Eifersucht und Verzweiflung schwappte so heftig über sie hinweg, dass sie ihr den Atem raubte. Kiara hasste ihn, hasste ihre Mutter, hasste die ganze verlogene Bagage! Das heftige Verlangen, ihm einen Denkzettel zu verpassen, einen, den er nicht so schnell vergessen würde, erfasste sie. Nicht nur ihm, auch ihren Eltern gehörte ein Denkzettel verpasst!
Ohne lange nachzudenken, hackte sie wütend auf die Tastatur ein. In ihrer Klasse war sie die unumstrittene Nummer eins, weil sie sich was traute und gut improvisieren konnte. Es würde auch diesmal klappen. Und falls nicht, was konnte ihr schon passieren? Schließlich war sie noch dreizehn. Als sie fertig war, verabschiedete sie sich aus dem Chat. Ehe sie sich ausloggte, löschte sie die eben geführte Unterhaltung.
Am nächsten Morgen durchforstete ich lange vor dem Erscheinen meiner Kollegin die Vermisstenanzeigen. Der Tote war nach Schätzung der Gerichtsmedizinerin Anfang dreißig und seit drei Tagen tot. Leider gab es in ganz Deutschland keine passende Vermisstenanzeige. Es konnte lange dauern, bis eine solche erstattet wurde.
Die Tür öffnete sich und Bianca steckte ihren Kopf herein. Als sie mich am Computer arbeiten sah, trat sie ein.
»Guten Morgen Jens.«
»Guten Morgen, hat deine Jüngste dich schon gehen lassen?«
Das jüngste ihrer drei Kinder befand sich gerade in der Eingewöhnungsphase des Kindergartens, was sich als langwieriges und zähes Projekt entpuppte.
»So langsam finden wir unser Abschiedsritual. Warst du schon bei Karl-Heinz?«
»Ich wollte ihm nicht das Vergnügen nehmen, dir seine Befunde persönlich mitzuteilen.«
»Dann lass uns gemeinsam hingehen.«
»Glaubst du, er ist schon fertig?«
»Klar, der ist doch genauso neugierig wie wir!«
Bianca trug keine Uhr mehr, die ihre Schritte zählte. Trotzdem hoppelte sie die Treppen hinab. Also verzichtete ich ebenfalls auf den Lift. Auf dem Weg berichtete ich ihr, dass keine zu unserer Leiche passende Vermisstenanzeige vorlag.
Die Labore der Kriminaltechnik befanden sich im Keller. Bei unserem Anblick grinste Karl-Heinz spitzbübisch.
»Man hört, ihr habt eine Wette laufen?«
»Stimmt leider nicht, Jens hat gekniffen.«
»Schlau von ihm, aber du bist eine wahrlich brillante Ermittlerin! Hut ab!«
Er zog einen imaginären Hut, verbeugte sich, trat auf Bianca zu und schüttelte ihr die Hand.
»Es sind also tatsächlich zwei verschiedene Biere?«
Ich gönnte Bianca ihre Freude. Einmal mehr war ich froh darüber, sie an meiner Seite zu haben.
»In der Flasche befand sich billiges Industriebier eines Discounters. Das Bier aus dem Becher ist hingegen vermutlich selbst gebraut.«
»Jaaa!«
Sie beugte den Arm und ballte ihre Rechte zur Faust. Eine derart männertypische Geste hatte ich noch nie zuvor an ihr beobachtet.
»Was kannst du uns über das Gift sagen?«
»Wie von Bianca vermutet, befand es sich nur im Becher.«
»Ich meine …«
»Es handelt sich um einen ganzen Cocktail toxischer Alkaloide. Als Quelle tippe ich auf eine Knolle des Blauen Eisenhutes. Ist die entsprechende Dosis erst einmal erreicht, hilft nichts mehr. Man stirbt qualvoll an Atemlähmung und Herzversagen. Das selbst gebraute Bier enthält viele Bitterstoffe, unter denen das Gift nicht zu schmecken war. Zum Ausgleich wurde extra viel Malz beigemischt, um das Gebräu trinkbar zu machen.«
»Also wurde der Mann vergiftet?«
»Zumindest, wenn wir ausschließen, dass er das selbst gebraute Bier in einem offenen Becher eine enge, unregelmäßige Weinbergtreppe hinauftrug, um dann eine halb leere Plastikflasche vom Discounter daneben zu platzieren.«
»Er müsste es, sollte es sich tatsächlich um einen Suizid handeln, viel weiter als nur die Treppe hinaufgetragen haben. Schließlich haben wir kein ihm gehörendes Fahrzeug gefunden und die nächsten U-Bahn-Haltestellen liegen weit entfernt.«
»Das zu ermitteln ist euer Job, auf mich wartet ein Berg Arbeit.«
»Was ist mit Fingerabdrücken?«
»Sowohl auf dem Becher als auch auf der Flasche sind nur welche vom Toten. Ich habe eine Kollegin noch einmal zum Weinberghäusle geschickt. Sie soll in Wurfweite rings ums Häuschen gründlich nach Gefäßen suchen, die sich für den Transport von Bier oder Gift eignen. Nicht, dass uns ein findiger Anwalt noch die Mordanklage versaut.«
»Und die Fingerabdrücke des Toten …«
»… sind in keiner Datenbank erfasst.«
»Was ist mit der Inschrift »Ich kann nicht mehr!« an der Wand oberhalb der Leiche?«
»Die stammt wahrscheinlich tatsächlich vom Toten. Zumindest haben wir in seiner Jackentasche ein handgeschriebenes Gedicht gefunden, dessen Schriftbild dem der Inschrift ähnelt und einen blauen Edding, mit dem sie an die Wand geschrieben wurde. An seinem linken Zeigefinger ist ein kleiner Strich des Eddings, wie er typischerweise entsteht, wenn man beim Aufsetzen der Kappe nicht aufpasst. Ach ja, außerdem haben wir zahlreiche Haare und Hautschuppen sichergestellt.«
Wir verabschiedeten uns und stiegen die Treppen wieder hoch. Wortlos folgte Bianca mir in mein Büro.
»Wo fangen wir an?«
»Solange wir die Identität des Toten nicht kennen, tappen wir im Dunkeln. Aber genau das will der Mörder …«
»Oder die Mörderin! Gift wird bevorzugt von Frauen benutzt.«
»Und vom russischen Geheimdienst!«
Bianca verdrehte die Augen.
»Schon gut, dann reden wir halt jetzt von der Mörderin und schließen einen Mann mit ein. Jedenfalls hat die Mörderin verdammt viel davon, uns möglichst lange im Dunkeln tappen zu lassen. Wir können weder das Umfeld des Toten durchleuchten, noch nach Motiven suchen, solange wir seine Identität nicht kennen.«
»Warum verscharrte sie ihn dann nicht? In diesem Fall würden wir noch viel länger im Dunkeln tappen.«
»Weil sie versuchte, den Mord als Suizid zu tarnen, was nur geht, wenn man sein Opfer nicht vergräbt. Außerdem ist es verdammt schwer und anstrengend, eine Leiche die enge, schiefe Treppe hinab in ein Fahrzeug zu schleppen und irgendwo zu vergraben. Mal ganz abgesehen vom Risiko, ertappt zu werden. Die Straße ist nur für Anlieger. Einige Wengerter wohnen bestimmt in der Nähe und beäugen kritisch jedes fremde Fahrzeug. Dazu kommt der Umstand, dass man ein Fahrzeug braucht und eine Leiche darin leicht Spuren hinterlässt.«
»Einverstanden! Alles was wir bisher haben, ist also das Weinberghäusle. Es muss eine Verbindung zwischen dem Toten, seiner Mörderin und dem Häuschen geben. Wem gehört es eigentlich?«
»Herrn Kempf, er fand auch die Leiche.«
»Wurde er schon befragt?«
»Nein, er kollabierte, während er mit seinem Handy den Notruf über den Leichenfund informierte. Die Kollegin schickte geistesgegenwärtig gleich einen Notarzt los, sonst hätte es in dem Häuschen möglicherweise zwei Tote gegeben.«
»Ob er jetzt wieder fit genug für eine Befragung ist?«
Am Telefon erfuhr ich, dass Herr Kempf nicht nur aus dem Gröbsten heraus war, sondern von sich aus dringend mit der Polizei sprechen wollte. Also machten wir uns auf den Weg. Durch die Sicherheitsschleuse verließen wir das Gebäude. Entgegen meinen bisherigen Gewohnheiten bog ich nicht nach links zum Parkplatz ab, sondern stapfte geradeaus Richtung U-Bahn.
»Was ist mit dir los?«
»Bis zum Klinikum sind es nur ein paar Haltestellen. Bei dem Verkehr und bis wir dort einen Parkplatz finden, sind wir mit der Bahn schneller.«
»Man höre und staune.« Sie schmunzelte süffisant. »Der Flurfunk munkelt, dass du endlich zur Vernunft gekommen bist und deine alte Dreckschleuder verkauft hast?«
Seit Tagen wartete ich darauf, dass sie es ansprach. Ich hatte mir fest vorgenommen ruhig und souverän zu bleiben, wenn es so weit war. Jetzt wallte Ärger in mir auf. Also schwieg ich vorsichtshalber.
»Pardon, ich meine natürlich deinen Oldtimer. Hast du viel Geld für ihn bekommen?«
»Ich bin zufrieden.«
»Was für ein Auto hast du dir gekauft?«
»Ein Elektroauto.«
»Du?«
Fassungslos glotzte sie mich an.
»Überrascht?«
»Allerdings, natürlich positiv! Hätte ich dir gar nicht zugetraut!«
Es handelte sich um kein reines Elektroauto, sondern einen Hybrid. Die Kleinigkeit erwähnte ich nicht und war froh, dass sie nicht genauer nachfragte.
»Wieso wirst du plötzlich zum Grünen? Ich denke, du magst uns nicht?«
»Nur, weil man ab und zu mit der U-Bahn fährt und sich ein neues Auto kauft, ist man noch lange kein Grüner. Außerdem bin ich nicht so platt und undifferenziert, wie deine Worte suggerieren. Auch bei euch gibt es Menschen, die ich mag, dich zum Beispiel.«
Sie errötete tatsächlich. Dabei war ihre Stichelei nichts, verglichen mit dem, was sie sich von mir schon alles hatte anhören müssen. Ich überlegte, mich zu entschuldigen, beließ es aber bei der Überlegung.
Der Rest der Fahrt verlief schweigend. Am Hauptbahnhof, an dem die zukünftige unterirdische Haltestelle langsam Konturen annahm, stiegen wir in den Bus um, der uns bereits bei der nächsten Haltestelle direkt vor dem Klinikum wieder ausspuckte. Noch immer schweigend trottete ich hinter Bianca her. Sie zeigte an der Pforte ihren Dienstausweis und erfuhr, dass Herr Kempf im siebten Stock lag. Ich schloss die Augen, ahnte ich doch, was jetzt kommen würde. Tatsächlich steuerte sie zielstrebig auf das Treppenhaus zu. Ich schielte sehnsüchtig zum Aufzug, entschied dann aber, die Buße auf mich zu nehmen. Im sechsten Stock war ich schweißgebadet und außer Atem.
»Bevor wir Herrn Kempf befragen, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Meine Worte waren unangemessen. Ich war einfach überrascht. Normalerweise bin schließlich ich für die giftigen Sticheleien zuständig.«
Bianca hielt tatsächlich inne, zögerte kurz, drehte sich dann um und meinte:
»Entschuldigung akzeptiert. Es war auch nicht okay von mir, so gegen dich zu sticheln.«
»Vertragen wir uns wieder?«
Sie nickte, machte kehrt und nahm das letzte Stockwerk in Angriff. Herr Kempf erwies sich als ledriges Männlein von schätzungsweise siebzig Jahren. Seine auffallend rote Gesichtsfarbe, die bläulichen Adern in seinen Wangen und seine grobporige Nase wiesen auf einen Hang zum Trinken hin. Ich hoffte bei seinem Anblick inständig, nicht eines Tages wie er für jeden sichtbar ein Säufer zu werden und schwor mir, von einem auf zwei alkoholfreie Tage pro Woche zu erhöhen.
In Anbetracht der Umstände tippte ich bei Herrn Kempf auf einen Winzer, der seinem Trollinger zu sehr zugetan war, was sich als Treffer erwies.
»Kannten Sie den Toten?«
»I? Ha noi, wo denked se na!«
»Haben Sie ihn auch nie zuvor gesehen?«
»Noi, han i nedde! Halded Sie mi jetzt no glei für soin Mörder?«
»Bisher fragen wir uns nur, wieso er in Ihrem Weinberghäusle zu Tode kam. Haben Sie eine Erklärung hierfür?«
»Noi, han i nedde!«
»Wer außer Ihnen benutzt das Häusle?«
»Koiner nutzt mei Woiberghäusle!«
»Wer besitzt noch einen Schlüssel? Immerhin war die Tür nicht aufgebrochen!«
»S’isch hald a billigs Schloss. Des ka jeder mit ama Diedrich uffkriaga!«
»Aber wieso ausgerechnet Ihr Häusle?«
»Koi Ahnung!«
»Ihr Sohn …«
»Den könned se selber froga. Bisher hot der sich aber net für’s Häusle interessiert.«
»Gibt es Führungen durchs Cannstatter Zuckerle oder Feste, von denen her jemand ihr Häusle kennt?«
Er schwieg. Offensichtlich überlegte er, was er uns sagen sollte.
»Bitte seien Sie ehrlich, jede Kleinigkeit kann uns helfen!«
»Di geits nemme!«
»Nicht mehr heißt, früher gab es welche?«
Mit zusammengepressten Lippen nickte er.
»Was? Führungen oder Feste?«
»Feschdla isch ned so mois.«
»Also Führungen?«
»Dr Wengert isch doch a Schtick von onserer Tradition, von onserer Gschicht! Do han i hald denkt, des willsch de Loid zoiga ond mi in Weinsberg zom Woi-Erlebnis-Führer ausbilda lassa.«
»Und? Interessierten sich Leute für unsere Geschichte und Traditionen?«
»Ha freili! D’ Führunga sen emmer guad bsucht gwäh! Bsonders d’Woibsbilder hen gern ihren Jonggsellina-Abschied in moim Wengert gfeiert!«
Er lächelte stolz, in den Erinnerungen an jene Zeiten schwelgend.
»War Ihr Häusle ein Teil der Führungen durchs Zuckerle?«
»Freili! Dort han i de Leit moin Trollinger ausgschenkt. Den hen elle gern dronka.«
Ein weiteres stolzes Lächeln.
»Kann es sein, dass der Tote an einer dieser Führungen teilgenommen hat?«
»Ha scho, des send jedes Jahr honderte Leit gwäh!«
»Aber erinnern können Sie sich an ihn nicht?«
»Noi, des hett i doch scho gsait!«
»Wenn die Führungen so erfolgreich waren«, mischte ich mich in Biancas Befragung ein, »warum haben Sie dann damit aufgehört?«
Er zuckte zusammen und errötete noch mehr, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Beide starrten wir gebannt auf ihn, waren wir doch sicher, dass er uns etwas verschweigen wollte.
»Warum …«
»I han Ihr Frog scho verschdande! Wissed se, d’ Leit send net emmer so, wia mer se sich wünschd.«
»Es ist also etwas vorgefallen?«
Er nickte.
»Im Zusammenhang mit dem Weinberghäusle?«
Erneutes Kopfnicken.
»Was?«
Er holte tief Luft, setzte an und brach wieder ab.
»Bitte! Jede Kleinigkeit kann wichtig für uns sein!«
Bianca griff nach seiner Hand und tätschelte sie leicht.
»I will aber nix von dem, was i ehna jetzt erzähla dua in dr Zeitung läsa!«
»Keine Sorge, wir werden ganz sicher mit niemandem von der Presse darüber reden!«
»Also guad! Im Sommer hot mi nachts der Raimund agrufa ond gmoind, vor moim Häusla dät a Fuir brenna. I ben sofort na. Da hot et bloß a Fuir brennt, sondern au no a paar Fackla. Da han i mir denkd, goats no ond ben de Staffla ruffgschdürmd. Was i dann doa vorgfonda han, war zom Gruasla. Rengs ums Fuir send Menner en schwarze Kudda gschdanda ond mittadren …«, er schluckte, Tränen traten in seine Augen, er räusperte sich, »… a naggeds Mädla. I han des zuerschd ned glauba wella. Des Woibsbild war richtig vom Deifel bsessa, hot eddamoal gmerkt, wia i komma ben. Oiner von denne en de Kudda hot mi g’säh ond uff mi zoigt. Da isch dr Deifel von mir wiadr abgfalla ond i han losbrülld, se solled sich schloinigst davonmacha!«
Er beendete seinen Bericht. Tränen rannen seine Wangen hinunter.
»Könnte der Tote einer der Männer unter der Kutte gewesen sein?«
»I woiß et, i han von dene do niamand richtig gseha. Nur des Woib, des däd i wiader erkenna. A richtigs Satansweib war di!«
»Wie alt war die Frau?«
»Jong, oigendlich no a Kend.«
»Haben die Männer damals etwas getrunken?«
»Dronka?«
Ratlos starrte er mich an.
»Ja, ich meine, standen irgendwo Flaschen, Gläser oder sonstige Trinkbehältnisse herum?«
»Jedzd erinner i mi wiedr. Di hen Krüag ond so Becher ghet, so Dinger us Ton. Ond obwohl se en moim Wengert waret, hend se Biar gsoffa!«
Seine Empörung war deutlich, während mich die Erregung des Jägers beim Anblick der Fährte erfasste.
»War es so ein Becher?«
Ich streckte ihm das Foto des Tonbechers auf meinem Handy hin. Er fummelte eine Lesebrille aus seiner Jackentasche, setzte diese umständlich auf, nahm mein Handy, suchte die richtige Entfernung zum Bildschirm und rief:
»Genau so oiner wars!«
Stolz lächelnd reichte er mir mein Telefon zurück.
»Wie können Sie sich da so sicher sein?«, warf Bianca ein. »Immerhin war es dunkel und …«
»Die hen oin liega lassa, den i am nächschda Morga gfunda han!«
»Haben Sie den Becher zufällig noch?«
»Ha freili!«
»Warum das denn?«
Bianca sah ihn entgeistert an. Er zuckte nur mit den Schultern. Obwohl Bianca in Stuttgart geboren war, verstand sie einfach die schwäbische Mentalität nicht.
»Welled se den Becher han? I ka moi Woib arufa.«
Er hatte nie nach Stuttgart gewollt. Gesichtslose, von Industrie und Kommerz geprägte Städte interessierten ihn nicht. Überhaupt, die Neuzeit! Er schnaubte. Die Aufklärung verachtete er, die Industrialisierung ekelte ihn an und die Moderne stieß ihn ab. Seine Welt war das Mittelalter, als Männer noch richtige Kerle waren und keine verweichlichten Jammerlappen und die Welt noch voller Mysterien. Wobei sich für ihn persönlich das Mittelalter in abgelegenen Landstrichen bis ins neunzehnte Jahrhundert erstreckte, so lange waren jene noch vom Teufelswerk der Neuzeit verschont worden. Alles danach war nur noch Schrott.
Eines Tages hatte er gegen seinen Willen nach Stuttgart gemusst. Ausgerechnet in diesem seelenlosen Moloch war er ihr begegnet. Beim ersten Blick in ihre Augen hatte er sich hoffnungslos in sie verliebt. Ehe er ihren Namen erfuhr, hatte er sie spontan Cannstatter Zuckerle getauft, nach dem Riesling, den er in jenem denkwürdigen Augenblick trank, war sie doch genauso hell und lecker wie der Wein. Leider war es seinem Zuckerle nicht wie ihm ergangen. Seit er älter wurde, brauchte es zunehmend Zeit und Geduld, einem Weib seine Bestimmung aufzuzeigen. Wobei sich bei seinem Cannstatter Zuckerle ungeahnte Schwierigkeiten auftaten. Aber das zeigte nur, dass sie besonders war.
Heute war er nur wegen ihr nach Stuttgart gekommen. Sie wollte ihm etwas sagen, persönlich und unter vier Augen. Beim Lesen ihrer Nachricht hatte sein Herz vor Freude und Hoffnung einen Sprung gemacht. Sehnsüchtig sah er in alle Richtungen. Seit einer Viertelstunde wartete er im Arkadenhof des Alten Schlosses auf sie. Es ärgerte ihn, dass sie ihn wieder einmal warten ließ. Aber auch das zeigte ihm nur, wie besonders sie war. Außerdem steigerte es seine Erregung. Die Vorstellung, eines Tages mit seinen Händen ihre nackte Haut zu streicheln, während sie sich genüsslich rekelte und sich ihm entgegenstreckte, machte ihn schier wahnsinnig.
»Gegrüßet seid Ihr, Graf«, ertönte es hinter ihm.
Er zuckte zusammen, drehte sich um und stand ihr gegenüber. Blass und mager stand sie vor ihm, ihr hübsches Gesicht hinter ihren Haaren und der Kapuze ihres Hoodies verborgen. Wie eine Trauernde war sie von oben bis unten in Schwarz gekleidet.
»Der Graf erwidert euren Gruß. Es ist schön, euch zu sehen, auch wenn ihr kränklich wirkt.«
»Nun, ist das nicht angemessen? Schließlich logiere ich derzeit in einem Spital.«
»Wollt Ihr von dort flüchten? Ihr könnt sofort mit mir kommen! Meine Kutsche steht für euch bereit!«
»Das ist lieb von euch!«
Ihre zarten Finger tätschelten kurz seine Pranke. Elektrische Stöße fuhren durch seinen Körper, strömten in seinen Unterleib.
»Aber sie würden nach mir suchen. Ich will euch keine Unannehmlichkeiten bereiten.«
»Für euch nehme ich alle Unannehmlichkeiten dieser Welt auf mich! Auf meinem Gut seid ihr sicher vor ihren Schergen!«
»Vielen Dank, eines nicht fernen Tages greife ich vielleicht auf euer großzügiges Angebot zurück. Zuvor muss jedoch noch etwas getan werden.«
Er hielt inne, fürchtete er sich doch vor dem, was jetzt kommen würde.
»Wolltet Ihr mich deshalb treffen?«
Sie nickte.
»Was ist euer Begehr?«
»Mein Herz.«
Sie sah ihm tief in die Augen.
»Wie Ihr wisst, ist es nicht frei.«
»Wollt Ihr freundschaftlichen Rat?«
»Rat ist es nicht, den ich benötige. Seid Ihr nicht ein Mann der Tat?«
Schweiß trat ihm aus allen Poren, hatte er doch befürchtet, jene Worte zu hören. Sein Zögern entging ihr nicht. Sie griff nach seiner Hand, legte diese auf ihre linke Brust.
»Mir ist euer Werben nicht entgangen, nur muss ich hier drinnen frei sein, um euch erhören zu können.«
Bianca fuhr vom Klinikum direkt zur Kita, um ihre Tochter abzuholen. Sollte ich zurück ans Präsidium? Solange der Tote nicht identifiziert war, gab es dort nichts zu tun. Frühestens morgen würde die Staatsanwaltschaft erlauben, ein Bild von ihm zu veröffentlichen. Auch das nur, falls es keine neue, passende Vermisstenanzeige gab. Also machte ich mich auf den Heimweg.
Bei den Mineralbädern streifte die U-Bahn den Schlossgarten. Es wimmelte von Joggern, die ihren Körpern Gutes taten. Sobald ich zu Hause war, würde ich ebenfalls meine Sportklamotten anziehen und loslaufen. Wann hatte ich zum letzten Mal so früh Feierabend gemacht? Keine Ahnung, es musste lange her sein. Es tat mir gut, bei einer Ermittlung ausnahmsweise mal nicht unter dem Druck zu stehen, rasch Ergebnisse liefern zu müssen.
Meine Bude lag im Dachgeschoss eines Gewerbebaus am Cannstatter Wasen. Beim Betreten blieb mein Blick an der samstags auf dem Flohmarkt gekauften CD von Leonard Cohen hängen. Mühselig fummelte ich die Folie ab, legte sie in den CD-Player ein und drehte die Lautstärke auf.
Der Klang der Boxen beamte mich weg. Ich schloss meine Augen und sank tief in die Polster zurück. Es fühlte sich an, als säße ich direkt dem Altmeister gegenüber, wie er lässig Gitarre schrammelnd Suzannes perfekten Körper besang. Leider weilte Cohen nicht mehr unter uns Lebenden.
Unwillkürlich kam mir der Tote vom Rosenstein in den Sinn. Viele meiner Anschaffungen standen mit Mordfällen in Verbindung. Auf der Rückfahrt vom Rosenstein war ich in Schwäbisch Gmünd unerwartet vor dem Werk eines Hi-Fi-Bastlers von Weltruf gelandet. Die Gelegenheit beim Schopfe greifend hatte ich mir die schlanken, eleganten Lautsprecher gegönnt. So werden diese für mich immer mit dem Albwolf verbunden sein.
Warum eigentlich nicht erst die CD zu Ende hören? Anschließend blieb immer noch reichlich Zeit für Sport. Für die Boxen hatte ich viel Geld ausgegeben, sie aber bisher noch nicht so richtig ausgekostet. Cohen besang Honiglicht. Die Herbstsonne warf genau jenes auf meine selbst verlegten Eichendielen. Ich lächelte, war das doch ein eindeutiges Zeichen. Samstags hatte ich nicht nur die CD, sondern auch einen neuen Rioja erstanden, einen Club Privado vom Baron de Ley. Der passte exzellent zur momentanen Stimmung. Also holte ich die Flasche und entfernte geübt den Korken. Eine herrliche, rubinrote Flüssigkeit gluckerte in die Weintulpe. Das leicht blumige Bouquet des edlen Spaniers kitzelte meinen Gaumen. Kurz darauf verbreitete sich ein warmes, behagliches Gefühl in meinem Bauch. Konnte man einen Arbeitstag besser ausklingen lassen? Gelöst lehnte ich mich zurück, nahm einen weiteren Schluck und schloss die Augen. Zufrieden und entspannt spürte ich ein seliges Lächeln auf meinen Lippen.
Plötzlich stand der Tod im Türrahmen und grinste gehässig auf mich hinab. Erschreckt fuhr ich hoch.
»Was willst du?«
»Dich holen.«
»Jetzt schon?«
Er grinste noch gehässiger, sein Totenkopf verzog sich zu einer schaurigen Grimasse. Wie war das überhaupt möglich?
»Wie kannst du grinsen, wenn du keine Muskeln mehr für deine Mimik hast?«
Über diese Frage erwachte ich. Ein weiteres Mal lag ich auf dem Sofa, vor mir eine halb leere Rotweinflasche, im Mund einen schalen Geschmack. Wollte ich das? Besoffen auf meiner gammeligen Couch liegend vom Tod geholt werden? Was würde Lena denken, wenn sie davon erfuhr?
Der Gedanke an meine Tochter weckte eine diffuse Sehnsucht in mir. Ich wollte leben, mit ihr möglichst viel Zeit verbringen, schöne Erlebnisse mit ihr teilen. Es stimmte, Versäumtes ließ sich nicht nachholen, aber irgendwie entschädigen schon.
Ich rollte vom Sofa, warf einen Blick auf die Uhr. Mitternacht war lange durch und ich hellwach. Wenn ich jetzt ins Bett ginge, würde ich mich schlaflos darin herumwälzen. Warum hatte ich nach Dienstschluss nichts Besseres getan, als mich zu besaufen? Weil der Wein mir so gut schmeckte? Nein, die Lüge ließ ich mir dieses Mal nicht durchgehen.
Ich ging ins Schlafzimmer, zog mich aus und Sportklamotten an. War es so weit? War ich endgültig zum Säufer geworden? Jedenfalls hatte ich heute auch getrunken, um den schaurigen Anblick des Toten im Weinberghäusle zu vergessen. Sein vor Entsetzen verzerrtes Gesicht mit getrockneten Schaumresten um den Mund sah ich überdeutlich vor meinem inneren Auge.
Auf der König-Karls-Brücke trabte ich über den Neckar. In seinen dunklen Fluten spiegelte sich die silbrige Scheibe des Vollmondes. Auch das noch! In Vollmondnächten schlief ich besonders schlecht. Vorbei am Mineralbad Leuze erreichte ich bei den Berger Sprudlern die Ausläufer des Rosensteinparks. Ein einsamer Radfahrer kam mir entgegen, schlug vorsichtshalber einen weiten Bogen um mich. Ich lächelte, war ich doch offensichtlich immer noch ein gefährliches Raubtier. Hinter dem Schwanensee ging es steil aufwärts zum Schloss Rosenstein. Das Seitenstechen setzte ein. Ich hörte auf zu traben, lief stattdessen. Sollte ich umkehren? Nein! Ich würde die Runde bis zum Löwentor durchziehen, erst kehrtmachen, wenn ich an dessen schmiedeeisernem Gitter abgeschlagen hatte! Außerdem würde ich in den nächsten Tagen etwas Schönes mit meiner Tochter Lena unternehmen!
Als ich spät am nächsten Morgen die Sicherheitsschleuse des Präsidiums passierte, signalisierte mir der Diensthabende, ich solle kurz in seinen Kabuff kommen. Seinem feisten Grinsen nach hatte sich etwas Unterhaltsames ereignet.
»Rekrutierst du deine Hilfssheriffs jetzt im Altersheim?«
»Man muss sehen, wo man bleibt.«
»Das hier wurde in aller Herrgottsfrühe für dich abgegeben. Dabei hat mir die Seniorin mindestens dreimal eingeschärft, es dir nur persönlich auszuhändigen!«
Er hielt mir einen sauber in einen wiederverschließbaren Gefrierbeutel eingetüteten Tonbecher entgegen. Auf einem pinken Zettel war in akkurater Handschrift vermerkt, dass der Becher nie gespült und auch nicht mit bloßen Händen angefasst worden sei. Mithin müssten alle nicht von ihrem Mann stammenden Fingerabdrücke von den Satanisten sein.
Die Lektüre der Nachricht entlockte auch mir ein Schmunzeln. Offensichtlich war Frau Kempf eine versierte Krimileserin. Mit dem Beweisstück in der Hand stieg ich die Treppe in die Kriminaltechnik hinab. Karl-Heinz saß hinter seinem Computer.
»Hast du einen Augenblick Zeit?«
»Eigentlich nicht, aber für dich nehme ich ihn mir. Worum geht’s?«
»Um den hier.«
Ich stellte den Becher vor ihm ab. Er reagierte mit einem Stirnrunzeln.
»Der wurde aber nicht ordnungsgemäß sichergestellt!«
»Sei nicht so streng, die Kriminalistin ist über siebzig Jahre …«
»Warum genießt sie dann nicht schon längst ihren Ruhestand?«
»Mensch Karl-Heinz, das war ein Spaß!«
Ich erklärte ihm, was es mit dem Becher auf sich hatte. Er hörte aufmerksam zu. Als ich geendet hatte, schüttelte er seinen Kopf.
»Satanisten im Cannstatter Zuckerle! In was für einer Welt leben wir?«
»Die Beantwortung dieser Frage überlasse ich dir. Mich interessiert, ob unser Toter etwas mit den Satanisten zu tun hatte.«
»Und das willst du mithilfe dieses Bechers herausbekommen?«
Ich nickte.
»Indem wir ihn mit dem beim Toten gefundenen Becher vergleichen?«
»Genau, und indem ihr den hier auf Fingerabdrücke und Genspuren untersucht.«
Karl-Heinz erhob sich, nahm den Becher und ging in sein Labor. Ich folgte ihm. Er zog sich Einweghandschuhe über, nahm den Becher aus dem Beutel und betrachtete ihn von allen Seiten. Dann holte er den anderen Becher aus einem Regal und stellte sie nebeneinander. Beide waren aus dem gleichen, braunen Material gefertigt, innen durchsichtig lasiert, außen brauner Ton. Der bei dem Toten gefundene Becher war jedoch niedriger, dafür breiter und etwas bauchiger. Außerdem war bei ihm zur Zierde rings um den Rand eine weiße Lasur aufgetragen.
»Sehen beide handgetöpfert aus.«
»Finde ich auch.«
»Kannst du feststellen, ob sie aus der gleichen Werkstatt stammen? Vielleicht, indem du den Ton analysierst? Wobei ich nicht weiß, ob jede Töpferei ihren eigenen Ton verwendet oder ob alle ihr Material vom gleichen Großhändler beziehen. Dann …«
»Nicht nötig, beide stammen aus der gleichen Töpferei.«
Mit offenem Mund starrte ich ihn an.
»Woran erkennst du das?«
»Ganz einfach hieran.«
Er drehte beide Becher um und wies auf zwei Stellen auf deren Böden. Ich beugte mich darüber, ging näher ran und wieder weiter weg. Vor meinen Augen verschwamm alles, ich konnte nichts erkennen. Was hatte Karl-Heinz hier nur mit bloßem Auge gesehen?
»Hier.«
Er hielt mir eine Lupe hin, die ich nach kurzem Zögern nahm. Jetzt erkannte ich eine kleine, runde Vertiefung im Becherboden, die eine winzige, gezackte Schlange enthielt. Aufgeregt wechselte ich zum anderen Becher. Dort fand ich die gleiche Vertiefung.
»Was ist das?«
»Vermutlich so eine Art Stempel, den der Töpfer vor dem Brennen in den Ton drückte, um seine Werke zu markieren.«
»Das hast du mit bloßem Auge erkannt?«
Er nickte grinsend.
»Vielleicht wird es bei dir ja Zeit für eine Lesebrille?«
»Also gibt es eine Verbindung zwischen dem Toten und den Satanisten!«
»Scheint so.«
»Kannst du herausfinden, aus welcher Werkstatt die Becher stammen?«
»Das sind handgefertigte Einzelstücke. Letztes Jahr haben alleine im Ländle neunundvierzig Werkstätten am Tag der offenen Töpferei teilgenommen. Soll ich an alle Töpfer Bilder der Becher schicken und fragen, ob die von ihnen stammen?«
»Warum nicht? Setz bitte jemand darauf an!«
Karl-Heinz seufzte, nickte dann aber.
»Wir fangen im Ländle an. Haben wir damit keinen Erfolg, weiten wir es auf ganz Deutschland aus. Das sind dann Hunderte Werkstätten. Wobei die Becher auch aus einem anderen Land stammen können.«
Ich bedankte mich bei ihm und begab mich auf den Weg hinauf in mein Büro. Auf dem Weg klopfte ich an Biancas Tür, die jedoch noch nicht da war. Ich ahnte, dass uns eine mühselige Puzzlearbeit bevorstand. Lohnte es sich, die Kundendatei der Töpferei mit jener von Herrn Kempfs Weinbergführungen abzugleichen? Das klang einfach. Aber abgesehen davon, dass wir die Töpferei noch nicht kannten, befürchtete ich, dass weder die Töpferei noch Herr Kempf eine elektronische Kundendatei führten. Herr Kempf besaß keine Übersicht, wer bei ihm alles eine Führung gebucht hatte. Meistens hatte eine Person für eine Gruppe angefragt. Laut seiner Frau war er ein Schlamper, der keine E-Mail löschte. Sie hatte versprochen, sein Konto zu sichten und für uns eine Liste mit Namen und E-Mail-Adresse aller Personen zu erstellen, die eine Führung gebucht hatten. Insofern hatte der Kollege an der Pforte nicht ganz unrecht, dass ich sie als Hilfssheriff verpflichtet hatte. Mein Vorgehen war etwas ungewöhnlich, aber Frau Kempf hatte förmlich darauf gebrannt, uns helfen zu dürfen. Später konnte ich immer noch einen Kollegen bitten, Herrn Kempfs E-Mail-Konto zu sichten und ihre Liste zu prüfen.
Im Wald schrie ein Käuzchen. Dort, in der drohenden Masse der Bäume raschelte es. Die Dunkelheit der Nacht bot Beutetieren einen gewissen Schutz und war zugleich die Zeit der Jäger. Von der anderen Seite, aus dem vom Zahn der Zeit gebeugten Hofgebäude drang gelblicher Lichtschein aus winzigen Fenstern. Ein Frauenlachen klang glockenhell durch die Nacht. Vor wenigen Minuten hatten sich die Frauen verabschiedet. Sie würden spülen, sich selbst frisch machen und dann in ihre Betten gehen.
Er war alleine am Feuer zurückgeblieben. Das störte ihn keineswegs, im Gegenteil. Er liebte es, in die Glut zu starren und seine Gedanken schweifen zu lassen. Mit einem Stock schob er die Reste zusammen. Eine Flamme zuckte auf und warf einen orangenen Schein auf den abblätternden Putz des alten Hauses. Für einen winzigen Augenblick dachte er, die Flammen hätten den alten Fachwerkbau erfasst und erschrak heftig. Schnell beruhigte er sich jedoch wieder, hatte er doch darauf geachtet, die Feuerstelle weit entfernt vom Haus, genau in der Mitte zwischen dem Gebäude und dem Wald anzulegen.
Schon als Kind hatte ihn Feuer fasziniert. Er runzelte die Stirn. Nein, das stimmte nicht ganz. Einst hatte er es gehasst, sich im Winter bei Dunkelheit und Eiseskälte aus dem Bett quälen zu müssen, um den Ofen anzufeuern. Aber wenn er es versäumte, in der Stube für Wärme zu sorgen, ehe der Wecker des Vaters klingelte, hagelte es Schläge. Die setzte es auch sonst oft, und zwar grundlos.
In der Grundschule gab es einen Ausflug, bei dem der Lehrer zur Mittagszeit ein Grillfeuer entzündet hatte. Damals hatte er die Begeisterung seiner Mitschüler aus den Neubaugebieten für das Feuer nicht verstanden. Doch nur wenig später waren die Flammen seine Freunde geworden, aber nicht, weil man über ihnen Würstchen und Marshmallows grillen konnte.
Plötzlich stand er wieder vor dem brennenden Häuschen, fasziniert von der Macht des Feuers, beeindruckt von der Hitze, die ihr schäbiges Heim brennend ausstrahlte und vom bedrohlichen Geräusch des tödlichen Monsters, das in den Flammen wütete. Am meisten hatte ihn fasziniert, dass seine kleinen Hände es waren, die das tödliche Monster zu Hilfe gerufen hatten.
In jener Nacht war eine Rechnung beglichen worden. Und, auch wenn er lange gebraucht hatte, das zu begreifen, eine neue aufgemacht. Hass kochte in ihm hoch. Auch diese Rechnung würde beglichen werden.
Es klopfte. Auf meine Aufforderung hin öffnete Kommissarin Olga Oleg die Tür.
»Hast du einen Augenblick Zeit?«
»Olga! Wie schön, dich zu sehen. Für dich habe ich immer Zeit!«
Ich erhob mich und lief ihr erfreut entgegen. Wir umarmten uns. Sie gehörte zu den wenigen Kolleginnen, mit denen ich gerne zusammenarbeitete. Seit einiger Zeit wurde Olga von Mordermittlungen verschont.
»Wie geht es dir?«
»Man lebt.«
Aus Respekt vor ihrem Burnout drang ich nicht weiter in sie.
»Suchst du immer noch Vermisste?«
Olga nickte.
»Genau das führt mich zu dir. Wie ich höre, habt ihr einen Unbekannten von etwa dreißig Jahren in der Gerichtsmedizin liegen.«
»Das stimmt, hast du etwas für uns?«
»Ist das auf dem Foto euer Toter?«
Sie klappte ihre Mappe auf. Ich erkannte ihn sofort.
»Ja.«
»Sicher?«
»Absolut.«
»Scheiße!«
Sie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Ich zuckte zusammen, ehe ich sie irritiert ansah.