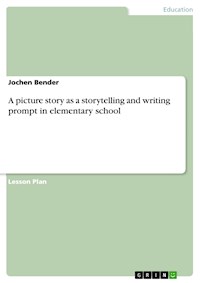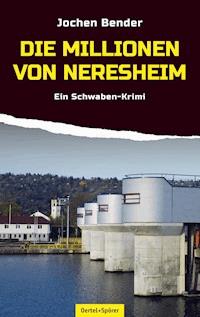Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die EU ist implodiert, in Deutschland herrscht Bürgerkrieg. Dr. Jens Baitinger weigerte sich bis zuletzt, die Zeichen des gesellschaftlichen Zerfalls wahrzunehmen. Während seiner Tochter Pauline im letzten Augenblick die Flucht nach Australien gelingt, sitzt er mit dem Rest seiner Familie in Stuttgart fest. Mit den Nachbarn graben sie sich auf den Fildern ein, während ringsum blutige Kämpfe toben. Im Remstal gelingt es Landrat Balmer, eine demokratische Gesellschaft aufrecht zu erhalten, tatkräftig unterstützt durch Sascha, einem jungen Mann mit einem düsteren Geheimnis. Familie Baitinger wagt schließlich die Flucht aus Schwaben und strandet als mittellose Flüchtlinge in Arabien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine gute Gesellschaft ist keine GemeinschaftThomas Schmid „Die Welt“ im Oktober 2016
Der Korb des Fernsehturms hing in Fetzen. Scharfkantige, gezackte Reste seiner Außenverkleidung schaukelten träge im Wind hin und her. Von den Fenstern des einst viergeschossigen Turmkorbes war nichts mehr zu sehen. Sein in Rot und Weiß gestrichener Funkmast lag zertrümmert zu seinen Füßen. Nur ein kläglicher, rußgeschwärzter Stumpf war von ihm noch übrig, an dem deutlich der Rost nagte. Die Reste der Aluminiumverkleidung des Turmkorbes wiesen dunkle Brandspuren auf. Krähen umkreisten die Ruine und komplettierten den düsteren Gesamteindruck. Einzig der Turmschaft, eine simple Röhre aus grauem Stahlbeton, sah aus wie immer.
Ich setzte das Fernglas ab. Bleierne Schwermut lastete auf mir. Würde ich mich jemals an den Anblick der Ruine gewöhnen? Bei jedem Termin mit Struve nutzte ich die Aussicht vom Kappelberg für einen Blick auf das für mich unerreichbare Wahrzeichen meiner Heimatstadt.
Dieses Ritual diente mir als Mahnung. Ich durfte nie wieder so nachlässig werden wie vor der Katastrophe.
„Hey, Widmeyer!“, bellte es hinter mir.
Betont langsam drehte ich mich um. Drago, ein vierschrötiger Typ in Flecktarn, mit Bürstenschnitt und spiegelnder Sonnenbrille, steuerte direkt auf mich zu.
„Struve hat heute keine Zeit für dich!“
„Ich bin in Balmers Auftrag hier!“
„Egal, Struve hat keine Zeit! Basta!“
Drago hakte die Daumen beider Hände in den breiten Gürtel ein. Sein Bauch wölbte sich vor, als sollten meine Forderungen an seinem Fett abprallen.
„Der Landrat wird nicht erfreut sein, dies zu hören!“
Der massige Kroate zuckte demonstrativ mit den Schultern. Ich seufzte innerlich. Mit einem Anflug von
Resignation wandte ich mich meinem Mountainbike zu. Noch ehe ich danach greifen konnte, setzte er nach:
„Entspann dich, brauchst deswegen ja nicht gleich beleidigt abzurauschen!“
Ich hielt inne, drehte mich um.
„Ja wie nun? Hat Struve Zeit für mich oder nicht?“
„Der Boss nicht…“
„Aber?“
„Ich hätte da noch eine Frage.“
Mein Widerwillen gegen das, was jetzt käme, war groß. Aber es wäre dumm, Drago unnötig zu verärgern. Also ermunterte ich ihn:
„Schieß los!“
„Kannst du mir Nylonstrumpfhosen besorgen?“
Ohne mit der Wimper zu zucken musterte ich ihn.
Schließlich ließ ich demonstrativ meinen Blick seine Beine hinuntergleiten.
„Ich weiß nicht, ob es die in deiner Größe überhaupt…“
„Nicht für mich!“
Mit geballten Fäusten, sichtlich um Kontrolle ringend, starrte er mich wütend an. Noch ein falsches Wort und ich bekäme seine geübte Brutalität zu spüren.
„Das war doch nur ein Späßchen“, lenkte ich mit einem Lächeln ein. „Ich dachte, das verstehst du.“
„Deine Späßchen mag ich nicht!“
Außer seinen engsten Spießgesellen mochte auch niemand seine Späßchen. Der Kroate liebte es, andere zu schikanieren und zu demütigen. Seine Schwelle, hierbei auch rohe Gewalt einzusetzen, lag extrem niedrig.
Drago war ein harter Typ, einer von jener Sorte, dem die unzähligen Menschenleben, denen er ein Ende bereitet hatte, kein schlechtes Gewissen bescherten.
Es war ihm anzusehen. Er würde sich jetzt liebend gerne mich vornehmen. Ich trat einen Schritt auf ihn zu und lächelte auf ihn herab.
„So? Was hält Struve von deinem Humor? Gefallen ihm deine Späßchen besser als meine?“
Drago starrte wütend zu mir auf. Dann senkte er den Blick zu Boden. Seine verspiegelten Gläser halfen ihm nicht, seine Unterwerfungsgeste ließ sich nicht verbergen. Wenn er mich umbrachte, wäre auch sein Leben vorbei. Zumindest hoffte ich, dass dem so wäre.
„Besorgst du mir nun die Strumpfhosen oder nicht?“
Drago war ein brutaler Grobian, aber kein Dummkopf.
Er wusste, bis zu einem gewissen Grade war auch ich auf ihn angewiesen.
„Klar!“, lenkte ich ein. „Größe?“
„Hast du bei deinem letzten Termin mit Struve Maria gesehen?“
„Die rassige Schwarzhaarige?“
„Genau die! Ist sie nicht super?“
Ich nickte.
„Ihr sollen sie passen.“
Also hatte Struve bereits wieder sein Interesse an Maria verloren. Jetzt waren Drago und seine Kumpane an der Reihe. Eine weitere, die fälschlicherweise geglaubt hatte, mit Struve das große Los gezogen zu haben.
„Dürfte möglich sein, dauert aber ein bisschen“, schloss ich das Gespräch ab.
Ich nickte ihm zu. Er nickte knapp zurück, dann wandte er sich ab. Möglichst lässig schlenderte ich zu meinem Rad. Langsam rollte ich am Waldschlössle vorbei die Piste Richtung Fellbach hinunter. Balmer erwartete in Schorndorf ungeduldig meinen Bericht. Aus Sicherheitsgründen hatte der Landrat seinen Sitz von Waiblingen hinter die dicken Mauern des Schorndorfer Schlosses verlegt. Dort erwartete mich ein Berg Arbeit.
Dem würde ein weiterer einsamer Abend in meiner winzigen Kammer eines Schorndorfer Fachwerkhauses folgen. Der Blick auf Stuttgart hatte das Verlangen geweckt, in meine Heimatstadt zurückzukehren. Aber daran war vorläufig nicht zu denken.
*
Eine unsanfte Bewegung des Wagens riss mich aus meinem Traum von den letzten einigermaßen friedlichen Tagen meines früheren Lebens. Unbequem auf der mittleren Sitzbank eines Kleinbusses liegend, raste ich durch die nächtliche Wüste. Mühsam rappelte ich mich auf, um nach draußen zu sehen. Im spärlichen Licht einer mageren Mondsichel fiel mein Blick auf eine leicht gewellte, helle Sandfläche, vereinzelt von dunklen Flecken durchbrochen. Konnte dieses karge Land meine neue Heimat werden?
Der Himmel im Osten hellte sich bereits auf, als drei riesige Betonhäuser in Sicht kamen. Waren wir endlich am Ziel unserer einjährigen Flucht? Der Fahrer hielt vor dem ersten Betonblock. Umgehend wurde die Schiebetür aufgerissen. Ein hochgewachsener, kahlköpfiger Uniformierter mit stechenden, hellgrauen Augen musterte mich.
„Sind Sie Dr. Baitinger?“
Sein Deutsch besaß einen leichten schwäbischen Einschlag. Also war er vermutlich ein Landsmann. Ich nickte stumm.
„Wir erwarten Sie schon dringend! Folgen Sie mir!“
Der Hochgewachsene war das Kommandieren gewohnt. Er trat einen halben Schritt zur Seite, um mich nicht zu behindern. Seine hellen Augen forderten Eile.
„Was heißt, Sie erwarten mich schon dringend?“
„In unserem Arztposten ringt eine junge Frau seit Stunden mit dem Tod. Sie müssen ihr das Leben retten!“
Sein letzter Satz hatte flehentlich, fast verzweifelt geklungen. Sechs Worte verrieten etwas Persönliches über ihn. Handelte es sich um seine Tochter? Seine Geliebte? Oder um seine Frau?
„Warum bringen Sie die Frau nicht ins Krankenhaus?“
Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich.
„Weil das nicht möglich ist.“
Etwas Derartiges hatte ich befürchtet. Ich rutschte über die Bank auf die Tür zu, stieg endlich aus. Augenblicklich stach er los. Ich folgte ihm.
„Gibt es hier noch einen anderen Arzt?“, fragte ich seinen Hinterkopf.
„Nein.“
„Was ist mit meinem Vorgänger?“
Er blieb so abrupt stehen, dass ich auf ihn auflief.
Mühsam beherrscht drehte er sich um. Drohend starrte er auf mich herab.
„Diese eine Frage beantworte ich Ihnen noch! Dann erledigen Sie endlich den Job, für den ich Sie angefordert habe!“
Ich ahnte, dass ich aufgrund meines Berufes eine Sonderbehandlung erhielt. Normalerweise war er vermutlich nicht annähernd so geduldig und auskunftsbereit.
Durch ein knappes Nicken signalisierte ich ihm meine Zustimmung.
„Ihr Vorgänger war den Herausforderungen hier nicht gewachsen. Er ist vor vier Wochen abgehauen!“
Der Uniformierte wandte sich wieder seinem Ziel zu. Im Stechschritt steuerte er eine durch einen roten Halbmond gekennzeichnete Glastür an. Ich folgte ihm.
Also hatte ich es der weiteren Flucht meines Vorgängers zu verdanken, der Hölle des Lagers entflohen zu sein. Wobei ich schon nach den ersten Minuten bezweifelte, dass dies hier wirklich besser war. Interessant war immerhin, dass man von hier aus noch weiter, in bessere Länder flüchten konnte, zumindest als Arzt. Wo mein Vorgänger wohl hin war? Vielleicht nach Australien? Oder gar Amerika? Mein Herz begann voller Hoffnung schneller zu schlagen.
Im Nebenraum der winzigen Krankenstation lag eine Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einer Pritsche. Ihr Atem ging flach und stoßweise, Schweißperlen rannen über ihre Stirn.
„Hat sie Schmerzmittel bekommen?“
Er schüttelte stumm den Kopf. Gut, dass sie ihr nichts gegeben hatten. So würde mir die Diagnose leichter fallen. Ich berührte sanft ihre Schulter und fragte:
„Wie heißen Sie?“
Die vom Tod Gezeichnete öffnete die Augen. Verängstigt sah sie mich an.
„Hannah.“
„Okay Hannah, was fehlt Ihnen?“
„Sind Sie Arzt?“
Ich nickte.
„Mein Bauch schmerzt höllisch“, presste sie hervor.
„Außerdem fühle ich mich entsetzlich schwach. Ich habe panische Angst zu sterben.“
„Wo genau tut es Ihnen weh?“
„Der ganze Bauch!“
„Gibt es eine Stelle, von welcher der Schmerz ausgeht?“
Sie nickte.
„Zeigen Sie bitte darauf!“
Hannah wies auf einen Bereich schräg links unterhalb ihres Bauchnabels. Das hatte ich befürchtet. Sie lag auf dem Rücken. Ich drücke an der von ihr bezeichneten Stelle die Bauchdecke mit beiden Händen ein, ließ sie dann wieder emporschnellen. Hannah schrie vor Schmerzen auf.
Eine Frau im weißen Kittel hatte an ihrer Pritsche Wache gehalten. Bei unserem Eintreten war sie aufgesprungen, hatte sich an die Wand des kleinen Raums verdrückt. Mich an sie wendend fragte ich:
„Sind Sie Krankenschwester?“
Stumm schüttelte sie den Kopf.
„Haben Sie ihr trotzdem die Temperatur gemessen?“
„Sie hat über neununddreißig Grad Fieber“, flüsterte sie heiser.
„Gibt es hier einen Operationssaal?“
„Dies hier ist unser OP“, mischte sich der Uniformierte mit offenem Zynismus in der Stimme ein.
Ich starrte ihn an. Er starrte verkniffen zurück.
„Kommen Sie mit!“, forderte ich ihn, fluchtartig die Krankenstation verlassend, auf.
Vor der Tür wartete Sascha auf uns. Er hatte auf der Rückbank des Kleinbusses geschlafen, war aber offensichtlich geweckt worden. Jetzt nickte er schüchtern in meine Richtung, blieb aber, wo er war.
Auf dem staubigen Platz vor dem Gebäude stiegen soeben hunderte Männer europäischer Abstammung in orangene Busse. Der Anblick hatte etwas derartig Surreales, dass ich ihn mit offenem Mund anstarrte. Alle trugen exakt den gleichen hellgrauen Anzug und die gleiche rote Krawatte. Äußerst diszipliniert und geduldig schnurgerade Linien bildend, warteten sie darauf, in die Busse steigen zu dürfen.
„Was ist das?“, entfuhr es mir schließlich.
„Die Leute werden zur Arbeit gefahren. Ihr Sohn“, der Uniformierte zeigte auf Sascha, „wird morgen auch dabei sein.“
Die ersten Busse hatten ihre Fracht aufgenommen. Über die kurze Zufahrt fuhren sie in Richtung der Überlandstraße, auf der wir gekommen waren. Mit den Augen folgte ich dem weiteren Verlauf der Straße in die andere Richtung. Dort sah man in der Ferne die Gebäude einer Stadt, mit Palmen zwischen niedrigen Wohngebäuden und modernen Hochhäusern aus Glas im Hintergrund. Hier, rings um die drei schäbigen Betonblöcke, gab es hingegen nichts als staubigen Sand und vereinzeltes Gestrüpp.
„Was fehlt Hannah?“, fragte der Uniformierte.
Sorge und Verzweiflung standen in seinem Gesicht.
Seufzend wandte ich mich ihm zu.
„Sie hat vermutlich eine akute Blinddarmentzündung.
Deshalb muss sie ganz dringend dort hinten“, ich wies mit dem Finger in Richtung der Stadt, „operiert werden.“
„Das geht nicht.“
„Gibt es dort kein Krankenhaus?“
„Doch, sogar ein sehr modernes und gut ausgestattetes. Nur werden wir Europäer dort nicht behandelt.“
„Dann wird sie sterben.“
Sein Gesicht versteinerte. Sachlich fragte er:
„Können Sie Hannah operieren?“
„Nein.“
„Warum nicht?“
„Erstens haben wir hier keinen OP.“
„In den Schränken befindet sich die komplette Ausrüstung eines kleinen Feldlazaretts, inklusive Skalpellen, Klammern, Nadeln, Morphiumspritzen und was Sie sonst noch für eine Operation benötigen!“
Seine Betonung des Wortes Morphiumspritzen weckte meine Neugierde. Einen winzigen Augenblick zögerte ich. Dann fuhr ich ihn jedoch an:
„Woher wollen Sie wissen, was ich für eine Operation benötige!“
Herausfordernd sah ich zu ihm auf. Ohne mit den Wimpern zu zucken, mit fest aufeinander gepressten Lippen, hielt er meinem Blick stand. Meiner Intuition folgend fuhr ich fort:
„Hat mein Vorgänger hier operiert?“
„Nein.“
„Na also!“, trumpfte ich auf. „Ich bräuchte für eine Operation einen Anästhesisten, zwei OP-Schwestern und die übliche technische Mindestausstattung eines Operationssaals.“
„Es wäre wunderbar“, entgegnete er mühsam beherrscht, „wenn wir über all diesen Schnickschnack verfügten. Aber rein grundsätzlich sind zumindest kleinere Operationen auch ohne möglich!“
„Wir reden hier nicht davon, unter Kampfbedingungen eine Kugel aus einem Arm zu puhlen oder die klaffende Wunde eines Granatsplitters provisorisch zusammenzunähen. Ich soll einer Frau den Bauchraum öffnen, um ihr ein eitriges Organ zu entfernen!“
Er starrte auf eine Art und Weise auf mich herab, die nichts Gutes verhieß.
„Wenn Sie sich weigern zu operieren, kann ich Sie hier nicht gebrauchen.“
„Wunderbar! Ich will hier ohnehin nicht bleiben!“
Er zog seine Pistole, entsicherte sie, drückte den Lauf auf meine Stirn. Seine stahlgrauen Augen blickten kalt auf mich herab. Meine Blase entleerte sich.
„Was soll das!“, schrie ich panisch. „Warum lassen Sie mich nicht einfach abhauen, wie meinen Vorgänger?“
„Tu ich doch! Aber von hier aus geht’s nur ins Paradies. Vorausgesetzt natürlich, Sie glauben daran. Ansonsten halt ins Jenseits. Ihr Vorgänger beamte sich mit einer Morphiumspritze zu viel selbst dorthin. Ich besitze nicht mehr die Geduld abzuwarten, bis Sie den gleichen Weg gehen. Sie sind die einzige medizinische Versorgung, die uns hier zugestanden wird. Entweder Sie nehmen diese Aufgabe an und leisten unsere Versorgung, oder wir brauchen Sie nicht. Dann bin ich es meinen Leuten schuldig, ohne unnötige Zeitverzögerung einen neuen Arzt anzufordern.“
Mein ganzer Körper zitterte.
„Was ist, wenn ich eine Operation versuche und Hannah stirbt?“, stammelte ich.
Sichtlich erleichtert zog er seine Pistole zurück, sicherte sie, steckte sie zurück in sein Halfter.
„Dann würde ich sagen, gratuliere, Sie haben die Herausforderung angenommen! Doch genug geschwätzt, legen Sie endlich los!“
Erneut zeigten sich Sorge und Verzweiflung in seinem Gesicht.
„Wie heißen Sie?“, fragte ich ihn.
„Kommissar Keller.“
„Kommissar? Wie…“
„In meinem vorherigen Leben war ich Kriminalkommissar. Die hiesigen Behörden übertrugen mir wegen dieser Qualifikation die Verantwortung für Ruhe und Sicherheit in der Siedlung.“
Kommissar! Eine völlig irrationale Hoffnung erfüllte mich. Würde ich doch noch Antworten auf meine beiden letzten relevanten Fragen erhalten? Aufgeregt legte ich los:
„Ich werde mein Möglichstes tun, um Hannah zu helfen. Aber im Gegenzug bitte ich Sie, mir dann auch zu helfen!“
Keller wirkte ungehalten. Verkniffen antwortete er:
„Wenn es in meiner Macht steht.“
„Tut es! Erstens habe ich von meiner Tochter Pauline seit drei Jahren nichts mehr gehört. Ihre Fluchtroute führte ebenfalls Richtung Südost. Können Sie etwas über Pauline in Erfahrung bringen?“
„Kein Problem. Viele suchen ihre Angehörigen. Die Behörden verhalten sich hierbei kooperativ. Was noch?“
Die zweite Frage war heikler. Daher rang ich kurz um passende Worte:
„Finden Sie heraus, ob er“, ich nickte in Richtung des außerhalb unserer Hörweite wartenden Saschas, „meine Frau ermordet hat.“
„Sie wollen wissen, ob Ihr Sohn Ihre Frau tötete?“
Ich nickte. Keller schien nicht sonderlich überrascht. Es herrschten grausame Zeiten. Nüchtern fragte er:
„War Ihre Frau seine Mutter?“
Ich zögerte einen verräterischen Augenblick zu lang mit meiner Antwort, erwiderte aber trotzdem:
„Ich war nur einmal verheiratet und habe keine außerehelichen Kinder.“
Durch ein Nicken drückte er seine Zustimmung aus, sich auch um diese Angelegenheit zu kümmern. Er schien mir ein guter Kriminalist zu sein und würde mich sicherlich noch genauer befragen. Andererseits lag ihm offensichtlich persönlich etwas an meiner Patientin Hannah. Vielleicht würde er mich, sollte ich die Operation vermasseln, auch kurzerhand liquidieren, statt meine Angelegenheiten zu den seinen zu machen. Dies berührte mich nicht sonderlich. Permanente Lebensgefahr stumpfte ab. In meinem bisherigen Leben hatte ich nur bei zwei oder drei Blinddarm-Operationen assistiert. Dies war vor über einem Vierteljahrhundert während des Studiums gewesen. Hannah würde meine erste eigene Operation sein.
*
Am Schorndorfer Schloss angelangt, marschierte ich geradewegs ins Büro des Landrats. Balmer erwartete mich bereits. Mit Sorgenfalten auf der Stirn sah er mir entgegen.
„Was meint Struve?“
„Er hat mich nicht einmal empfangen.“
Ermüdet vom Radfahren sank ich auf den Besucherstuhl gegenüber seinem Schreibtisch.
„Scheiße!“
Normalerweise war sich der Landrat für Fäkalworte zu schade. Dass er jetzt doch eins nutzte, zeigte, unter welchem Druck er stand. Ich beugte mich vor:
„Können wir uns nicht auch ohne Struve mit General Wahler und seinen Leuten vereinen? Ich meine zwischen uns und ihnen liegt nur der Stuttgarter Osten. Dass unsere Kämpfer in Untertürkheim den Neckar überqueren und die paar Kilometer hoch bis zur Filderebene besetzen, kann doch nicht so schwer sein! Ein Zipfel des Ostens ist sogar noch in Wahlers Hand.“
Balmer saß ungerührt in seinem Chefsessel. Mir blieb viel Zeit, seinen Dreitagebart und seinen vollen Haarschopf zu betrachten. Tief versunken starrte er vor sich hin. Hatte er mir überhaupt zugehört?
„Struve war schon vor Ausbruch des Bürgerkriegs Offizier, wenngleich auch nur Oberleutnant. Wenigstens hat er eine Ausbildung in militärischer Strategie und Taktik durchlaufen. Wenn er sich meinem Ansinnen derart verweigert, wäre es dumm von mir, einfach darüber hinwegzugehen. Außerdem müssen wir darauf achten, das fein austarierte Gleichgewicht zwischen unseren Warlords nicht zu gefährden. Demokratie hin oder her, in diesen Zeiten hat ein gewählter Zivilist wie ich schnell nichts mehr zu sagen.
Vielen Dank Sascha! Du bist den mühseligen Weg von hier hoch auf den Fellbacher Kappelberg und wieder zurück geradelt. Mach Schluss für heute.“
Frustriert starrte ich meinen Chef an. Ich fühlte mich wie ein Kind, das von den Erwachsenen, gerade wo es anfängt spannend zu werden, ins Bett geschickt wird. Ganz so war es wohl nicht. Aber zum engsten Kreis seiner Berater gehörte ich keineswegs. Balmer vertraute mir, nutzte mich als Boten mit engem Verhandlungsspielraum. Benzin erreichte uns schon lange nicht mehr. Einige wenige, vor allem von unseren Kämpfern genutzte Lastwagen, fuhren mit vor Ort produziertem Biodiesel. Ansonsten besaß die politische Administration ein einziges Elektroauto, dessen Akku aus dem knappen, durch Wind- und Wasserkraft erzeugten, Strom geladen wurde. Ganz unerwartet hatte das Remstal die ökologische Energiewende vollzogen. Balmer schickte mich auf meinem Mountainbike durch den Kreis. Er vertraute weder Telefon noch Funk, da er fürchtete beides werde von unseren Feinden abgehört. Vor dem Schorndorfer Schloss blieb ich unschlüssig stehen. In meiner Kammer war es kalt und einsam. Es gab dort nichts zu Essen. Also schlug ich den Weg zur Skybar ein. Normalbürger konnten dort nur hineingelangen, wenn sie jung, weiblich und attraktiv waren.
Als das große Sterben begann, hatten Waffen tragende Männer eine steile Karriere von einer Randgruppe, auf die man herabsah, zum Garant des eigenen Überlebens hingelegt. Das Patriarchat war in seiner extremsten Form zurückgekehrt.
In der Skybar dröhnte die Musik der Band des Abends ohrenbetäubend laut. Die Musiker arbeiteten ohne elektrische Verstärkung. Eine andere Wahl blieb ihnen auch nicht. Selbst die privilegierte Skybar nutzte ihre knappe Stromration lieber, um Bier zu kühlen, als für Licht oder Musik. Die Lautstärke störte nicht weiter. Reden wollte hier ohnehin keiner, sondern feiern und vergessen.
Niedrige Lounge-Möbel waren schmalen Holztischen und noch schmäleren Sitzbänken gewichen. Die Gäste rekrutierten sich mehr als je zuvor aus den Bevorzugten Schorndorfs. Aber, selbst hier galt es, möglichst viele unterzubringen, statt es sich wenigen bequem machen zu lassen. Direkt am Panoramafenster Richtung Stuttgart zwängte ich mich auf das Ende einer schmalen Holzbank. Die tiefhängenden Wolken wurden unregelmäßig von flackerndem Licht unterschiedlicher Färbung und Intensität erleuchtet. Das Schauspiel verhieß nichts Gutes. Ich meinte das dumpfe Grollen schwerer Explosionen zu vernehmen, wenngleich dies auf die Entfernung und in Anbetracht der Lautstärke der Musik nicht möglich war.
„Die Nationalisten schlachten endgültig die Osmanen ab!“, brüllte mein Gegenüber mir ins Ohr.
Fragend blickte ich ihn an. Der Tisch war so schmal, dass er sich kaum vorbeugen musste, um mir erneut ins Ohr zu brüllen:
„Mein Trupp sichert in Poppenweiler die Grenze. Früher lieferten wir uns regelmäßig kleine Scharmützel mit den Osmanen. Fast jede Nacht gab es Alarm und wir mussten eilig aus unserem Quartier in der alten Dorfscheune ausrücken. Jetzt ist auf deren Seite des Neckars keine einzige Wache mehr zu sehen. Wir könnten einfach rüber. Jeder Osmane, der eine Waffe halten kann, kämpft verzweifelt darum, die Rechten von ihren Frauen und Kindern fernzuhalten.“
Die Bedienung kam. Ungefragt stellte sie einen Teller Eintopf, das einzige verfügbare Gericht, und ein Bier vor mir ab. Osmanen, einst eine aus Türken rekrutierte Ludwigsburger Rocker-Gang, war zum Namen für unsere muslimischen Nachbarn geworden.
„Die Osmanen gehören zwar nicht zu uns“, brüllte er mir weiter ins Ohr, „aber dass die Nationalisten ihre Frauen und Kinder abschlachten, ist nicht richtig. Hoffen wir, dass uns nicht das Gleiche blüht!“
Ich zwang mich, meinen Teller des undefinierbaren Eintopfs langsam zu essen. Das knorpelige Fleisch spülte ich mit zwei Bier hinunter. Dann drängte ich auf die enge Tanzfläche. Ich riss die Arme empor und tanzte möglichst wild zu den ungestümen Klängen der Musik. Eines musste man dem Bürgerkrieg lassen: Die Partys waren geiler geworden. Jeder lebte im permanenten Wissen, heute könnte sein letzter Tag sein.
Ein Feuerschopf warf mir interessierte Blicke zu. Ich lächelte ihr zu, drängte mich in ihre Richtung. Wir tanzten uns an, entfachten unsere Lust. Als diese loderte, begleitete sie mich in meine Kammer. Dort verschaffte sie mir Trost und Erlösung. Entspannt schlief ich in ihren Armen ein. Doch auch in dieser Nacht kehrte der Traum von meinen letzten Stunden vor dem Bürgerkrieg zurück:
Ein lauter Knall riss mich aus dem Lernen. War das ein Schuss? Mein Herz pochte wild.
„Quatsch, jetzt werde du nicht auch noch paranoid!“, versuchte ich mich selbst zu beruhigen. „Reicht es nicht, dass Pauline mit ihrem Gequatsche von einem bevorstehenden Bürgerkrieg Mama um den Schlaf bringt?“
Gewaltsam zwang ich meinen Blick zurück zum Arbeitsblatt auf dem Bildschirm vor mir. Ich durfte mich durch nichts ablenken lassen! Schließlich wollte ich mein Masterstudium im Frühjahr abschließen. Bei einer Arbeitslosenquote von nahezu fünfzig Prozent für die unter sechsundzwanzigjährigen würde es verdammt schwer werden, einen Job zu finden. Nur die Besten besaßen eine realistische Chance. Zu denen wollte ich gehören.
Auch wenn es mir schwerfiel, verzichtete ich dafür heute auf die Halloween-Party im Keller. Zumindest würde ich dort nicht vor zweiundzwanzig Uhr hingehen, während die übrigen Studenten meines Wohnheimes bereits unüberhörbar feierten. Ich las eine weitere Zeile des Arbeitsblattes, ehe ich mich seufzend erhob. Der laute Knall war durch die Wand des Nachbarzimmers gedrungen. Es konnte nichts schaden, kurz nach Ameer zu sehen. Seit fünf Jahren wohnten wir Tür an Tür und de facto hatte ich so eine Art Patenschaft für ihn übernommen. Zu Beginn war ich einfach nur neugierig auf die direkte Begegnung mit einem Menschen gewesen, der dem Bürgerkrieg in Syrien entronnen war. Wir waren gleich alt und hatten uns auf Anhieb gut verstanden. Energisch klopfte ich an seine Tür. Ameer antwortete nicht. Ich legte mein Ohr an den Pressspan. Sein unterdrücktes Schluchzen war kaum zu hören. Entschlossen stieß ich die Tür auf. Ameer fuhr von seinem Bett hoch. Mit großen Augen starrte er mich an.
„Alles klar bei dir?“, fragte ich.
Meine Worte verklangen. Er reagierte nicht. Den Boden zierte ein großer, dunkelroter Fleck. Fassungslos machte ich zwei Schritte hinein in sein winziges Wohnheimzimmer. Vor dem Fleck bückte ich mich. Die Flüssigkeit breitete sich langsam weiter aus, befand sich also noch nicht lange auf dem Linoleum. Sie sah verdammt nach etwas aus, das sie nicht sein sollte.
„Ist… ist das… Blut?“, stammelte ich.
„J..ja, ich..ich habe mich verletzt.“
„Verletzt?“
Aus einem seiner weißen Turnschuhe tropfte Blut. Ich griff vorsichtig danach. Er ließ es geschehen. Der Sportschuh wies oben im Bereich des Vorderfußes ein kreisrundes Loch auf. Ich hob den Fuß an und bückte mich fast bis zum Boden. In der Sohle war ebenfalls ein kreisrundes Loch, aus dem Blut sickerte.
„Wie kann man sich so verletzen?“, fragte ich entsetzt.
Er sah beschämt zur Seite.
„Eigentlich auch egal“, meinte ich. „Das muss auf jeden Fall desinfiziert und verbunden werden. Am besten, ich bringe dich ins Krankenhaus.“
„Nein! Kein Krankenhaus!“, rief er entsetzt.
„Warum nicht?“
„Gibt nur Probleme!“
„Probleme bekommst du, wenn dein Fuß nicht richtig behandelt wird!“
Vor ihm kniend starrte ich zu ihm auf. Er hielt meinem Blick stand. In seinem sonst so sanftmütigen Gesicht lag Trotz. Es vergingen einige Momente, dann griff er unter die Decke. Mit zitternder Hand zog er eine Pistole hervor.
„Stammt von ihr das Loch in deinem Schuh?“
Er nickte.
„Warum schießt du dir in den Fuß?“
„Habe ich nicht!“, protestierte er schwach.
Irritiert sah ich mich in dem kleinen Zimmer um.
„Hier ist aber sonst niemand.“
„Ich…ich wollte die Pistole nur entsichern und…“ Erneut wandte er den Blick ab.
„Ist auch egal“, lenkte ich ein. „Lass mich zumindest die Wunde desinfizieren und verbinden.“
Vorsichtig schnürte ich den Schuh auf, bog ihn so weit wie möglich auseinander. Ameer zuckte zusammen, biss sich stöhnend auf die Lippe. Seine dunklen Augen verrieten seine Qual. Er hatte nie ein schlechtes Wort über einen anderen Menschen verloren, war jedem Konflikt aus dem Weg gegangen. Die Pistole passte überhaupt nicht zu ihm. Was hatte er mit ihr vor? Als ich seinen Socken abstreifte, stöhnte er erneut. Das Projektil hatte ein kreisrundes Loch in den Fuß gestanzt. Die Wunde blutete nur noch schwach. Also war vermutlich kein größeres Gefäß verletzt. Kurz überlegte ich, meinen Vater in Stuttgart anzurufen. Aber der war nur Psycho-Doc und würde mir hierbei kaum helfen können. Außerdem würde er bestimmt Mama davon erzählen. Die stand ohnehin kurz vor dem Durchdrehen. Also ließ ich es sein.
„Halte durch, ich hole meinen Verbandskasten.“
Er nickte tapfer. Ich eilte nach nebenan. Dort füllte ich eine Schale mit Wasser. Aus dem Schrank holte ich einen frischen Waschlappen und ein Handtuch.
Vorsichtig säuberte ich die Wunde so gut es ging, desinfizierte und verband sie.
„Fertig.“
Ich sah ihn voller Ernst an.
„Danke, Yannick.“
„Ich bleibe dabei, du solltest die Wunde ärztlich versorgen lassen!“
„Das geht nicht“, flüsterte er.
„Warum nicht?“
„Weil!“
Sein Gesicht verfinsterte sich. Ich wartete. Er schwieg verstockt. Also fragte ich weiter:
„Wer hat dir die Pistole gegeben?“
„Ein Bruder.“
„Ein Bruder? Meinst du damit, ein anderer Moslem?“
Er nickte schwach.
„Seit wann nennst du Moslems Brüder? Bisher hast du dich lustig darüber gemacht, wenn Moslems so voneinander sprachen!“
Seine Lippen wurden schmal. Trotzig sahen mich seine dunklen Augen an. Ich starrte zurück. Kurz zögerte ich, dann setzte ich mich neben ihm aufs Bett. Er ließ es geschehen.
„Ist es unsere Schuld, dass es so weit gekommen ist?“
„Du meinst, weil wir das Gipfelkreuz durch den goldenen Halbmond ersetzten?“
Ich nickte.
„Das war nur ein dummer Streich von uns! Wir konnten doch nicht ahnen, dass die Sache so bitter ernst genommen wird!“
Einmal mehr hatten wir ein Saufgelage als Gin-Verköstigung getarnt. Spät in der Nacht lallte Ameer im Suff, die deutschen Gipfelkreuze diskriminierten ihn als Moslem. Am Wochenende zuvor hatten wir vier eine Bergtour auf den Hochvogel unternommen, auf der Ameer die Kultur der Gipfelkreuze kennenlernte. Bis zu jenem Tag hatte ich nie einen Gedanken daran verschwendet, dass Gipfelkreuze ein christliches Symbol sein könnten.
Als er sich über diese christliche Symbolik beschwerte, befanden wir uns in einem Zustand, in dem der Alkohol längst jegliche Vernunft fortgespült hatte. Wie sonst hätte es zu einer Diskussion darüber kommen können, jedes wievielte Bergkreuz durch einen goldenen Halbmond zu ersetzen sei? Wir hatten unseren Spaß, ich bereits am darauffolgenden Tag die Diskussion wieder vergessen. Nicht so Paul und Kevin, die als Maschinenbau-Studenten verkatert öde Pflichtstunden in den Werkstätten absaßen.
Ein Foto von uns vier unter dem Gipfelkreuz bildete den Ausgangspunkt ihres Plans. Auf dem Bild war deutlich zu sehen, dass das große Kreuz durch nur zwei Schrauben mit den massiven Stahlträgern seines Fundaments verbunden war. Die beiden berechneten die Maße und erstellten die technische Zeichnung eines Gipfelhalbmonds in Leichtbauweise, der sich in vier Teile zerlegt auf unseren Rücken zur Bergspitze tragen ließ.
An einem weiteren Abend mit reichlich Alkohol stellten sie uns ihre Entwürfe vor. Wir amüsierten uns königlich über die Vorstellung, was wohl im Allgäu los wäre, wenn wir heimlich den Hochvogel zum Islam bekehrten. Der aus dem Allgäu stammende Paul hielt einen Wochentag im Oktober für den idealen Zeitpunkt einer Missionierung des markanten Gipfels. Mit Geschick und Feuereifer machten er und Kevin sich an die Arbeit. Seinen Worten entnahm ich, dass er noch eine Rechnung mit den stieren, erzkonservativen Allgäuern offen hatte.
In aller Frühe fuhren wir an einem Dienstag im Oktober ins Allgäu. Bei Tagesanbruch machten wir uns bei grau verhangenem Himmel auf den Weg zum Gipfel. Ich war wegen des Himmels skeptisch, aber Paul meinte, bei diesem Wetter seien wir garantiert die Einzigen dort oben. Anfangs war ich nervös. Die verpackten Teile des Halbmonds lugten aus unseren Rucksäcken. Jeder würde uns ansehen, dass wir was Krummes vorhatten. Aber wie von Paul vorhergesagt, begegneten wir tatsächlich niemandem. So beruhigte ich mich rasch.
Auf der Spitze löste Paul die Schrauben des Gipfelkreuzes. Mit Seilen und einem selbstgebauten Flaschenzug sicherten wir drei Übrigen die schwere Konstruktion aus Stahl und Holz vor dem Umfallen. Bald lag sie flach neben ihrem Fundament. Beim Zusammensetzen unseres Halbmonds erfasste uns eine fiebrige Erregung. Wir malten uns in den schillerndsten Farben aus, wie die Allgäuer wohl reagieren würden, kicherten hysterisch bis albern. Als wären wir ein eingespieltes Team, das seit Jahren Kreuze durch Halbmonde ersetzte, benötigten wir keine Stunde. Bald war das Werk vollbracht. Schnell machten wir noch ein paar Fotos von uns unter dem Halbmond, mit einem breiten Grinsen im Gesicht und Victory-Zeichen in den Fingern. Dann eilten wir den Berg wieder hinunter. Die letzten Meter stiegen wir im Schein unserer Stirnlampen ab. Noch in der Nacht fuhren wir zurück nach Karlsruhe. Wir wollten keinerlei Spuren im Gästeverzeichnis einer schäbigen Pension hinterlassen.
Gespannt durchforsteten wir am nächsten Morgen, nein, es war wohl schon eher Mittag, das Internet nach Reaktionen. So oft wir auch Begriffe wie „Halbmond“, „Hochvogel“ oder „Gipfelkreuz“ eingaben, nichts wies auf unser Tun hin. Auch am Donnerstag blieb zu unserer Enttäuschung alles ruhig.
Am Freitag brach dann der Sturm los. Endlich hatten die Allgäuer entdeckt, welches Ei wir Ihnen ins Nest gelegt hatten. Ein verknitterter Almödi empörte sich öffentlich und alle Empörten der Republik stiegen hasserfüllt darauf ein. Galt anfänglich der Hass rein den Tätern, also uns, richtete sich neuer Hass rasch gegen die Hasser. So hasste bald so ziemlich jeder jemanden.
Spätestens, als eine Diskussion einsetzte, jedes wievielte Gipfelkreuz als Schutz gegen Diskriminierung durch Gipfelhalbmonde zu ersetzen sei, verflog unsere Belustigung. Zudem erfuhren wir über die Medien, dass schon seit einiger Zeit um die Gipfelkreuze ein Kulturkampf tobte. Im Sommer 2016 waren in Bayern drei Gipfelkreuze zerstört worden, eines davon am zweitausendeinhundert Meter hohen Gipfel des Schafreiter. Reinhold Messner, der gerne alles rund um die Berge kommentiert, äußerte daraufhin „Gipfel sollten leer sein und nicht für irgendeine Religion missbraucht werden“. Hätte der Guru uns dies doch nur rechtzeitig persönlich gesagt! Vielleicht hätten wir auf ihn gehört. So führten wir viel zu spät eine halbherzige Diskussion, ob es die Situation entschärfen würde, wenn wir uns zu erkennen geben und das Ganze als Dummer-Jungen-Streich darstellten. Mitten in unsere Diskussion platzte die Meldung von den zwei Toten in Dresden.
„Doch!“, entgegnete ich in Ameers winzigem Zimmer.
„Wir hätten wissen müssen, dass die gesellschaftliche Atmosphäre bereits so vergiftet war, dass unser Streich fatale Folgen haben könnte.“
„Dass ein linker Spinner zwei rechte Spinner erschießen würde, konnte keiner von uns ahnen!“
„Stimmt, aber dass die Sache nicht im friedlichen Allgäu verbleiben, sondern bundesweit zu giftigen Diskussionen führen würde, hätte uns klar sein müssen. Genauso, dass man die Sache deinen Glaubensbrüdern anhängen würde.“
Es belastete mich schwer, Mitverantwortung am Tod zweier Menschen zu tragen. Der Vorfall lag gut zwei Wochen zurück. Gefühlt hatte es sich bei den Morden in Dresden um den berühmten Tropfen gehandelt, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Schwelle zur Anwendung tödlicher Gewalt war überschritten worden, was sich nicht rückgängig machen ließ, zumal die brutale Antwort von rechts bald erfolgte. Vorige Woche waren zwei bekannte Linksautonome aus Leipzig vor ihrer Stammkneipe erschossen worden. Vermutlich war ihnen ihre Teilnahme bei den tödlichen Krawallen in Dresden zum Verhängnis geworden. Das uralte, archaische Prinzip der Blutrache war in unsere moderne Gesellschaft zurückgekehrt. Gott sei Dank waren wir hier in Deutschland. Polizei und Justiz würden dies wieder stoppen.
„Die Zeiten haben sich geändert“, meinte Ameer.
Ich sah ihn irritiert an.
„Was meinst du damit“ Er starrte nur düster vor sich hin. Also fuhr ich fort:
„Heißt das, du willst zurück nach Syrien, in den Krieg?“
„Dort ist kein Krieg mehr.“
„Ein Pedant bist du also auch geworden!“
Ich sah ihn an. Er schwieg. Behutsam setzte ich mich neben ihn aufs Bett, tätschelte seine Schulter und fuhr fort:
„Geh nicht dorthin. Der ganze Scheiß ist doch absolut sinnlos. Es lohnt sich nicht, dafür sein Leben zu riskieren. Du hast schon genug Schreckliches erlebt. Außerdem bist du kein Krieger.“
Tränen strömten seine Wangen hinab. Ich blieb neben ihm sitzen und wartete. Schließlich flüsterte er:
„Ich geh nicht dorthin. Der Krieg kommt her.“
„Wie bitte?“
Er nickte zur Bekräftigung.
„Du meinst hierher? Nach Deutschland?“
Erneutes Nicken.
„Das kann nicht sein!“
In meinen Eingeweiden tat sich ein Loch auf. Jetzt redete Ameer schon wie meine Schwester Pauline!
„Doch!“, flüsterte er. Tränen traten in seine Augen.
„Du bist ein guter Mensch. Ich bin glücklich, dir begegnet zu sein und danke dir für das Geschenk deiner Freundschaft. Aber nicht alle Deutschen sind wie du und nicht alle Moslems sind wie ich. Zu viele glauben, die Zeit der Gewalt sei gekommen.“
Ein Teil meines Verstandes weigerte sich, so zu denken. Politiker und Medien versicherten gebetsmühlenartig etwas anderes. Zögernd fragte ich Ameer:
„Willst du dich deren Kampf anschließen?“