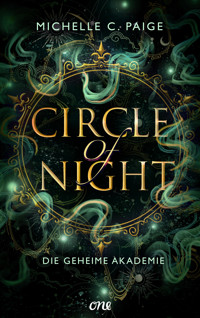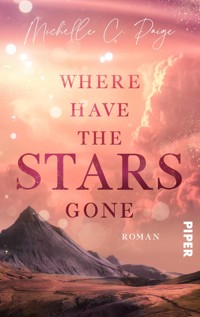3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein gebrochenes Herz und die Magie der Polarlichter Den schwarzen Sand unter den Füßen und die tosenden Wellen vor sich – Emilia steht an der eisigen Küste Islands und erhofft sich nichts mehr vom Leben. Der plötzliche Verlust ihres Ehemanns hat eine tiefe Wunde in ihr hinterlassen. Eigentlich wollten sie zusammen die Nordlichter bestaunen, doch jetzt ist Emilia allein hier und es gibt keine Spur von den tanzenden Lichtern am nachtschwarzen Himmel. Emilia droht in ihrer Trauer zu versinken, bis Arnar in ihrem Leben auftaucht. Der sehr hilfsbereite Isländer zeigt ihr nicht nur die Schönheit der Insel, sondern könnte auch ihr Licht in der Dunkelheit sein. Doch ist Emilia überhaupt bereit, ihr Herz neu zu verschenken, obwohl es immer noch in Scherben liegt? »Unser Herz hält uns am Leben, so viele Jahre ohne Pause und doch ist es extrem zerbrechlich. Es ergibt keinen Sinn, dass meines noch funktioniert, seitdem es in tausend Teile zersprungen ist.« Eine herzzerreißende Liebesgeschichte auf der Sehnsuchtsinsel Island
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Ähnliche
Together we shine
Die Autorin
Michelle C. Paige, geboren 1990, lebt aktuell mit ihrem Mann im Rhein-Main-Gebiet und arbeitet als Projektmanagerin in einer Digitalagentur. "Schriftstellerin" hat sie als Kind in jedes Freundebuch als Traumberuf geschrieben, denn ihre Leidenschaft ist und war schon immer nur eins: Geschichten schreiben. Ihre ersten Erfolge als Autorin hat sie seit 2017 mit drei in Anthologien erschienen Kurzgeschichten erlangt und tüftelt zu jeder Zeit an unzähligen frischen Romanideen. Wenn man sie nicht in einem ihrer vielen Tagträume findet, dann vermutlich auf Island, wo sie seit 2016 jedes Jahr hinreist, ihr Herz verloren hat und zukünftig leben möchte.
Das Buch
Den schwarzen Sand unter den Füßen und die tosenden Wellen vor sich – Emilia steht an der eisigen Küste Islands und erhofft sich nichts mehr vom Leben. Der plötzliche Verlust ihres Ehemanns hat eine tiefe Wunde in ihr hinterlassen. Eigentlich wollten sie zusammen die Nordlichter bestaunen, doch jetzt ist Emilia allein hier und es gibt keine Spur von den tanzenden Lichtern am nachtschwarzen Himmel. Emilia droht in ihrer Trauer zu versinken, bis Arnar in ihrem Leben auftaucht. Der sehr hilfsbereite Isländer zeigt ihr nicht nur die Schönheit der Insel, sondern könnte auch ihr Licht in der Dunkelheit sein. Doch ist Emilia überhaupt bereit, ihr Herz neu zu verschenken, obwohl es immer noch in Scherben liegt?
Michelle C. Paige
Together we shine
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH,Berlin Januar 2022 (1)© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © 2021 Styrmir & Heiðdís // Iceland Wedding PhotographerE-Book powered by pepyrus
978-3-95818-659-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Triggerwarnung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Danksagung
Nachwort: Hilfe für Betroffene
Leseprobe: All die Sterne zwischen uns
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Triggerwarnung
Widmung
Für Greg. Für immer und so. Du weißt schon.
Triggerwarnung
Liebe Leser*innen,wir möchten euch darauf aufmerksam machen, dass Together we shine Elemente enthält, die triggern können.
Diese sind: Angstattacken, Depression, Suizidgedanken und Suizidversuch.
Kapitel 1
Das hier ist die richtige Entscheidung. Das weiß ich, als ich aus meinen Schuhen steige und den eiskalten schwarzen Sand unter meinen Füßen spüre. Schon seit Stunden ist es dunkel. Die einzige Lichtquelle sind die Laternen der um diese Zeit nicht mehr besetzten Touristeninformation und trotzdem habe ich abgewartet, bis auch die letzten Menschen den beliebten Strand verlassen haben. Endlich bin ich allein. Mühsam schäle ich mich aus meinem Parka, der sofort von einer Böe weggerissen wird. Meine Haare sind zerzaust vom Wind und binnen Sekunden frisst sich die Kälte durch mein dünnes Kleid tief in meine Knochen, sodass sich langsam eine willkommene Taubheit in meinem Körper ausbreitet. Die tosenden Wellen sind an diesem stürmischen Tag besonders hoch und gewaltig, tödlich innerhalb von Minuten für jeden, der es wagt, ihnen zu nahe zu kommen. Die zahlreichen Warnschilder erklären zwar die unberechenbaren und plötzlich kommenden »Sneaker Waves«, beobachtet habe ich heute aber dennoch viele leichtsinnige Touristen, die sich zu ihrem Glück nur nasse Schuhe geholt haben.
Aber genau wegen dieser Gefahr bin ich hier.
Nicht, weil ich es schon seit Wochen geplant hatte, doch es kommt mir wie der einzige Weg aus der Dunkelheit vor, die mich von innen seit Langem zerfrisst.
Mit jedem Schritt, den ich auf das Wasser zugehe, wird mein Herz leichter. Mit jeder Sekunde, die vergeht, werde ich unruhiger, weshalb ich schneller laufe. Die letzte Welle hat sich gerade zurückgezogen und den Sand eiskalt hinterlassen, sodass ein stechender Schmerz meine Füße durchschießt. Ich stoppe, atme tief ein und aus und schließe die Augen. Das Tosen in meinen Ohren wird intensiver, während ich blind weitergehe. Ich warte darauf, dass mich von einer Sekunde auf die nächste eine Welle packt, von den Beinen reißt und mich hinaus aufs Meer zieht. Doch ehe ich mich dem hingeben kann, durchschneidet ein entsetzter Schrei die Nacht und ich fahre zusammen, reiße die Augen auf.
Mir bleibt keine Zeit zu reagieren, als ich von jemandem gepackt und festgehalten werde und wir zeitgleich zusammen von einer Welle auf die Knie geworfen werden. Das kalte Wasser durchfährt meine Haut wie tausend kleine Nadelstiche, die ich zwar erwartet habe, mich jetzt aber doch so überrumpeln, dass ich erschrocken aufkeuche. Außerdem spüre ich den Sog, der mich und die Person, die mich jetzt noch fester hält, mit ins Meer zu nehmen droht. Doch dann zieht sich die Welle wieder zurück und wir liegen komplett durchnässt am Strand. Die nächste rollt bereits unbarmherzig auf uns beide zu, aber bevor sie uns mit voller Wucht davonreißen kann, werde ich aus der bedrohlichen Brandungszone herausgezogen. Nach Luft ringend versuche ich, mich von dem Fremden zu befreien, nur ist er zu stark und schleift mich heftig keuchend durch den Sand.
»Lass los!«, schreie ich auf Englisch. Als wir ein Stück vom Wasser entfernt sind und er etwas lockerlässt, reiße ich mich los. Ein lautes Klingeln erfüllt meine Ohren, welches das Tosen der Wellen und alle anderen Geräusche dämpft. Vor mir verschwimmt die Welt. Ich richte mich mit wackligen Beinen auf und während der schwer atmende Fremde mich mustert, schüttelt er wütend den Kopf. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, doch dann betrachtet er mein Gesicht und mein Kleid und blinzelt schockiert.
»Warte.« Seine Augen weiten sich, als hätte er verstanden. »Du hast das mit Absicht gemacht!«
Wie durch Watte dringen seine Worte zu mir durch. Ich bin wie in Trance, zu perplex, um wegzulaufen. Nicht umsonst habe ich so lange gewartet, bis alle weg sind. Die Gefahr, dass mich jemand hätte aufhalten können, wollte ich nicht eingehen. Ich habe so gut aufgepasst. Woher ist er gekommen und warum ist er hier? Warum jetzt? Ich bin nicht bereit weiterzuleben. Doch schon nachdem ich einen einzigen Schritt nach hinten mache, um zu rennen, um in die Wellen zu laufen, packt er mich am Handgelenk. Hilflos sehe ich ihn an.
»Bitte lass mich gehen!« Meine Lippen beben. Unvermittelt kommen mir die Tränen und mein Herz hämmert so heftig in meiner Brust, dass mir schwindelig wird. Wo kommen diese Emotionen auf einmal her? Mein Körper betrügt mich, nachdem ich monatelang nicht eine einzige Träne vergossen habe, es nicht konnte.
Überrascht runzelt er die Stirn, aber er wagt es nicht, mich loszulassen, sondern greift auch nach meinem anderen Arm.
»Auf keinen Fall!« Seine Stimme ist so laut, dass ich kurz zusammenzucke. Er schüttelt den Kopf. »Ich lasse dich nicht in deinen Tod rennen!«
Ich habe geahnt, dass er so was sagt. Kann er mich nicht einfach in Ruhe lassen?
Er holt tief Luft, bevor er wieder spricht. »In den kalten Wellen zu ertrinken ist kein schneller, schmerzloser Tod, falls du das gehofft hast.«
Beschämt wende ich mich ab und senke den Kopf. Schnell und schmerzlos ist ganz und gar nicht, was ich will. Ich will, was ich verdiene: Qualen. Aber was, wenn er mich nicht mehr gehen lässt? Schwer atmend balle ich die Hände zu Fäusten. Mein Brustkorb ist wie zugeschnürt und der Kloß in meinem Hals zu groß, um zu sprechen. Vor wenigen Minuten habe ich innerlich mit meinem Leben abgeschlossen. Es sollte mich längst nicht mehr geben, ich sollte befreit sein von dieser Bürde. In meinem Magen breitet sich ein unangenehmes Gefühl aus und ich schmecke plötzlich Magensäure in meinem Mund. Schwindel überfällt mich für einen Moment, doch der Fremde hält mich immer noch fest, sodass ich nicht umkippe. Ich kneife die Augen zusammen, versuche, meine Gedanken zu sortieren. Das hier ist falsch. Meine Energie ist verbraucht.
»Hey«, sagt er, nun ruhiger. »Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber bestimmt gibt es einen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Irgendwie wird es wieder gut werden. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.« Der junge Mann wählt seine Worte vorsichtig. Sein Gesichtsausdruck ist unsicher und voller Mitleid.
Es gibt keinen anderen Weg, aber das wird er mir nicht glauben. Das wird mir niemand glauben.
»Okay?« Er zieht mich sanft weiter weg vom Meer. »Lass uns erst mal ins Trockene kommen, damit du nicht völlig unterkühlst.«
Nicht nur ich bin ausgekühlt, auch seine Schuhe und Hose haben sich mit Wasser vollgesogen. Rasch streift er seine wasserabweisende und zumindest teilweise trocken gebliebene Jacke ab, die er mir dann über die Schultern legt und die ich instinktiv festhalte, damit sie nicht vom Wind wegfliegt.
»Ich würde dich in die Stadt fahren, nur erwarten wir heute Nacht einen Schneesturm und wir sollten möglichst schnell einen Unterschlupf finden.«
Ich reagiere nicht auf seine Worte, weshalb er sich skeptisch umschaut.
»Bist du allein hier? Sollen wir jemanden anrufen? Vielleicht –«
»Nein«, unterbreche ich ihn. Meine Stimme ist belegt, kaum hörbar. »Da ist niemand.«
Das Alleinsein habe ich längst freiwillig für mich gewählt. Um niemanden zurückzulassen.
Nachdenklich nickt der junge Mann, wiegt womöglich ab, was er als Nächstes tun soll und reibt sich unbewusst die kalten Hände.
»Meine Eltern haben in der Nähe ein Sommerhaus, wo wir den Sturm aussitzen können. Wo sind deine Sachen? Hast du Gepäck? Bist du mit einem Auto da?«
Ich schüttele den Kopf. Nur ein kleines Portemonnaie habe ich mir für das Bezahlen des Bustickets mitgenommen und in meinem BH verstaut. Alles andere habe ich in meinem Hotelzimmer zurückgelassen. Ich habe nicht vorgehabt, aus den Wellen zurückzukehren. Das alles ist Teil von meinem Leben. Da ist nichts, was ich noch brauche, denn ich will nicht mehr leben.
Er runzelt die Stirn. Sicherlich denkt er, dass eine junge Frau in einem leichten Kleid während einer arktischen Winternacht irgendetwas bei sich haben muss.
»In Ordnung.« Er zögert kurz. »Mein Jeep steht auf dem Parkplatz oben, da können wir dich schon mal aufwärmen. Das Haus ist eine Viertelstunde entfernt.«
Er läuft los, doch ich rühre mich nicht, weshalb er stehen bleibt. Ich kann ihn nicht ansehen, während ich den Mund zögerlich öffne, um zu sprechen.
»Kannst du mich nicht hierlassen?« Meine Stimme klingt verzweifelter als ich erwartet habe. Er soll sich nicht für mich verantwortlich fühlen, denn er ist nur ein Fremder, zur falschen Zeit am falschen Ort. »Kannst du nicht einfach weggehen? Du könntest dich umdrehen und so tun, als hättest du mich nie gesehen. Ich wünschte, du hättest mich nicht gesehen. Du schuldest mir nichts. Wir kennen uns nicht mal. Niemand wird davon erfahren.«
Es dauert ein paar Momente, bis er antwortet. »Auf keinen Fall«, beharrt er. »Das kann ich nicht. Damit könnte ich nicht leben.«
Als ich aufblicke, ruht sein Blick fest auf mir und gibt mir zu verstehen: Er wird seine Meinung nicht ändern. Sein Arm zuckt, als wäre er bereit, mich jederzeit wieder festzuhalten, sollte ich versuchen wegzulaufen. Ausgerechnet hier treffe ich auf jemanden, der mich nicht aufgibt. Wieso bin ich so jemandem nicht schon früher begegnet? Bevor ich meinen Entschluss gefasst habe. Jetzt ist es zu spät. Alles ist verkorkst.
Ich lasse den Kopf hängen und folge ihm widerwillig, denn ich bin zu schwach, um zu kämpfen, zu schwach, um mich zu wehren. Die Kraft fehlt mir nicht nur mental, sondern auch körperlich. Wenn er will, kann er mich packen und in sein Auto zerren. Ich presse die Fingernägel in meine Handinnenfläche und halte die Luft an. Werde ich jemals an diesen Strand zurückkommen? Werde ich diesen Schritt noch einmal gehen können?
Der Wind frischt überraschend auf und Schneeflocken mischen sich unter die Böen, sodass der Mann etwas auf Isländisch flucht. »Komm, lass uns schnell zum Auto gehen«, sagt er dann und deutet auf einen Jeep – das einzige Auto weit und breit. Der Schneefall wird von Minute zu Minute stärker und das intensiver werdende Tosen der Wellen konkurriert mit dem lauten Pfeifen der zunehmenden Windböen. Wir sollten uns beeilen, aber dennoch ist er geduldig mit mir, scheint zu bemerken, wie entsetzlich schwer mir jeder Schritt fällt, weil ich am ganzen Leib friere. Und auch wenn der Schmerz in meinen Gliedern bedeutet, dass ich noch am Leben bin, fühlt sich die Situation und die Welt um mich herum surreal an. Bin ich wirklich hier? In meinem Kopf drehen sich gleichzeitig eine Milliarde Gedanken und trotzdem kein einziger. Ich bin voll damit und dennoch leer. Mein eigenes Leben kommt mir vor wie ein Film. Eigentlich sollte längst alles vorbei sein und ich will, dass es vorbei ist. Oder? Ich bin mir so sicher gewesen, dass heute alles sein Ende finden wird. Trotzdem bin ich weiterhin gefangen in meinem persönlichen Albtraum, entferne mich mit jedem Schritt von den Wellen, die mich erlösen sollten.
Ich halte inne, als ich meine Schuhe im Sand entdecke. Augenblicklich will ich mich übergeben, denn eine entsetzliche Tatsache durchfährt mich wie ein Schock: Meine Schuhe wären die einzigen Überbleibsel, die am Morgen verraten hätten, dass ich überhaupt hier gewesen bin. Das wäre, was ich hinterlassen hätte. Ich wende mich ab, kann ihren Anblick nicht ertragen.
»Deine?«, hakt der Isländer nach, was ich mit einem Nicken bejahe. Er reicht sie mir und ich streife sie widerwillig über.
Als wir im Auto angekommen sind, startet er den Motor, dreht die Heizung auf und lehnt sich zur Rückbank, von der er nach ein paar Augenblicken ein paar Kleidungsstücke hervorzieht.
Erst jetzt bemerke ich, wie ich am ganzen Leib zittere. Die Taubheit von gerade vergeht mit einem Kribbeln, das schleichend durch meine Glieder kriecht.
»Hier, zieh dir das über«, sagt er und reicht mir eine Decke sowie einen dicken Wollpullover, der genauso weiß-schwarz gemustert ist wie der, den er trägt. »Du hast dich ja nicht besonders gut auf Island vorbereitet.« Ein unsicheres Lächeln umspielt seine Lippen. Er muss wissen, dass seine Worte in dieser Situation unpassend sind, dennoch hat er sie ausgesprochen.
»Ich hatte nicht vor, lange zu bleiben.« Die Temperatur im Auto sinkt trotz Heizung plötzlich auf den Gefrierpunkt. Seinen Blick vermeidend, streife ich den Pullover über meine kalte Haut und die Decke obendrüber. Der junge Mann seufzt leise, schweigt und hält sich am Lenkrad fest.
»Ich wollte die Nordlichter sehen, das war alles«, erlöse ich uns aus der unangenehmen Stille. Das ist nicht einmal eine Lüge, das war der ursprüngliche Plan und vielleicht hätten die Lichter mir Halt gegeben. Womöglich habe ich mir sogar selbst eingeredet, dass sie mir die Hoffnung gegeben hätten, die ich so sehr brauche.
Er atmet tief ein und will dann wissen: »Und hast du sie gesehen?«
»Nein.«
»Das ist schade.« Nervös tippt er mit seinen Fingern aufs Lenkrad. »Es braucht einiges an Glück dafür. In den letzten Tagen war die Wolkendecke zu massiv. Selbst bei sternenklarem Himmel sind sie nicht garantiert.« Er setzt das Auto in Bewegung. »Der Winter ist immerhin lang. Du bekommst bestimmt noch einmal die Chance, sie zu sehen.«
Darauf reagiere ich nicht. Wahrscheinlich erwartet er das auch nicht. Der Winter ist zwar lang, aber für mich längst vorbei.
Kapitel 2
Der Schnee fällt nach kurzer Zeit so dicht, dass er uns jegliche Sicht raubt. Gleichzeitig bringt der Sturm das Auto zum Wackeln, sodass ich mich am Türgriff festhalte. Der junge Isländer umklammert das Lenkrad und ist vollkommen darauf konzentriert, das Auto zu lenken und vorwärtszubringen, ohne uns von der mit Schnee und Eis überzogenen Straße zu manövrieren.
Erst jetzt mustere ich ihn genauer. Er wirkt gutherzig, aber wie kann man das sicher wissen, wenn man eine Person nicht kennt? Ich schätze ihn auf Mitte zwanzig, vielleicht auch etwas älter, jedoch nicht viel älter als ich. Seine Haare sind zu einem kleinen Zopf gebunden, sein Bart recht lang gewachsen und mir schießt durch den Kopf, dass er mit offenen Haaren wie Thor aussehen muss. Wie ein Wikinger, ein isländisches Klischee.
Die Jacke, die er mir gegeben hat, ist dick und augenscheinlich für jedes Wetter geeignet – genau richtig für einen Schneesturm wie diesen.
Was er wohl dort draußen mitten in der Nacht gemacht hat? Immerhin muss das auch für ihn riskant sein. Dann wiederum scheint er sich vor Gefahr nicht zu scheuen, sonst hätte er sich für eine Fremde nicht in die hohen Wellen geschmissen. Möglicherweise ist es hier aber normal und nächtliche Spaziergänge am Strand kurz vor einem großen Sturm sind so etwas wie eine isländische Tradition. Immerhin sind die Isländer ziemlich hartgesottene Leute.
Die Minuten im Auto ziehen sich in die Länge. Nachdem meine Hände und Füße eine Weile unangenehm gekribbelt haben, wärmen sie sich endlich auf.
Aber wenn das so weitergeht, werden wir niemals ankommen. Der Schneefall ist so stark, dass wir auf eine weiße Wand schauen, und ich verliere mich in der Unendlichkeit davon.
Vielleicht bin ich gar nicht wach, vielleicht ist das nur ein Traum. Und vielleicht hätte ich diesen Strand nie betreten sollen, auch wenn ich nicht weiß, was dann mit mir passiert wäre. Wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, was wäre aus meiner Seele geworden? Aus diesem Kampf mit mir selbst und gegen mich? Was ich getan habe, war beides – richtig und falsch.
Ich lasse meine schweren Lider zufallen. Meine Gedanken sind gleichzeitig so leer und so voll, dass ich tief darin versinke, und erschrecke, als der Fremde laut flucht und das Auto plötzlich mit einem Ruck stoppt.
Verwirrt öffne ich die Augen, blinzele und versuche auszumachen, was passiert ist. Auf der Hauptstraße sind wir mittlerweile nicht mehr. Um uns liegt der Schnee in einer dicken Schicht und die Straße ist im Schneegestöber nicht zu erkennen. Dann verstehe ich, warum wir nicht weiterkommen: Wir stecken in einem Berg aus Schnee fest.
»So ein Mist!« Der Mann schlägt mehrmals wütend aufs Lenkrad, tritt noch mal auf das Gaspedal und versucht, vorwärts- oder zurückzukommen, aber außer dem Aufwirbeln von Schnee tut sich nichts. Wir sitzen fest.
Stöhnend lässt er sich in den Sitz zurückfallen und schüttelt den Kopf. »Tut mir leid.« Er atmet tief ein. »Wir sind fast da. Aber mit dem Auto haben wir keine Chance mehr heute Nacht. Das Sommerhaus ist nur noch knapp fünf Minuten entfernt. Wir haben keine andere Wahl, als zu laufen, auch wenn da draußen die Hölle los ist.«
Kurz blicke ich durchs Fenster, bevor ich mich wieder an ihn wende. »Jetzt?«
»Der Sturm wird nur stärker werden, je länger wir warten.« Er deutet auf die Fensterscheibe. »Im Moment ist es noch ein kleiner Schneesturm. In ein paar Stunden wird es ein Blizzard sein.«
Unmöglich kann ich da draußen nur einen Schritt tun. Es fröstelt mich, denn eine Wahl habe ich nicht. Doch vielleicht ist das nicht schlimm. Vielleicht kann ich mich in der Kälte endlich meiner unendlichen Erschöpfung hingeben.
Wieder lehnt er sich zur Rückbank, wo er eine weitere Jacke, einen Schal und Handschuhe hervorholt. Letztere gibt er mir, während er sich die Jacke überzieht und ich meine enger um mich schlinge.
»Immerhin habe ich für den Notfall im Winter immer warme Sachen im Auto.« Er schließt den Reißverschluss seiner Jacke bis zum Kinn, bevor er sich zu mir herumdreht. »Mein Name ist übrigens Arnar«, sagt er unvermittelt, lächelt verlegen. »Dafür war vorhin keine Gelegenheit.«
Irritiert blinzele ich. Dass ich seinen Namen noch gar nicht kenne, war mir bisher nicht aufgefallen. Außerdem bemerke ich, dass sein Englisch fast akzentfrei ist, nur mit ein paar unscheinbaren Ecken und Kanten hier und da.
»Emilia«, bringe ich leise hervor und weiche seinen intensiven blauen Augen aus, die für den Bruchteil einer Sekunde aufleuchten.
»Emilia«, wiederholt er nachdenklich.
Mein Name klingt merkwürdig aus seinem Mund. Ungewohnt und sanft. Als wäre mein Leben tatsächlich immer noch von Bedeutung. Die letzte Person, aus deren Mund ich meinen Vornamen gehört habe, hat vor zwei Monaten aufgehört, mich in meiner verwahrlosten Wohnung zu besuchen.
»Dann lass uns diese kurze Schneewanderung in Angriff nehmen.« Er stockt und mustert mich. »Ich komme rüber auf deine Seite und kann dir helfen, wenn du magst.«
Ich weiche seinem Blick aus. Seine Hilfe anzunehmen, wäre beschämend, doch ohne ihn werde ich womöglich nicht einmal die ersten paar Meter schaffen. Angespannt lege ich den Kopf an die Scheibe, starre in das endlose Weiß.
Mit Mühe und Not und zahlreichem Fluchen kämpft Arnar sich aus seiner Tür hinaus, die vom Wind ständig zugedrückt wird. Weil der Wind aus der anderen Richtung kommt, kann ich meine eigene Tür ohne Probleme öffnen, aber dennoch werde ich vom eisigen Schnee begrüßt, sodass die gewonnene Wärme sofort wieder dahin ist. Der Schnee geht mir schon bis hoch zu den Waden.
»Und das ist noch kein Blizzard?«, bringe ich angestrengt hervor, worauf Arnar lacht, der jetzt neben mir steht und mir seine Hand reicht.
»Nein, das ist gar nichts.«
Der Schnee ist hoch genug, dass jeder Schritt ein Kampf ist, während der Wind so stark ist, dass ich mich anstrengen muss, um ihm standzuhalten. Arnar ist sofort zur Stelle und packt mich unter den Achseln, ohne zu fragen. Mein Magen zieht sich unangenehm zusammen. Das hier ist erbärmlich. Ich bin erbärmlich und furchtbar schwach. Eine Welle von Erschöpfung überkommt mich, die ich nicht niederkämpfen kann. Meine Beine geben unter mir nach und nur dank Arnar falle ich nicht in den mittlerweile knietiefen Schnee. Er hält mich erst am Rücken fest, zieht mich dann an sich und packt mich schließlich unter den Beinen, um mich zu tragen. Voller Scham drücke ich mein Gesicht an seinen Oberarm. Das hier ist so peinlich, dass ich mich zurück an den Strand wünsche, die Zeit zurückdrehen will, um schneller in die Wellen zu rennen und jetzt nicht hier sein zu müssen. Dann müssten weder er noch ich das in diesem Moment ertragen.
Schwer atmend, aber zügig bringt er uns beide durch den Schnee. Und er behält recht. Es können nicht mehr als fünf Minuten vergangen sein, bis er mich vor der Tür der unerwartet großen Hütte absetzt und besorgt meinen Blick sucht.
»Geht es?«, will er wissen. Ich weiche ihm aus und nicke. Meine Knie sind wacklig, aber sie tragen mich für den Moment.
Im Inneren von Wärme begrüßt zu werden, ist erlösend für meine von Kälte verkrampften Muskeln. Das Licht flackert für wenige Sekunden, nachdem Arnar es eingeschaltet hat, doch dann erleuchtet es das gemütlich eingerichtete Zimmer.
Während er hektisch durch die verschiedenen Räume eilt, begutachte ich die Holzmöbel, die alle selbst gefertigt scheinen und dem Haus einen angenehm herben Geruch verleihen.
»Hey!«, ruft Arnar, sodass ich zu ihm herüberblicke.
Als er aus einem der Zimmer kommt, hat er einen kleinen Stapel Kleidung und weitere Decken auf dem Arm. Er kommt auf mich zu, hebt seine Hand und hält kurz vor meinem Gesicht inne. »Darf ich?«, fragt er und sucht dabei meinen Blick.
Ich runzle die Stirn, verstehe nicht ganz, nicke aber dennoch zögerlich.
Vorsichtig und nur kurz legt er mir den Handrücken auf die Wange. Auch wenn er gefragt hat, schrecke ich ein wenig zurück und fahre über die Stelle, die er mit seiner Hand berührt hat.
»Entschuldige!«, sagt er schnell und läuft rot an. »Ich wollte nur sichergehen, dass du nicht unterkühlt bist. Aber die Heizung im Auto und hier drinnen haben ihren Job getan, auch wenn du noch ein wenig kalt bist.«
Ich atme die Luft aus, die ich kurz angehalten habe, während Arnar sich unsicher mit der Hand durch die Haare fährt.
»Du solltest eine Dusche nehmen«, schlägt er vor. »Ich mache uns inzwischen etwas Warmes zu trinken. Tee? Heiße Schokolade?«
Perplex zucke ich mit den Schultern, denn ich habe weder Lust auf das eine noch auf das andere. Mein Geschmackssinn ist in den letzten Monaten etwas verkümmert. Zögerlich nickt Arnar. Er gibt sich so viel Mühe. Zurückgeben kann ich ihm dennoch nichts.
Da ich aber sowieso schon hier bin, klingt eine heiße Dusche gar nicht schlecht. Er zeigt mir das große Bad und legt dort die frische Kleidung auf einer Kommode ab.
»Da ist ein bisschen was von mir und von meiner Mutter dabei.« Er kratzt sich am Kopf. »Ich hoffe, du findest etwas Passendes. Sag Bescheid, wenn dir irgendetwas fehlt. Oh!« Rasch hastet er zu einem der Schränke, aus dem er einige Handtücher herauszieht, die er ebenfalls neben der Dusche ablegt. »Pass mit dem heißen Wasser auf. Unsere Leitung wird von Erdwärme erhitzt und wenn man den Hahn zu weit nach links dreht, wird es manchmal ein wenig zu heiß. Außerdem warst du ziemlich lange im Kalten. Auch ohne Unterkühlung solltest du warm duschen, nicht zu heiß. Verstanden?«
Ich nicke. Ihm zuzustimmen, ist die einfachste Option. Eigentlich hat er meine Pläne ruiniert und ich könnte mich allem verweigern, könnte ihm widersprechen oder es ihm schwermachen. Gar weglaufen. Ich bin erwachsen, er kann mich nicht aufhalten. Mich da draußen zu verlaufen und zu erfrieren, wäre nicht schwierig.
Aber ich bin so unglaublich müde. Außerdem würde ich nicht wollen, dass er mich womöglich suchen käme.
Also wozu? Ich habe all diese Kämpfe schon gekämpft und die Kraft dafür verbraucht. Für den Moment ist Existieren so surreal, dass es simpler ist, mich von ihm leiten zu lassen. Ohne zu denken, ohne zu fühlen oder groß zu handeln.
Zufrieden verlässt er schließlich das Bad und lässt mich mit mir selbst allein.
Bevor ich in die Dusche steige, will ich prüfen, ob ich wirklich noch da bin, denn ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Die dunklen Ringe unter meinen Augen sind tiefer, als ich sie in Erinnerung habe und beißen sich mit meiner gruselig blassen Haut. Viel ist nicht von mir übrig geblieben. Ich bin ein Geist, nichts weiter. Nur ein Schatten, ohne Seele oder Sinn. Jämmerlich. Wäre das hier mein eigenes Haus, würde ich den Spiegel auf den Boden werfen und zertrümmern. Doch ich werde Arnar keinen Ärger machen. Er hat schon einiges in dem Schneesturm da draußen für mich riskiert.
Das Wasser der Dusche ist zu heiß, wie er es gesagt hat, aber genau so will ich es. Ich zucke kurz, weil die Tropfen auf meiner Haut und der Dampf in meiner Nase brennen. Der Schmerz tut gut, ist befreiend. Er erinnert mich daran, dass ich am Leben bin. Meine Hände und Finger zittern trotz der Hitze, die mich umgibt. Ich bin wirklich noch hier. Aber wie kann ich hier sein, wenn Noah es nicht ist? Wie kann die Welt sich seit sechs Monaten noch weiterdrehen, wenn er nicht mehr da ist? Das ganze Universum hätte aufhören sollen zu existieren.
Meine Augen füllen sich mit Tränen und ich presse meine Lippen fest zusammen. Ich will mich auflösen, will verschwinden, einfach weg sein. Stattdessen bin ich gefangen in diesem Körper, der mein persönliches Gefängnis ist. Hätte Arnar mich doch bloß nicht aufgehalten.
Wütend balle ich meine Hände zu Fäusten und schlage gegen die Wand. Es war meine Entscheidung. Ich kann entscheiden, wie ich leben oder sterben will. Er dachte, er müsste mich retten. Stattdessen hat er mir die Möglichkeit genommen, selbst zu bestimmen. Ich hole tief Luft. Nein. Es war nicht seine Schuld. Denn danach habe ich mich nicht mehr genug angestrengt. Aber warum? Habe ich etwa insgeheim gehofft, dass es nicht klappen wird?
»Alles in Ordnung?«
Arnars Stimme kommt nur dumpf gegen das Rauschen des Wassers und das laute Pochen meines Herzens an.
»Ist dir was runtergefallen? Ich habe etwas Lautes gehört und …« Eine Pause folgt. »Schon gut. Lass dir alle Zeit, die du brauchst.«
Endlich stelle ich das Wasser ein wenig kühler und lehne meinen Kopf an die Wand. Meine Chance habe ich vertan, als ich ihm gefolgt bin, als ich nicht gekämpft habe und nicht gerannt bin. Jetzt sitze ich fest. Gänsehaut überzieht meinen Körper, auch wenn das Wasser warm ist. Letztlich sinke ich auf den Boden der Dusche, lasse meine Gedanken frei durch den Raum schweben, bis mein Kopf ganz leer ist.
Ich muss sehr lange in der Dusche gewesen sein, denn Arnar beobachtet mich unablässig und ein Blick auf die Uhr verrät mir trotz der Dunkelheit, dass es bereits früher Morgen ist.In Decken gewickelt sitze ich auf der Couch und Arnar gähnend auf einem Sessel neben mir. Er hat mir eine heiße Schokolade gemacht, die ich in meiner Hand halte, ohne davon zu trinken, weil ich immer noch in meinen Gedanken umherirre. Nachdem ich endlich daran nippe, blickt Arnar lächelnd auf.
»Und ich dachte schon, du würdest dir bloß die Hände an der Tasse wärmen.« Er schmunzelt, bevor er erneut gähnt. »Ich hoffe, sie schmeckt dir.«
Ich nicke, um ihn zu beruhigen, auch wenn der Kakao nur süß und warm schmeckt und nicht nach Schokolade.
»Warum gehst du nicht schlafen?«, will ich wissen.
Arnar zieht verwundert die Augenbrauen in die Höhe. Vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt so viele Worte mit ihm wechseln würde. Ich sehe ihm an, dass er furchtbar müde ist, sich aber zwingt, wach zu bleiben. Der Grund dafür ist offensichtlich.
»Schon gut. Ich bleibe lieber noch wach.«
»Bis ich eingeschlafen bin?«, will ich wissen.
»Ja, klar. Ich meine …« Er knetet seine Hände.
»Damit du sicher sein kannst, dass ich mir nicht doch etwas antue?«
Warum ich so direkt bin, weiß ich nicht. Aber irgendwie bin ich nun wütend auf ihn, statt auf mich selbst, auch wenn er nur das Richtige tun wollte. Aber er soll sich nicht so verdammt verantwortlich für mich fühlen.
Arnar setzt sich auf, wirkt jetzt wacher. »Um ehrlich zu sein, ja.« Er hält an meinem Blick fest. »Ich kann verstehen, dass du dich einem Fremden nicht anvertrauen willst. Natürlich können wir trotzdem gern reden. Solange ich bei dir bin, bist du nicht allein. Auch wenn wir uns nicht kennen, werde ich nicht zulassen, dass du dein Leben wegwirfst.«
Hitze steigt schlagartig in meinen Wangen auf. »Du hast recht, du kennst mich nicht.« Meine Stimme klingt scharf und warnend. »Du weißt nicht, was passiert ist. Und dass ich weiterleben soll, kannst du nicht einfach entscheiden!« Trotz der Decken wird mir kalt. Er hat kein Recht darauf, so etwas zu sagen oder gar zu bestimmen.
Arnar seufzt leise und reibt sich mit einer Hand übers Gesicht, bevor er mich wieder ansieht. »Entschuldige, Emilia. So habe ich das nicht gemeint. Natürlich kann ich nicht über dein Leben urteilen. Aber ich kann auch nicht dabei zusehen, wie du es beendest, das widerspricht all meinen Grundsätzen.« Er stoppt, als würde er darauf warten, dass ich ihm widerspreche. »Hör zu. Wenn du mir erzählen möchtest, was passiert ist, bin ich da. Wenn du nichts sagen möchtest, bin ich auch da. Ich will, dass du weißt, dass ich hier in diesem Augenblick bei dir bin und mich um dein Leben sorge. Du bist nicht allein. Verstanden?«
Ich schlucke schwer, denn sein Blick wirkt einerseits gequält von Bedenken, andererseits so voller Hoffnung, dass ich ihn nicht länger ansehen kann. Dieser fremde Mann sollte sich nicht kümmern, was mit mir passiert. Das ist pure Zeitverschwendung.
Anstatt etwas zu erwidern, lege ich mich auf die andere Seite und ziehe die Decke über meinen Hinterkopf. Ich vergesse, dass er da ist, dass er mich womöglich immer noch beobachtet, und gebe mich stattdessen einem traumlosen Schlaf hin. An diesem Tag bin ich gescheitert. Und ich bin mir nicht sicher, was das nun für mich bedeutet. Mich damit abzufinden, dass ich einfach weitermachen soll, kann ich nicht. Nicht nach allem, was ich verloren habe. Nicht, nachdem Noahs Tod diesen tiefdunklen Riss in mich geschlagen hat.
Kapitel 3
Am nächsten Tag tobt der Schneesturm ähnlich stark wie gestern. Arnar wuselt bereits durchs Haus, während ich beinahe regungslos auf der Couch liege. Ich werde mich nicht rühren, wenn er nicht darauf besteht. Denn jeden Tag im Bett zu bleiben, habe ich in den letzten sechs Monaten perfektioniert. Mein Körper ist daran gewöhnt.
Doch Arnar macht mir einen Strich durch die Rechnung. Er muss mitbekommen haben, dass ich wach bin, und stellt mir einen dampfenden Tee auf den Tisch neben dem Sofa. Ich rühre mich nicht, auch nicht, als er mich erwartungsvoll beobachtet.
»Müsli oder Brot mit Butter?«, unterbricht er schließlich die Stille und bietet mir die Schüssel Müsli in seiner anderen Hand an. »Eine größere Auswahl haben wir leider nicht.«
Ich presse meine Lippen zusammen. Frühstück ist undenkbar.
Für ein paar Augenblicke mustert er mich. »Ich werde dich nicht zum Essen zwingen. Aber ich empfehle es selbstverständlich.« Er lässt sich auf dem Sessel neben mir nieder und blickt durch die verschneiten Fenster. »Ich weiß nicht, wie lange wir hier festsitzen werden. Es könnte eine Weile dauern, bis die Straßen wieder befahrbar sind. Außerdem steckt der Jeep erst einmal fest, bis das Wetter gut genug ist, um ihn freizugraben.«
Seufzend rolle ich mich auf den Rücken. »Wie lange dauert so ein Schneesturm normalerweise an?« Ablenkung ist meine beste Waffe.
»Unterschiedlich.« Er isst etwas von dem Müsli, bevor er weiterspricht. »Manchmal ein paar Stunden, manchmal einige Tage. Laut des Wetterberichts sollte er sich heute Abend aber ein wenig legen. Bestenfalls können wir morgen Früh hier weg. Viel länger werden die wenigen Essensvorräte auch nicht reichen.«
Am nächsten Morgen werde ich hier also vermutlich wegkommen. Was genau ›weg‹ bedeutet, ist mir allerdings nicht klar. Es gibt keinen Ort, an den ich zurückkehren kann.
Ich stoppe das beginnende Gedankenkarussell, starre aufs Fenster und drücke meine Hände ins Sofakissen.
»Alles in Ordnung?«
Nichts ist in Ordnung.
»Kommt ihr auch im Winter in dieses Sommerhaus?«, weiche ich aus. Ich lasse das Kissen los und sehe ihn wieder an.
»Normalerweise nicht. Deshalb nennen wir es ja Sommerhaus«, setzt er leise lachend hinzu. »Aber ab und zu, um mal fürs Wochenende rauszukommen. Für Fälle wie diesen haben wir zumindest Essensvorräte, die für ein oder zwei Tage reichen. Ich wäre letzte Nacht wohl auch ohne dich hier gelandet. Den Sturm habe ich unterschätzt.«
Ich mustere ihn interessiert. Über ihn zu reden ist eine gute Idee, denn dann muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen.
»Was hast du eigentlich mitten in der Nacht am Reynisfjara Strand gemacht?«
Arnar zuckt mit den Schultern. »Ich habe mir den Kopf freipusten lassen. Nachts ist normalerweise die einzige Zeit, zu der keine Touristen dort sind und alles friedlich ist. Ich war dort früher öfter, da meine Heimatstadt nur knapp fünfundvierzig Minuten entfernt ist.« Er beobachtet mich, als schätze er ab, ob er weitersprechen soll, und lehnt sich dann in den Sessel zurück. »Ich meine, seit ich in Reykjavík mein Apartment habe, komme ich seltener hier rüber. Allerdings war ich die letzten Tage bei meinen Eltern. Normalerweise wäre ich so knapp vor einem Sturm nachts nicht rausgefahren, vor allem, wenn eine gelbe Sturmwarnung rausgegeben wurde. Aber sie haben mich zur Weißglut gebracht. Also brauchte ich etwas Ablenkung.« Ein bitteres Lachen entfährt ihm. »Eigentlich ziemlich blöd von mir.«
Ich unterdrücke den Drang, ihm zuzustimmen. Wäre er nicht rausgefahren, hätte ich bekommen, was ich wollte, und hätte ihn niemals kennengelernt. Ich will das Gespräch jedoch nicht in diese Richtung lenken. Es reicht schon, wenn sich in meinen Gedanken alles darum dreht.
»Wieso? Was haben sie gemacht?« Ich setze mich auf, nehme den Tee in die Hand und ziehe die Beine an. Er lächelt erleichtert, während ich vom Tee trinke.
»Das ist eine lange Geschichte«, entgegnet er.
Doch das reicht mir nicht als Ausrede. Ich deute zum Fenster. »Wir haben noch ein paar Stunden, oder nicht?«
Immerhin sitzen wir hier zusammen fest und haben nichts Besseres zu tun. Um mein Argument zu stützen, zwinge ich mir ein schmales Lächeln auf.
»Na gut.« Unvermittelt steht er auf. »Gib mir eine Minute.«
Kurz verschwindet er in der Küche und danach über den Flur in eines der anderen Zimmer. Zurück kommt er mit einer Decke für sich selbst, die er sich über die Schultern geschlungen hat, einer großen Packung Keksen und einem dampfenden Teekessel.
»Keine Angst«, sagt er grinsend, gleich nachdem er meinen verwirrten Blick bemerkt. »Die müssen wir nicht alle essen. Aber wir können, wenn wir wollen.« Er zwinkert und schiebt die Kekse in meine Richtung. Ich greife nicht danach, sondern lehne mich zurück und beobachte ihn erwartungsvoll.
»Meine Eltern wollen einfach das Beste für mich.« Erst atmet er tief ein, dann nimmt er sich einen Keks. »Ich bin vor zwei Jahren nach Reykjavík gezogen, um zu studieren, und das hat ihnen weder damals noch heute gefallen.«
Ich runzele die Stirn. »Warum nicht?«
»Sie hätten lieber gehabt, dass ich ihre Farm übernehme. Auf ihrem Stück Land bin ich schließlich aufgewachsen. Und ich liebe mein Zuhause, wirklich. Ich liebe das einfache Leben auf dem Land und bin froh, dass ich damit aufwachsen konnte. Aber ich will nicht den Rest meines Lebens dort verbringen, so wie sie. Ihre Welt ist mir zu klein.« Beiläufig fährt er sich durch den Bart. »Ich habe angefangen, Geologie zu studieren, und will mich auf Vulkanologie spezialisieren. Die Nähe zu den Vulkanen hat mich fasziniert, seit ich denken kann. Klar, das ergibt Sinn hier in Island. Meinen Eltern war nur nicht bewusst, dass ich dafür möglicherweise sogar ins Ausland gehen werde. Als ich es ihnen gesagt habe, hatte ich das Gefühl, sie klammern sich regelrecht an mich. Meine Mutter wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Mein Vater hat mich angeschrien, wie ich ihnen das jemals antun könnte. Sie wollen, dass ich jederzeit für sie erreichbar bin, und das bin ich momentan, das war ich immer. Nur will ich das nicht mehr, zumindest für eine Weile.« Er sieht mir in die Augen, als suche er darin nach Zustimmung. Mit einem Nicken gebe ich ihm diese, weiß aber nicht, was ich sagen soll. Die Beziehung zu meinen Eltern war nie besonders gut und sie sind das Gegenteil von Arnars: Hauptsache sie müssen sich nicht mehr mit mir auseinandersetzen.
»Ich will nicht undankbar sein. Wie gesagt, sie wollen das Beste für mich. Sie sind leider ein wenig« – kurz hält er inne und scheint zu überlegen – »überfürsorglich. Am liebsten würden sie mein Leben kontrollieren. Und gestern hat meine Mutter sich in meinen Stundenplan eingemischt, hat gesagt, ich müsste diesen und jenen Kurs unbedingt belegen. Wenn ich mich nicht dafür anmelde, dann brauche ich nicht mehr auf ihre finanzielle Unterstützung zu hoffen, und davon bin ich nun mal trotz Nebenjob abhängig. Gerade habe ich zwar Semesterferien und kann einige Schichten im Restaurant übernehmen, aber sobald die Vorlesungen wieder losgehen, bin ich auf sie angewiesen. Auch wenn es nur noch ein Semester ist.« Augenrollend senkt er den Kopf. »Entschuldige. Ich weiß, dass das Jammern auf hohem Niveau ist. Ich will sie nicht enttäuschen, aber ich will mich auch nicht von ihnen kontrollieren lassen.«
Als er erneut aufschaut, insgeheim vielleicht auf mein Verständnis hoffend, meide ich seinen Blick, starre stattdessen auf den abgekühlten Tee in meiner Hand.
»Immerhin bist du ihnen wichtig und sie wollen in deinem Leben sein.« Meine Stimme klingt bitterer als gewollt. Ich kann ihn verstehen. Dennoch werde ich unweigerlich wieder an meine eigenen Eltern erinnert. Nachdem Noah und ich jünger als die meisten geheiratet haben, habe ich sie aus meinem Leben verbannt und sie haben nie darum gekämpft, wieder Teil davon zu werden. Sie haben sowieso nie Teil davon sein wollen. Und deshalb ist mein Leben jetzt leer.
Arnar spricht nicht weiter und ich ärgere mich, dass ich diesen Satz überhaupt ausgesprochen habe. Er verrät bereits zu viel über mich und wird vielleicht Neugier in ihm wecken. Aber ich werde ihm auf keinen Fall mehr von mir erzählen. Nicht, wenn ich bald sowieso wieder aus seinem Leben verschwinden werde.
»Da hast du recht«, erwidert Arnar endlich. »Und sie haben allen Grund, so zu sein. Sie wollen mich beschützen, das ist alles. Das verstehe ich. Nur wollen sie mich so sehr beschützen, dass sie mich damit ersticken.«
Seine Stimme klingt bedrückt, sodass ich zu ihm aufblicke. Ich würde gern den Grund dafür erfahren, wage es aber nicht zu fragen. Doch er scheint auch noch nicht fertig zu sein, also warte ich geduldig. Womöglich will er mir sogar davon erzählen. Immerhin bin ich eine Fremde, die er nie wiedersehen wird, sobald ich aus dieser Hütte herauskomme.