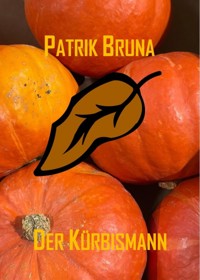Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vier Jugendliche. Vier Schicksale. Ein schonungsloses Bekenntnis. Die Suche nach dem eigenen Lebenssinn. Ein verschollener, bester Freund. Die Flucht aus der Welt. Die Jugendlichen in den vier Kurzromanen müssen sich ihrem Lebenspfad voll von Schrecken und Verlust, Wut und Trauer, Schuld und Sühne, Vergangenem und Zukünftigem stellen: Werden Sie sich ihrem Schicksal behaupten und überleben können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tote Kinder Weinen Nicht:
Vier Sommermärchen
Texte: © Copyright by Patrik BrunaUmschlaggestaltung: © Copyright by Patrik Bruna
Verlag:Patrik BrunaMasch 7a38154 Königslutter am [email protected]
Vertrieb: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Der Tod des Liam Gram: Ein Bekenntnis
Kapitel 1: Geständnis
Es begann alles mit einem Scherz, einem scheinbar belanglosen, kindlichen Streich, der jedoch ganz plötzlich aus den Fugen geriet und eine Verkettung von Ereignissen auslöste, der ich nicht gewachsen war. Diese Untat, verschuldet durch vier Jugendliche, führte zum Verschwinden des Gramjungen. Es gibt keine anderen, keine richtigeren Worte, wenn ich bekenne: Ich bin schuld am Tode Liam Grams.
Kapitel 2: Letzte Worte
Im Nachhinein fragte ich mich nicht nur einmal, warum ich so viel Zeit verstreichen ließ, mich so lange von meinem Gewissen und der Vergangenheit habe quälen lassen, bis ich mich endlich entschließen konnte, alles in einem schonungslosen Bekenntnis niederzuschreiben. Das hier sind keine Memoiren mit dem kläglichen Versuch, das eigene Leben für die Nachwelt festhalten zu wollen; es ist ein Geständnis. Und keineswegs erwarte ich Verständnis, Gnade oder den Freispruch von meiner Schuld. Von unserer Schuld. Ich glaube, dass mir diese Niederschrift in erster Linie dazu dient, bei geistiger Gesundheit zu bleiben – sofern man mir diese zu attestieren vermag – und die Geister meiner Vergangenheit etwas zu besänftigen, damit ihre regelmäßigen Besuche womöglich etwas seltener werden.
Zuvor hatte ich wenigstens versucht, mit jemanden darüber zu sprechen; aber jedes Mal, wenn ich das Wort ergreifen und über die so lang zurückliegenden Geschehnisse berichten wollte, wurde ich zurückgehalten. Es war mir ganz und gar unmöglich, das Unaussprechliche auszusprechen, das Unvorstellbare in reales Grauen umzuwandeln und über die Taten vierer Dreizehnjähriger zu erzählen, die eigentlich Untaten waren.
Merkwürdigerweise empfand ich so nicht, als ich zu Stift und Papier griff und die simplen, aber so wahren Worte auftauchen ließ: Ich bin schuld am Tode Liam Grams. Ich setzte also mein Werk ungebremst fort, schrieb Gedanken um Gedanken auf, und als ich das Papier doppelseitig beschriftet hatte, verstand ich, dass ich so weitermachen musste. Natürlich wechselte ich kurz darauf das Medium und tippte alles auf meinem Laptop, den ich in der Vergangenheit kaum anrührte und zumeist nur für die jährliche Steuererklärung oder ein seltenes Kündigungsschreiben verwendete. Im letzten Jahr wurde er mir aber ein treuer Begleiter und half mir dabei, das Erlebte aus seinem Kokon der Erinnerung in einen Schmetterling der Realität zu verwandeln. Aber das Ergebnis der Metamorphose ist nicht schön und elegant mit zarten Flügeln und langen Fühlern, sondern hässlich und grausam wie der Abgrund der menschlichen Seele.
Als ich schließlich glaubte, fertig zu sein, las ich all diese Worte, die mir zugleich eigen und fremd meiner Zunge vorkamen, und dachte in immer wiederkehrenden Intervallen daran, was man über mich, Fabian, Lukas und Brecher denken würde. Würde es Abscheu sein und Hass? Schlimmeres: der Wunsch nach Wiedergutmachung und Bestrafung? Oder könnte man das Vergangene auf eine empfindsame Art nachvollziehen, irgendwie in Anbetracht setzen, dass dies vier Jugendliche verursachten, die es nicht besser wussten und alles Ungeschehen machen würden, wenn es ihnen ermöglicht sei? Ich denke, dass nicht ich eine Antwort auf diese Frage finden kann, sondern Ihnen diese Aufgabe mit der Lektüre auferlege. Begleiten Sie mich in die furchtbare Vergangenheit meines Seins und schrecken Sie nicht davor zurück, mein Schöffe zu werden.
Sie müssen wissen, dass dieser Stapel an Buchstaben und Blättern, der gerade vor Ihnen liegt, genauso vor mir stand, als ich vor einem Monat, vielleicht einiger Zeit mehr, endlich alles verschriftlicht, ergänzt, korrigiert, gekürzt, erneut korrigiert und schließlich ausgedruckt hatte. Dann las ich alles und glaubte mich darin, noch nicht ganz fertig zu sein. Etwas fehlte: eine Einleitung zu diesem Geständnis. Ich hoffe, dass diese Worte – die gewissermaßen letzten meinerseits und zugleich die ersten Ihrerseits – beenden, was ich vor mehr als einem Jahr angefangen habe. Schließt man die eigentliche Tat und die Erinnerung an sich mit ein, so spreche ich von weit mehr als dieser Zeitspanne: Dann wandern wir zwanzig Jahre zurück in eine Ferne, die ich am liebsten missen und aus meinem Gedächtnis bannen würde. Dass ich aber davon berichte, beweist, dass mir letzterer Wunsch wohl immer verwehrt bleibt.
Vielleicht wird es mir nun endlich möglich sein, einen Abschluss zu finden – wie die Konsequenzen für mein Betragen auch aussehen mögen. Ich habe sie allesamt verdient und glaube, endlich dafür bereit zu sein. Viel zu lange habe ich gezögert, davon zu berichten, wie der Junge aus der Kleinstadt Birkenteich von einem Tag auf den anderen urplötzlich verschwand und nimmermehr aufgefunden wurde. Ich, Severin, habe dies zu verantworten. Dies ist mein Bekenntnis.
Kapitel 3: Birkenteich
Liam Gram hatte das Unglück, in derselben Stadt zu leben, in dieselbe Schule zu gehen und in demselben Alter zu sein, wie ich und meine Freunde es taten. Stimmte auch nur ein Parameter nicht oder würde verändert in dieser unglückseligen Konstellation, so würde Liam Gram heute noch leben. Zumindest nehme ich das an, denn als heute Vierunddreißigjähriger hätte er gewiss einen großen Teil seines Lebens – den größeren, wenn man bei diesem Alter einen biographischen Schnitt mit einer Schere setzen würde – noch vor sich. Er wäre gewiss verheiratet mit einer lieben Frau, hätte zwei, möglicherweise drei Kinder, um die er sich tagtäglich sorgen und mit seiner Arbeit als Verwaltungsangestellter, Makler oder KFZ-Mechatroniker durchbringen würde. Sicherlich würde es ihn nicht aus seiner Heimat, unserer Heimat, verschlagen, denn die meisten Leute bleiben gerne bei dem, was sie kennen und schätzen gelernt haben; und sollte ich mich doch irren, so sollte er keine Autostunde von diesem Orte entfernt wohnen. So stelle ich mich das zumindest vor, dieses womöglich etwas langweilige, doch zugleich auch schöne Kleinstadtleben.
Stattdessen sollte er jedoch niemals dieses vierunddreißigste Lebensjahr mit all seinen Meilensteinen erreichen und als Dreizehnjähriger an einem Herbsttag sterben.
Wie wir anderen wuchs er in unserer Heimstadt, dem Kleinstädtchen Birkenteich auf. Es ist wie so viele andere Kleinstädte eigentlich nur für dessen Bewohner sowie die seiner Nachbardörfer ein Begriff; im Nordosten unseres Landes liegt es, keine vierzig Kilometer von der Ostsee entfernt. Der Ort war einst vor vielen Jahrhunderten von einem dicken Birkenwald umzingelt, der allerdings im Laufe der Zeit durch die Gier der Menschenhand dahinraffte, bis nur noch ein Waldstück im Osten übrigblieb. Folgt heute man der Bundesstraße 110 stadtauswärts, so kündigen sich bereits seine ersten Bäume an, noch bevor das durchgestrichene Ortsschild außer Sichtweite gerät. Und verlässt man dann die asphaltierte Straße, die entlang der Waldesgrenze gezogen wurde, und begibt sich stattdessen auf einen der vielen Waldwege, so wird man nach kurzer Zeit mit einem offenen Geheimnis belohnt: Ein riesiger Teich – fast schon ein See – steht mitten im Forst. Von Weitem kann man bei schönem Wetter das Glitzern der grellen Sonnenstrahlen zwischen den Birken sehen. Nähert man sich diesem Lichtspiel im Wasser, so nimmt die Dichte der Bäume spürbar ab und die eigentliche Größe des Teiches offenbart sich; längs seiner Umrisse stehen nur noch vereinzelte Birken sowie einige Schilfpflanzen, deren dunkle Kolben wie Bojen wirken. Bei heiterem Wetter zeigt sich hier ein idyllisches Bild, und ich muss kaum erwähnen, dass ich als Jugendlicher bei warmen Sommertemperaturen zum See fuhr, um der Hitze im kühlen Wasser zu trotzen – zumindest solange ich die Unbeschwertheit der Jugend noch bewahrte. Gänzlich anders wirkt es jedoch, wenn sich der Himmel verfinstert, Donner grollt, als sehne er sich schon so lange nach bittersüßer Vergeltung, und dicke Regentropfen wie schnelle Pfeile von der Himmelsdecke auf den Boden herabsinken; dann hat man das Gefühl, dass der Teich das Epizentrum des Weltunterganges ist. Gesellen sich dann noch Blitzschläge hinzu, kann einen nichts und niemand von einer klangheimlichen Flucht abhalten.
Denke ich an diesen Teich zurück, der selbstverständlich namensgebend für unseren Heimatort ist, sehe ich letzteres Untergangsszenario wirklich nur, wenn ich mich konzentriere und in den tiefen Fächern der staubigen Erinnerungsakten nach solchen Vorstellungen suche. Denn: Natürlich bin ich mit meinen Freunden ausschließlich zum See gegangen, wenn das Wetter gut, eigentlich zu gut war; äußerst selten setzte daher ein unangekündigter Regenschauer und noch unwahrscheinlicher ein Sturm ein, der uns unverhohlen in die Zivilisation zurücktrieb. Folgerichtig zeigen die Dias in meinem Gedächtnisprojektor diese wunderbare Kulisse eines versteckten Teiches inmitten eines Waldes, der nur von wenigen Besuchern betreten wurde.
Dieser Teich, ein wunderbarer Platz für Heranwachsende, wirkte magisch auf mich; es war, als gehörte er hier nicht hin, sondern sei vielmehr einem Märchen entsprungen. So zumindest hatte ich es einmal aufgeschnappt, als sich zwei meiner damaligen Mitschüler über diesen Ort unterhielten. Solch eine erzählerische Beschreibung wäre mir nie aus dem eigenen, jugendlichen Munde herausgeströmt. Es wäre so ziemlich das Gegenteil dessen, was meine Freunde Brecher, Fabian, Lukas und ich zu verkörpern versuchten.
In unserer Oberschule – der einzigen weiterführenden Bildungsstätte in Birkenteich; zu den anderen Einrichtungen musste man einen beschwerlichen Busweg zu den Nachbarorten in Kauf nehmen – galten wir durch unser, gelinde gesagt, asoziales und destruktives Verhalten als Problemschüler. Wir zogen Ärger und Schwierigkeiten förmlich an uns, als könnten wir uns diesen unmöglich entziehen; oder wir verursachten – natürlich beabsichtigt – Probleme, Streiche und Rangeleien, die immer kurz davor waren, in regelrechte Schlägereien mit Krankenhausaufenthalten zu eskalieren. Oder ganz anders formuliert: Kam es zu einem kleineren oder gerne auch größeren Ärgernis und Problem, waren wir im Grunde immer beteiligt – ob nun direkt als Verursacher und Schuldige oder indirekt als Anstifter, Befürworter und Zuschauer. Dies galt freilich auch außerhalb der Bildungseinrichtung, dessen Schultore die Außenwelt nicht von unserem Verhalten fernhalten konnten. So gelang es uns innerhalb von kurzer Zeit eine unheilvolle Aura um uns herum zu bilden, die für alle präsent war. Es wundert mich daher auch nur wenig, dass die anderen Jugendlichen wie auch Lehrer stets bemüht waren, uns zu meiden und damit einem potenziellen Konflikt auszuweichen.
Dies bedeutete aber zwangsläufig trotzdem nicht, dass unsere Mitmenschen von uns verschont blieben. Ich schreibe dies nur ungern, aber wir waren mächtig stolz darauf, wie wir von den anderen wahrgenommen wurden. Wenn wir durch die Schulkorridore gingen, machte man uns Platz, damit man uns ja nicht versehentlich anrempelte; fingen wir den Augenkontakt von einem Mitschüler ein, blickte dieser sofort weg, als hoffte er dadurch, dass wir sein Glotzen nicht vernommen hätten; verließ unsere Lippen ein unanständiger Kommentar gegenüber einem Mädchen, so beleidigte uns dieses nicht aus Trotz und Scham zurück, sondern zwang sich zu einem verkniffenen Lächeln.
Ich durchlebe gerade so einen Marsch während einer der großen Pausen und sehe uns von außen: Fabian, dem dunkle Strähnen über seine quadratische Brille seitlich abfallen und eines seiner Slipknot-T-Shirts mit dem charakteristischen S-Logo trägt; Brecher, der eigentlich Levin heißt, aber diesen Namen verabscheut, führt wie immer seine übergroße Lederjacke spazieren, welche ihm sein älterer Bruder Noah vermachte, als er zur Bundeswehr aufbrach; Lukas mit seinem unverkennbaren linken Schlupflid und stets geweiteten Lippen, als könne oder wolle er sie niemals schließen, geht fast schon mechanisch vorwärts, als stünde er auf Schienen und könnte nicht aufgehalten werden; und ich, Severin, der immer ein kleines Stück – es sind nur wenige Zentimeter – hinter der Truppe marschiert, aufpasst und das gesamte Geschehen zu überschauen versucht. Wir sind schon eine ziemlich merkwürdige Clique, die es schafft, selbst einen weiten Flur wie den der Schule mit unserer Präsenz einzunehmen. Ich kann nachempfinden, wie ich mich und wie sich wahrscheinlich auch meine Kumpels so gefühlt haben, und muss gestehen, dass Euphorie wohl die richtige Beschreibung für unseren Zustand war; der Zustand dieser Gruppe aus Jugendlichen, die im Grunde von jedem verachtet wurde, der man sich aber unter keinen Umständen freiwillig stellen wollte und daher lieber aus dem Weg ging.
Ich könnte nun über die zahllosen Untaten harmloser, grenzwertiger und schier krimineller Art berichten, wie wir unsere Klassenkameraden schikanierten, sie mit unseren verächtlichen und beleidigenen Worten zu Tränen brachten oder in den viel zu engen Schulspinden für Stunden einsperrten; wie es sich Lukas nicht nehmen lassen konnte, Frau Meier als eine gemeingefährliche Fotze zu beschimpfen – er sagte wortwörtlich gemeindegefährliche Fotze, weil er offen gestanden etwas beschränkt war –, als sie der Klasse den Rücken zukehrte und dies Nils anhängen wollte – natürlich vergeblich; oder als Brecher und Fabian den Fußballplatz der Fünftklässler stürmten, sie mit ihrem eigenen Spielgerät abschossen, schließlich vertrieben sowie drohten, sie zu verprügeln, wenn sie je wieder einen Fuß auf die Rasenfläche setzen sollten. Dieses und so vieles mehr könnte ich schildern, aber ich will es in diesem Zeugnisbericht nur auf ein paar Begebenheiten beschränken, die wirklich wichtig waren für das Bevorstehende und von denen ich noch zu bald zu spreche komme: vor allem der erste Streich, gefolgt von zwei weiteren, der im Nachgang betrachtet alles in Gang setzte.
Jedenfalls gab es in Birkenteich neben der Schule als öffentliche Einrichtung nur noch einen Kindergarten, den selbstverständlich alle Birkenteicher zu besuchen hatten, eine Schreinerei, der man jedes Jahr nachsagte, in Konkurs zu rutschen, die es stets aber schaffte, sich durch einen großen Auftrag aus öffentlicher Hand aus der Schlinge zu ziehen, eine Brauerei mit britischem Eigentümer, einen Supermarkt sowie einige kleinere Geschäfte und verlassener Bauten am Stadtrand. Es handelte sich um alte Fabriken und Läden, die in regelmäßigen Abständen von wechselnden Eigentümern erworben und erneuert, bald aber genauso zuverlässig aufgegeben wurden. Meine Mutter sagte mal ganz beiläufig zu einer ihrer Bekannten, dass ein Fluch auf diesen Gebäuden liege und selbst ein Milliardär wie Warren Buffett oder einer der Scheiche des Nahen Ostens diesen mit ihren finanziellen Mitteln nicht brechen könnte. Ich persönlich glaube, dass es weniger magische als vielmehr weltliche Ursachen waren, die ein Bestehen in einer bedeutungslosen Kleinstadt wie Birkenteich mit ihren wenigen tausend Einwohnern unmöglich machte.
Eine Ausnahme bildete die angesprochene Brauerei. Sie wurde zwischen den beiden Weltkriegen von einem Briten gegründet und blieb trotz wechselnder politischer Verhältnisse und Katastrophen der vergangenen hundert Jahre immer in den Händen seines Urhebers. Irgendwie schaffte er es, Beziehungen spielen zu lassen und nahe Verwandte aus Deutschland mit seinem Geschäft anzuvertrauen, sodass er und seine Nachfahren zumindest indirekt Besitzer des Brauhauses blieben. Der gebraute Hopfensaft widersetzte sich in dieser Zeit genauso störrisch den vehementen Versuchen und Versuchungen, seinen Namen abwandeln zu lassen, und heißt daher bis heute immer noch Birch Beer – das Birkenbier aus unserer Kleinstadt, das in Fässern aus ortsnahen Birken aufbewahrt wird.
Natürlich tranken wir den Gerstensaft, aber wahrscheinlich viel seltener, als Sie wohl für solch eine wilde Truppe wie die unsere annehmen würden. Es dauerte zwei, drei, manchmal vier Wochen, bis wir für jedes Mitglied unserer Chaosgruppe eine Flasche zusammengefunden hatten. Mal erbarmten sich Ältere und schenkten uns gegen einen viel zu hohen Aufpreis eine Flasche oder zwei; dann fanden wir ganz zufällig eine unverschlossene, ganz und gar charakteristische grüne Bierflasche mit dem Wappen von Birch Beer in einem Einkaufswagen, die offenbar vergessen oder für besonders Durstige zurückgelassen wurde; äußerst selten trauten wir uns an die Vorräte unserer Eltern, die mit Argusaugen über ihr Lieblingskaltgetränk wachten. Wenn wir dann endlich eine Flasche für jeden parat hatten, gingen wir nach der Schule mit unserer kostbaren Fracht zu einem der verlassenen Bauten am Stadtrand und tranken langsam die Biere, als wären es die letzten auf dieser Welt. Dann verweilten wir, genossen den leichten Schwips, scherzten, spannen Pläne, lachten, verdammten unseren Heimatort, scherzten noch mehr, bis wir wieder ausgenüchtert unsere Heime aufsuchten.
Mir ist klar, so wie es mir als Dreizehnjährigen sowie den anderen ebenso bewusst war, dass wir mit einiger Anstrengung zu deutlich mehr Bier und anderem Alkohol hätten kommen können. Wir kannten, wie bereits angedeutet, Leute, die gegen eine kleine Vergütung bereitwillig so viel gekauft hätten, wie wir über Geld besaßen, und es riefen förmlich die abseitsgelegenen, alten Häuser in unserer Kleinstadt nach etwas mehr Geselligkeit. Zumal sich ein solches Tun nahtlos an unser asoziales Verhalten reihen würde. Wir hätten dies machen können, aber wir wollten nicht – kein Einziger von uns. Dass wir alle so dachten, gehörte zu den unausgesprochenen Vereinbarungen, den geheimen Schwüren unseres Bundes, die uns verbanden.
Es hatte aber natürlich triftige Gründe, warum wir so einen sorgsamen Umgang mit Alkohol zu pflegen suchten. Es lag selbstverständlich nicht an unseren Lehrkräften, die uns wenig glaubhaft weißmachen wollten, wie schnell man in eine Abwärtsspirale und Abhängigkeit geraten könnte, selbst bei einem vermeintlich geringen Konsum. Oder die Aufkleber auf den Flaschenhälsen, die zu einem verantwortlichen Trinken aufriefen. Nein. Keineswegs. Solch plakative Auswürfe der Panikmache und Appelle an die eigene Vernunft würden eher zum genauen Gegenteil führen. Dass wir selten tranken, war Fabians Vater geschuldet, der es sich zur Lebensaufgabe machte, ein durchtriebener und verwahrloster Alkoholiker zu werden.
Kurz geriet ich ins Stocken beim Verfassen dieser Worte, denn ich durchforstete meine Erinnerungen nach Begegnungen mit ihm, Bernhard Erfurth, in denen er nicht besoffen war, nicht eine Flasche Bier oder Hochprozentigen in seiner Hand oder Nähe aufbewahrte und nicht danach stank, Stammesmitglied der Kneipengänger zu sein. Aber ich fand keine. Kein einziges Aufeinandertreffen, wenn dieser erwachsene Mann nicht seinen Verstand durch das Nervengift abzutöten versuchte. Um es ganz offen auszusprechen: Er widerte mich durch und durch an mit seinem Zustand, nicht in der Lage zu sein, einen Satz kerzengerade ausformulieren zu können, geschweige denn Nützliches von sich zu geben. Er war das perfekte Unvorbild für alle, die mit dem Gedanken spielten, sich ein helles Blondes genehmigen zu wollen. Schlimmer noch erscheint mir in meinen vergangenen Bildern Fabian, der hilflos zusehen musste, wie sich sein Vater langsam, aber sicher tottrank, und zugleich seinem launenhaften Gemüt ausgesetzt war.
Ich wollte mich einmal ganz spontan mit Fabian treffen und entschied mich, vorher bei ihm anzurufen, anstatt ungebeten vor seiner Haustür zu erscheinen. Nach einigem Telefonklingeln nahm er ab und wirkte ganz verunsichert, als er sich mit seinem Namen zu Wort meldete. Ich begrüßte ihn, fragte, ob wir gemeinsam etwas unternehmen wollten, als ich aus dem Hintergrund ein wütendes Bellen vernahm. Den genauen Wortlaut kann ich nicht mehr rekonstruieren, aber ich meine mich zu erinnern, dass Fabian nicht so verdammt laut sprechen und am besten das scheiß Telefon gegen die scheiß Wand werfen sollte. Daraufhin verabschiedete er sich kleinlaut und bat mich, ihn abzuholen, während weitere Ausrufe an mein Telefonende ankamen.
Ich benötigte mit meinem Fahrrad zehn Minuten, bis ich sein Elternhaus erreichte. Die gesamte Fahrzeit über lag mir der Schrecken über das Gehörte in den Knochen; es war mir, als hätte mich dieser Trunkenbold angekläfft und nicht seinen Sohn. Oder vielleicht galt es uns ja beiden. Fabian saß auf dem Bürgersteig vor dem Haus und starrte ins Leere. Kurz musterte ich ihn und befürchtete schon, dass es nicht nur beim lauten Toben geblieben ist. Aber als er mich sah, erhob er sich mit einer fröhlichen, aber nur aufgesetzten Miene und deutete mir, das Weite von seinem ungeliebten Zuhause zu suchen.
Es war das erste und einzige Mal, dass ich mich telefonisch bei ihm meldete. Ich wollte nicht, dass er durch meine eigentlich so nichtige Handlung in Schwierigkeiten geraten könnte, aber fairerweise muss ich anführen, dass er auch ohne mein Zutun diesem ekelhaften Menschen ausgesetzt war, der es nicht nur mit verbaler und psychischer Gewalt hielt, sondern ihn auch körperlich züchtigte – zumindest solange er daheim war. Es überraschte mich schon damals nicht, dass wir als Clique nie Zeit bei ihm verbrachten und er es vorzog, erst den Nachhauseweg anzutreten, wenn es wirklich sein musste.
Bernhard Erfurth war freilich nicht der einzige Alkoholiker in Birkenteich, der entweder daheim oder mit anderen Saufkumpanen ihre Zeit im Hölzernen Zapfhahn totschlugen und sich ihrer Sucht hemmungslos hingaben, aber die Bekanntschaft mit diesem Mann reichte aus, dass wir gebührenden Respekt vor dem Trinken hatten. Auch wenn es uns letztendlich nicht davon abhielt. Damals wie heute.
Und so lebten wir in dieser Kleinstadt, die manchmal so trostlos, fast schon leblos auf uns wirken musste, in der wir alle mit unseren eigenen und gemeinsamen Problemen zu kämpfen hatten und zahlreiche selbst verschuldeten. Trotzdem glaube ich, dass wir diesen Ort stets als unsere Heimat empfanden und gerne hier wohnten – mit seinen guten wie schlechten Seiten und Menschen. Das änderte sich jedoch in den Herbsttagen vor zwanzig Jahren.
Dies alles änderte sich mit Liam Gram.
Kapitel 4: Stadtgeflüster
Mit dem Ende der Sommerferien gelangte ich mit meinen Freunden in die achte Klasse unserer Oberschule. Irgendwie schaffte es jeder aus unserer Gruppe, keine Ehrenrunde drehen zu müssen, obwohl die Vorzeichen dafür nicht gut standen. Ich habe mir nicht nur einmal darüber Gedanken gemacht, was passiert wäre, wenn sich Lukas oder Fabian oder vielleicht sogar beide nicht noch im letzten Moment des vergangenen Schuljahres gerettet und wir dadurch nicht mehr denselben Klassenraum geteilt hätten; ob dies eventuell unsere kleine Gang gesprengt und nicht zu den Ereignissen in jenem Herbst geführt hätte, die unser aller Leben verändert haben. Aber sich mit einem Hätte,Wäre,Vielleicht und Eventuell auseinanderzusetzen, kann allenfalls in meiner Vorstellung das Geschehene verkehren. Trotzdem merke ich, wie schwer es mir fällt, einfach hinzunehmen, was sich ereignete. Es ist mir, als ob ich Erklärungen für unsere Taten finden sollte, um mir nicht eingestehen zu müssen, dass ich und die anderen nicht bloß Jugendliche waren, die es nicht besser wussten, sondern die es nicht besser wollten; die einfach alles zuließen, was wenige Wochen nach dem Schuljahresbeginn geschah und nicht wieder gut gemacht werden kann.
Brecher und ich hatten keine Schwierigkeiten, den Anforderungen des Realschulzweigs unserer Oberschule gerecht zu werden. Dass wir freilich keine guten Zeugnisse vorzuweisen hatten, war mit unserer Faulheit, Ablehnung und den Streichen zu erklären, die wir brav wie Paninisticker sammelten. Bis auf eine Fünf im Kunstunterricht ließ sich meine Benotung durchaus begutachten. Und die Fünf hatte ich mir redlich verdient: Über mehrere Wochen hinweg sollten wir an einem Stillleben arbeiten. Sie wissen schon, diese Bilder und Zeichnungen von Obstschalen, Gegenständen auf einem Schreibtisch und allerlei anderem unsinnigen Zeugs. Ich ließ es mir nicht nehmen, einen verdammt detailreich ausgestalteten, erigierten Penis zu zeichnen, der im Moment der Aufnahme gerade ejakulierte. Um den Ganzen eine Krönung aufzusetzen, signierte ich das Bild für meine Kunstlehrerin Frau Krause, wünschte ihr viel Spaß bei der Sichtung meines Stilllebens und unterschrieb mit meiner schönsten Handschrift, die einem Kaligraphen entstammen könnte. Ich darf mich wohl glücklich schätzen, dass sie genug Humor hatte, mir immerhin noch ein Mangelhaft zu verpassen und nicht meine Mutter anzurufen oder mit anderen Konsequenzen um die Ecke zu kommen.
Brechers Leistungsbewertung zeugte sogar von guten Noten, allerdings wurde sein Betragen – ebenso wie das unserer gesamten Gruppe – negativ auf dem Schuldokument verewigt. Wir lasen uns später unter den Schatten der großen Birken im Wald die Kommentare unserer Lehrkräfte durch und lachten schallend: Severin war nicht bereit, mit allen Schülern einen guten Umgang zu pflegen, und musste wiederholt an die Klassen- und Schulregeln erinnert werden. Und darunter hieß es: Severin zeigte sich wenig lernwillig und leistungsbereit. Diese Worte waren wie Abzeichnungen für uns und bestätigten nur, was wir zu erreichen gedachten.
Allerdings täuschte dieses Lachen hinweg, dass wir tatsächlich Sorge hatten, nach den Sommerferien keine Einheit mehr in unserer Klasse bilden zu können. Fabians Notenbild bewegte sich eng an der Grenze zum Nichtbestehen, schlimmer war es jedoch bei Lukas. Denn es waren nicht primär seine fehlende Motivation sowie der nicht vorhandene Fleiß, die ursächlich an seinem schulischen Versagen waren. Lukas war, ich hoffe, Sie nehmen mir diesen Ausdruck nicht übel, beschränkt, so verdammt beschränkt und begriffsstutzig. Wahrhaftig und zweifelsfrei.
Ich bin mir nicht sicher, wie viel er im Unterricht überhaupt verstand. Gewiss hörte er ohnehin nur wenig zu, kritzelte irgendwas in sein Schulheft oder starrte vor sich hin und behielt dabei – ich habe es bereits erwähnt – immer seinen Mund leicht geöffnet. Von Weitem musste dieser Junge mit zerzausten Haaren, linkem Schlupflid und den offenstehenden Lippen einem unvoreingenommenen Beobachter schon schräg vorgekommen sein. Er trieb es aber auf die Spitze, wenn er etwas in seiner tiefen Stimme von sich gab und dabei falsche Prä- und Suffixe verwendete. Zum Beispiel beschwerte er sich über die bedammten Hausaufgaben, die er sowie nicht in seiner geschissenen Freizeit erledigen würde; das innötige Nachsitzen für ebenjene nichterledigten Aufgaben wenige Tage später; oder die gemeindegefährlicheFotze, mit der er Frau Meier schmeichelte und die wiederum anhand seiner charakteristischen Sprechweise sofort erkannte, dass es nur Lukas sein konnte, der seiner eigenen Muttersprach nicht Herr war. Es war zum Brüllen komisch. Besser aber war noch seine sinnfreie Fragerei: Ständig musste er alles nachfragen oder Sachen wissen, die sich als offensichtlich herausstellten. Wollten wir uns etwa beim Teich treffen, so erkundigte er sich doch tatsächlich, welchen wir meinen würden und wer alles zugegen sei. Manchmal brachte mich das ganz schön zum Verzweifeln, aber bis auf diese Marotte war er ein wirklich ordentlicher Kerl, der treu zu uns hielt und uns bei jedem Unterfangen – so gemeindegefährlich es auch sein konnte – unterstützte. Zumal Schuld jemand anderes an seinem Zustand trug.
Birkenteich ist eine Kleinstadt, die sich genauso wenig den Tugenden und Lastern anderer kleinerer Orte erwehren kann. Es dürfte daher wenig überraschen, dass Klatsch und Tratsch über unliebsame Gestalten, ebenso jedoch über engste und treuste Verbündete die Runde machten, Geheimnisse schonungslos ausgeplaudert wurden und selbst oder gerade deswegen die eigene Familie mitnichten ausgeschlossen war und man sich über seine Eltern, den Onkel oder gar den eigenen Ehemann das Maul zerriss. Dass ausgerechnet vier Jungs ein Geheimnis, das zugleich so groß und bedeutend wie das eines Menschenlebens war, eigentlich zu groß, um es wirklich begreifen zu können, für sich behalten konnten, erscheint mir so viele Jahre später unvorstellbar. Aber im Gegensatz zu den vielen anderen Einwohnern unserer Heimatstadt schafften wir es dicht zu halten, während die anderen Heimlichkeiten und Gerüchte ohne schlechtes Gewissen einander weitersagten – natürlich stets mit der Bitte, bei einer möglichen Weitergabe nicht namentlich erwähnt zu werden.
Lukas war Teil, eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, eines solchen Kleinstadtgelästers, das große Welle schlug, aber nie bewiesen werden konnte. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass polizeiliche Untersuchungen diesbezüglich angestellt wurden oder nicht. Man hätte es zwangsläufig in Birkenteich mitbekommen, oder Lukas höchst selbst hätte uns im kleinen Kreis davon berichtet, wie peinlich diese Episode auch sein mochte. Obgleich es nie eine tatsächliche Bestätigung dieses Gerüchts durch Lukas‘ Worte oder irgendwelche Berichte oder Zeitungsartikel gab, hielt es sich so hartnäckig, dass man noch Jahre später darüber sprach. Aber denke ich an meinen alten Schulfreund zurück, so sind Zweifel am Wahrheitsgehalt nur schwer zu halten.
Gemeinsam mit seinen Eltern sowie seiner älteren Schwester Julia wohnte Lukas in einem kleinen Einfamilienhaus etwas abseits vom Schuss des Geschehens in der Hainbuchenallee. Die Lage sowie das ohnehin nicht allzu beliebte Kleinstädtchen erlaubten seinem Vater, der in Greifswald eine Wäscherei sowie zwei Ferienwohnungen betrieb, den Kauf eines vergleichsweise riesigen Grundstückes mit seiner Fläche von rund 2500m², auf welchem nur das zu kleine Häuschen gebaut wurde und dadurch deplatziert wirkte. Auffallend war zudem der hohe, braun lackierte Holzzaun, der an den Grenzen zu den anderen Fluren aufgestellt war. Im Grunde konnte man damit schon ableiten, dass die Sommers – insbesondere das Familienoberhaupt – kein allzu großes Interesse an seinen Nachbarn und Mitmenschen hatten. Ginge es nach ihm, Herrn Sommer, sollte sie ihn und seine Familie am liebsten vollständig in Ruhe lassen. Und dies stellte er gerne und offen zur Schau, ohne Sorge davor zu haben, die Einwohner unseres Ortes dadurch zu verprellen. Wahrscheinlich wäre er gegenteilig darüber entzückt, wenn ihm dies gelänge und er fortan ignoriert würde. Aber ganz so einfach ging das natürlich nicht – vor allem in einer neugierigen Kleinstadt, in welcher kaum etwas los war.
Als damals das Grundstück gekauft und ein gutes Jahr später die Familie in das neugebaute Haus zog, bestanden die Sommers aus drei Personen, denn Lukas war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezeugt. Und als ein weiteres Jahr verstrich, war plötzlich mein Freund geboren. Ganz ohne Ankündigung, ohne das Wissen oder einer Ahnung durch ihre Mitmenschen. Dass Gerrit Sommer ein verschrobener Kerl war, der sich für was Besseres hielt – geschenkt. Dass er sich mit seiner Familie auf diesem riesigen Grundstück einbunkerte und mit nichts und niemanden etwas zu tun haben wollte – vergelt’s Gott! Aber dass von hier auf morgen ein Neugeborenes auftauchte, ohne die geringste Andeutung, dass sich so etwas zutragen könnte – das würden die Einwohner von Birkenteich nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Dabei handelte es nicht nur um die kleinstädtische Neugierde, die Licht ins Dunkel bringen wollte; unausgesprochen und doch spürbar ging etwas Mysteriöses, für einige sogar Finsteres von diesem Kind aus.
Von da an begann das Tuscheln, das sich wie ein immer schneller ausbreitendes Lauffeuer nicht aufhalten ließ.
Nach einer jeden Begegnung mit der Familie, vor allem im Beisein des neuen Kindes, tauschten sich Frauen wie Männer über das Gesehene aus und wurden nicht müde, Theorien über das Findlingskind aufzustellen, als würde das richtige Erraten dazu führen, dass das Geheimnis gelüftet würde. Zu Beginn tendierte man zu einer der beiden vorherrschenden Ideen: Da man mit der Familie, die sich so gerne abschotte, selten in Berührung kam, fiel das Anwachsen des Babybauches bei der ziemlich stämmigen Mutter erst gar nicht auf; durch den für Augen unüberwindbaren Zaun konnte man die Gelegenheiten, wenn man Frau Sommer erblickte, an einer Hand abzählen und somit die Veränderungen an ihrem Körper nicht realisieren. Für ärztliche Termine musste man zu einem der Krankenhäuser in den Nachbarsorten fahren – für Gerrit Sommer bedeutete dies wohl zweifelsfrei Greifswald –, sodass hierdurch Informationen nur äußerst schwer nach Birkenteich gelangten. Es lag also an der Zurückgezogenheit der Familienbande, die so eine unerwartete Geburt ermöglichte.
Die zweite Vorstellung stützte sich darauf, dass – zuwider aller anderen Beobachtungen – Annemarie Becker angeblich gehört hätte, dass sich die Sommers in den vergangenen zwölf Monaten mindestens viermal in einem osteuropäischen Land, mal war es die Ukraine, dann Rumänien und ganz sicher die Slowakei, aufgehalten und dort eine Leihmutter für ein weiteres Kind gefunden hätten. Schließlich war Theresa Sommer bereits weit über fünfunddreißig – so zumindest die Schätzung ihres Alters –, sodass es zu einer Risikogeburt kommen konnte. Die Behauptungen waren haltlos, fanden aber genug Abnehmer, die sie wiederum gerne anderen aufschwatzten, schließlich klang dies spannender als die vermeintliche Aufklärung durch die erste Theorie.
Aber eines Tages, mittlerweile wussten die Einwohner dieser Kleinstadt, dass das Kind Lukas genannt wurde, suchte Frau Sommer den Kinderarzt Dr. Ludger in Birkenteich auf. Lukas hatte, wie sich im Nachhinein herausstellte, nur eine leichte Erkältung mit erhöhter Körpertemperatur, aber seine Mutter wollte auf Nummer Sicher gehen und nicht das Leben des Babys durch eine unerwartete Krankheit gefährden. Bei dieser Angelegenheit war Melinda Grasser zugegen, die ihre Ausbildung als medizinische Fachangestellte bei der Arztpraxis absolvierte. Nachdem die Sommers mit ihrer harmlosen Diagnose wieder heimkehren durften, ließ sich die junge Auszubildende nicht davon abbringen, ihren Bekannten sofort von den Neuigkeiten zu berichten, die sie soeben erfahren hatte: Lukas Sommer, der Zweitgeborene der eigenartigen Familie, hatte ohne jeden Zweifel eine geistige, wenngleich nur leichte Einschränkung.
Das Altweibergeschwätzt über die Sommers nahm nun so richtig an Fahrt auf, wie mir viele Jahre später einmal meine Tante Kassandra erzählte. Von ihr habe ich all dies erfahren und mit deutlicher Missgunst musste ich feststellen, dass sie selbst nach so langer Zeit immer noch gerne über die Familie meines Freundes schwadronierte und bei den nachfolgenden, wahrhaftig pikanten Schilderungen ganz aus der Haut fuhr: Sie sah plötzlich wie die junge Frau vor mehr als dreißig Jahren aus, die wie alle anderen leidenschaftlich das Schicksal und Mysterium des Lukas Sommer diskutierte und dabei gar nicht bedachte, wie es ihm wohl erginge, wenn er all dies wüsste, all diese hässlichen Worte und Gerüchte hörte. Dennoch unterbrach ich Tante Kassandra nicht und lauschte stattdessen, was man sich damals heimlich zurief: so heimlich, dass man es unmöglich für sich selbst behalten konnte, und zugleich so laut, dass es im Grunde doch jeder mitbekam.
Man sprach nicht mehr über die Geschichte mit der Leihmutter. Annemarie Becker, die diese Vermutung als Tatsache hinstellte, war sich wie die anderen nun sicher, dass die Degeneration des Sommerjungen auf das Alter Theresa Sommers zurückzuführen sei. Empört kritisierte man hinter vorgehaltener Hand, dass all dies die Schuld der Mutter sei, die sich den zweiten Kinderwunsch hätte viel früher verwirklichen und nicht so lange warten sollen. Dass es ihr zudem ebenso wenig geschadet hätte, etwas für die bevorstehende Geburt abzunehmen, um das Neugeborene möglichst wenigen Risiken auszusetzen, floss in den hässlichen, für die allermeisten jedoch recht amüsanten Sprech mit ein.
Dennoch gab es mehrere, die Evidenzen dafür haben wollten, dass Theresa Sommer nicht die Mutter des Jungen sein könnte. So erkundigte sich eine Freundin meiner Mutter, Mareike Stelitz, beim hiesigen Apotheker, ob dessen Schwester, die in Greifswald als Krankenpflegerin arbeitete, zufällig die vermeintliche Mutter irgendwann angetroffen habe. Obwohl der Besitzer der Arzneiladens wenig von diesem Tratsch hielt, ließ er sich dennoch zu dieser Fragerei hinreißen, schließlich wollte er nicht Gefahr laufen, in die Ungnade der Birkenteicher zu fallen, wenn er doch schon an der Quelle saß, wie es meine Tante ausdrückte. Die baldige Antwort sollte aber Mareike Stelitz und die anderen zumindest vorläufig enttäuschen: Theresa Sommer war weder im Krankenhaus gesehen, noch hatte sie irgendwelche Arzttermine – so viel konnte die Schwester des Apothekers herausfinden, ohne sich in die Nesseln zu setzen.
Die Einwohner versuchten daraufhin die neuen Informationen in ein kohärentes Bild zusammenzufügen, aber je mehr sie sich Gedanken machten und dabei verschiedene Szenarien durchspielten – etwa ob Frau Sommer schlicht und ergreifend daheim von Ärzten untersucht wurde, wobei niemand in den vergangenen Wochen und Monaten einen Krankenwagen oder das Fahrzeug eines privaten Behandlungszentrum gesehen hatte –, desto unwahrscheinlicher schien die Idee, dass sie wirklich seine Mutter war.
Etwa zeitgleich erzählten zwei Mädchen ohne vorherige Absprache unter einander ihren Müttern davon, dass Lukas‘ ältere Schwester Greta im derzeitigen Schuljahr solch enorme Fehlzeiten aufwies, dass ihre Lehrkraft bereits laut davon sprach, dass sie um eine Wiederholung nicht herumkäme. Greta war damals dreizehn Jahre alt. Die beiden Mütter, die unabhängig voneinander genau dasselbe in diesem Augenblick dachten, taten das Einzige, was Kleinstädter wohl als die angemessenste Reaktion betrachten würden: Sie erzählten es weiter. Nicht Theresa, sondern Greta Sommer war die Tochter des jungen Bengels. Um zu kaschieren, dass sich Greta – eine Dreizehnjährige! – auf irgendeinen Typen eingelassen hatte und ihr Dummheit und Pech gleichermaßen schlecht mitspielten, würden die Sommers behaupten, dass Lukas Gretas jüngerer Bruder wäre. Das eigentliche Geschehen würde dadurch nicht rückgängig gemacht, aber immerhin wäre das junge Mädchen unbelastet und müsste sich dem Spott und der Verachtung durch andere nicht hingeben.
Das war es, das Geheimnis war gelöst und gleichzeitig so abstoßend und niederträchtig, dass es eine ganz und gar großartige Geschichte war, an der man sich stundenlang und wiederholt abarbeiten konnte. Die hochnäsigen Eigentümer des Riesengrundstückes waren also auch nur Menschen, die sich den Versuchungen der menschlichen Gelüste nicht entziehen konnten. Zufrieden über diese Gewissheit wurde das Stadtgespräch über die Sommers allmählich zurückgefahren und man wandte sich wieder anderen Geschehnissen zu, die dieser oder jener Nachbar hier oder dort gemacht haben wollte.
Wieder war es Annemarie Becker, die äußerst flexibel ihre Annahmen zum Sommerjungen anpasste. Etwas gefiel ihr wohl nicht an der Idee, dass die Dreizehnjährige die Mutter des Burschen sei. Dass sie ganz ohne Zweifel seine Erzeugerin sein musste, das würde sie natürlich unnachgiebig kundtun. Aber etwas passte noch nicht. Es lag auch nicht an der designierten Mutter, sondern… Sondern an Lukas. Annemarie fragte sich selbst, warum ausgerechnet Greta mit ihrer tollen genetischen Veranlagung – sie sah ganz anders als ihre korpulente und nicht besonders hübsche Mutter aus – einen Behinderten gebären sollte. Und dann fiel es ihr von einem Moment auf den anderen ein, als hätte das Schnipsen ihrer Finger hierzu beigetragen – zumindest erzählte sie es ziemlich genau so meiner Tante und allen anderen Interessierten. Sie kannte nun das ganze Geheimnis dieser verdorbenen Familie, die ihre Schandtaten hinter hohen Mauern zu verstecken suchten: Greta war die Mutter von Lukas und gleichzeitig seine Schwester. Gerrit Sommer hatte sich an seiner eigenen Tochter vergangen und dadurch einen Krüppel mit einer geistigen Einschränkung gezeugt.
Jeder vernahm bald das Gerücht um den inzestuösen Sommerjunge sowie dem Verbrechen seines Erzeugers an der dreizehnjährigen Tochter. Mit einem ungemeinen Selbstverständnis wurde das nicht bestätigte Gerede als unwiderrufliche Tatsache hingenommen. Es musste einfach stimmen, es würde doch alles erklären: Warum sich die Sommers so abkapselten, denn schließlich wollte der Familienvater nicht riskieren, dass man ihn dabei beobachtete, wie er das Bett mit seiner Tochter teilte und diese ihm ein weiteres Kind gebar; warum die Familie keinen Anschluss an der Gemeinschaft suchte, da ansonsten garantiert der auftauchende Babybauch des minderjährigen Mädchens zu Tage käme oder sie sich versehentlich verplappern würde, was Vati abends so mit ihr trieb; warum alle diese gottlose Familie eigentlich immer schon verachteten und damit offenbar richtig lagen, denn selbst an die elementarsten Grundzüge eines aufrichtigen Lebens schien sich das Familienhaupt nicht halten zu wollen beziehungsweise wurde bei seinem Treiben von seiner Frau, der eigenen Frau und Mutter, toleriert, womöglich sogar unterstützt, denn so müsste sie nicht ihren eigenen Körper seinen Begehren hinhalten.
Die Sommers wurden zu verbrannter Erde. Keiner wollte mehr mit ihnen gesehen werden, befürchtete man doch, ebenfalls zur Zielscheibe der wütenden Kleinstadtgesellschaft zu werden. Es ging wohl tatsächlich so weit, dass sich einige Bürger bei der ansässigen Polizei meldeten und danach verlangten, die Umstände um Lukas‘ Zeugung und Geburt prüfen zu lassen. Ob es diese Untersuchungen gab und was letztendlich dabei herausgekommen ist, davon konnte mir meine Tante nichts berichten. Aber, so sagte sie mir, sie hätten mit dieser hässlichen und garantiert bewahrheiteten Geschichte erreicht, was sie sich von Anfang an wünschten: Von nun an wurden die Sommers von allem und jedem geschnitten, wurden ignoriert und wären, selbst wenn sie nun gegenteiliges Begehren hätten, niemals mehr Teil der Birkenteicher Gemeinde geworden. Und dazu mussten sie nur eine kleine Missgeburt in die Welt setzen, lachte spöttisch meine Tante, als sie zum Abschluss ihrer kleinen, widerwärtigen Erzählung kam.
Vielleicht fragen Sie sich in diesem Moment, was ich von diesem Stadtgeflüster halte. Es ist kompliziert, wie man zu sagen pflegt. Bevor mir meine Angehörige diese abscheuliche Geschichte darlegte, die nicht nur die menschlichen Abgründe einer Kleinstadt zu vergegenwärtigen versucht, sondern bis heute hartnäckig am Leben gehalten wird, kannte ich als Kind und Jugendlicher zumindest in rudimentärer Form das Gerücht, was mir jedoch als Wahrheit verkauft wurde, nämlich: dass Lukas kein normaler Junge wäre. Er hätte eine geistige Behinderung, die auf das verwerfliche Verhalten seines Vaters zurückzuführen sei. Und später sagte mir ein Mitschüler, dass Lukas‘ Vater seine Schwester gefickt hätte und er darum ein Spast sei. Da verstand ich und hinterfragte es ehrlicherweise nie, wie es auch Brecher oder Fabian nicht taten. Wir nahmen Lukas, wie er war, ohne dass wir ihn bedauerten oder er uns leidtat, denn er war unser Freund. So wie er nun einmal war und so einfach das auch klingen mag.
Und wir sprachen ihn ebenso wenig auf diese vermeintliche Wahrheit an, wie wir auch Fabian nicht nach seinem alkoholsüchtigen Vater befragten, von Brecher wissen wollten, wie er ohne seinen Bruder auskam, oder warum ich, Severin, eine solche Abscheu gegenüber meinen Eltern bewahrte. Es gehörte zu den unausgesprochenen Vereinbarungen, den geheimen Schwüren unseres Bundes, die uns verbanden, wie ich schon vor einigen Seiten erzählte.
Selbstverständlich waren wir nicht gerade zimperlich, wenn es jemand wagte, einen von uns auf sein individuelles Schicksal anzusprechen. Antonio Gallo, den alle nur Toni nannten und der italienische Vorfahren aufwies, spielte sich gerne als Don unserer Schule auf. Er war zwei Jahre älter als wir und wollte offenbar nicht wahrhaben, dass unsere kleine Truppe von Siebtklässlern die Bildungsinstitution mehr aufmischte, als er es je machen könnte. Also wollte dieser Großkotz klarstellen, wem die Schule gehörte und konfrontierte uns deshalb in einer Mittagspause an einem spätwinterlichen Mittwoch; er sorgte im Vorfeld dafür, dass sich Gerüchte über eine großartige Bloßstellung und womöglich sogar Schlägerei in der Schulgemeinschaft verbreiteten. Ich habe mir sagen lassen, dass selbst Schüler noch an ebenjenem Mittwoch freiwillig länger in der Schule blieben, nur um zu sehen, ob sich das Gerede bewahrheiten würde.
Wir hielten uns also in der besagten Mittagspause im Atrium auf, darauf hoffend, dass dieser langweilige Schultag endlich ein Ende finden würde, als Toni mit einer Traube von Mitschülern auf uns zukam. Die Art und Weise, wie er sich uns näherte und wie die Luft elektrisch geladen schien, verkündete Unheilvolles. Obwohl das sicherlich jeder von uns spürte, bemühten wir uns alle, ihn zu ignorieren und keines Blickes zu würdigen. Gewiss hatten wir damit ins Schwarze getroffen, denn wutschämend rief er uns zu, unsere Tagträume zu beenden, in denen wir uns gegenseitig einen hobeln würden. Ich lachte laut auf, als ihn sprechen hörte; Brecher und Fabian kicherten ebenso und Lukas – der bekanntermaßen ein wenig mehr Zeit benötigte – stimmte verzögert ins Lachen mit ein. Ich will nicht anhören davon zu träumen, wie wir uns gegenseitig die Palme wedeln, kam es ihm aus dem Mund geschossen und danach brüllte er vor Freude. Sein dümmliches Lachen war echt ansteckend und nicht nur wir lachten herzhaft und ungeniert, sondern auch einige aus Tonis Ansammlung.
Mir war klar, dass dieses Zwischenspiel böse enden würde. Entweder für uns, da die Anzahl an Heranwachsenden, die sich hinter Antonio angesammelt haben, ganz schön beachtlich war, oder für ihn, der sich wohl dieses Aufeinandertreffen von Anfang an gänzlich anders vorgestellt hatte. Anstatt uns vorzuführen und ein für allemal in die Schranken zu verweisen, lachten wir diesen Wichtigtuer aus. Ich bin mir sicher, dass die Vorurteile über italienisches Blut Blödsinn sind; sollte ich mich doch irren, so musste es zu diesem Zeitpunkt in seinen Adern nur so kochen vor Zorn und Scham.
Er trat auf uns zu und schrie, dass wir verstummen sollten – natürlich verwendete er dafür eine andere Ausdrucksweise, aber ich denke, dass Sie es mir nicht nachtragen, wenn ich unser flegelhaftes Hin und Her zumindest nicht vollständig zitieren muss. Die folgenden Beleidigungen, als wir seinem Befehl nicht nachkamen, prallten einfach von uns ab, als hätten wir uns telepathisch zugeflüstert, bloß keine Dummheiten anzustellen. Wir waren in viele Rangeleien, manchmal sogar Schlägereien verwickelt und wussten sehr wohl, wie sehr es wehtat, wenn man sich ein blaues Auge verdiente oder der eigene Körper zu einem Boxsack eines überlaunigen Typen wurde. Ich hatte wirklich keine Angst davor, mich auf ein solches Handgemenge einzulassen, aber gerne verzichtete ich auf Tage und Wochen voll von schmerzenden Gliedern. Außerdem war da diese große Ansammlung an weiteren Mitschülern, die tatsächlich einschüchternd wirkte. Selbst bei einem raschen Eingriff einer Lehrkraft – wobei diese sich in unserem Fall gewiss Zeit ließ – würden wir definitiv einiges abgekommen. Daher hoffte ich innerlich, dass es ausschließlich beim Wüten des Jungen blieb, dessen Stolz wohl ganz schön angeknackst war.
Toni fielen noch weitere, zutiefst beleidigende Ausdrücke ein, auf die wir keine Erwiderungen gaben, sondern schlicht lachten. Im Gegenzug zu uns war er jedoch keineswegs zu einem herzhaften Lachen aufgelegt, sondern lief im Gesicht rot an, als würde ihm sein Kopf gleich platzen wollen. Für einen kurzen Augenblick wurde es ganz ruhig, als er nichts mehr sagte, sondern uns nur noch seine Faust drohend entgegenzeigte. Brecher, Fabian und auch ich wussten, dass wir einfach am besten die Klappe hielten – das war eine reelle Chance ohne großen Ärger aus dieser misslichen Lage herauszukommen. Lukas, der mal wieder verlangsamt handelte, fehlte es jedoch an Weisheit an diesem Tag.
Hast du nicht noch ein paar vereindruckende Worte für uns, du Klugscheißer?, provozierte er den Neuntklässler und starrte ihn fröhlich an. Zu fröhlich und erwartungsvoll, wie uns alles bewusst war.
Du hast gut reden, du Missgeburt. Dein Vater hätte niemals deine abstoßende Schwester ficken sollen.
Ich wollte eigentlich darauf verzichten, diesen ekelhaften Worten zusätzlichen Raum zu geben. Ich glaube aber, dass es doch wichtig ist, sie hier zu notieren. Hätte ich sie nur umschrieben, dann hätten sie gewiss nicht den Effekt, den sie auf Lukas, aber ebenso auf uns, seine Freunde, hatten, als Toni so dumm war und diese verbotene Wahrheit so ungeniert auswarf, als müsste er sich von tiefsitzendem Rotz aus seinem Hals befreien.
Lukas stürzte sich sofort auf Antonio, schlug mit den flachen Händen auf sein Gesicht ein und schrie vor Wut. Er kreischte und aus den Zorneslauten wurden bald wüste Beleidigungen, die durch das Atrium hallten. Brecher, Fabian und ich kamen unserem Freund zu Hilfe: Brecher und ich hielten die anderen mit drohenden Fäusten fern und traten ins Leere, um zu veranschaulichen, dass mit uns nicht gut Kirschen essen war. Obwohl mein Körper augenblicklich mit Adrenalin gefüllt war, erbat ich, dass das alles nicht komplett eskalieren würde. Währenddessen beackerte Fabian Toni mit Tritten, wobei er natürlich darauf achtete, nicht Lukas zu erwischen, der auf ihm saß und weiter auf ihn einschlug.
Die ganze Situation dauerte nicht lange; noch bevor Toni die Grenze überschritt, die zu dieser Prügelei führte, hatten zwei Mädchen bereits die aufsichtsführende Lehrkraft Frau Schlegel über den möglicherweise gleich ausbrechenden Konflikt informiert – und leider dabei recht behalten. Frau Schlegel ist sofort zu uns hin geeilt, aber es blieb wohl doch noch genug Zeit, damit Antonio Lukas schikanieren konnte und sich dadurch eine saftige Abreibung verdient hatte. Der Lehrerin gelang es, die versammelten Schüler zu verscheuchen und mit ihrer gewaltigen Stimme Fabian und Lukas zum Aufhören zu bewegen. Als Lukas nicht mehr schlug, schubste sie ihn unsanft von Toni und erkundigte sich nach seinem Wohlergehen. Natürlich ist er vergleichsweise gut weggekommen; hätte sich Frau Schlegel mehr Zeit gelassen oder wäre gar nicht erschienen, dürfte er sich in den folgenden Tagen, vielleicht Wochen im Krankenhaus erholen. So trug er nur Wunden und Schmerzen davon, die spätestens nach zwei Nächten vergessen waren. Zumindest die körperlichen.
Der Schrecken, dem wir ihn verpassten, sowie die Scham über das vermeintlich einfache und doch verlorene Scharmützel lasteten schwer auf ihn. Obwohl ich mir sicher bin, dass er früher oder später auf Rache aus war, womöglich dieses Mal wirklich mit Kumpels, die bereit waren, eine dicke Lippe zu riskieren, wenn sie es vier Halbstarken so richtig zeigen konnten, überwog wohl die Furcht und Einsicht, dass man uns nicht so einfach herumschubsen konnte. Vor allem Lukas nicht. Geistig behindert hin oder her; in dieser Situation war er wie ein Verrückter. Verdammt, ich glaube, wäre ich an Tonis Stelle, würde ich mich auch vor diesem Irren fürchten. Aber das war ich nicht. Ganz im Gegenteil: Lukas war mein Freund, unserer aller Freund.
So stand es nun in den letzten Zügen am Schuljahresende: Lukas, der aufgrund seiner Beeinträchtigung mit eigentlich jedem Schulfach zu kämpfen hatte und darüber hinaus in einem Konflikt verwickelt war, würde nur mit größter Kraftanstrengung die Kurve kriegen. Es widerstrebte uns, sich in unserer Freizeit mit der Schule und ihren Inhalten auseinandersetzen zu müssen, aber die Sorge davor, nicht mehr Lukas – und Fabian wohlgemerkt – in unseren Klassenreihen sitzen zu wissen, verlangte nach unliebsamen Maßnahmen. Von April bis Juni beschränkten wir unsere Schikanen im Schulraum und mimten stattdessen die geläuterten Schüler, die sich fortan bessern wollten oder es wenigstens so lange taten, bis die Zensurenkonferenz tagen würde.
Ich kann mir nur zu gut vorstellen, wie sich Lehrer fühlen müssen, die bis kurz vor Zensurenschluss von ihren Schülern zur Weißglut getrieben werden, welche sich dann urplötzlich in zarte Lämmchen verwandeln, weil ihr potenzielles Zeugnis den Duft des Versagens schon von Weitem trägt. In diesen letzten Wochen roch es in unserer Clique wohl gewaltig nach diesem beschämenden Aroma, und ich will es unserem Lehrkörper gar nicht verübeln, dass wir als Schüler nun als Bittsteller auftraten, die irgendwie die Gunst unserer Lehrkräfte zu gewinnen suchten. Ganz im Gegenteil: Es spricht offenbar für unsere Pädagogen, zumindest für die meisten, dass diese es zwar auskosteten, vermutlich sogar sehr genossen, uns dennoch aber eine faire Chance gaben, welche wir dankend annahmen. Es war freilich kein schönes Unterfangen, vor allem das Flehen Lukas‘, endlich mit dem geschissenen Lernen aufzuhören und lieber etwas Spannendes anzugehen. Aber wir zogen es durch, sodass wir am letzten Schultag vor den schier ewig währenden Sommerferien mit unseren Zeugnissen belohnt wurden, auf denen die Versetzungen in den achten Jahrgang feierlich verkündet wurden – wenngleich ich anhand der Miene unserer Klassenlehrerin deutlich ablesen konnte, dass sie sich Gegensätzliches aus tiefsten Herzen ersehnte und nun wie eine desillusionierte Märchenfigur vor einem versprochenen, aber dennoch erloschenen Wunsch stand.
Auch dies nehme ich ihr nicht böse, schließlich waren wir alles, aber keine guten oder wenigstens lieben Schüler, die die Klasse auf irgendeine Art und Weise positiv bereicherten. Wenn ich so darüber nachdenke, was sich unweit später in der Zukunft zutrug, so hätte ihr Wunsch wohl in Erfüllung gehen sollen. Unbedingt sogar, wie mir mein Gewissen einzureden gedenkt. Aber so sehr es fleht und hofft und bittet, es bleibt ungehört.
Kapitel 5: Der erste Streich
Wir waren nun also Achtklässler und dachten nicht daran, unser tugendhaftes Benehmen vom Ende des vergangenen Schuljahres nachzustellen. Eigentlich, so phantasierten wir am Vorabend des neuen Schulbeginns, wollten wir es so richtig krachen lassen. Uns – Fabian, Lukas, Brecher und mich – sollte dieser verhasste Lernort in Erinnerung behalten. Die anderen möglichen Konsequenzen blendeten wir dabei gekonnt aus, als hätten wir nicht noch vor wenigen Monaten mit einer Not gedrungen, die sich als besonders wehrhaftes Monstrum darstellte. Oder vielleicht war es genau diese Schmach, die wir erdulden und unbedingt verkehren mussten. Ich kann es nicht genau sagen, aber der Zorn und die Wut von pubertierenden Teenagern überwog wohl gewaltig gegenüber unserem Verstand.
Drei besonders erinnerungswürdige Streiche führten wir im Spätsommer und Herbst ebenjenes Jahres aus, die in der besagten Katastrophe gipfelten; diesem unerträglichen Ereignis rund um Liam Grams Tod.
Der erste unserer Gemeinheiten trug sich nur wenige Tage nach dem Ende der Sommerferien zu. Die Birkenteicher Oberschule galt für viele Jugendliche als Sprungbrett für eine andere, höherwertige Bildungsinstitution in einem der Nachbarorte oder als notwendiges Übel, um nach dem Erhalt des Sekundarabschlusses eine Ausbildung beginnen zu können. Für die anderen war sie jedoch gleichbedeutend mit einem Auffangbecken für all jene, die wenig schmeichelnd dem verdorbenen Kaffeesatz der Gesellschaft zuzuordnen waren. In allen drei Fällen – um ehrlich zu sein, bin ich mir heute nicht ganz sicher, welcher Kategorie ich und meine Freunde angehörten – war der Schulbesuch unfreiwillig. Dabei lag es nicht nur am schlechten Ruf der Schule oder der Schulform an sich, sondern an einer gewissen Perspektivlosigkeit, die sich beim Begehen der Flure des alten und definitiv renovierungsbedürftigen Schulgebäudes erfühlen ließ.
Daher überraschte es uns selbst als Schüler, wenn sich neue Quereinsteiger zu uns verirrten. Adrian Lachzer war einer dieser Neuen, der am ersten Schultag sichtlich nervös neben unserer Klassenlehrerin Frau Mäuser stand und sich garantiert an einen anderen Ort wünschte; überall hin, bloß nicht hierher an diese Schule. Es gelang ihm kaum, fünf Worte über die Lippen zu bringen in seinem aufgeregten Stottern, bis Lukas zu kichern begann und Fabian hinter vorgehaltener Hand Adrian als einen stotternden Schwachkopf unüberhörbar verunglimpfte. Nur wenige lachten leise, als sie dies vernahmen, aber ich sah in den meisten Gesichtern der Klasse, dass ihnen der fiese Ausspruch durchaus gefiel – schließlich waren sie selbst nicht die Leidtragenden. Adrian wurde wohlwissend von unserer Lehrkraft weit von mir und den anderen in die hintere Sitzreihe geführt, während wir vorne Platz nehmen mussten – als ob uns dies von unserem Verhalten abgehalten hätte.
Trotzdem verschonten wir ihn zunächst, da wir ihn einerseits nicht kannten und nicht recht wussten, was sich hinter diesem stotterndenSchwachkopf verbarg; andererseits keimte in uns bereits ein Plan, wie wir ihn gebührend an seiner neuen Schule begrüßen könnten. Davor jedoch loteten wir zuerst aus, wie weit wir bei ihm gehen durften.
Es waren vor allem kleinere Drangsale, die viel von seinem Charakter preisgaben. So stießen wir auf dem Pausengang – natürlich nur rein zufällig – mit unseren Schultern gegen seinen etwas dicklichen Körper und schimpften ihm zu, gefälligst die Augen offen zu halten. Bis auf eine kleinlaute Entschuldigung und ein beschämtes Weggucken tat er nichts. Dann borgte sich Fabian ungefragt Stifte aus seinem Etui und gelobte, sie zurückzubringen. Weder Protest noch Nachfragen, ob Adrian denn sein Hab und Gut wiederhaben könnte, erreichte meinen Freund. Schließlich ließen wir es uns nicht nehmen, ihn in den guten alten Schubskreis zu befördern und zwischen anderen Mitschülern unserer Klasse wie einen Ball hin und her zu werfen. Auch hierauf machte er keine Anstalten, sich uns entgegenzustellen oder es einer Lehrkraft zu petzen. Unser Opfer war für seine Aufnahme an dieser Schule bereit.
Ich muss an dieser Stelle betonen, dass ich mich nicht träumerisch nach diesen Tagen zurücksehne oder ein Lächeln auf meinen Lippen spüre, während ich über Adrian Lachzer berichte. Er tut mir natürlich leid, dass er uns begegnen durfte. Vieles aus der damaligen Zeit reiht sich ein in dieses Konglomerat aus verächtlichem Tun. Mit Schrecken muss ich mir selbst eingestehen, dass ich selbst daran mitgewirkt habe. Um aber alles verstehen zu können, muss ich einfach erzählen, alles niederschreiben, was sich in jener Zeit zugeraten hatte.
Schon immer kam es zu Diebstählen an unserer Schule. Geld, Handys, Jacken oder ganze Schulrucksäcke wechselten ihre halbwüchsigen Schulbesucher, selbstverständlich ohne das Einvernehmen des Beschädigten. Wenige Maßnahmen erwiesen sich als wirkungsvoll gegen die Langfingrigkeit mancher. Ich möchte mich selbst auch nicht herausnehmen, aber tatsächlich gehörte ich ebenso zu den Leidtragenden wie meine Freunde. Eine Herangehensweise zeigte durchaus einen positiven Effekt gegen das plötzliche Verschwinden von kostbaren Gegenständen: Alle Schüler mussten ihre Schultaschen stets in ihren Klassenräumen oder Spinds aufbewahren. Selbst wenn man nach einer Pause zum naturwissenschaftlichen Trakt oder der Sporthalle gehen musste, so galt es stets, seine Schulsachen hinter den abgeschlossenen Klassenzimmern zu deponieren. Unsere Klasse befand sich im Erdgeschoss, sodass man von außen nur durch die dicken Fenstergläser davon abgehalten wurde, einbrechen zu können. Und genau dies wollten wir uns zunutze machen.
Am Donnerstag endete der Schultag mit dem Sportunterricht in der fünften und sechsten Stunde. Nach dem Pausenklingeln ließ uns unserer Sportlehrer Herr Janssen – dieser wird zu einem weiteren Zeitpunkt noch eine bedeutende Rolle spielen – den Raum betreten und rasch unsere Sportsachen herausholen. Bereits vor der Pause gelang es Brecher unbemerkt einen Fenstergriff zu lösen, sodass man das Fenster weit öffnen konnte. Als wir unsere Turnbeutel und Taschen nahmen, blickte ich auf ebenjenes Fenster: Es verharrte in seiner Fensterluke und niemand schien wahrzunehmen, dass es nicht verschlossen war. Demonstrativ langten wir lautstark nach unseren Sportsachen, sodass uns mehrere Mitschüler weit vom Fenster entfernt sahen. Diese kleine Vorbereitung erwies sich als voller Erfolg, da wir nun einen Zugang hatten und uns gleichzeitig gedeckt hatten. Voller Vorfreunde auf das Bevorstehende rannten wir zur Turnhalle und konnten es nicht abwarten, bis wir Adrian Lachzers Gesichtsausdruck nach dem Unterricht zu sehen bekommen würden.
Ein weiteres Instrument, um gegen die Diebstähle vorzugehen, sah das Absperren der Umkleiden vor: Man betrat diese und fand an einem Wandharken den passenden Schlüssel hängen. In der Regel waren es die vertrauenswürdigen Klassensprecher oder einer der anderen Lehrerlieblinge, die den sogenannten Schlüsseldienst hatten und von innen die Tür verschlossen, sodass sich niemand unbemerkt hineinstehlen konnte, und zugleich die Verantwortung trugen. Außerdem garantierte es, dass sich niemand dem Sportunterricht entziehen durfte.
Ich beobachtete in der vergangenen Woche, wie Yasin, der sich zum ersten Mal um diese Aufgabe kümmern durfte, den Schlüssel mit einem Gummiband um seine Trinkflasche band. Offenbar gefiel ihm diese Methode, denn auch an diesem Tag führte er sie aus. Gleichzeitig bemerkte ich jedoch im Unterricht, dass er sich an diese Verpflichtung noch nicht gewöhnt hatte, denn er wirkte immer irritiert, wenn er sich einen Schluck Wasser genehmigte und dann das Klirren des kleinen Metallgegenstandes hörte. Es war im Grunde genommen ein perfekter Zufall für unseren Plan: Würde der Schlüssel bei einem weiteren Male nicht erklingen, wenn er erneut seinen Durst stillte, würde es ihm gar nicht auffallen; dafür war seine neuerliche Tätigkeit noch zu frisch. Ich tat ihm also gewissermaßen einen Gefallen damit, ungestört trinken zu können, und riss das Gummiband samt seinem wertvollen Besitz an mich.
Nun kam der wohl schwierigste Part in unserem wagemutigen Vorhaben: die Ablenkung. Lukas, der mächtig viel angestaute Wut über das vergangene Schuljahr noch in seinen Knochen mitführte, und Brecher waren für diese Aufgabe zuständig. Wir spielten an diesem Tag Volleyball und beide triezten während der Übungen bereits ihre Mitspieler und sorgten wiederholt für Wortgefechte über Nichtigkeiten wie ein unpräzises Zuspiel oder einen schlechten Abschlag. In der zweiten Unterrichtsstunde begannen Freispiele; Brecher befand sich im selben Team wie Fabian, während Lukas und ich jeweils einer anderen Mannschaft angehörten. Glücklicherweise – ein weiterer Wink des Schicksals – war die Anzahl an mitspielenden Schülern so unausgegoren, dass die vier Volleyballteams mindestens drei Auswechselspieler hatten. Ich war mir sicher, dass dadurch unser baldiges Fehlen erst gar nicht bemerkt würde.
In den beiden stattfindenden Spiele nahmen die Verschmähungen durch Brecher und Lukas – du wirfst wie ein geschissenes Huhn! – mit jedem Punktgewinn beziehungsweise -verlust zu und ich konnte deutlich die angespannte Atmosphäre spüren. Es dauerte nicht lange, bis auch meine Freunde mit wütenden Ausrufen und Lächerlichkeiten abgestraft wurden. Nicht nur die Worte, sondern auch die Bälle, die übers Netz geschmettert wurden, waren zunehmend härter, und es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand einen davon abbekommen würde. Christian, der sich nun zum fünften oder sechsten Mal, vielleicht sogar noch häufiger von Lukas gefallen lassen musste, dass seine Mutter einen verschickteren Ball werfen würde, platzte der Kragen und er zielte direkt auf den Jungen, der ihn über die gesamte Zeit verschmähte. Viel zu überrascht von seinem raschen Abschlag landete der Ball direkt in Lukas‘ Gesicht. Nach einem kurzen, verwirrten Aufblinzeln klappte dieser auf der eigenen Bodenhälfte zusammen. Intuitiv wollte Fabian losstürmen und Christian eine Tracht Prügel verpassen, aber ich hielt ihn mit meinen Armen zurück und deutete ihm mit vielsagenden Blicken die Chance, die sich in diesem Moment für uns und unseren Plan ergab. Es wurde sogar noch besser: Anstatt sich zu entschuldigen, rief der Angreifer das aktualisierte Punktergebnis, schaute auf dem am Boden Liegenden und grinste belustigt.
Lukas, der einige Augenblicke benötigte, um sich wieder aufraffen zu können und dem Blut aus der Nase floss, blickte wütend auf den Verursacher seines Schmerzes. Er rannte auf ihn los und stieß ihn zu Boden. Sofort versammelten sich ihre Mannschaften sowie auch die anderen Teams um die beiden Streithähne. Brecher nutzte die Gelegenheit und stachelte die Kämpfenden mit Jubelrufen an, in die die anderen Schüler mit einstiegen, sodass ein regelrechtes Chaos in der Turnhalle ausbrach. Ich wiederum packte mir Fabian und lief in Richtung der Umkleide, die wir mithilfe des Schlüssels verließen und danach wieder von außen verschlossen. Nichts sollte darauf hinweisen, dass sich jemand aus dem Staub machte.
Unser Plan sah vor, bald wieder zurückzukehren; sollte wir dies nicht schaffen, so würden Lukas und Brecher unsere Sportsachen mitnehmen und hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Abwesenheit niemanden auffiele. Der nette Nebeneffekt wäre zudem die Bestrafung Yasins, weil er seine Aufgabe als Schlüsselträger ganz offensichtlich vernachlässigte, denn man würde bei unserem Fehlen den Schlüssel nicht auffinden können. Trotzdem wollten wir natürlich wieder zurück sein, um nicht als Schuldige für unser Vorhaben erwischt oder zumindest vermutet zu werden.
Wir schlichen uns von der Turnhalle um das Schulgebäude herum und beobachteten durch die großen Fenster, ob die Hausmeisterei besetzt war. Natürlich gab es keinerlei Anzeichen für den Verbleib von Joachim Kässler, der sich erfahrungsgemäß vor seinen eigentlichen Pflichten so sehr scheute wie der Antichrist vor dem Vaterunser. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie oft Schüler zu ihm hingeschickt wurden, um Schäden an Tafeln, defekte Leuchten oder abgerissene Vorhängen zu melden, aber vor verschlossenen Türen ausharren mussten, bis sie es aufgaben und mit gesenkten Köpfen zurück in ihre Klassen kehrten. Unser Glück schien an diesem Tag nicht enden zu wollen. Ich fühlte mich wie ein Roulettespieler, der stets seinen ganzen Einsatz von einer Runde auf die nächste setzte und einen immer größeren Gewinn einfuhr.
Da es mitten in der Unterrichtszeit war, trafen Fabian und ich auf niemanden auf dem Pausengelände. Bald erreichten wir die Rückseite des Gebäudes, von wo aus wir unseren Klassenraum erblickten. Vorsichtig näherte ich mich dem Fenster und hoffte, dass nicht doch irgendjemand den lösen Fenstergriff bemerkt und ins Schloss eingerastet hatte. Ich lehnte mich gegen das Glas und augenblicklich ließ es sich von außen öffnen. Ein leiser triumphaler Ausruf entlockte sich aus Fabians Lippen und bald darauf standen wir im Inneren unseres Klassenzimmers.