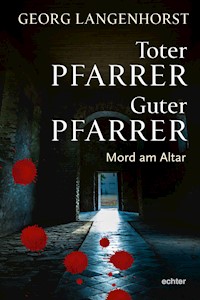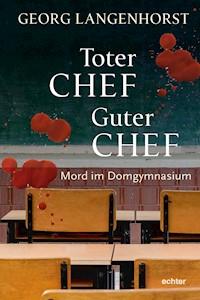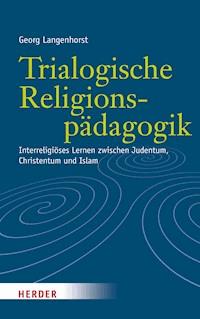Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum bringt jemand eine fast 90-Jährige um? Ging es um Geld? Oder waren Wut oder Eifersucht die Gründe für den Mord? Vor diesen Fragen steht Kommissar Bernd Kellert in seinem sechsten Fall. Seine Frau findet ihre Tante Regina Föhrenbach tot im Seniorenstift auf. Es muss Mord gewesen sein. Regina ist lateinisch und bedeutet auf Deutsch "Königin". Und genauso wurde die Tante auch im katholischen St. Vinzenzstift wahrgenommen – selbstbewusst, reich und bestimmend. Und wie an einem echten Königshof gibt es auch dort ergebene Anhänger, Feinde, Intrigen und jede Men-ge Motive. Kellert steht vor einer schweren Aufgabe. Wer ist der Mörder der "Königin"?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Langenhorst
Tote Tante – gute Tante
Mord im Seniorenstift
Kriminalroman
Georg Langenhorst
Tote Tante – gute Tante
Mord im Seniorenstift
Kriminalroman
GewidmetElli, Helmut und Anita
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären reiner Zufall und sind auf keinen Fall intendiert. Auch unmittelbare Bezüge zu real existierenden Institutionen oder Orten entbehren jeglicher Absicht
Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei diesem Buch auf die Folienverpackung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2023
© 2023 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: wunderlichundweigand.de
Coverfoto: shutterstock, Inc.
Satz: Crossmediabureau, Gerolzhofen
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05843-2 (Print)
978-3-429-05243-0 (PDF)
978-3-429-06593-5 (ePub)
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Folgende Personen treten auf
Christine Balderschwang, Chefpflegerin
Olenka Bolnarenko, Altenpflegerin
Elmar Maria Brandtstätter, Professor für Pastoraltheologie
Holger Brechtken, Stationspfleger
Gisbert Cornelius, Senior
Peter Föhrenbach, Manager
Regina Föhrenbach, Seniorin
Dr. Kerstin Gläser, Ärztin
Georg Hemlein, Senior
Bernd Kellert, Kriminalhauptkommissar
Beate Kellert, Steuerfachfrau
Gerda Lohkemper, Seniorin
Schwester Luitgard, Franziskanerin
Hannah Mellrich, Kriminalkommissarin
Luise Platzheimer, Seniorin
Imogen Schmelter, Leiterin des St. Vinzenzstifts in Friedensberg
Siegfried Spieker, Senior
Josefine ‚Fini‘ Vatheuer, Seniorin
und viele mehr
1.
„Dreimal bin ich dem Tod von der Schippe gesprungen, dreimal!“ Der alte Herr ließ sich einfach nicht abschütteln. Seine rechte Hand krallte sich an Beate Kellerts linkem Unterarm fest. Er sprach mit drängender und heiserer Stimme auf sie ein, kam ihr viel zu nahe. ‚Hartmann heißt der!‘, glaubte Beate Kellert sich zu erinnern. Sie hatte ihn schon mehrfach hier gesehen. Vor Jahren hatte er sich ihr mit Namen vorgestellt. Damals war er noch ganz normal gewesen. Noch nicht dement. Er wohnte auf derselben Etage wie ihre Tante Ina, wenn auch auf einem anderen Gang des St. Vinzenz-Seniorenstifts.
„Dreimal!“, wiederholte der Alte. „Das erste Mal, da war ich zehn. Im letzten Kriegsjahr war das. Da wäre ich fast von einem Viehtransporter überrollt worden. Im letzten Moment hat mich mein Vater von der Fahrbahn gerissen. Aber eigentlich war es ein Engel. Das weiß ich genau. Ein Engel!“
‚Ich muss das jetzt hier beenden, sonst komme ich nie zu Tante Ina. Die wartet bestimmt schon!‘, ging es Beate Kellert durch den Kopf. Mit der freien Hand löste sie den erstaunlich kräftigen Griff des Alten und redete ihn freundlich, aber bestimmt an: „Das erzählen Sie mir ein anderes Mal, Herr Hartmann. Ich muss jetzt zu meiner Tante. Regina Föhrenbach, die kennen Sie doch!“
Der Alte blickte sie verwundert an, nickte langsam, drehte sich um und schlurfte in die andere Richtung des orangegrün gestrichenen Flurs. Zweimal im Monat, immer an einem Dienstagnachmittag, besuchte Beate Kellert ihre Tante. Sie mochten sich gegenseitig nicht besonders und wussten das auch. Aber Tante Ina war die letzte Verwandte in der Generation ihrer Eltern und Schwiegereltern, die noch lebte. Da kümmerte man sich.
Inas eigene Kinder wohnten weit weg. Beate hatte kaum Kontakt zu ihren Cousins und Cousinen. Der Älteste, Peter, war nach Amerika ausgewandert und betrieb in der Nähe von Washington eine Mercedes-Filiale. Seine Schwester, Christiane, lebte in Hamburg und hatte dort einen gut bezahlten Job in der Versicherungsbranche. Keiner der beiden hatte Zeit und Lust, sich um die Mutter im fernen Friedensberg zu kümmern.
Beate Kellert holte die Schachtel Mon Chéri aus ihrer Handtasche, die sie jedes Mal als kleines Geschenk mitbrachte. Die liebte ihre Tante, das wusste sie. Warum also die Mühe auf sich nehmen, sich immer etwas Neues auszudenken? Nein, das passte so. Der Rhythmus der Besuche und der streng ritualisierte Ablauf. Ina, eigentlich Regina, war achtundachtzig. Noch völlig klar im Kopf, soweit ihre Nichte das beurteilen konnte, aber eigen. Sie bestimmte, was wann und wie abzulaufen hatte. Das war schon immer so gewesen. So lange Beates Erinnerungen zurückreichten.
Das St. Vinzenzstift galt in Friedensberg als ausgezeichnete Adresse. ‚Das Vinzenz‘, wie man hier sagte. Früher von Vinzentinerinnen geleitet, aber der Orden hatte seine Niederlassung schon in den 1970er Jahren aufgegeben. Immer weniger Frauen entschieden sich für den Lebensweg als Nonne, was blieb der Ordensleitung also schon für eine Alternative? Das Bistum hatte damals die Einrichtung übernommen und verfügte bis heute über den überwiegenden Anteil an Aktien im inzwischen freien Trägerverein.
Teuer war es, ‚das Vinzenz‘, aber das konnte sich Ina und das konnten sich ihre Kinder problemlos leisten. Gut geführt. Bemüht um den etablierten Ruf. Beates eigene Eltern hätten ihren Lebensabend in dieser Einrichtung nicht finanzieren können. Aber sie waren im Abstand von drei Jahren zu Hause gestorben. Wie sie es sich gewünscht hatten.
Auf jeder Seite des breiten, teppichbodengedämpften Flurs befanden sich vier großzügig geschnittene Appartements. Neben den Zugangstüren war ein normiertes, kupferfarbenes Schild angebracht, auf dem der Name der jeweiligen Bewohner eingraviert war. Dritte Tür rechts: „Regina Föhrenbach“.
Jeder nannte sie ‚Ina‘, aber der offizielle Name war nun einmal Regina. ‚Regina‘, die ‚Königin‘. ‚Ja, das passt‘, dachte Beate immer wieder, wenn ihr Blick auf dieses Namensschild fiel. Sie klopfte, wartete einen kurzen Moment, trat dann aber ein, ohne auf eine Reaktion der mehr und mehr schwerhörig werdenden Bewohnerin zu warten. So war es üblich.
„Hallo, Tante Ina!“, rief sie in den großzügig bemessenen Wohnraum hinein, bevor sie sich dort nach der Angesprochenen umsah. ‚Nanu, kein Kaffeeduft?‘, wunderte sie sich, ohne diesen Gedanken ganz präzise denken zu müssen. Normalerweise war der Tisch stilvoll eingedeckt, mit Kaffeetassen und einer passenden Porzellanplatte mit kleinen Gebäckstückchen, die sich ihre Tante vom Bring-Service des Stifts nach peniblen Anweisungen kommen ließ.
Nichts. Auch ihre Tante war nirgends zu sehen. War sie im Haus unterwegs? Hatte sie den fest ausgemachten Besuchstermin vergessen? Beides sah ihr nicht ähnlich. Überhaupt nicht. „Tante Ina?“, fragte Beate Kellert mit übertrieben kräftiger Stimme. Die Tür zum Schlafzimmer war angelehnt. Beate ging hinüber, zog die Tür an der Klinke zu sich, begab sich vorsichtig in den von ihr normalerweise nicht betretenen Raum und wiederholte: „Tante I …?“.
Der Rest blieb ihr im Halse stecken. Das, was sie sah, war so absurd, dass sie verstummte. Ihre Augen weiteten sich. Ihre Tante lag in voller Kleidung auf dem ungemachten Bett, das schwere Federkissen hing umgeschlagen über den hinteren Rand des Gestells. Ihr unnatürlich bleiches Gesicht war erfroren zu einer Fratze. Die schreckgeweiteten Augen starrten an die Decke. Um den Hals hatte sie einen ihrer Seidenschals gebunden. Das tat sie gern.
Dieses Mal aber war der Schal zu einem Strick zusammengedreht. Mit aller Gewalt. Er hatte ihr die Atemluft abgeschnürt. Tante Ina war tot. Das war Beate Kellert sofort klar. Immerhin war sie die Ehefrau eines Kriminalkommissars, der die ortsansässige Mordkommission leitete. Sie hatte sich erstaunlich gut im Griff. Keine Panik. Aber was sollte sie tun? Doch noch nach Lebenszeichen suchen, und dann Hilfe leisten? Oder nichts Derartiges tun, keine Spuren verwischen, ihren Mann anrufen, den Profis das Feld überlassen?
Sie blickte noch einmal auf ihre Tante. Kein Zweifel, die alte Dame lebte nicht mehr. Sie zückte ihr Handy, wählte die Dienstnummer ihres Mannes, schilderte ihm in hastigen Worten, was passiert war, steckte das Telefon weg, ging in das Wohnzimmer hinüber, setzte sich in einen der zwei Sessel, legte den Kopf in die Hände und begann dann, erst jetzt, hemmungslos zu weinen.
2.
„Wann haben Sie die Frau Föhrenbach denn zum letzten Mal gesehen?“, fragte Kriminalkommissar Bernd Kellert die ihm gegenübersitzende Leiterin des St. Vinzenzstifts, Imogen Schmelter. Er hatte seine Frau in den Arm genommen und zu beruhigen versucht. Erfolgreich. Sie hatte ihn mit knappen Worten über das Vorgefallene informiert. Beate Kellert stand unter Schock, soviel war klar, behauptete jedoch, fahrtüchtig zu sein. Sie wollte nach Hause. Weg von hier. Mit den Worten „Wir sprechen uns später, ja?“ hatte er sie aus dem Stift begleitet und war schnell umgekehrt, um so bald wie möglich weitere Einblicke in das Geschehen gewinnen zu können.
Nun saß der Kommissar also der Leiterin des Seniorenstifts gegenüber. Die Mitte Vierzigjährige – schlank, in einem eng anliegenden, dunkelblau gestalteten Kostüm, brünett mit halblangem, glattem, akkurat frisiertem Haar – rückte ihre randlose Brille zurecht, blickte ihn aufmerksam an und antwortete dann in sehr korrektem Hochdeutsch mit leicht norddeutschem Einschlag: „Ich selbst habe Frau Föhrenbach gestern tagsüber gar nicht gesehen, da war ich nämlich ganztägig außer Haus, bis heute Mittag. Bei einer Konferenz unseres Trägervereins in Ingolstadt.“
„Das heißt …“, warf der Achtundfünfzigjährige ein, wurde aber von der Leiterin des Seniorenheims unterbrochen. Sie wirkte erstaunlich gefasst. ‚Gut, in einer Einrichtung wie dieser hat man ständig mit Tod und Sterben zu tun‘, überlegte Kellert. ‚Aber doch nicht mit Mord!‘, wunderte er sich. ‚Ist sie so abgebrüht, wie sie tut, oder spielt sie ihre professionelle Rolle einfach perfekt?‘
„Das heißt, dass ich sie wohl am Sonntagabend beim Abendessen zum letzten Mal gesehen haben werde“, erklärte die Leiterin des Stifts, ohne ihren Tonfall zu ändern. „Ich schaue dort abends immer vorbei und suche das Gespräch mit unseren Klienten. So nennen wir unsere Bewohner. Das schaffe ich natürlich nur, wenn ich nicht auswärts unterwegs bin“, ergänzte sie, während sie erneut an ihrer Brille nestelte.
Ihr Blick ließ keinen Zweifel daran, dass sie noch weitersprechen würde. „Allerdings habe ich keine besondere Erinnerung daran, ob ich am Sonntag mit ihr, also mit Frau Föhrenbach, überhaupt einige Worte gewechselt habe. Das kommt vor. Manchmal verlangt ein anderer Klient nach besonderer Aufmerksamkeit. Oder – wie in diesem Fall–eine Klientin. Frau Wertinger. Aber das tut hier nichts zur Sache. Wenn Frau Föhrenbach gefehlt hätte, wäre mir das aufgefallen. Da bin ich mir absolut sicher. Sie ist … äh, sie war eine Person, die sich bemerkbar machte. Gegebenenfalls eben auch durch ihr Fehlen.“
„Aber …“, wollte Kellert einwerfen, doch erneut kam er nicht zu Wort. ‚Ist mir auch recht, lass sie reden!‘, ging es dem erfahrenen Kriminalisten durch den Kopf. „Ich habe vorhin sofort meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen lassen. Der zuständige Stationspfleger, Holger Brechtken, hat Frau Föhrenbach heute Mittag nach dem Essen im Speisesaal auf ihr Zimmer begleitet. Kurz nach dreizehn Uhr. Er war wohl der letzte Angestellte des Stifts, der sie lebend gesehen hat.“
„Und den werde ich natürlich sobald wie möglich zu sprechen haben“, meldete sich der Kommissar nun doch erfolgreich zu Wort, um im gleichen Atemzug nachzufragen: „War das denn normal, dass Frau Föhrenbach sich um diese Zeit auf ihr Zimmer zurückzog?“
Imogen Schmelter lächelte undurchschaubar vor sich hin. „Sie sollten sich das so vorstellen“, begann sie, unterbrach sich aber gleich wieder. „Sie sind entfernt mit ihr verwandt, oder? Darf ich also ganz offen sprechen?“ Kellert hob die Lider, blickte ihr in die meerblauen Augen und sprach: „Selbstverständlich, ich bitte sogar darum. Und ja, Frau Föhrenbach war eine Tante meiner Frau. Ich selbst hatte aber nur wenig Kontakt zu ihr.“
„Nun, die Tante Ihrer Frau war schon eine besondere Person. Sie trug ihren Namen nicht zu Unrecht, Regina, die Königin. Sie hatte eine Art – wie sage ich das jetzt? – des Residierens entwickelt. Sie empfing andere Heimbewohner oder auch Angestellte des Hauses in ihrem Zimmer. Sie ‚gab sich die Ehre‘, so bezeichnete sie das. Und irgendwie hatten sich alle auf diese Spielregeln eingestellt. Warum nicht? So war nun einmal ihre Art. Und wenn sie ihr ‚Gemach‘ verließ, war sie stets in Begleitung. Von ihrem ‚Hofstaat‘. So wirkte das.“
Verständnis heischend blickte die Leiterin des Seniorenstifts zu ihrem Gast, der sich freilich nicht als ‚Gast‘ fühlte, sondern als Vertreter der Ordnungsmacht. Des Staates. Als zuständiger Kommissar, der einen Mord aufzuklären hatte. Denn das hatten die ersten Ergebnisse der Kriminaltechnik und der Spurensicherung sofort erwiesen: Regina Föhrenbach war umgebracht worden. Mit ihrem eigenen Seidenschal erdrosselt.
Die Polizei war sehr schnell am Tatort eingetroffen, schließlich waren die Wege in der mittelalterlich geprägten Bischofsstadt Friedensberg kurz. Kellert hatte einige seiner Mitarbeiterinnen sofort dazu eingeteilt, einerseits für Ruhe im St. Vinzenzstift zu sorgen, andererseits wach und aufmerksam zu sein für alle Informationen, die ihnen später nützlich werden könnten.
Die Leiterin wartete auf seine Reaktion. Er war gedanklich kurz abgeschweift und riss sich wieder zusammen: „Ja, so ähnlich hat meine Frau mir das auch immer erzählt“, antwortete er jetzt. „Was meine Lust daran, sie zu diesen Besuchen bei ihrer Tante zu begleiten, nicht gerade befördert hat“, fügte er hinzu, ärgerte sich aber sofort darüber, etwas Privates preisgegeben zu haben. Das gehörte nicht hierher!
Rasch setzte er hinzu: „Und? Wer war das, ihr ‚Hofstaat‘, wie Sie das genannt haben?“ Imogen Schmelter musterte den immer noch sportlich wirkenden Polizisten vor ihr mit professionellem Blick. Dessen kurzgeschorenes, lückenlos wachsendes graues Haar gab ihm einen Hauch von George Clooney – wie seine Frau Beate immer wieder sagte. Aber sie lächelte dabei auf eine Art, die ihm nur zum Teil gefiel.
An der Miene der Leiterin des St. Vinzenzstifts ließ sich nicht ablesen, was sie dachte. „Das wechselte“, gab sie zurück. „Regina wusste es, ihre Gunst oder Ungunst zu verteilen. So, dass ihre Rolle unantastbar blieb. Meistens waren das Luise Platzheimer und Fini Vatheuer, die drei kannten sich schon seit Ewigkeiten.“
Sie unterbrach sich. „Fini, das sagen alle. Eigentlich heißt die gute Frau Vatheuer Josefine. Aber niemand, wirklich niemand nennt sie so. Jedenfalls: Deshalb haben die drei Damen ja auch benachbarte Zimmer auf demselben Flur bezogen. Die Bekanntschaft ging schon weit zurück, in jedem Fall in die Zeit vor ihrem Einzug bei uns. Ach, was sage ich denn da? Schon seit Schultagen kannten sie sich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber, wie gesagt, Regina Föhrenbachs Gunst konnte wechseln.“
Kellert versuchte die Informationen zu einem inneren Bild zusammenzufügen, wurde aber nach einer kurzen Pause unterbrochen. „Verstehen Sie mich bitte richtig“, ergänzte die Heimleiterin. „Ich mochte sie, die Ina. Die Regina. Sie konnte äußerst charmant sein, klug, witzig, intelligent. Auf ihre Art eben. Eine Frau von Welt, wenn ich das so sagen darf.“
Sie lächelte erneut schwer deutbar vor sich hin. „Und sie hat uns, der Leitung des Stifts, enorm geholfen. Intuitiv erkannte sie Spannungen unter den Klienten und konnte sie beruhigen. Sie hatte ein großes Interesse daran, dass das Zusammenleben friedlich und kultiviert vonstatten ging. Sie sah sich fast als eine von uns, den Verantwortlichen, verstehen Sie?“
„Höre ich da ein ‚Aber‘?“, warf Kellert ein. Imogen Schmelter nickte. „Ja, schon“, gab sie zu. „Es sollte halt durchaus nach ihren Vorstellungen laufen“, erläuterte sie. „Sie stand – oder besser: saß – gern selbst im Mittelpunkt des Geschehens. Und der Bewunderung. Ja, darauf hat sie schon geachtet, die Ina.“
Der Kommissar und die Leiterin der Seniorenresidenz schauten sich eine Weile schweigend an. Sie saßen im repräsentativen Büro der Chefin, das Eleganz, Chic und Stil ausstrahlte. Das St. Vinzenzstift wollte sich Besuchenden von vornherein als bessere Adresse präsentieren. Danach wählte man die Innenausstattung aus. Auch die Bewohner. Erst recht die Angestellten, allen voran die Leiterin.
Die fühlte sich taxiert. Und antwortete, ohne gefragt zu werden. „Seit acht Jahren leite ich dieses Stift, falls Sie das wissen wollen, Herr Kommissar. Und das sehr erfolgreich, wenn Sie mir dieses Selbstlob gestatten. Wir schreiben durchgängig schwarze Zahlen. Und können uns vor Anfragen nicht retten. Friedensberg könnte problemlos drei Institutionen unserer Art vertragen. Wobei der gute, ach was: der exzellente Ruf unser Markenzeichen ist.“
Sie lachte kurz und humorlos. „Das alles können Sie nachlesen und das werden sie überall bestätigt bekommen. Umso mehr bitte ich Sie, alles dafür zu tun, dass diese Angelegenheit“ – sie wies in die Richtung des Zimmers von Regina Föhrenbach – „diesem guten Ruf nicht schadet. Ich werde Sie bei allem unterstützen, so gut ich es vermag. Das kann ich Ihnen versprechen.“
Kellert kannte das schon. Wo immer er zu ermitteln hatte, wurde er um Diskretion gebeten. Zur Wahrung des ‚guten Rufes‘. Um Verschwiegenheit, soweit dies möglich war. Nicht immer hielt er sich an diese Vorgaben. Manchmal konnte er es nicht, manchmal wollte er es nicht. Inzwischen versprach er also gar nicht erst, diese Bitte zu erfüllen.
„Das wäre natürlich wunderbar“, war alles, was er antwortete. „Dann würde ich als Erstes gern diesen Pfleger sprechen, der Frau Föhrenbach zuletzt gesehen hat, diesen …“ – er suchte nach dem Namen – „Holger Brechtken?“, half ihm die Leiterin aus. Er nickte. „Wollen Sie gleich hier mit ihm sprechen?“, bot die Leiterin des Stifts an. „Gern!“, erwiderte Kellert, überrascht, dass ihm dieses Angebot gemacht wurde. Er nahm es gern an.
3.
„Wissen Sie, was ich an unseren Klienten so mag?“ Holger Brechtken beugte sich vertraulich zu dem ihm gegenübersitzenden Kommissar hinüber. „Die Alten, das sind immer die anderen“, beantwortete er sich die selbst gestellte Frage sofort. „Egal, wie alt sie persönlich sind. Reden von den Alten und rechnen sich selbst nicht dazu. Sehen sich selbst als irgendwie nicht dazugehörig. Als jünger. Und fitter. Das ist wie ein Selbstschutz. Das finde ich cool. Das hat etwas von …“ – er suchte nach Worten – „Würde. Ja, genau. Von Würde!“
Der vielleicht dreißigjährige Pfleger wog deutlich mehr als einhundert Kilo. Er hatte das lange rote Haar zu einem Zopf nach hinten gebunden und trug seine ganz in Weiß gehaltene Berufskleidung sichtlich mit Stolz. „Holger Brechtken“ war in stilisierter Schreibschrift rechts oberhalb der Brusttasche mit dunkelblauem Faden eingestickt worden. Er wirkte massig, aber eher kräftig als korpulent. ‚Wenn es hier etwas zu tragen und zu stemmen oder zu halten gibt, ist er bestimmt der Richtige‘, dachte Bernd Kellert. ‚Oder zu schlichten‘, fiel ihm dann zusätzlich ein.
„Und noch etwas mag ich an meinem Beruf“, gab der Pfleger ungefragt von sich. „Viele ältere Menschen tun sich schwer mit dem Älterwerden, weiß man ja. Kann man auch verstehen. Die müssen immer mehr Einschränkungen ertragen: Der Bewegungskreis wird ständig kleiner. Der Mann oder die Frau, aber auch Freunde sterben und hinterlassen eine große Lücke. Der eigene Körper wird mehr und mehr zum Problem, die geistigen Fähigkeiten lassen nach … Puh, echt nicht leicht zu ertragen, das Ganze.“
„Und das mögen Sie an Ihrem Beruf?“, unterbrach Kellert, der nicht so recht verstand, worauf Holger Brechtken hinauswollte. „Nee, das natürlich nicht!“ Der Pfleger grinste und schüttelte den Kopf. „Das habe ich nur erwähnt, weil es eben der Normalfall ist. Kann man ja verstehen, dass da einige depressiv werden. Passiv. Den Lebensmut verlieren.“
Seine Mimik unterstützte das Gesagte. Gerade hatte sein Gesicht noch vollkommen zerknirscht gewirkt, nun hellten sich seine Züge auf. „Gibt eben auch andere, das wollte ich eigentlich sagen. Die achten nicht immer nur darauf, was nicht mehr geht, sondern darauf, was noch möglich ist. Was ihnen bleibt. Was das Leben trotz allem schön macht. Bei allen Einschränkungen. Vor denen habe ich Respekt! Von denen versuche ich zu lernen. Die imponieren mir.“
„Hm, aber das kann man sich doch nicht aussuchen“, versuchte Bernd Kellert sich in den Gedankengang einzudenken. „Das kann man ja nicht einfach frei wählen. Das ist doch eine Typenfrage, wie man damit umgeht, oder nicht?“ Sein Gegenüber nickte heftig und stimmte ihm zu: „Ja, schon. Hängt natürlich von den ganz konkreten Umständen ab. Was man alles zu ertragen hat. Das ist ja bei jedem anders. Und trotzdem: Wenn du das mitkriegst, wie manche ihr Leben hier im Vinzenz gestalten: das ist schon großartig. Das erlebst du anderswo nicht.“
Kellert bewunderte die Begeisterung des Pflegers für seinen Beruf und sein Urteil über die Menschen, mit denen er tagtäglich hier zu tun hatte. ‚Sicherlich ist das nicht leicht, ständig Menschen in dieser schwierigen Phase zu begleiten‘, dachte er. ‚Schön, wenn er das mit so viel Elan tut.‘ Er selbst fühlte in Senioreneinrichtungen immer eine gewisse Beklemmung. Stellte sich immer vor, dass er selbst vielleicht später ja auch mal so wohnen würde. Wohnen müsste.
„Wie lange arbeiten Sie eigentlich schon hier?“, lenkte er das Gespräch in die Richtung, die für ihn in professioneller Hinsicht wichtiger war. „Moment!“ Sein Gegenüber lehnte sich zurück, sodass der Sessel im Besucherzimmer neben der Rezeption ein unangenehmes Quietschen von sich gab. Das der Pfleger aber überhörte. Der Kommissar nicht.
Brechtken runzelte die Stirn, strich sich eine widerspenstige Strähne des rötlichen Haares hinter das Ohr und antwortete dann mit seiner erstaunlich hohen Stimme, die man bei einem solchen Koloss nicht erwartet hätte. „Werden jetzt bald sechs Jahre. Nach der Ausbildung war ich erst zwei Jahre in München. Coole Stadt. Aber kannst du natürlich nicht bezahlen, mit meinem Gehalt. War ich also froh, dass das im ‚Vinzenz‘ geklappt hat. Eine feine Adresse. Kannste nicht meckern.“
„Und die Frau Föhrenbach“, setzte Kellert nach, „war die damals schon hier, als Sie anfingen?“ „Da fragen Sie mich was!“, entgegnete der Pfleger. „Warten Sie mal!“ Wieder schob er die Strähne zurück, sie hatte sich sofort wieder gelöst. „Ich war damals zuerst auf einer anderen Station“, erinnerte er sich dann mühsam. Seine Sprache folgte dem Denken mit leichter Verzögerung. „Bin jetzt seit vier Jahren auf der C“. Das gab er so selbstverständlich von sich, als müsste der Kommissar doch wissen, was ‚die C‘ ist. Mühsam tauchte Brechtken Schicht um Schicht tiefer in seine Erinnerung hinab. „Ja klar, da war sie natürlich schon da, die Ina.“
‚Aha, er nennt sie auch beim Vornamen‘, notierte sich der Kommissar innerlich. „Ach Quatsch!“, brach es nun aus dem Pfleger heraus, und er klopfte sich mit der mächtigen rechten Handfläche auf den noch viel mächtigeren rechten Oberschenkel. „Wie blöd bin ich denn? Natürlich war sie da. Von Anfang an. War doch die ‚Königin‘, wie alle sagten. Klar, habe ich nur gerade vergessen.“
„Die Königin?“, hakte Kellert nach. „Wie meinen Sie das?“ Über Brechtkens Gesicht zog sich ein breites Grinsen. „Na, so hieß die doch, Regina. Ist Lateinisch für ‚die Königin‘. Hat man mir sofort erklärt, damals. Und so war die auch. Irgendwie überlegen. Anders als die anderen. Wenn die was von dir wollte, die Königin, hast du das auch gemacht. Und wolltest dann auch von ihr gelobt werden. So war das.“ Er nickte heftig vor sich hin.
„Und heute Mittag?“, lenkte Kellert das Gespräch auf den unmittelbaren Anlass des Gesprächs. „Da haben Sie sie als Letzter lebend gesehen. Ist das richtig?“ Erschrocken hielt der Pfleger inne. Seine Augen weiteten sich. „Stimmt!“, entwich es ihm. „Verdammt nochmal: Da könnten Sie recht haben!“ Aber dann schlug er mit der rechten Handfläche auf die Tischplatte. Ein lauter Knall, der Kellert zusammenzucken ließ. „Nee, Unsinn“, rief Brechtken deutlich lauter als zuvor. „Dann hätte ich sie ja umgebracht! Als Letzter hat sie der Typ gesehen, der sie getötet hat. Oder?“
Kellert nickte. Der mächtige Mann vor ihm atmete heftig aus und ließ sich wieder rückwärts gegen die gepolsterte Lehne seines Sessels fallen. Der Kommissar beobachtete ihn mit nur angedeutetem Lächeln. „Aber Sie haben Frau Föhrenbach nach dem Mittagessen auf ihr Zimmer gebracht, das stimmt doch, oder?“ fragte er nun zurück. Der Pfleger brauchte einen kurzen Moment, um sich auf eine Antwort zu besinnen. „Ach, was heißt schon ‚gebracht?‘“, gab er mit nachdenklicher Stimme zurück. „Die musstest du nicht ‚bringen‘, die Ina. Die war doch noch vollkommen fit.“
„Aber?“, warf Kellert ein. „Tja“, Brechtken rutschte auf seinem Sessel hin und her, soweit dessen Breite es zuließ, „war eben so üblich. Die …“, er suchte nach Worten. „Die ließ sich begleiten. Kann man vielleicht sagen. Entweder durch eine ihrer Freundinnen, also hier aus dem Haus. Oder eben von uns. Jetzt, wo Sie mich fragen: Die ging eigentlich nie allein. War nun einmal so. ‚Ina und ihr Gefolge‘, lästerten wir immer. Waren aber oft genug selbst Teil davon. Aber verstehen Sie?“ Er blickte den Kommissar nun direkt an. „Das tat man gern. Da fühlte man sich gut, irgendwie.“
‚Interessant‘, überlegte Kellert. ‚Die Tante Ina! Das hätte ich der gar nicht zugetraut. Aber naja: Ich kannte sie ja nicht besonders gut. Habe mich immer ein bisschen zurückgehalten. Vielleicht habe ich gespürt, dass mir das nicht gepasst hätte.‘ Er riss sich zusammen und konzentrierte sich wieder auf das Gespräch. „Und dann haben Sie die Ina“ – er benutzte nun auch deren gebräuchliche Anrede – „an ihrer Tür verabschiedet?“ „Nee, nee“, schüttelte der Pfleger den Kopf. „So lief das nicht. Von wegen: Ich hätte sie verabschiedet!? Sie winkt mit der Hand. Du bist entlassen und gehst. So ungefähr.“
Er verzog das Gesicht zu einer schwer deutbaren Grimasse. „Hört sich komisch an, wenn man die nicht kannte, die Ina. Kann ich mir vorstellen. Aber so war das nun mal.“ Kellert wollte einwerfen, dass er Regina Föhrenbach ja durchaus gekannt hatte, ließ es dann aber sein. Das war hier nicht von Belang.
Und der Pfleger sprach weiter. „Danach habe ich sie jedenfalls nicht mehr gesehen, die Ina. Das war aber auch ganz normal. Erst hielt sie ein Mittagsschläfchen. Und dann empfing die nachmittags gern Besuch. Kam aber nur ab und zu selbst vor dem Abendessen aus ihrem Zimmer raus. So war das!“
Nachdem Kommissar Kellert den Pfleger wieder zu seiner täglichen Arbeit entlassen hatte, beriet er sich mit seiner Mitarbeiterin, Kommissarin Hannah Mellrich. Sie beide bildeten seit drei Jahren ein gutes Gespann. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte sich Kellert daran gewöhnt, die achtundzwanzig Jahre Jüngere zu duzen. Hannah Mellrich fiel das umgekehrt immer noch schwer. Kellert war ihr Chef. Und in der Anfangsphase für den Abschluss ihrer Ausbildung zuständig gewesen. Deswegen vermied sie meistens die direkte Anrede mit Namen.
„Und, Hannah, wie laufen die Ermittlungen?“ Seine Mitarbeiterin hob die rechte Hand. Sie blickte auf die Daten in ihrem Smartphone. „Nicht so einfach, Chef. Der medizinische Befund ist da. Wie erwartet: Tod durch Ersticken. Zeitpunkt zwischen zwölf Uhr dreißig und dreizehn Uhr dreißig. Frau Doktor Blume war sich da vollkommen sicher. Soweit das Einfache.“ Die Kommissarin strich sich durch das kurzgeschnittene blonde Haar. Wie gewöhnlich versuchte sie sich optisch möglichst dezent zu kleiden und zu stylen. Sie trug einen unauffälligen Hosenanzug.
Sachlich und ruhig referierte sie den Stand: „Die Kollegen von der Spurensicherung sind leider weniger zufrieden. Mindestens dreißig verschiedene Fingerabdrücke haben sie in den Räumen der Toten schon identifiziert. Das verheißt wenig Hilfreiches für uns. Und die Befragungen der Heimbewohner“ – „Stiftsbewohner!“, unterbrach Kellert, ärgerte sich aber sofort über seine völlig unnötige Unterbrechung; seine Mitarbeiterin sprach jedoch einfach über seinen Einwand hinweg weiter – „gestalten sich als ausgesprochen schwierig.“
Nun sah sie ihren Vorgesetzten aber doch an, als erwartete sie einen Kommentar. Er tat ihr den Gefallen. „Wieso das?“ „Nun ja, viele der älteren Herrschaften hören nicht mehr so gut, da musst du laut und langsam sprechen und eine ebensolche Antwort abwarten. Andere sind schon ein bisschen dement und verstehen kaum, was wir von ihnen wollen. Aber wir sind mit drei weiteren Kolleginnen hier. Die machen das schon. Es wird halt noch dauern. Und ob wir danach schlauer sind, muss man abwarten.“
„Hm“, Kellert strich sich übers Kinn und ließ seinen Gedanken freien Lauf. „Aber es kommt doch eigentlich nur jemand als Täterin oder Täter in Betracht, der entweder hier im Stift wohnt oder sich leicht Zugang dazu verschaffen kann. Der nicht auffällt. Oder die, die nicht auffällt.“ Hannah Mellrich musste innerlich grinsen. ‚Okay, in Bezug auf das Gendern habe ich den Chef inzwischen ganz gut erzogen‘, dachte sie.
„Dafür spricht einiges“, stimmte sie ihm zu. „Aber leider hat das Stift insgesamt fünfundsiebzig Bewohnerinnen und Bewohner, und dazu kommen noch um die dreißig Beschäftigte, wenn man alle mitzählt. Das macht es uns nicht gerade leicht.“
„Stimmt auch wieder“, knurrte Kellert vor sich hin. „Dann sollten wir uns doch fragen: Warum? Warum bringt irgendjemand eine knapp Neunzigjährige um? Ging es um Geld? Wer profitiert von ihrem Tod? Oder ging es um Aggression und Wut? Worüber? Ging es um Gefühle wie Missachtung, Zurückweisung oder Eifersucht? Die Ina war ja wohl eine Art Alpha-Tier. Hatte den Laden hier ganz gut im Griff. Da gibt es Günstlinge, aber eben auch einige, die sich benachteiligt fühlen. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.“
Er überlegte. „Ist eigentlich irgendetwas gestohlen worden?“, fragte er seine Mitarbeiterin dann. „Oder können wir Raubmord ausschließen?“ Kellert hatte das Zimmer der Toten als sehr aufgeräumt und ordentlich in Erinnerung, irgendwie friedlich. Derartige Tatorte hatte er in seinen langen Jahren als Leiter der Mordkommission von Friedensberg nur selten zu Gesicht bekommen.
„Das habe ich Frau Schmelter auch sofort gefragt“, entgegnete die Kommissarin. „Sie hat sich umgeschaut und auf den ersten Blick keine Spuren davon feststellen können, dass irgendetwas fehlen würde. Das hat dann auch dieser Pfleger bestätigt, der Frau Föhrenbach oft betreut hat, dieser …“ „Holger Brechtken“, half ihr der Chef bei der Namenssuche. Normalerweise waren diese Rollen umgekehrt verteilt. Hannahs Namensgedächtnis war viel besser als das ihres Chefs. Aber da Bernd Kellert sich ja gerade erst mit dem Pfleger unterhalten hatte, hatte er dessen Namen ausnahmsweise sofort parat.
„Ja, dieser Brechtken, genau“, bestätigte die Kommissarin nun. „Und Frau Schmelter hat auch noch eine ältere Dame dazu gebeten, die das Zimmer direkt gegenüber bewohnt. Deren Namen hat sie mir gar nicht genannt, wenn ich mich recht erinnere. Aber da werde ich noch einmal nachhaken. Die beiden älteren Damen waren wohl mehr als nur einfach Nachbarinnen, sie waren befreundet. Deshalb kannte sie sich im Wohnbereich von Frau Föhrenbach ziemlich gut aus. Auch ihr ist nichts aufgefallen. Offensichtlich wurde also nichts entwendet. Ganz genau kann man das natürlich noch nicht sagen.“
„Eben! Vorsicht, keine vorschnellen Schlüsse!“, gab sich Kellert selbst mit auf den Weg, obwohl es wie eine Belehrung seiner Mitarbeiterin klang. Aber die konnte derartige Äußerungen ihres Chefs inzwischen bestens einschätzen. „Einen Brief, einen Ring, eine Kette, eine Versicherungspolice, ein Erbdokument, Aktien – all so etwas vermisst zunächst niemand“, zählte Bernd Kellert auf. „Und vielleicht nie. Das dürfen wir also nicht gleich ausschließen.“
Er strich sich übers Kinn, eine Geste, so wusste Hannah Mellrich, die sein Nachdenken häufig begleitete. „Habe ich das richtig verstanden, Chef? Du warst mit dieser Frau Föhrenbach irgendwie verwandt?“, hakte sie nach, nachdem er eine Weile nichts gesagt hatte.
„Verwandt?“, nahm ihr Chef ihre Frage auf. „Das ist zu viel gesagt. Sie war eine Tante meiner Frau. Aber ich hatte zu ihr kaum Kontakt. Wann habe ich die das letzte Mal gesehen? Bei einer Beerdigung vor vielleicht drei oder vier Jahren, nehme ich an. Beate hat sie halt regelmäßig besucht, das war es dann aber auch schon. Ich bin da nicht so gut, im Pflegen von familiären Kontakten. Im Reden über längst verstorbene Großtanten hier, noch lebende Vettern und Cousinen da. Das interessiert mich einfach nicht. Oder kaum. Nun ja, so ist es nun einmal.“
Er grinste seiner Mitarbeiterin mit schiefem Lächeln zu, ein bisschen überrascht über den ihr ungewollt gewährten Einblick in sein Privatleben. Das hielt er normalerweise aus seinem Berufsleben heraus. ‚Es ist viel besser, das zu trennen‘, betonte er immer, wenn man ihn darauf ansprach. Aber das war in diesem Fall nicht so einfach. Das Opfer war nun einmal Beates Tante. Da vermischten sich die Bereiche, ob er das nun wollte oder nicht. Kellert verzog das Gesicht. Diese Entwicklung gefiel ihm nicht. Ließ sich aber nicht ändern. „Okay“, schloss er das Gespräch ab, „dann lassen wir uns mal überraschen, was die Vernehmungen ergeben.“
4.
Kellert hatte es sich wieder angewöhnt, wann immer das Wetter es zuließ mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Sein Auto, dessen Nutzung für ihn in den letzten beiden Jahren zum Normalfall geworden war, blieb gewöhnlich zu Hause stehen. Er war jeweils eine knappe Dreiviertelstunde unterwegs, um von seinem Wohnort Polzingen nach Friedensberg und wieder zurück zu kommen. Vor knapp zehn Jahren waren sie raus aus der Stadt gezogen in die ruhige Wohngemeinde in der großen Fluss-Schleife westlich von Friedensberg, ein Entschluss, den weder seine Frau noch er selbst bisher bereut hatten.
Der Preis, den sie zu zahlen hatten, war die Pendelei. Daran hatte er sich gut gewöhnt. Aber in den letzten Jahren war er doch mehr und mehr mit dem Auto gefahren, obwohl er das eigentlich anders geplant hatte. Nun hatte sich einiges verändert. In der Corona-Pandemie war er richtiggehend eingerostet, so empfand er das zumindest. Die wiederentdeckte tägliche Bewegung mit dem Fahrrad tat ihm einfach gut. So konnte er sich einerseits morgens gut innerlich auf seinen Arbeitstag vorbereiten und andererseits abends die gedankliche Beschäftigung mit seiner Arbeit hinter sich zurücklassen.
Das ging dieses Mal nicht. ‚Ausgerechnet Tante Ina!‘, ging es ihm durch den Kopf. Er ahnte, dass er Beate beistehen und ihr zuhören musste. Sie vielleicht trösten. Zuhören und trösten? Nicht gerade seine Stärken. Aber er musste einfach mehr über die Hintergründe wissen, die nur sie ihm offenlegen konnte. Genau die Art von Familiengeschichten, die ihn normalerweise nicht besonders interessierten.
Seine Frau begrüßte ihn dann auch ungeduldig, hatte offensichtlich schon sehnsüchtig auf seine Rückkehr gewartet. „Ich kann gar nicht richtig trauern!“, gestand sie ihm. „Ich habe sie ja nicht einmal besonders gemocht, die Ina. Aber ist das nicht furchtbar, wenn man das über eine gerade Verstorbene denkt? Oder sogar sagt!“
Sie saßen am Abendbrottisch. Beate Kellert hatte sich – völlig entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit – eine Flasche Rotwein geöffnet. ‚Schon halbleer‘, bemerkte Kellert. Er selbst hatte sich seinerseits ein alkoholfreies Bier eingeschenkt. Ein Brötchenkorb, eine kleine Platte mit Wurstaufschnitt und Käse, vegetarischer Aufstrich aus Linsen und Paprika, das war es schon. Aber das war bei ihnen so üblich. ‚Alles andere liegt nachts so schwer im Magen‘, hatte Beate Kellert vor einigen Jahren bestimmt, und ihrem Mann war die von ihr getroffene, für ihn mitbestimmte Festlegung recht.
„Warte mal“, überlegte Bernd Kellert, „hilf mir ein bisschen auf die Sprünge: Wie war das noch: Die Ina, das war die jüngste Schwester Deines Vaters, oder?“ „Genau“, stimmte seine Frau zu, froh, sich auf etwas Konkretes besinnen zu können. „Da gab es noch die Walli und die Gundi, aber die sind natürlich schon lange tot.“
Sie bemerkte den fragenden Gesichtsausdruck ihres Mannes und fügte mit einem Lächeln an: „Na, so nannte man die eben, die Schwestern meines Vaters. Walli für Walburga, Gundi für Gundula und Ina für Regina. Walli, Gundi, Ina. Nur meinen Vater, den einzigen Bruder, haben sie immer so genannt, wie er hieß: Norbert.“
Beate Kellert lächelte matt vor sich hin. „Nein, nie Nobbi, obwohl das gewissermaßen naheliegend gewesen wäre.“ Sie versank in ihren Erinnerungen, kaute auf einer Brotscheibe herum und nahm einen Schluck von dem in der Region angebauten trockenen Rotwein. „Aber die Ina“, fiel ihr dann ein, „die war immer schon etwas Besonderes. Eine eigene Marke. Kein Wunder irgendwie, dass sie alle anderen Geschwister lange überlebt hat. Die waren nicht reich, die Benders, das weißt Du ja.“
Ja klar, das war Bernd Kellert bewusst. Beate stammte aus eher kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sein Schwiegervater, Norbert Bender, war ein Handwerker gewesen, Installateur. Ein umgänglicher, ehrlicher, vollkommen aufrichtig lebender Mensch. Bernd Kellert hatte seinen Schwiegervater gemocht und das hatte auf Gegenseitigkeit beruht, gerade weil sie sich nicht ähnlich waren. Norbert Bender hatte seiner Familie ein gutes Auskommen ermöglicht. Mehr nicht. Weniger nicht.
„Regina, die Jüngste,“ – unterbrach Beate die Gedanken ihres Mannes – „die wollte mehr vom Leben. Hatte ja im Büro eine Ausbildung gemacht, bei Werzfeld & Co. War dann zur Sekretärin aufgestiegen. Dann schnell zur Chefsekretärin. Und lernte dort alle möglichen interessanten Leute kennen. Vor allem Männer. Meine Güte, das war in den frühen sechziger Jahren. Da waren die Rollen noch klar verteilt. Die Männer haben alles bestimmt. Die Frauen durften ihnen zuarbeiten.“
„War vielleicht gar nicht so schlecht“, wagte Bernd Kellert einzuwerfen. Er wusste, dass seine Frau das als Provokation verstehen würde. Und dass sie wusste, dass er das letztlich nicht so meinte. Aber heute hatte sie keine Lust auf derartiges Geplänkel. Sie schüttelte nur andeutungsweise den Kopf und verzog den Mund.
„Die Ina jedenfalls hatte keine Lust auf diese Spielregeln“, fuhr Beate Kellert fort. „‚Regina heiße ich, Regina will ich sein‘, sagte sie immer, so hat das mein Vater erzählt. Und dann hat sie sich mit Winfried Föhrenbach verlobt. DEM Föhrenbach. Der war damals noch Juniorchef von ‚Klotzig & Föhrenbach‘, dem wichtigsten Kaufhaus bei uns in Friedensberg. Weißt Du ja. Und sie hat natürlich ihre Eltern gar nicht erst gefragt.“
In Gedanken versunken nippte sie erneut an ihrem Glas. „Nun, ihr Plan ist dann ja auch aufgegangen. Sie hat den Sprung in die hohen Kreise von Friedensberg geschafft, die Ina. Da wollte sie hin. In die ‚Hautevolee‘, so nannte sie das. Wie stolz sie war auf ihre Villa, in Reutershain, dem Edelviertel. Wo sie dann ja auch im ‚Vinzenz‘ noch gewohnt hat, keine fünfhundert Meter weiter. Zwei Kinder, beide natürlich Einser-Abiturienten, beide erfolgreich. Und sie im Kontakt mit den oberen Klassen der Stadt. Mit dem Oberbürgermeister, dem Bischof, dem Rotary-Club. Das war ihr wichtig. Daraus hat sie ihre Kraft gezogen. Die Ina.“
„Aber?“ Ihr Mann spürte, dass es Vorbehalte gab. Gegenströmungen, von denen er auch wusste. „Ja, aber. Der gute Onkel Winfried hat es nicht gerade leicht gehabt mit ihr. Ich habe mich immer gefragt, ob er es nicht insgeheim bereut hat, sich gerade für diese Frau entschieden zu haben. Sie wusste, was sie wollte, gut und schön. Aber sie war auch …“ – Beate suchte nach den richtigen Worten – „herrisch. Ja, genau: herrisch. Es musste schon ganz genau nach ihren Vorstellungen laufen. Sie wollte die Bestimmerin sein. Immer und überall. Sonst konnte sie ungemütlich werden.“
‚Ja, das passt zu meinen eigenen Erinnerungen‘, überlegte Kellert. ‚Und zu den Beschreibungen der Mitarbeiter aus dem Stift.‘ „Der Winfried ist doch dann auch früh gestorben, wenn ich mich richtig erinnere. Wann war das, kurz vor der Jahrtausendwende, habe ich das richtig in Erinnerung?“, schaltete sich Bernd Kellert wieder in das Gespräch ein.
„Ja, richtig. 1998. Im Herbst. Hatte ja vorher das Kaufhaus an Hertie verkauft. Und dabei keinen schlechten Schnitt gemacht, erzählte man sich damals. Genau: gestorben mit gerade mal sechsundsechzig Jahren. Von wegen. ‚Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an‘, wie das der gute Udo Jürgens so leichthin vor sich hinträllert. Da kann es auch schon vorbei sein. Beim Onkel Winfried war das so. Aber an den kann ich mich sowieso kaum erinnern. Wir hatten nie viel miteinander zu tun.“
Sie suchte in ihrer Erinnerung, konnte aber kaum klare Bilder aufrufen. „Sechsundsechzig? Ganz schön jung, finde ich – aus heutiger Perspektive. Damals ist mir das natürlich gar nicht so jung vorgekommen. Aber wenn du mal selbst Mitte fünfzig bist, siehst du das anders, oder? Heute frage ich mich auch, ob die Ina ihn nicht ganz schön belastet hat. Ob sie nicht ihren Anteil an seinem Schicksal hatte. Die ganz große Liebe war es ja wohl nie. Zumindest von ihrer Seite aus. So hat das mein Vater wenigstens immer erzählt.“
„Also, wenn Du mich fragst“, überlegte Bernd Kellert: „Es ist ja auch kein Zufall, dass die beiden Kinder“ – „Peter und Christiane“, warf seine Frau ein und er bestätigte sie nickend – „so weit weg wohnen. Und dass sie nur ziemlich selten da sind, wenn ich Dich da immer richtig verstanden habe. Von denen erzählst Du auch fast nie etwas. Kann man das so sagen, Beate: Diese Frau war für ihre engsten Verwandten nur schwer zu ertragen. Oder irre ich mich da?“
Beate Kellert blickte ihren Mann ernst an, schüttelte leicht den Kopf. „Bernd. So sollte man über eine gerade Verstorbene nicht reden!“ Sie dachte nach, kratzte sich mit den Fingerkuppen der rechten Hand über die linke. „Na ja, Unrecht hast Du nicht. Das war schon nicht so leicht mit ihr. Selbst mein Vater und ihre Schwestern hatten ja kaum noch Kontakt zu ihr. Ich habe als Kind mit Peter und Christiane nie gespielt. Das wollte sie nicht. ‚Die schämt sich für uns‘, meinte Papa immer. ‚Wir sind der zu gewöhnlich. Die hält sich für etwas Besseres.‘ Vielleicht ist da etwas dran, kann sein. Aber ich will das gar nicht beurteilen.“
„Aber erinnerst Du Dich nicht?“, fiel es Bernd Kellert nun ein, obwohl er seit Ewigkeiten nicht mehr daran gedacht hatte. „Zu unserer Hochzeit sind sie damals auch nicht erschienen. Die ehrenwerten Föhrenbachs. Mit irgendeiner halb glaubwürdigen Ausrede. Ich weiß noch, dass ich ziemlich sauer war. Und dann haben sie uns irgend so ein blödes Geschenk gemacht. Sauteuer, aber völlig unbrauchbar.“
Seine Frau nickte: „Ja, diese Bodenvase. Chinesisch, glaube ich. Echt, aber eben auch echt hässlich. Die stand dann nur im Weg herum. Als die Kinder kamen, habe ich das teure Teil in den Keller geräumt. Irgendwann ist sie kaputt gegangen und ich habe sie entsorgt. Jaja, das stimmt natürlich alles, Bernd.“
„Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum ich nie Lust hatte, sie zu besuchen“, überlegte ihr Ehemann. „Zu uns einladen ließ sie sich ja sowieso nicht. Das war wohl unter ihrer Würde. Ich werde da noch im Nachhinein aggressiv. Dieser Dünkel! Dieses Sich-für-etwas-Besseres-halten! Das habe ich alles komplett verdrängt. Jetzt kommt es wieder hoch. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn ich an meine Aufgabe als Kommissar denke: Die Frau konnte einen echt aggressiv machen, das steht mir jetzt wieder sehr deutlich vor Augen.“
„Aber es ist besser geworden in den letzten Jahren, echt, Bernd“, beschwichtigte Beate Kellert. „Nein, ‚altersmilde‘ ist sie nicht geworden, die Ina, das hätte auch nicht zu ihr gepasst. Aber sie war nicht mehr so verbissen in ihrer permanenten Rechthaberei. In ihrem Bestehen darauf, dass nur ihr Weg der richtige, erfolgreiche ist. Doch, ihr Mann hat ihr gefehlt. So lange Witwe zu sein, das war für sie schon schmerzlich. Und dass ihre Kinder sich kaum bei ihr meldeten, das hat ihr richtig weh getan. Obwohl sie es immer überspielt hat.“
Beate Kellert überließ sich den Bildern ihrer Erinnerung. „Weißt Du noch, welchen Aufstand sie früher um ihre Enkel gemacht hat? Als die noch klein waren. Die klügsten, besten, erfolgreichsten. Natürlich. Ach, unerträglich! Unsere beiden Kinder kamen da gar nicht vor. Aber zuletzt hat sie immer mal wieder nach Tobias und Jenny gefragt. Von sich aus. Und sie erinnerte sich sogar an ihre Namen, das hätte ich gar nicht erwartet. Also: Da hat sich etwas entwickelt bei ihr. Zum Besseren verändert. Klar, Königin bleibt Königin, aber sie war verträglicher geworden.“
„Ich habe sie nun einmal nicht gemocht, Punkt“, legte Bernd Kellert sich fest. „Warum sollte man das nicht so klar benennen, wie es nun mal ist?“ „Sie Dich auch nicht, falls Dich das beruhigt“, bestätigte seine Frau. „Und ich weiß auch, glaube ich, warum das so war. Du hast Dich nie in die Untertanen-Rolle eingefügt, die sie Dir wie allen anderen in ihrem Umfeld, vor allem in der Großfamilie, zugedacht hatte.“
Sie grinste vor sich hin. „Das war schon klug von Dir, Bernd. Du hast auch nicht gegen sie rebelliert, das hätte sie in ihrer Position ja indirekt eher noch bestärkt. Du hast sie einfach ignoriert. Das hat ihr nicht geschmeckt. Das hat sie richtiggehend geärgert. Aber wir, sie und ich, haben, ganz ehrlich, auch nur selten über Dich gesprochen, wenn ich sie besucht habe.“
„Ach, damit kann ich ganz gut leben“, kommentierte ihr Mann leichthin. „Vielleicht war das taktisch allerdings nicht ganz so klug. Da werden wir jetzt wohl eher nichts erben, oder?“ „Bernd!“, unterbrach ihn seine Frau mit tadelndem Ton. „Na, ist doch so! Nicht, dass wir das nötig hätten. Aber für Tobias und Jenny hätte es mich gefreut. Das erinnert mich daran: Wir müssen unbedingt klären, wer nun das Erbe übernimmt. Da dürfte ja einiges zusammenkommen. Oder weißt Du, wie das geregelt ist?“
„Darüber hätte Ina nie mit mir gesprochen“ erwiderte Beate Kellert kopfschüttelnd. „Weißt Du: Diese Gespräche mit ihr verliefen nie auf Augenhöhe. Sie bestimmte, was besprochen wurde. Und wie, in welchem Ton. So war das nun einmal. Und wer erben wird? Da nehme ich doch ganz stark an, dass das Peter und Christiane sind. Auch wenn die es ja nun wahrlich am allerwenigsten brauchen. Ewig habe ich die nicht mehr gesehen. Ich bin mal gespannt, ob sie sich nun hier sehen lassen. Zur Beerdigung werden sie schon kommen, oder?“
Sie massierte ihr rechtes Ohrläppchen und griff einen Gesprächsfaden auf, den ihr Mann angeschnitten hatte. „Na ja, und vielleicht hinterlässt die Ina auch ihren Enkeln etwas, das würde mich gar nicht wundern. Oder irgendwelchen Stiftungen?“
Ihr Mann unterbrach sie. „Warte mal, sagtest Du ‚Stiftungen‘? Und wenn Sie nun dieses ‚St. Vinzenzstift‘ begünstigen würde? Da, wo sie ihren Lebensabend verbracht hat? Das würde die Suche nach einem Motiv noch einmal erweitern.“ Er notierte sich diesen Gedanken im Geiste. Er würde Hannah Mellrich mit den Hintergrundrecherchen beauftragen. Wie üblich.
Er wandte sich wieder an seine Frau: „Nun, das werde ich abchecken lassen. Auch, ob die Einrichtung in einer finanziellen Notlage steckt. Das hat die Leiterin, diese Frau Schmelter, zwar weit von sich gewiesen, aber wer weiß, ob sie da ganz aufrichtig zu mir war. Jedenfalls gut, Beate, dass Du mich darauf gestoßen hast.“
5.
Bernd Kellert war doppelt gegen Corona geimpft. Und geboostert. Das war für ihn völlig klar gewesen, als diese furchtbare Pandemie das gesamte öffentliche Leben lahmgelegt hatte. Er hatte täglich mit so vielen Menschen zu tun: Weder wollte er die in Gefahr bringen, noch sich selbst. Für die vielen Impfverweigerer hatte er keinerlei Verständnis. Ja, natürlich gab es viele offene Fragen. Aber welche innere Sicherheit brauchen Menschen denn, um auf den Rat der