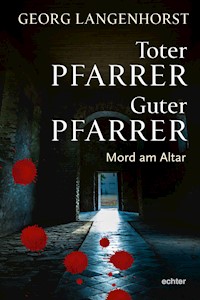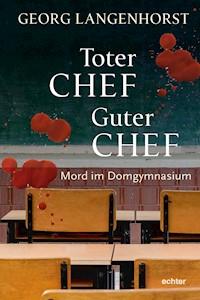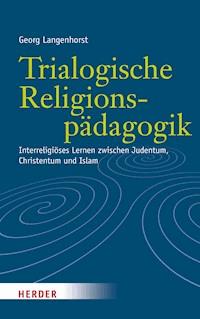Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Religion wird heute zur Privatsache erklärt. Jeder soll nach seiner Überzeugung leben. Viele Eltern werden unsicher, ob sie ihre Kinder überhaupt religiös erziehen sollen. Kindertagesstätten und Schule greifen zwar religiöse Elemente auf, scheuen sich aber davor, konfessionelle Prägungen zu berücksichtigen. In diese Situation hinein setzt das Buch ein eindeutiges Plädoyer: Kinder brauchen Religion, weil sie ohne sie weder ein stimmiges Weltbild aufbauen noch eine umfassende Identität herausbilden können. Und beides ist nur möglich in eindeutiger konfessioneller Beheimatung. Das Buch entwirft - gerade auch für Eltern - praktische pädagogische und innovative theologische Perspektiven, wie heute und morgen in Familien, Kindertagesstätten, Schulen und Gemeinden christliche Erziehung und Bildung möglich wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Langenhorst
Kinder brauchen Religion
Orientierung fürErziehung und Bildung
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: excogito, Freiburg im Breisgau
ISBN (E-Book) 978-3-451-80117-4
ISBN (Buch) 978-3-451-32746-9
Inhalt
Vorwort: Ziel und Absicht des Buches
Hinführung in zehn Schritten:Religiöses Lernen heute und morgen
1. ReligionVerständigung über einen vielstimmigen Begriff
2. Lernen?Was ist das, wie geht das?
3. Veränderte KindheitKind-Sein in der Gegenwart
4. Aufwachsen in der PostmoderneGesellschaftliche Rahmenbedingungen
5. Kinder erleben Welt auf ihre ArtReligionspsychologische Wegmarken
6. Jugendlicher Glaube, jugendliche MoralEntwicklungspsychologische und empirische Erkenntnisse
7. Pluralität ernstnehmenReligiöse Einstellungen von Kindern und Jugendlichen
8. Zwischenbilanz für ErwachseneKonsequenzen für die religiöse Erziehung und Bildung
9. Christentum heute neu denkenTheologie elementarisiert
10. Das Kind als Mittelpunkt?Chancen und Grenzen von Kindertheologie
Hauptteil:Fünf Grundelemente religiösen Lernens
I. Kinder brauchen Gott!
1. „Ich gönne mir das Wort Gott“Warum SchriftstellerInnen ‚Gott brauchen‘
2. Zuspruch und AnspruchNachdenken über die Grund-Logik des Christentums
3. Taufe als das unbedingte JA Gottes zum MenschenWas es bedeutet, Christ zu werden
4. Seligpreisungen als Zuspruch unbedingter WürdeVom Zuspruch ohne Vorbedingungen
5. Erlösung – wovon und wohin?Neue Zugänge zu einem schwierigen Konzept
6. „Sein Name: Kendauchdich“Von der Ursehnsucht danach, wahrgenommen zu werden
7. Den Möglichkeitssinn schulenAuf der Spur der „noch nicht erwachten Absichten Gottes“
8. Geerdete MystagogieWie man Kindern Raum für Gotteserfahrungen schafft
II. Kinder brauchen Jesus!
1. „Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat“Jesus als unverzichtbares Bild Gottes
2. Von Jesus erzählenReligion erschließt sich über Narration
3. Mit Jesus betenDas Vater-unser als religiöses Grundgebet
4. Mit Jesus Empathie lernenSoziales Handeln als selbstverständliche christliche Praxis
5. Mit Jesus in der Eucharistie verbundenDen Glauben mit Gott und Menschen feiern
6. Vorbilder geben Jesus GestaltModell-Lernen als Weg realistischer Nach-Folge
III. Kinder brauchen Be-Geist-erung!
1. Geist als ‚Person‘?Zugänge zu einer sperrigen Vorstellung
2. Drei gleich eins – TrinitätAuflösungsmöglichkeiten eines spekulativen Rätsels
3. Religiöses Lernen als SymbollernenWarum Religion auf Symbole angewiesen ist
4. Sakramente – Symbole des GlaubensRituelle Gestaltung von Tiefenwahrheit
5. Buße und Beichte – das vergessene SakramentWege von der Krise zur Neubesinnung
6. Firmung – das verschenkte SakramentVorschläge zu einer neuen Firmpastoral
IV. Kinder brauchen Gemeinschaft!
1. FamilieNachdenken über den ersten Lernort der Gottesbeziehung
2. GemeindeBesinnung auf den zweiten Lernort der Gottesbeziehung
3. Religion in KindertageseinrichtungenZur neuen Bedeutung von religiöser Elementarpädagogik
4. Mitfeier des KirchenjahrsVom Wärmestrom christlicher Festgestaltung
5. Interreligiöse Gemeinschaft der abrahamischen ReligionenReligiöses Lernen in realistischem Miteinander
6. LesegemeinschaftWie Lesen religiöses Lernen unterstützen kann
V. Kinder brauchen Religionsunterricht!
1. Warum Religionsunterricht im religionsneutralen Staat?Rechtliche Begründung des Religionsunterrichts
2. Religionsunterricht am Lernort Schule?Pädagogisch-theologische Begründung
3. Streitpunkt KonfessionalitätZukunftsfähige Grundformen des Religionsunterrichts
4. Religion kompetenzorientiert lernen?Orientierung an religiösen Grundkompetenzen
5. Erstes Grundprinzip „Korrelation“Zur Wechselbeziehung von Glaubenstradition und Lebenserfahrung
6. Zweites Grundprinzip „Performation“Religion erleben und reflektieren
Ausblick
Dankeswort
Literaturverzeichnis
„Gott macht sich im Herzen
jedes Menschen spürbar“
Papst Franziskus
(„Über Himmel und Erde“, S. 34)
Vorwort: Ziel und Absicht des Buches
„Religion – das ist Privatsache!“
„Ob meine Kinder sich einer Religion anschließen, das sollen sie später selbst entscheiden. Ich möchte sie da nicht festlegen.“
„Religion – da bin ich mir nicht sicher, was ich selber denke. Wie soll ich da meinen Kindern etwas mit auf den Weg geben? Ich halte mich da lieber heraus.“
„Die Kirchen und die anderen Religionen sollten mit der öffentlichen Bildung nichts zu tun haben. Kindergarten und Schule sollten frei sein von konfessionellen Vorgaben.“
Solche und ähnliche Stimmen lassen sich in unserer postmodernpluralen Gesellschaft mehr und mehr vernehmen. Religion wird zur subjektiven Privatsache erklärt, die jede und jeder für sich selbst entscheiden muss. Den verfassten Religionen wird zunehmend das Recht abgesprochen, sich an öffentlichen Bildungseinrichtungen zu beteiligen. Dass Konfession, also das aktive Bekennen und Praktizieren einer ganz spezifischen Religion, als Teil persönlicher Lebensführung einen wichtigen Raum einnehmen soll und darf, wird dabei in der Regel nicht in Frage gestellt. Sehr wohl umstritten ist aber jegliche Forderung, hieraus politische, institutionelle und öffentlich wirksame Ansprüche herleiten zu dürfen.
Die Diskussion um die Legalität der Beschneidung von männlichen Kindern in Judentum und Islam hat zudem eine weitere Frage in das öffentliche Interesse gerückt: Dürfen Eltern in Sachen Religion überhaupt für ihre Kinder langfristig wirksame Entscheidungen treffen, Prägungen vornehmen, Wegspuren bahnen? Ist das nicht bereits einerseits eine pädagogisch unerlaubte Engführung, andererseits aber auch ein juristischer Eingriff in das Recht auf Selbstbestimmung der Person, das auch schon für Kinder gilt? Die Anfragen bleiben nicht auf die Religionen Judentum und Islam beschränkt. Legt nicht auch die christliche Säuglingstaufe, im kirchlichen Selbstverständnis die Verleihung eines character indelibilis (eines unauslöschlichen Merkmals), Menschen lebenslang auf eine Prägung fest – unabhängig davon, ob sie diese später akzeptieren und gestalten, sich dagegen wehren oder sie schlicht ignorieren?
Religion, religiöse Erziehung und religiöse Bildung sind im Kontext der postmodernen Gesellschaft schon seit einiger Zeit zum Streitthema geworden. Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen reagieren auf diese Situation mit unterschiedlichen Strategien:
mit dem Hinweis auf traditionell festgelegte juristische Rahmenvorgaben und Staatsverträge;
mit dem Rückzug auf vermeintlich eindeutige Aussagen von Katechismen und Dogmen;
mit der Vermeidung und einem Wegducken vor klarer Positionierung;
mit einem Blick auf potentiell langfristige Entwicklungen, der mittelfristige Probleme ignoriert;
mit der konfrontativ ausgerichteten Einforderung vom Menschenrecht auf religiöse Entfaltung, Praxis und Erziehung;
mit der Aufnahme von echten Dialogunternehmungen über künftige Wege und Organisationsformen;
mit kritischer Bestandsaufnahme und offenen Gesprächen.
Auch im Feld der wissenschaftlichen Religionspädagogik finden sich unterschiedliche Strategien und Meinungen: Manche verweisen auf die Notwendigkeit des Abschieds von konfessionellen Engführungen und plädieren für den verstärkten Ausbau christlich-ökumenischer Gemeinschaft auf der Ebene von Gemeinde und Schule. Andere sehen im Miteinander der drei abrahamischen, der monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam die tragfähige Basis für eine starke Wirkung in die unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen hinein. Und noch einmal andere setzen auf die grundlegenden gemeinsamen Anliegen aller Religionen, sei es im Blick auf das Ethos oder im Blick auf Spiritualität.
Dabei werden die Sorgen vieler gläubiger Menschen um das Weiterleben ihres Glaubens in den Folgegenerationen bis hin in die Formulierung von Buchtiteln aufgenommen. „Erwachsenwerden ohne Gott?“, fragt Karl-Ernst Nipkow 1987; „Werden unsere Kinder noch Christen sein?“ präzisieren Jürgen Hoeren und Karl Heinz Schmitt1990 die Fragestellung. Aus Fragen werden positionierte Forderungen: „Kinder nicht um Gott betrügen“ mahnt Albert Biesinger 1994 in einem bis heute immer wieder neu aufgelegten Buch; Friedrich Schweitzer postuliert im Jahr 2000 „Das Recht des Kindes auf Religion“ – und damit sind nur wenige auflagenstarke und wirkmächtige Einzeltitel in Erinnerung gerufen.
In diese Diskussion hinein soll das vorliegende Buch eine eigene Position einspeisen. Gewiss, Kinder können aufwachsen ohne Religion, das zu bestreiten wäre angesichts breiter Erfahrungen in Geschichte und Gegenwart absurd – außer man verwässert den Religionsbegriff so stark ins Allgemeine, dass man damit keine klar abgrenzbare Dimension mehr erfasst. Und gewiss, Menschen wachsen auf und leben gut ohne Religion, ja sogar besser als manche andere, die von fundamentalistischen Vertretern und Ideologen ihrer Religionen verkrüppelt und versklavt wurden und werden. Das mehrfach mit bedauerndem Ton vorgetragene Bekenntnis eigener ‚religiöser Unmusikalität‘ – ein Sprachbild, das Jürgen Habermas von Max Weber entlehnt hat – weist jedoch auf eine zentrale Analogie hin: Ja, man kann auch ohne Musik leben, moralisch gut, sinnvoll und glücklich– aber welch bereichernde menschliche Dimension fehlt dabei! Wie schade, wenn eine so grundlegende Ebene des Menschseins nicht entfaltet ist! Und mit welchem Bedauern werden musikalische Menschen auf unmusikalische blicken, die oft nicht einmal ahnen, was ihnen fehlt oder entgeht.
Auch wenn der Vergleich von Musik und Religion seine Grenzen hat: Tatsächlich ist es so ähnlich mit Religion. Auch das Religiöse ist eine Grunddimension des Menschen. Auch in ihr geht es um Wahrnehmung, Empfindung, Ausdruck und Gestaltung von Wirklichkeit in all ihren Facetten, ja mehr noch: um das Erahnen von Möglichkeiten, die unsere Erfahrungswelt übersteigen und so Raum geben für Sehnsucht, Hoffnung und Trost. Ganz in diesem Sinne wagte schon die Würzburger Synode – die Versammlung der deutschen katholischen Kirche im Versuch der Neuformulierung zentraler Glaubensüberzeugungen in das Zeitalter der Moderne hinein – vor vierzig Jahren die Behauptung: „Die ‚religiöse‘ Dimension“ von „Situationen und Erfahrungen“, die uns „unbedingt angehen“, auszuklammern, „hieße den Menschen verkümmern lassen“ (Der Religionsunterricht in der Schule 1974, S. 24).
„Kinder brauchen Religion!“ (in Hugoth/Benedix 2008, S. 9f.) – so überschrieben die Vorsitzenden der BETA (Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder) und des KTK (Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder) 2008 in ökumenischer Gemeinsamkeit ihr Plädoyer. In der Tat, das ist die Grundüberzeugung, die auch hier stark gemacht werden soll: Vor allem Kinder ‚brauchen‘ Religion weit jenseits einer „einseitigen Festlegung bloß auf das Nützliche“ (Schweitzer 2000, S. 24), und das gleich doppelt: zum einen jeweils gegenwartsbezogen in ihrem Kind-Sein, zum Aufbau von kindlich tragfähigen Weltbildern, Überzeugungen und Wertvorstellungen. Zum anderen aber auch zukunftsorientiert, um sich in unserer Gesellschaft zu eigenständigen, selbstverantworteten, gebildeten Persönlichkeiten entwickeln zu können. Ob sie sich als Erwachsene zu einer konkreten Religion bekennen und eine bestimmte Religion praktizieren, ist dabei zunächst zweitrangig – dafür und dagegen kann es gute Gründe geben, die in jedem Fall allein der persönlichen Einschätzung vorbehalten bleiben. Gut so! Von zentraler Bedeutung ist jedoch die grundlegende Befähigung zu einer solchen Entscheidung, die eine wenigstens basale religiöse Erziehung und Bildung voraussetzt. Wenn Kinder also in diesem Sinne ‚Religion brauchen‘, ergeben sich Konsequenzen für Eltern, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten, Schulen, staatliche Vorgaben.
Was aber, wenn gerade die Vertreterinnen und Vertreter dieser Instanzen sich selbst als ‚religiös unmusikalisch‘ einschätzen? Wenn sie die Verantwortung in Sachen Religion an die dafür zuständigen ‚Fachleute‘ abschieben – nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus der gut begründeten Selbsteinschätzung heraus, selbst viel zu unsicher, selbst viel zu inkompetent in Sachen Religion zu sein, um Kinder in dieser Hinsicht zu erziehen oder zu begleiten? Eine derartige Zurückhaltung hat ihre Berechtigung, gleichzeitig aber auch ihre Grenzen. Viele Eltern etwa nehmen heute beträchtliche Belastungen auf sich, um ihre Kinder bestmöglich zu fördern: ob im Blick auf sportliche Aktivitäten oder musikalische Ausbildung. Und niemand erwartet von ihnen, dass sie selbst in der entsprechenden Disziplin Höchstleitungen erbringen, dass sie selbst überragende Experten auf dem fraglichen Gebiet sind.
Im exemplarischen Bild gesprochen: Eine Mutter, die ihre Tochter zum Ballettunterricht bringt, muss nicht selbst Ballett tanzen können. Ein Vater, der seinen Sohn zum Fußballtraining begleitet, muss nicht selbst in der Bundesliga gespielt haben. Eine Großmutter, die ihren Enkel zum Flötenspiel animiert, muss nicht selbst das Instrument orchesterreif beherrschen. Ein Großvater, der seiner Enkelin den Reitunterricht bezahlt, muss nicht selbst jemals auf einem Pferd gesessen haben … Gewiss: Erneut sind die Vergleichsbedingungen begrenzt, aber trotzdem darf man fragen: Warum wird ausgerechnet im Bereich Religion eine eigene Kompetenz als Voraussetzung angeführt, um ihr in Erziehung und Bildung Raum zu geben, um selbst Energie und Zeit für die entsprechende Ausbildung der eigenen Kinder zu ‚investieren‘? Natürlich gibt es individuell sehr unterschiedlich bestimmte Grenzen der eigenen Zuständigkeit und Fähigkeiten. Aber: Den Kindern zuliebe braucht auch der Bereich der Religion alle Förderung und Stützung, zu der wir fähig sind.
Von einem Doppelten soll also in diesem Buch die Rede sein: Davon dass und warum und wie Kinder ‚Religion brauchen‘ auf der einen Seite, auf der anderen aber auch davon, welche Konsequenzen sich daraus für Erwachsene im privaten wie im öffentlichen Leben ergeben. Und da Kinder nolens volens immer früher zu Jugendlichen werden, da die Übergänge zwischen beiden Entwicklungsstufen immer mehr verwischen, darf sich die Perspektive dabei nicht auf Kinder allein beschränken, auch wenn dieses Buch diesen Lebensabschnitt ins Zentrum rücken will. Ein Plädoyer dafür, dass Kinder ‚Religion brauchen‘, kann nur dann sinnvoll sein, wenn die potentiellen Weiterentwicklungen zum Jugendlichen und Erwachsenen im Hintergrund mitbedacht werden.
Dieses Buch wendet sich so an Eltern, Erziehende, Unterrichtende, zielt auf an Erziehungs- und Bildungsprozessen pädagogisch und politisch Beteiligte. Es richtet sich aber auch an in den Religionen für Erziehung und Bildung Verantwortliche, weil es Orientierungen dahingehend anbietet, welche Art von Religion Kinder ‚brauchen‘ und welche Erschließungs- und Vermittlungsprozesse dafür geeignet sind. Es soll eine begründete Ermutigung dahingehend sein, Erziehung und Bildung auch religiös zu profilieren. Ein zu streng wissenschaftlicher Zugang (etwa: mit ausführlichem Fußnotenapparat, einer Fülle an Belegzitaten, einer engmaschigen Verweisstruktur auf bestehende Diskurse) ist dabei explizit nicht angestrebt. Orientiert an der Vorgabe von Lesbarkeit und Verständlichkeit sollen gleichwohl grundlegende Bezüge deutlich und Lesehinweise auf Quellen und Vertiefungslektüre gegeben werden.
Im Aufbau des Buches soll das bereits mehrfach angeführte Vergleichsbild von Musik und Religion aufgegriffen und strukturell fruchtbar gemacht werden. Nach einer Einführung in die thematischen Zusammenhänge von religiösem Leben und Lernen heute werden im Hauptteil vier Grundelemente religiösen Lernens entfaltet. Kinder brauchen Gott, Jesus, Be-Geist-erung und Gemeinschaft. Diese vier Aspekte verhalten sich zueinander wie die vier Saiten einer Geige. Jede kann für sich allein klingen; eine Symphonie der Töne, ein Gesamtklang aber kann nur durch alle vier Saiten gelingen. Mal wird eine Saite bespielt, mal zwei gleichzeitig, im Normalfall aber braucht es alle, damit die Geigenmusik umfassend und perfekt zum Klingen gebracht wird.
Und mehr noch: Es braucht Räume, in denen man das Spielen dieses Instrumentes erlernen kann. Zahlreiche derartige Räume gibt es: Familie, Kindertagesstätten, Gemeinde und viele mehr. Alle haben ihre besondere Bedeutung, ihre je eigene Reichweite, ihre speziellen Gesetze und Regeln. Ein Raum ragt jedoch heraus. Die meisten Kinder erlernen das Spielen eines Musikinstrumentes in der Musikschule. Ähnlich verhält es sich mit Religion. In der Schule, im Religionsunterricht wird der Raum bereitgestellt, um möglichst alle Kinder religiös zu sensibilisieren und zu bilden. Deshalb soll in diesem Buch im übertragenen Sinne davon gesprochen werden, dass Kinder im Blick auf die Fragestellung ein Fünftens brauchen: einen (guten) Religionsunterricht als Raum, in dem die vier Saiten zum Klingen gebracht werden können, in dem das kundige Hören und im Idealfall auch das Musizieren selbst eingeübt werden kann.
Der Geigenbauer Martin Schleske hat vor Kurzem ein faszinierendes Buch vorgelegt, in dem die Geheimnisse des Geigenbaus und des Geigenspiels in christlichem Geist spirituell gedeutet werden. „Der alles erfüllende Klang“ (Schleske 2010, S. 309) ist das nur bedingt planbare Ergebnis von umfangreicher Vorbereitung, vielerlei Mühen und dem beglückenden „Zusammenspiel von Arbeit und Gnade“ (ebd., S. 72). Ein vergleichbares Zusammenspiel lässt sich auch im Blick auf religiöse Lernprozesse finden. Auch sie bringen verschiedene Saiten zum Klingen, auch sie sind nur bedingt planbar, auch sie ein Ergebnis des Zusammenspiels von „Arbeit und Gnade“. Ihr viersaitiger Klang soll in diesem Buch zu Gehör kommen, für religiös Musikalische wie religiös Unmusikalische. Nicht um ein opulentes Opernwerk soll es dabei gehen, sondern um kleine Melodien, die zusammen gesungen und gespielt Lust und Mut machen zum ‚religiösen Musizieren‘.
Hinführung in zehn Schritten:Religiöses Lernen heute und morgen
Bevor die einzelnen Saiten des religiösen Lernens zum Klingen gebracht werden, bedarf es der Vorbereitung, des Stimmens des Instruments, der Klärung der Rahmenbedingungen. Wenn in diesem Buch von Religion die Rede ist, die Kinder ‚brauchen‘, sollte zunächst kurz geklärt werden, was damit gemeint ist. Dasselbe gilt für die grundlegenden Lerndimensionen von Erziehung und Bildung sowie für die heutigen und morgen zu erwartenden Lebensbedingungen von Kindern. Zu all diesen Themen liegen ungezählte, umfassende und hervorragende Studien und Untersuchungen vor. Sie sollen hier weder referiert noch diskutiert werden. Auch werden keine substantiell neuen Theorien oder Begriffsfüllungen etabliert. Es geht hier lediglich um eine Vergewisserung als Grundlage für die folgenden Ausführungen.
1. Religion
Verständigung über einen vielstimmigen Begriff
So einfach der Begriff ‚Religion‘ zu sein scheint, so sehr man bei ihm mit einem intuitiven Vorverständnis rechnen kann – so überraschend der Befund: Es gibt schlicht keine konsensfähige Definition dessen, was man damit bezeichnet (vgl. Porzelt 2009, S. 45ff.). Man kann den Begriff eng fassen, indem man ihn nur für die traditionell ausgebildeten großen Weltreligionen verwendet. Oder man fasst ihn weit und beschreibt dann eine menschliche Grundkonstante, den Bereich jener Grundfragen und Ursehnsüchte des Menschen, die er von sich aus nicht beantworten und stillen kann. In beiden Fällen kann man jeweils vier Zugangsmöglichkeiten voneinander unterscheiden, um den Begriff präziser auszudifferenzieren:
Man kann Religion von ihren
Funktionen
her bestimmen, also von den Zwecken, zu denen sie dient, etwa zur Stiftung von Sinn, Moral und Lebensorientierung, zur Bereitstellung von Trost, zum Umgang mit Leid, Trauer und Vergänglichkeit.
Oder man sieht sie als
grundmenschliches Potential,
als eigenständige Dimension, die allen Menschen innewohnt. Religion bezieht sich dann auf das Innerste eines Menschen, seine Seele, seinen Wesenskern.
Oder man beschreibt sie anhand ihrer objektiv beobachtbaren
Erscheinungsformen,
mittels derer sie konkrete Gestalt erhält: ihre Riten und Symbole, ihre sozialen Formen von Gemeinschaft, ihr ästhetisches Erscheinungsbild in Bauwerken und Kunst.
Oder man versucht ihre
innere Substanz
zu bestimmen, ihre eigene Weise der Erklärung und Gestaltung von Wirklichkeit. Dann konzentriert man sich auf die Lehre, den geistigen Gehalt, die ausformulierte Theologie.
All diese Versuche sind sinnvoll und beleuchten je unterschiedliche Seiten dessen, was Religion ausmacht. Für die Ausführungen in diesem Buch sollen folgende Aspekte besonders betont werden:
Religion wird zunächst verstanden als eine Dimension, die im Menschen verankert ist. Das religiöse Potential des Menschen liegt in all den Bereichen, die ihn tief prägen, ihn „unbedingt angehen“ – so die berühmte Formulierung von Paul Tillich –, die er aber letztlich nicht selbst begründen, mit Sinn füllen und auf letzte Ziele hin ausdeuten kann. Dazu zählen die Grundfragen: Woher komme ich, woher kommt die Welt? Wie soll ich leben? Warum gibt es mich und die Welt? Was wird aus mir und der Welt? Dazu gehören aber auch Grundsehnsüchte nach Anerkennung, Liebe, Gelingen und Sinn. Und schließlich zählen dazu alle Hoffnungen auf erfülltes Leben, Getragen-Sein im Leid und eine Form der Weiterexistenz nach dem Tod.
Diese Dimensionen kann und muss der Mensch selbst erforschen, soweit es geht, und mit Leben ausfüllen, soweit er kann. Letzte Sicherheiten und Bestätigungen wird er aus sich selbst heraus nicht finden. Deshalb umfasst Religion auch nicht ausschließlich die bislang skizzierten Dimensionen von Frage und bloßem Potential – diese sind auch rein anthropologisch, psychologisch und philosophisch zu erheben. Einem Plädoyer, dass Kinder in diesem Sinne ‚Religion brauchen‘, würde allgemeine Zustimmung und völlige Folgenlosigkeit sicher sein. Entscheidend: Religion stellt ein System zur Verfügung, das Antworten setzt, Perspektiven vorgibt, Handlungsimpulse enthält, sei es im Blick auf das spirituelle, rituelle, gesellschaftliche, moralische oder politische Verhalten und Handeln. Damit müssen keine ‚endgültigen‘ Antworten, Perspektiven und Handlungsimpulse gemeint sein, sondern vorläufige und provisorische, die gleichwohl als verlässlich, wahrhaftig und als nicht einfach verfügbar gelten. Religion in diesem Sinne bezieht sich auf festgefügte Traditionen, die als verfasstes System meistens eine jahrhundertelange Geschichte aufweisen und Massenbewegungen waren und sind. Zu diesen Traditionen kann sich der Einzelne in unserer Gesellschaft frei verhalten: Der Bogen spannt sich aus von völliger Identifikation zu resoluter Ablehnung, von Teilnutzungen bis zu freien Zusammenstellungen und Mischungen einer „Patchwork-Religion“.
Wenn also davon die Rede ist, dass Kinder „mehr als alles“ (Biesinger 2012, S. 18), und das heißt: dass sie ‚Religion brauchen‘, dann in dem folgenden Sinne. Sie sind darauf angewiesen, dass die in ihnen liegenden urmenschlichen Potentiale fruchtbare Bedingungen, unterstützende Möglichkeiten und wachstumsförderliche Rahmenvorgaben vorfinden, sodass sie sich innerhalb von religiösen Traditionen entwickeln und entfalten können – sei es auch nur, um sich später davon zu emanzipieren. So wie Musikalität sich nur durch musikalische Förderung entwickeln kann, so auch Religiosität. Um im Bild zu bleiben: Ob musikalisch ausgebildete Erwachsene weiterhin Musik hören oder spielen, ob sich ihr musikalischer Geschmack und ihre aktive Musikalität verfeinern oder wandeln, all das bleibt ihnen überlassen. Eine frühe Förderung – ob nur in Grundzügen oder in voller Konzentration – ist jedoch wesentliche Voraussetzung für spätere Wahrnehmungsund Ausübungskompetenz, aber auch für jegliche Entscheidungsfähigkeit, sei es in Sachen Musik, sei es in Sachen Religion. Wobei die grundsätzliche Möglichkeit einer auch später erfolgenden biografischen Annäherung nie ausgeschlossen werden kann.
Ein weiterer Vergleichsblick auf Musik: Sollten Kinder ein spezielles Musikinstrument lernen? Reicht nicht eine grundlegende Einführung und Einübung in Musikalität allgemein? Übertragen auf das Feld der Religion: Brauchen Kinder Religion im Sinne der Beheimatung in einer Religion oder reicht nicht eine allgemein religiös-sensible Erziehung und Bildung? Die Musikpädagogik führt uns nachdrücklich vor Augen, dass es zwar sehr wohl eine musikalische Früh- und Grundausbildung gibt, welche die allgemeine Musikalität fördert, dass Kinder aber ohne die vertiefte und zunächst exklusive Einübung in ein ganz bestimmtes Instrument eine tragende Musikalität nicht aufbauen können. Was die spätere Hinzunahme eines anderen Instrumentes oder einen Instrumentenwechsel explizit nicht ausschließt.
Hier freilich kommt der Vergleich an seine Grenzen. Die gleichzeitige Beherrschung mehrerer Instrumente ist durchaus möglich (wenngleich absolute Exzellenz eine Konzentration erfordert!), die gleichzeitige Ausübung mehrerer Religionen in der Regel nicht. Das ist aber auch nicht der hier entscheidende Punkt. Religiosität erweist sich als menschliche Grunddimension und es gibt Mittel und Wege, diese zu fördern: etwa durch Übungen der Achtsamkeit, der Stille, des Staunens, der Meditation, der Förderung grundethischer Werte und allgemein sozialer Verhaltensweisen. So wie im Blick auf Musikalität verlangt aber auch die Förderung von Religiosität die Einübung in ein System, die Beheimatung in eine gelebte Tradition. Das muss ja nicht zwangsläufig die Abwertung anderer mit einschließen, schließt auch die Wahrnehmung und positive Wertschätzung anderer nicht aus. Nur eine starke, nicht enggeführte und nicht angstbesetzte Beheimatung ermöglicht aber eine langfristig tragfähige Öffnung für andere.
Erneut hilft ein Blick auf ein anderes urmenschliches Lernfeld zur Verdeutlichung: Wie erlernen wir Sprache? Indem wir die in unserem Umfeld gebräuchliche Sprache – nicht zufällig ‚Muttersprache‘ genannt – als Normalfall erlernen. Je besser man die eigene Sprache beherrscht, um so leichter wird man später andere Sprachen lernen. Für fast alle Menschen (Ausnahmen gibt es sowohl im Blick auf Individuen als auch auf Kontexte) ist aber eine zu frühe Sprachmischung verwirrend, entwurzelnd, identitätsbedrohend. Natürlich kann man die erste Sprache zugunsten einer später erlernten aufgeben, nicht praktizieren, nur als Referenzform gebrauchen. Auch mag man ‚Fremd-Sprachen‘ schöner finden, reizvoller, attraktiver. Zentral jedoch: Ohne ein Aufwachsen in eine Muttersprache hinein verkümmert die Sprachfähigkeit. Ähnlich verhält es sich auch hier mit dem Bereich der Religionen. Wer zu frühe Mehrsprachigkeit oder Reduktion auf allgemeine Sprachfähigkeit fordert, verkennt das Wesen des religiösen Lernens: ohne Beheimatung keine Identität, ohne eigene Position kein Dialog und keine Toleranz!
‚Kinder brauchen Religion‘ – von welcher konkreten Religion ist im Titel dieses Buches die Rede? Grundsätzlich von der Überzeugung, dass Kinder eben tatsächlich die Religion ihrer regionalen und sozialen Umgebung und Tradition kennen und praktizieren lernen sollten: Juden im Judentum, Muslime im Islam, Hindus im Hinduismus, Buddhisten im Buddhismus, Christen im Christentum ihrer Konfession. Und religiös Positionslose, deren Zahl in unserer Gesellschaft ständig wächst? Sie sollten sich an zwei Kriterien orientieren: Zunächst daran, welche Religion ihrer Umgebung für sie am ehesten akzeptabel ist, zum anderen an der Religion, die ihren sozialen und regionalen Kontext prägt und deren Spuren ihre Lebensumwelt so weit beeinflusst, dass zumindest ein Bescheid-Wissen über wesentliche Regeln und Formen dieser Religion zu den Grundlagen der gesellschaftlichen Konvention gehört.
Da sich Religion nie abstrakt im luftleeren Raum vollzieht, gewinnen Ausführungen darüber nur dann an Bodenhaftung, wenn sie sich auf eine konkrete, gelebte und lebbare Realität beziehen. Und da dieses Buch von einem christlichen Autor stammt, in christlichem Kontext beheimatet ist und auf eine wohl vorrangig christlich geprägte Leserschaft stoßen wird, werden sich die folgenden Ausführungen primär auf das Christentum beziehen. Auch wird – erneut angesichts der Beheimatung des Autors – vor allem ein katholisch geprägtes Christentum vor Augen stehen, in aller ökumenischen Offenheit. Je präziser man zu beschreiben versucht, warum Kinder ‚Religion brauchen‘, wie sie ‚Religion brauchen‘ und welche konkreten erzieherischen und bildenden Maßnahmen dazu getroffen werden müssen, um so notwendiger wird ein klarer Bezug zu gelebtem Glauben in seiner praktischen Gestalt.
Ein Verzicht auf konfessionelle Konkretion wäre nur um den Preis von Unschärfe und blass bleibender Verallgemeinerung zu erkaufen. Deshalb erweisen sich die Präzisierungen aus dem katholisch geprägten Erfahrungsbereich des Autors als unumgänglich, die nie exklusivistisch gemeint sind. Bei fast allen Ausführungen sind Übertragungen in benachbarte Bereiche möglich: vor allem in das Gebiet evangelisch geprägter Christlichkeit, aber auch in die Bereiche der abrahamischen Geschwisterreligionen Judentum und Islam.
2. Lernen?
Was ist das, wie geht das?
Wir haben gesehen: Schon wenn man versucht, den Begriff ‚Religion‘ zu definieren, stößt man auf ein unübersehbares, breit ausdifferenziertes Feld von Definitionen, Perspektiven und Umschreibungen. Dieser Befund gilt umso mehr, wenn man sich dem Versuch zuwendet, das Umfeld von ‚Lernen‘ zu beschreiben, von so grundlegenden Begriffen wie ‚Erziehung‘ und ‚Bildung‘. Hier findet sich ein völlig unübersichlicher Theorienüberschuss, der zu Vereinfachungen zwingt. Im Folgenden werde ich also weder der Komplexität der Fachdiskussionen gerecht, noch füge ich den Theorien eine weitere hinzu. Ich entwerfe schlicht Verständnisgrundlagen für die weiteren Ausführungen. Sie lassen sich – leider – ohne eine gewisse Komplexität der Formulierung nicht verantwortbar treffen.
Unter Lernen soll demnach die prozesshafte – vorübergehende oder dauerhafte – Veränderung von Einstellungen, Kenntnissen, Kompetenzen, Verhaltensweisen oder Handlungsmustern aufgrund von Erfahrungen verstanden werden. Erfahrungen erwachsen ihrerseits aus der untrennbaren Verbindung von Erlebnis und verarbeitender Reflexion. Diese selbst- oder fremdgesteuerten Erfahrungen können sich auf Einzelne beziehen, aber auch auf Gemeinschaften. Sie können gewonnen werden vor allem aus Begegnung mit, Beziehung zu und Reflexion über Menschen, aber auch Gegenständen aus der Natur oder aus der menschgemachten Dingwelt. Religiöses Lernen bezieht sich spezifisch auf solche Prozesse, die entweder unmittelbar religiöse Inhalte betreffen oder sich in einer die naturwissenschaftliche Beweisbarkeit transzendierenden ‚gläubigen‘ Wirklichkeitssicht realisieren.
Lernen kann sich in besonderer, absichtsgeleiteter Form in Prozessen von Erziehung und Bildung ereignen. Zu beiden Begriffen ließen sich ganze Bibliotheken füllen. Hier soll folgende Charakterisierung genügen:
Erziehung
ist vor allem der von Erwachsenen vorgenommene Einfluss auf Prozesse der Selbstwerdung von Heranwachsenden. Erwachsene initiieren, planen, steuern und kontrollieren Lernprozesse, um die Heranwachsenden in die geltenden Normen, Werte, Kenntnisse und notwendigen Kompetenzen der ihnen zugedachten Gesellschaft einzuführen. Eltern, Großeltern und in der Elementarbetreuung Tätige sind deshalb die vorrangigen Subjekte von Erziehungsprozessen. De facto enthalten fast alle pädagogischen Beziehungen und Handlungen – zumindest auch – erzieherische Elemente. Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene können Objekte von Erziehungsmaßnahmen werden (‚Straferziehung‘, ‚Umerziehung‘, …), immer aber handelt es sich um hierarchisch klar getrennte Beziehungen von Erziehenden (‚Subjekt‘) und zu Erziehenden (‚Objekt‘). Mit zunehmendem Alter werden Heranwachsende mehr und mehr zu selbstverantwortlichen Subjekten von Erziehungsprozessen. Schließlich zielt Erziehung darauf ab sich selbst überflüssig zu machen, wenn das Ziel der Maßnahmen erreicht ist. Ihr Anspruch ist immer an zeitlichen und funktionalen Grenzen orientiert.
Ganz anders bei
Bildung:
Bildung zielt auf die ständig wachsende, aber nie abgeschlossene Selbstgestaltung, Selbstverfügung und Selbstverantwortung des einzelnen Subjekts. Ihr Ziel ist die Autonomie und Mündigkeit des Einzelnen, seine reflexionsgesteuerte Fähigkeit zu umfassender Kompetenz, zu vernunftgeleiteter Differenzierung und verantworteter Kritik. Hauptträger von Bildungsprozessen sind Institutionen wie Schule, religiöse Gemeinschaften und Universität sowie Kultureinrichtungen aller Art. Gegen ein rein konstruktivistisches Verständnis, dem zufolge das Kind aus sich heraus stets „in der Lage ist und danach strebt, Selbstbildungsprozesse durchzuführen“, so dass es „in seinen Interessen, Erkenntnissen und Theorien, seinen Selbststeuerungsprozessen und seiner Entwicklung von Problemlösungen möglichst wenig von den Interessen der Erwachsenen beeinflusst werden sollte“, wird hier ein „
ko-konstruktivistischer Ansatz
“ vorgelegt: Demzufolge wird das Kind zwar als „zur Selbstbildung fähig“ verstanden, für die „konkreten Bildungsprozesse als Wirklichkeits- und Sinnkonstruktionen ist es“ jedoch – diesem Verständnis zufolge – bleibend „auf die Anleitung und Begleitung anderer Menschen angewiesen“ (
Hugoth
2012, S. 112f.).
Wenn also in diesem Buch von einer zukunftsfähigen religiösen Erziehung und Bildung die Rede ist, dann in dem Sinne, dass alle für derartige „Anleitung und Begleitung“ relevanten TrägerInnen von Lernprozessen angesprochen werden sollen: Eltern und Großeltern genauso wie in Kindergärten und Kindertagesstätten Tätige; in Kirchengemeinden Aktive genauso wie Vertreterinnen und Vertreter von Schule, Universität, Erwachsenenbildung und von Kultureinrichtungen (Bücherei, Verlagswesen, elektronische und Printmedien, …). Religiöse Lernprozesse sind ein zentraler Teilbereich des Lernens, religiöse Erziehung genauso ein spezifisches Feld wie das der religiösen Bildung. Sie stehen im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen.
3. Veränderte Kindheit
Kind-Sein in der Gegenwart
Wie aber leben Kinder und Jugendliche heute? Was konstituiert ihre gegenwärtigen, ihre möglicherweise künftigen Lebenswelten, auf die sich eine potentiell zukunftsfähige religiöse Erziehung und Bildung ja beziehen muss? Das vielfach aufgenommene Schlagwort der „veränderten Kindheit“ (Maria Fölling-Albers) weist darauf hin, dass Kinder in der westlichen Welt seit einigen Jahrzehnten unter neuen Vorzeichen aufwachsen, bei allen Kontinuitäten, die diese Lebensphase bleibend auszeichnet. Zu diesen Kontinuitäten gehören unter anderem
das biologische und damit eingehend psychologische Wachstum;
die hierarchische Abhängigkeit von Erwachsenen;
der Zwang, aber auch die Chance zum Erlernen grundlegender Kulturtechniken;
sowie die Notwendigkeit des Aufbaus einer eigenen Persönlichkeit.
Von zentraler Bedeutung werden aber jene Merkmale einer eben ‚veränderten‘ Kindheit, die neue Wege des religiösen Lernens nach sich ziehen. Grundlegend wichtig: Veränderung bedeutet nicht zwangsläufig Verschlechterung! Fern von der Idealisierung der eigenen Prägung geht es darum, die Phänomene der beobachteten Veränderungen zu beschreiben, die fast immer sowohl positive als auch negative Aspekte aufweisen.
Biologisch und soziologisch betrachtet endet Kindheit immer früher. Zwar beginnt das Jugendalter juristisch erst mit 14 Jahren, de facto werden Kinder aber immer früher mit der jugendlichen Lebenswelt konfrontiert, oft auch aus eigenem Antrieb. Über Werbung, Medien und Konsumorientierung, aber auch über schulische und allgemeinpädagogische Erwartungen schleichen sich eigentlich jugendbestimmende Faktoren immer früher in die Kindheit. Dieser Prozess spiegelt sich auch in der biologischen Entwicklung, etwa im Blick auf den stetig vorrückenden Beginn der Geschlechtsreife: Fand die erste Regelblutung (‚Menarche‘) bei Mädchen im Jahr 1860 durchschnittlich mit 16,6 Jahren statt, 1950 mit 13,1 Jahren, so liegt der heutige Mittelwert bei 12,5 Jahren. Bei Jungen – hier sind die historischen Werte nicht gleicherart verlässlich erhebbar – liegt das derzeitige Durchschnittsalter beim ersten Samenerguss (‚Ejakularche‘) bei 13,4 Jahren. Konsequenz all dessen: Die Shell-Jugendstudien lassen das von ihnen untersuchte Jugendalter mit 12-jährigen beginnen.
Was also prägt die immer kürzere Kindheit heute? Zunächst wachsen Kinder meistens in veränderten Familienstrukturen auf, sei es als Einzelkinder oder mit einem Geschwist; sei es in klassischer Familienform mit Vater und Mutter, sei es in Patchworkfamilien (oft genug auf Zeit) oder mit einem Elternteil.
Nach offiziellen statistischen Angaben aus den Jahren 2008/2009 handelt es sich derzeit in Deutschland – in starker regionaler Differenz vor allem zwischen ‚alten‘ und ‚neuen‘ Bundesländern – bei 72% aller Familien um verheiratete Paare mit Kindern, 19% sind alleinerziehende Frauen oder Männer mit Kindern, 9% sind nichteheliche Gemeinschaften mit Kindern.
Ein anderer Wert: 13,6% der Haushalte mit Kindern sind so genannte Patchwork-Familien (offizieller Name ‚Stieffamilie‘).
52% aller Familien (als Sammelbegriff sämtlicher gemeinsamer Lebensformen von Erwachsenen und Kindern) sind Einkindfamilien, in 37% leben zwei Kinder, in 11% der Familien wachsen drei oder mehr Kinder auf.
Aus Sicht der Kinder lauten die Zahlen wie folgt: 76% der Kinder wachsen bei ihren verheirateten Eltern auf, 16% bei einem alleinerziehenden Elternteil, 7% in nichtehelichen Lebensgemeinschaften.
Die Beziehung zu den unmittelbar zugeordneten Erwachsenen hat sich für viele Kinder (keineswegs für alle!) verändert: von einem Befehlshin zu einem Verhandlungsstil. Im positiven Sinne kann das bedeuten, dass Erziehende Kinder als Individuen ernst nehmen und an den grundlegenden Entscheidungen beteiligen. Im negativen Sinne kann es sich jedoch auch schlicht um eine Verweigerung von Erziehung handeln, sei es aus Unsicherheit, Unwilligkeit oder Unfähigkeit.
Ein zusätzlicher Aspekt der veränderten Kindheit ergibt sich aus der zunehmenden Mediatisierung unserer Lebenswelt. Für viele Kinder ist das eigene (oder von anderen zur Verfügung gestellte) Kinderzimmer der Hauptaufenthaltsort, nicht mehr ‚Straße‘ oder ‚Natur‘ – wobei man derartige Räume nicht idealisieren darf. Dort freilich erleben sie vieles aus zweiter Hand, über (oft genug: elektronische) Medien, in sich potentiell durchaus wertvoll, aber eben ein Feld von Sekundärerfahrungen. Die Bereiche von Welterfahrung und Kommunikation werden mehr und mehr medial gesteuert.
Ein Weiteres kommt hinzu: Kindheit wird heute mehr und mehr verplant. Die Lebensräume von Elementarbetreuung und Schule nehmen immer mehr Zeit für sich in Anspruch. Auch die Freizeit wird streng getaktet und von Erziehungsberechtigten verwaltet und organisiert. Diese verplante Kindheit lässt immer weniger Schlupflöcher, kaum unbeaufsichtigte Phasen, nur geringen Raum zur nicht funktional und fremdbestimmten Selbstentfaltung. Viele Kinder leiden unter dem Phänomen der pädagogischen ‚Überbehütung‘, unter Eltern, die ihre Kinder vor lauter Sorge so stark beschützen (und dadurch: bestimmen) wollen, dass ihnen schon die ‚Abgabe‘ der Kinder an Kindertagestätten oder an die Schule schwer fällt. Wie sehr sie dadurch eine eigenständige Entwicklung ihrer Kinder behindern, wird ihnen dabei selten bewusst.
In all diesen Aspekten sind heutige Heranwachsende buchstäblich Kinder ihrer Zeit, haben sie Anteil an jenen Entwicklungen der gesellschaftlichen Gegenwartsepoche, die man als ‚Postmoderne‘ zu beschreiben versucht. Doch bevor eine knappe Skizzierung der Merkmale dieses Zeitalters versucht wird, eine notwendige Nachbemerkung: Die Zeichnungsversuche der ‚veränderten Kindheit‘ in Deutschland beziehen sich lediglich auf zwei Drittel der derzeit hier lebenden Kinder. Ein weiteres Drittel wächst in pädagogischen Grauzonen auf, erzieherisch vernachlässigt, weitgehend sich selbst überlassen, als Verlierer des Bildungssystems, lebend in oder bedroht von Armut und Marginalisierung. Gerade ein Blick auf religiöse Erziehung und Bildung darf diese Kinder und ihre spezifische Lebenswelt nicht aus den Augen verlieren.
4. Aufwachsen in der Postmoderne
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Unsere Epoche – und damit die Rahmenvorgaben für das Aufwachsen unserer Kinder – ist geprägt von Veränderungen, die man mit einigen etablierten Schlagwörtern umreißen kann (vgl. Mendl 2011, S. 15). Erneut geht es nicht um Wertungen, sondern um Beschreibungen von Tendenzen, die immer positive wie negative Auswirkungen mit sich bringen.
Im Übergang von der vernunftgeprägten und entwicklungsoptimistischen Moderne zeichnet sich die sogenannte Postmoderne durch eine generelle
Detraditionalisierung
aus: Die herkömmlichen Traditionen – moralisch, gesellschaftlich, politisch – werden in Frage gestellt, relativiert, auf ihre Bedeutsamkeit für unsere Zeit überprüft. In den Sog dieser Überprüfungen geraten auch die Religionen, die sich neu als gegenwartswirksam erweisen müssen.
Diese Detraditionalisierung geht Hand in Hand mit einer
Deinstitutionalisierung:
Institutionen (Parteien, Gewerkschaften, Vereine, …), die lange Zeit das öffentliche Verhalten entscheidend prägten und kontrollierten, verlieren an Mitgliedern, Einfluss und Zuspruch. Dabei wird ihre die Einzelnen entlastende Funktion genauso geschwächt wie ihre wertorientierende Ausstrahlung, nicht zuletzt ihre Machtausübung. Zu diesen Institutionen gehören in vorderer Linie auch die etablierten Kirchen. Jährlich schrumpft die Katholische Kirche in Deutschland um weit mehr als 150.000 Menschen, sei es durch Kirchenaustritte (2012: 118.335; Eintritte: 3.091; Wiederaufnahmen 7.185), sei es dadurch, dass weit mehr Katholiken sterben (Bestattungen 2012: 247.502) als durch Taufe neu aufgenommen werden (2012: 167.505; vgl. Katholische Kirche in Deutschland, S. 14ff.).
Detraditionalisierung und Deinstitutionalisierung sind wiederum Konsequenzen einer spürbaren
Pluralisierung
unserer Gesellschaft. Über Jahrhunderte hinweg lebten die meisten Menschen in weitgehend homogenen Gesellschaften mit klaren Wertehierarchien: Was gut und böse war, was man glauben durfte oder sollte, wie man sich verhalten und handeln musste – all das war gesellschaftlich vorgegeben und normiert. Anders heute. Zum einen speist sich unsere Gesellschaft aus Menschen unterschiedlicher Herkunft, Volkszugehörigkeit, Religion. Zum anderen werden aber unterschiedliche Werte, Normen, Lebenskonzepte und Lebensformen, Sinnangebote und Glaubensüberzeugungen
innerhalb
kleiner Gemeinschaften genauso gelebt und akzeptiert wie in der über Medien und Migration immer deutlicher präsent werdenden Weltgemeinschaft. Das Christentum hat die lange Zeit vorherrschende Rolle als maßgeblicher weltanschaulicher Rahmen verloren. Pluralisierung, die sich auch innerhalb des Christentums selbst findet, schließt die
Gleichwertigkeit
der unterschiedlichen Optionen ein. Anstelle einer früher vorherrschenden Hierarchie der Werte und Lebensmodelle findet sich nun ein großes Nebeneinander von gleich-wertigen Entwürfen und Angeboten. In diesem Zusammenhang spricht man auch vom ‚Warenhauscharakter‘ der Postmoderne – man kann sich aus einem breitgefächerten Angebot bedienen, sofern man dazu über Möglichkeiten und Mittel verfügt.
Eine entscheidende Konsequenz der Pluralisierung ist die
Privatisierung
. Was gut und richtig ist, welcher Religion man sich anschließt, welche Form der Lebensgestaltung man wählt, all das bleibt weitgehend dem Einzelnen und seinem privaten Umfeld überlassen. Gerade im Blick auf Religion gibt es kaum noch gesellschaftliche Anpassungszwänge – jeder kann und muss selbst frei entscheiden, ob, wie und mit welcher Form von Religion er sein Leben gestaltet. Dieser Zug zur
Individualisierung
geht Hand in Hand mit einem Bedeutungsverlust der Kirchen im öffentlichen Leben. Da Religion und Moral mehr und mehr als Privatsache angesehen werden, spricht man gerade den Kirchen immer deutlicher das Recht ab, über den privaten Bereich hinausgehende gesellschaftliche Ansprüche anzumelden. Sie sollen sich vielmehr gleichförmig in die breite Reihe der Sinnanbieter einreihen.
Aus all dem ergibt sich das ambivalente Phänomen von
Freiheit
auf der einen,
Orientierungslosigkeit
und Überforderung auf der anderen Seite. Für viele Menschen liegt ein zentraler Fortschritt, ein wirklicher Gewinn der Postmoderne gerade in der über die geschilderte Privatisierung ermöglichten Freiheit. Menschen haben wie wohl nie zuvor die Wahl, wie sie ihr Leben gestalten, wo sie sich engagieren, nach welcher ethischen und religiösen Orientierung sie ihr Leben gestalten wollen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Für viele andere wirkt sich diese Freiheit konkret als Orientierungslosigkeit aus, der sie sich hilflos ausgeliefert fühlen. Für sie ist die Postmoderne die Zeit der
neuen Unübersichtlichkeit,
der Beliebigkeit. Sie fühlen sich überfordert im Blick auf die entscheidenden Fragen ihres Lebens wie Berufswahl, Partnerschaftsgestaltung, moralischer und religiöser Orientierung. Wo also manche die
Gleich-Gültigkeit
pluraler Lebensentwürfe als den großen Gewinn der Postmoderne feiern, ergibt sich für andere die resignative Wahrnehmung von
Gleichgültigkeit
und Wertenihilismus.
All diese Phänomene der Postmoderne stehen freilich unter dem Vorzeichen radikaler
Ungleichzeitigkeit
. Die genannten Faktoren werden völlig verschiedenartig wahrgenommen, man kann nicht mit einheitlichen Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Lebensmustern rechnen. Zur Pluralität gehört es konstitutiv, dass Tendenzen neben Gegentendenzen stehen, Strömungen neben Gegenströmungen. Gegen die Tendenzen zur
Internationalisierung
und
Globalisierung
stehen Bewegungen, die das Regionale neu entdecken. Gegen die Tendenz zur Privatisierung lassen sich im Blick auf die Macht der Großkonzerne und der Weltpolitik Bestrebungen zur
Homogenisierung,
zur weltweiten Gleichschaltung gerade im Konsumverhalten aufzeigen.