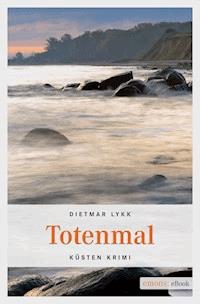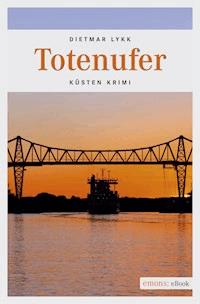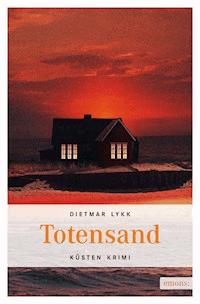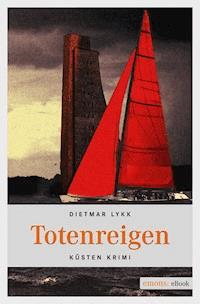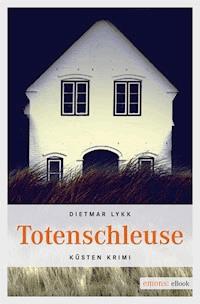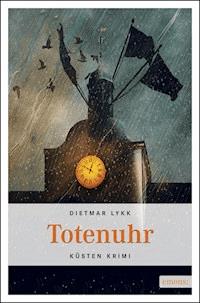
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eric Lüthje, Gerson Malbek
- Sprache: Deutsch
Der Industriellen Margot von Roekkelsdorff wird in ihrer Schleswiger Villa buchstäblich der Hals umgedreht. Kommissar Lüthje gerät unter Tatverdacht. Sein Vater könnte ihm helfen, doch der schweigt. Er weiß, dass es um viel mehr geht. 'Die Wege des Herrn sind unergründlich', sagt Kommissar Malbek und versucht auf seine Weise, die Mauer des Schweigens um Lüthje zu durchbrechen. Aber nichts ist so, wie es scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Lykk, Jahrgang 1949, wurde in Kiel geboren und studierte Rechtswissenschaften, Soziologie und Philosophie in Kiel und Hamburg. Forschungstätigkeit und Veröffentlichungen zur Sprachsoziologie mit mehreren Auslandsaufenthalten in London. Er lebt und arbeitet bei Flensburg.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-700-0 Küsten Krimi 4 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
The Middle of the Road Is a Very Dead End
Englische Redewendung
In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod
Deutsche Redewendung
Kiel, 10.April 1945
»Matrosengefreiter Lüthje!«
»Scheiße«, zischte Heinz Lüthje. Hätte er doch vorhin bei der Probefahrt nicht wieder sein Maulwerk so weit aufgerissen. Er hatte sich jetzt zwar schon hundert Meter vom U-Boot entfernt, aber im riesigen U-Bootbunker Kilian hallte sein Name nach. Er konnte nicht so tun, als hätte er es nicht gehört, und seinen Gang zu den Toiletten im Außenbereich fortsetzen.
Während der mehrstündigen Probefahrt des neuen Elektro-U-Bootes U-4708 hatte er den Gang zur Toilette an Bord, solange es ging, hinausgeschoben. Der Anblick der U-Boot-Toiletten ließ jedes Mal Panik in ihm aufsteigen. Es war das Gefühl, in einem kleinen Stahlsarg zu sitzen. Ein Kindersarg, der in einen Familiensarg eingebaut war. Außerdem wurde die Toilette wegen des Platzmangels auch als Stauraum für Lebensmittel benutzt. Das kam Heinz beim Essen buchstäblich hoch. Aber als Elektriker mit Gesellenbrief brauchte man ihn hier, er musste nicht an die Front und nur manchmal zur Probefahrt raus. Leider war die Front der Werft und seiner Heimatstadt Kiel sehr nahe gekommen.
Ein frischer auflandiger Nordostwind trieb den Gestank der zerstörten Stadt Richtung Neumünster und Rendsburg. Die Kläranlagen funktionierten nicht mehr, und die Abwässer flossen ungeklärt in den Kleinen Kiel und in die Förde. Überall Berge von Trümmerschutt und Müll, auf denen Kinder spielten und Ratten reichlich Nahrung fanden. Ein Millionenheer von Fliegen hielt die Stadt schon seit Jahren besetzt. Die Vögel waren nach den unzähligen Bombenangriffen fast alle aus der Stadt geflohen. Die Ratten versuchten ihr Bestes, sie mit ihrem schrillen Pfeifen zu ersetzen.
»Matrosengefreiter Lüthje!«
Die schneidende Stimme war jetzt dicht hinter ihm. Der Alte war ihm nachgegangen. Heinz konnte sein Verhalten nicht einschätzen. Vielleicht war er ja immer so, der U-Boot-Kommandant Oberleutnant zur See von Stamm.
»Sind Sie schwerhörig, Mann?«, schrie der Alte. Heinz deutete mit schüchterner Bewegung in Richtung Toiletten. »Sie da!« Der Alte hatte ein neues Opfer, einen vorbeigehenden Werftarbeiter. »Melden Sie sich beim Obergefreiten Paustian auf U-4708. Sie vertreten bis auf Weiteres den Matrosengefreiten Lüthje.«
»Aber ich wurde von Oberbootsmann Pischke zur Tischlerei geschickt, um…«, sagte Karl Krützfeldt. Karl war ein erfahrener Werftarbeiter, fünfzig Jahre alt. Aber wenn ein U-Boot-Kommandant ihm einen Befehl gab, hatte er ihn sofort auszuführen, auch wenn zuvor ein Oberbootsmann ihm etwas anderes befohlen hatte. Karl warf Heinz einen mitleidsvollen Blick hinüber, der mit hängenden Schultern und verkniffenem Gesichtsausdruck unruhig hinter dem Alten stand. Wenn der Kommandant einen nach einer Probefahrt so rauszitierte wie seinen Freund Heinz, dann war der in großen Schwierigkeiten. Karl nickte ihm aufmunternd zu. Er war überzeugt, dass er es besser getroffen hatte. Schließlich war es ihm egal, ob er nun auf dem großen U-170 oder dem kleineren U-4708 nebenan irgendwelchen Befehlen folgte. Heinz winkte Karl noch einmal kurz zu, als der in den Turm des U-4708 einstieg. Morgen war die Abnahme des Bootes durch die Marineaufsicht. Das Aufbringen der neuen gelochten Kunststofffolie gegen Schallortung, »Alberich« genannt, hatte die Fertigstellung schon um eine Woche verzögert. Sie würden die ganze Nacht durcharbeiten müssen. Vielleicht konnte er Karl nachher wieder ablösen oder mit ihm zusammenarbeiten.
»Ich dachte, Sie müssen dringend scheißen, oder haben Sie wieder die Befehlsgewalt über Ihren Arsch erlangt, Lüthje?«
»Na endlich! Folgen Sie mir!« Der Alte hatte vor den Toiletten auf ihn gewartet. Heinz bekam Angst. Zwar hatte der Kommandant nur gesagt, er solle ihm folgen. Und nicht vor ihm hergehen. Er hatte nicht die Pistole gezogen und ihn mit vorgehaltener Waffe zum Gebäude des Stützpunktes befohlen. Aber das hieß im Grunde gar nichts. Heinz ahnte nämlich, welchen Fehler er gemacht hatte. Als sich der Kommandant auf der Rückfahrt nach Kiel lautstark darüber beschwerte, dass er den neuesten Wehrmachtsbericht nicht mehr hören könne, weil sein Volksempfänger nicht mehr funktioniere, hatte Heinz seinen Mund nicht halten können. Dabei war er in die Falle getappt. Er hatte den Kommandanten gefragt, was denn an dem Volksempfänger nicht stimme, ob die Senderabstimmung nicht funktioniere oder ob der Lautsprecher jaule oder man vielleicht nicht einmal mehr das Rauschen der Endstufe höre.
Darauf hatte der Kommandant mit komischem Unterton gesagt: »Das hört sich ja so an, als ob Sie sich mit Radiogeräten gut auskennen, Matrosengefreiter Lüthje.«
Das Schlimmste daran war: Heinz war nicht in der Partei. Er hatte sich rausgeredet. Er war ein politisch unzuverlässiger Spezialist, den man brauchte. Noch. Deswegen war er immer noch Matrosengefreiter. Das war so viel wie Schütze Arsch. Heinz, du bist ein Trottel. Wer sich mit Radios auskennt, kann auch unbemerkt Feindsender hören. Und genau das tat er, sooft er konnte. Er hatte so vielen Kameraden schon das Radio repariert. Einer von denen hatte bestimmt was erzählt. Und er hatte sich jetzt endgültig verraten.
Das bedeutete die Todesstrafe. Mindestens aber das Arbeitserziehungslager Nordmark in Russee. Was auf dasselbe rauskam. Ein KZ-Außenlager von Neuengamme war das, nichts anderes, das wusste doch jeder. Vor ein paar Jahren hatte er im Radio von einem Jungen gehört, Helmut hieß er, das wusste er noch, der war wegen Abhörens von Feindsendern zum Tode verurteilt worden. Sie hatten ihn in Plötzensee an der Wand aufgehängt. Siebzehn Jahre alt war er. Aber der hatte ja die BBC-Nachrichten mitgeschrieben und dann auf Flugblättern unter Arbeitskollegen verteilt. So dumm war Heinz nicht. Er hörte es allein in seinem Mansardenzimmer in der Tirpitzstraße, höchstens mal zusammen mit Karl.
Heinz hatte keine Freunde. Karl Krützfeldt aus Laboe war wohl so etwas wie ein Freund, wegen des Altersunterschiedes ein väterlicher Freund. Jedenfalls standen sie oft in den Arbeitspausen zu zweit, rauchten eine Zigarette und konnten auch dasitzen, ohne etwas zu sagen, nur zusammen Bier trinken oder BBC hören. Karl hatte einen eigenen Kopfhörer, den er mitbrachte, wenn er Heinz besuchte, und ein bisschen verstand er auch etwas von Schaltplänen, Einkreisern, Superhets und modernen Drehkondensatoren. Das war wohl Freundschaft.
Der Alte ging auf das Wohnschiff Holtenau, das am Kai zur Schwentinemündung festgemacht war. Vielleicht wollte der Alte ihn hier erst mal allein verhören.
Hier wohnte er seit seinem Dienstantritt in Kiel. Nur wer am Stadtrand noch keinen Unterschlupf gefunden hatte, übernachtete hier. Bei Luftalarm hatte man höchstens eine Stunde Zeit, in einen Bunker zu fliehen. Der Alte war angeblich aus Pillau gekommen, nachdem russische Flieger sein U-Boot im Hafen mit einem Volltreffer versenkt hatten. Er war zufällig nicht an Bord gewesen. Er hätte als Einziger überlebt, hieß es.
»Da steht er!«, sagte der Alte, als sie in seiner Kajüte angekommen waren. Er deutete zum Volksempfänger auf einem kleinen Tisch vor der Luke. Es war ein VKE301. Zur Stromversorgung mit Bleiakkus war das Netzteil überbrückt worden, da Originalbatterien nicht einmal auf dem Schwarzmarkt zu bekommen waren. Genau wie bei ihm in seiner Mansarde. Auch Karl kannte die Art der Überbrückung. Er schien für den Alten hier tätig gewesen zu sein. Ein Stück Hochfrequenzlitze hing als Antenne aus der angelehnten Luke. Die Antennenlitze war ein besonderer Luxus. Sonst hätte man in diesem Wohnschiff, das nichts anderes war als ein großer Eisenkasten, nur Rauschen aus dem Lautsprecher gehört. Die Luke ging nach Westen. RichtungBBC.
»Was gucken Sie so blöd, Lüthje? Sie haben doch gesagt, dass Sie was davon verstehen. Also los, frisch ans Werk, junger Mann!« Er schob die Mütze ein Stück in den Nacken und setzte sich mit verschränkten Armen erwartungsvoll auf einen hölzernen Schreibtischsessel, der sicher aus einem der zerbombten Verwaltungsgebäude auf dem Werksgelände stammte.
Heinz kannte die Macken dieses Gerätetyps. Der Abstimmknopf war von der Welle der Skalenscheibe gesprungen. Die Schraube, die das Rotorpaket des Drehkondensators auf der Antriebsachse festhielt, hatte sich gelöst. Ein derartiger Defekt trat nur auf, wenn man sehr oft den Sender wechselte. U-Bootkommandanten taten das nicht, weil sie nur den Großdeutschen Rundfunk hörten. Heinz dämmerte, dass der Kommandant ihn als Reparateur ausgewählt hatte, weil er irgendwoher wusste, dass Heinz BBC hörte. Er suchte sich einen Mann, der auch den Feindsender hörte. Der würde ihn nicht verraten, weil er sonst Gefahr liefe, auch verraten zu werden. Eine stillschweigende Vereinbarung.
»Das kommt oft vor mit dieser Schraube, Käpt’n. Fertigungsmangel, der in den letzten Jahren häufig beobachtet wurde«, sagte Heinz. Sollte heißen: Ich habe verstanden, ich verrate dich nicht. Funktionsstörung.
Heinz fand den passenden Schraubenzieher im Sortiment in seiner Jackentasche, zog die Schraube fest und schob das Chassis wieder zu. Er schaltete das Radio ein, drehte am Abstimmknopf, das Rauschen wechselte, mehr hörte man nicht. Die Sendungen des Großdeutschen Rundfunks beschränkten sich mehr und mehr auf Übertragung von Wehrmachtsberichten und Sondermeldungen. Heinz widerstand der Versuchung, zur Frequenz BBC zu wechseln.
»Sie haben dienstfrei bis morgen früh, Matrosengefreiter Lüthje«, sagte der Kommandant. Sollte heißen: Wir haben uns verstanden, ich verrate dich auch nicht.
Einer, der ein Geheimnis mit mir teilt, ist ein Freund, dachte Heinz. Dann hatte er jetzt zwei Freunde, Karl und den Alten.
Als er aus dem Wohnschiff kam, blendete ihn die Nachmittagsonne in den Fenstern der Sanitätsbaracke. Er hob die Hand schützend vor die Augen und sah, dass sich das Sonnenlicht in den Splittern einer Fensterscheibe reflektierte, die, wie ein Strahlenkranz angeordnet, im Rahmen steckten. In der Mitte des Strahlenkranzes sah er ein Frauengesicht, eingerahmt von schwarzschweren Locken. Er blinzelte, das Gesicht verschwand. Ein paar Sekunden später trat eine schlanke Frau in sehr figurbetonter Schwesternuniform aus der offenen Tür der Baracke, sah noch einmal zu ihm hinüber, lächelte, wandte sich dann ab und rief einer Gruppe von Krankenschwesterhelferinnen etwas zu, die einen Lastwagen mit Wäschesäcken beluden. Plötzlich drehte sie sich wieder zu ihm um, als hätte sie seinen Blick im Rücken gespürt. Sie schloss für ein paar Sekunden die Augen. Es war, als ob sie direkt vor ihm stünde. Ihr Gesicht näherte sich seinem, so als ob sie ihn küssen wollte. Ihr starkes Parfüm stach ihm paradoxerweise als hoher Ton schmerzhaft in den Ohren. Ihr schwarzes, gelocktes Haar fiel in weichen Linien über die Schultern. Sie öffnete plötzlich wieder die Augen, und Heinz hörte sie Anweisungen rufen, die Helferinnen kletterten auf die Ladefläche, der Motor wurde angelassen. Die Frau hielt sich mit einem Arm am Türholm neben dem Beifahrersitz fest, zog ihren engen Rock etwas höher, wandte sich noch einmal zu ihm und schlug die Wagentür zu, der Lkw sprang zögernd an und verschwand in Richtung Werkstor.
Heinz war nach hundert Metern vom Fahrrad gestiegen, der Gleichgewichtssinn war ihm irgendwie abhandengekommen. Den Rest des Heimwegs schob er sein Rad und hing seinen Gedanken nach. Sie war zweifellos die schönste Frau der Welt. Dichte schwarze Locken, die bei jeder ihrer sinnlich-eleganten Bewegungen hin und her schwangen. Die schwarzen Strümpfe. Makellos geformte Beine. Wie die Dietrich.
Sie war offensichtlich Krankenschwester. Ärzte sah man nur noch selten auf dem Werftgelände. Man fand sie in den überbelegten Krankenhäusern oder an der Front. Krankenschwestern und ihre Helferinnen waren an ihre Stelle getreten. Sie versorgten täglich die verwaiste Krankenstation der Werft mit dem Nötigsten und behandelten kleine Arbeitsunfälle. Jeder wusste, dass die Frauen ihre überall gültigen Passierscheine auch zu anderen Zwecken nutzten. Sie hatten Zugang zu den Vorratslagern und schafften so viel raus, wie sie konnten. Vieles von dem tauchte in den mobilen Krankenstationen in der Stadt auf. Aber sie holten auch alles, was auf dem Schwarzmarkt begehrt war: Zigaretten, Lebensmittel, Decken und Alkohol.
»Junger Kerl, hast keine Augen mehr ihm Kopf?«, schimpfte eine alte Frau in einem speckigen Männermantel mit Fischgrätmuster, mit der er zusammengestoßen war. Heinz murmelte eine Entschuldigung und sammelte die aus ihrem Rucksack herausgefallenen Kartoffeln ein. Frühkartoffeln. Eine Delikatesse. Er widerstand der Versuchung, ein paar für sich einzustecken. Wahrscheinlich war sie dafür den ganzen Tag im Umland unterwegs gewesen. Zwischen den Kartoffeln lag eine angerostete Handglocke mit abgewetztem Holzgriff am Boden. Heinz hob sie auf und gab sie der Frau in die schwielige Hand. Ein kleines Gesicht wie ein vertrockneter Apfel sah ihn an, zerknittert und fleckig, trübgelbes Augenweiß. Ein paar Pflaster deckten notdürftig ein paar nässende Pickel ab. Sie wandte sich zum Gehen, dann drehte sie sich wieder um und sah Heinz prüfend ins Gesicht. »Du siehst glücklich aus. Warum?« Ihre Stimme klang brüchig und gleichzeitig überraschend jung.
Heinz öffnete den Mund. »Ich…« Ihr schien es Antwort genug, und sie schlug die Glocke mit der Hand, als ob sie der Stadt nun als Stadtruferin die wundersame Kunde von dem jungen, glücklichen Mann verkünden wollte, der nichts über sein Glück sagen konnte. Heinz gab ihr die Tasche mit den eingesammelten Kartoffeln und sah ihr nach, bis sie in die Allee einsturzgefährdeter Keller einbog, die einmal die Faulstraße gewesen war, und die Glockenklänge langsam erstarben.
Man sah in diesen Zeiten nur glücklich aus, wenn man den Verstand verloren hatte– vor Schmerz oder vor Glück? War er glücklich? Natürlich, immerhin war er der schönsten Frau der Welt begegnet. Und sie hatte ihm tief in die Augen gesehen. Wenn das kein Grund war, glücklich zu sein. Als er sich vorstellte, dass er sie irgendwann wiedersehen würde, verließ ihn der Mut.
Seit ein paar Wochen trug er einen Brief an Gerda in seiner rechten Jackeninnentasche. Beim letzten Streit mit Gerda hatte er ihr geraten, doch gleich mit dem spitznasigen Leutnant am nächsten Tisch anzubändeln, der würde doch schon ständig nach ihr schielen. Es war ihr letzter Streit gewesen. Er hatte sie überhaupt erst auf den Schönling aufmerksam gemacht. Am Kleinen Kiel, kurz vor der Bergstraße, zog er den Brief aus der Tasche, zerriss ihn und sah den beschriebenen Papierschnipseln zu, wie sie sich vom leichten Nordostwind auf das Wasser treiben ließen.
Als er sein Fahrrad müde die Bergstraße hochschob, fiel ihm wieder ein, dass er seit Monaten einen Umweg nahm. Im Winter hatte er dreimal vergeblich versucht, wie früher, den kürzesten Weg vom Kilian in Dietrichsdorf zu seinem Dachzimmer in der Tirpitzstraße69 zu nehmen. Im Januar hatte er aufgegeben. Er ertrug das Gefühl der erneuten Niederlage nicht mehr. Davon hatte es in seinem jungen Leben schon genug gegeben. Es fing damit an, dass er sich irgendwann im vergangenen Herbst im Traum durch eine verbrannte Landschaft quälen musste. Das Atmen fiel ihm schwer, er konnte nicht richtig sehen. Er wollte schreien, aber aus seiner Kehle kam nur ein Röcheln. Er sah an sich herunter und merkte, dass er nackt war, faltige Hände voller Altersflecken, ein ausgemergelter Körper, dürre Beine, überall stachen Knochen heraus. Er begriff, dass er ein Greis war, mit verbrauchten Gliedern und Sinnen. Todesangst würgte ihn. Er erwachte mit einem Schrei in kaltem Schweiß auf. Am nächsten Morgen nahm er sich vor, den Traum zu vergessen.
Nach Dienstschluss musste er wie immer um die Hörn mit dem Fahrrad Richtung Seegarten fahren. Der Fährbetrieb war seit Langem eingestellt. Voriges Jahr waren die Fähranleger auf beiden Uferseiten zerstört worden. Die Fähre war mit einem Volltreffer versenkt worden, nur die Schornsteine ragten noch aus dem Wasser und riefen mit den drei aufgemalten Ringen immer noch den Namen des Schiffes: Tertius.
Als er ein paar Meter im Prinzengarten geradelt war, brach ihm wieder der kalte Schweiß aus. Vor ihm lag die Landschaft aus dem Traum. Er ging zwischen verbrannten Baumstümpfen, braungrünen Grasinseln, zerrissen von der tödlichen Glut neuer Bombenkrater und den Feuerfunken, die bei den nächtlichen Angriffen über die Stadt in jeden Winkel Feuer brachten, der bisher verschont geblieben war. Der Frühling nahte, und das Grün wagte einen neuen vergeblichen Anlauf. Die Vögel würden zurückkommen. Es würde noch entsetzlicher sein, weil alles beim nächsten Luftangriff wieder verbrennen würde. Auch viele Vögel, die schon beim Herannahen der Flieger jede Orientierung verloren.
Heinz war vom Fahrrad gestürzt. Er hatte sich die nach Halt suchende linke Hand aufgeschürft, sein Kinn hatte eine blutende Schramme, das Knie tat nur etwas weh. Er war also doch noch kein Greis. Aber er konnte diesen Weg im Prinzengarten nie mehr betreten.
Der von seinen Ängsten erzwungene Umweg führte am Fischmarkt vorbei, durch die Flämische Straße, auf den Alten Markt. Heinz blieb stehen und sah zu den Trümmern der im letzten Jahr zerstörten Nikolaikirche hoch, dem höchsten Punkt der Innenstadt. Er blieb jedes Mal so lange, bis das Gefühl von Traurigkeit ihn überwältigen wollte, bis er die Tränen tief aus der Brust aufsteigen fühlte. Im letzten Winter, als der Schnee sich wie ein Leichentuch über die Trümmerberge gelegt hatte und hier nur die Reste des Kirchenschiffs als Mahnmal aufragten, meinte er für einen Moment, statt der Tränen so etwas wie Todessehnsucht aufsteigen zu spüren. Vielleicht war es auch einfach nur Resignation, also das, was man als junger Mensch von neunzehn Jahren schon für Todessehnsucht hielt. Wenigstens hatte ihn der Umweg von seinen Ängsten befreit.
Jetzt lag kein Schnee mehr, hier gab es keine leeren Versprechungen, nicht die Lüge eines Neubeginns im Frühling, wie im Park zwischen Prinzengarten und Schlossgarten am Kleinen Kiel. Die Straßen waren nur noch schuttgesäumte Schluchten. Dazwischen Häuserwände mit leeren Fensterlöchern, die vorher Kirchen, Kaufhäuser, Wohnhäuser gewesen waren. Als Ruinen glichen sie sich fast ununterscheidbar. Nur wer die Stadt vor dem Krieg gekannt hatte, konnte sagen, dies war die Kirche, hier standen die Persianischen Häuser, dort das Stadtcafé. Für Heinz war die tote Stadt ehrlich und schön. Wenn die Sonne schien, fasste der Himmel mit dürren Lichtfingern durch die leeren Fensterhöhlen und malte schmerzhaft verzerrte Muster auf die Schutthügel. Kinder spielten in den Lichtinseln auf den Hügeln und banden die Grenze zwischen Licht und Schatten in ihr lebensgefährliches Spiel ein. Wenn der Himmel über Kiel eisengrau und schwer wie eine Bunkerdecke hing, begrüßte Heinz die zerstörten Hausfassaden wie Theaterkulissen seiner verlorenen Jugend.
Heinz überlegte, ob er sich in Laboe ein Zimmer suchen und Fischer werden sollte. Der Gedanke gefiel ihm. Wenn er dann noch die richtige Frau dabeihätte… er hatte heute die schwarzbestrumpften Beine der schönsten Frau der Welt gesehen. Aber vielleicht gab es ja in Laboe schöne Fischertöchter.
Er wachte auf, ohne sich an einen Traum erinnern zu können. Er erhob sich von seinem Bett, öffnete die vordere Dachluke, von der er die Werft und den Kilian sehen konnte, nachdem die Bomben der letzten Monate eine Sichtschneise durch Häuser und Bäume hinunter bis zum Hindenburgufer geschlagen hatten. Er vergewisserte sich, dass die Tür zum Treppenhaus abgeschlossen war, zog die kleine Blechdose aus der Hosentasche, öffnete den Knebelverschluss und sog den Duft der salbenartigen, eichenholzfarbenen Paste gierig ein. Er hebelte die Türschwelle an der Zimmertür mit einem Schraubenzieher auf, entnahm dem Versteck ein Stoffbündel und wickelte Lötkolben und das zum Knäuel aufgerollte Lötzinn aus. Der harzig-malzige Rauch erfüllte die Dachkammer, als sich der Kolophoniumrest an der Lötspitze langsam erhitzte, und umschwebte in Wirbeln die geöffnete Dachluke, als wolle er das Zimmer nicht verlassen. Ohne Kolophonium hatte das Lötzinn keine Fluss- und Hafteigenschaften. An einer »kalten«, defekten Lötstelle war meist mit Kolophonium gespart worden.
Heinz öffnete die Hinterabdeckung des Radios. Es war ein »Kapsch4-Röhren-Batteriesuper«, das ihm seine Eltern Weihnachten 1941 geschenkt hatten. Klein, einfach, deshalb wartungsarm, aber komfortabel für Mittelwellen-, Langwellen- und Kurzwellenempfang ausgestattet, für alle Sender der Welt. Die benötigten Batterien und Akkus für die Stromversorgung waren immer »Fundstücke« von der Werft.
Er setzte die Lötspitze auf und beobachtete, wie sich die starre kalte Lötstelle in heiß waberndes rauchendes Silber verwandelte. Im Alter von sechs Jahren hatte sein Vater ihm erlaubt, den Zauberstab festzuhalten, während das Metall sich verflüssigte. Er lernte, wie er Körperhaftes voneinander trennen, aber auch für immer verschmelzen konnte. Das Kolophonium war der Katalysator, der den Zauberstab zum Leben erweckte. Zusammenfügen, verschmelzen. Bis man sich entschied, sie zu trennen. Einen Tag lang. Oder für immer.
Er klemmte die Kopfhörerbuchsen an die Lautsprecherpole und schaltete das Radio ein. Nachdem sich Heinz vergewissert hatte, dass der Lautsprecher stumm blieb, setzte er die Kopfhörer auf. Die Röhren begannen ihr sanftes Glühen, und aus weiter Ferne näherte sich in den Kopfhörern das feine Rauschen des Äthers. Irgendein regionaler Sender des Großdeutschen Rundfunks war eingeschaltet, der aber kein Programm, nicht einmal ein Erkennungszeichen sendete. Die Sendeenergie verströmte ungenutzt. Heinz sah einen menschenleeren Senderaum mit seinen mannshohen Senderöhren vor sich, die niemand mehr abschalten konnte oder wollte.
Die Sirenen heulten auf. Luftalarm. Die wenigen Lichter verloschen, die Stadt versank in schwarzer Angst. Tausende Menschen drängten jetzt in die Luftschutzräume in den Kellern der Mietshäuser und in die würfelförmigen grauen Bunker, die im Stadtbild immer deutlicher hervortraten, je mehr die Häuser den Bomben zum Opfer fielen.
Er hatte vor Monaten ein paar Straßen weiter im Bunker im Düsternbrooker Gehölz Schutz gesucht. Es war keine Halle mit Betonhimmel wie der Kilian, sondern das überfüllte Wartezimmer der Hölle. Das Schluchzen, Flüstern, die Flüche, laute und leise Gebete, die Augen der Kinder, der Geruch der Angst, die gehetzten Blicke zum Ausgang, ob er diesmal wieder frei von Trümmern bleiben würde. Wenn nicht, wie lange würde der Sauerstoff reichen? Inzwischen waren die Menschen, mit denen er die Angst geteilt hatte, alle tot. Der Bunker hatte einen Volltreffer abbekommen, als Heinz sich ausgerechnet an diesem Abend auf dem Weg nach Haus, vom Alarm überrascht, noch in den Gablenz-Bunker an der Werftstraße flüchten konnte. Er war wieder einmal davongekommen. Seitdem blieb er bei jedem Luftangriff in seiner Mansarde.
In jeder schuttgesäumten Straße gab es inzwischen mindestens einen ehemaligem Hauseingang, an dem man die weiß aufgetünchten Buchstaben LSR mit nach unten weisenden Pfeilen sah. Jeder sollte wissen: In diesem Keller war ein Luftschutzraum. Jedenfalls galt dies, als das Haus noch stand. Auch das Haus, in dem Heinz im zweiten Stock rechts hinter dem Türschild »Lüthje« aufgewachsen war, hatte einen solchen LSR. Die Bezeichnung war allerdings eine Lüge. Die Fenster und die Türen hatten einen provisorischen Bombendruckschutz, das war alles. Nicht einmal die Luft war in diesen Räumen sicher. Seine Eltern waren bei einem Bombenangriff am 18.Juli 1944 im Keller des Mietshauses in der Elisabethstraße im Arbeiterviertel Kiel-Gaarden mit fünf anderen Familien erstickt. Über ihnen war das Haus mit allen Wohnungen nach einem Treffer abgebrannt. Als Heinz nach Hause gekommen war, hatte er nur noch den Rest der Hausfront mit den Buchstaben LSR und den nach unten weisenden Pfeilen gesehen.
Auf Langwelle fand Heinz das englischsprachige Programm der BBC, in dem ein Reporter erzählte, dass er in einem Hotel in Deutschland sitze und der verängstigen Hotelbesitzerfamilie erläutert habe, wie man BBC einstelle. Der Familienvater hätte schüchtern gesagt, dass sie das schon wüssten. Sie hätten kein Wort Englisch verstanden, aber sie hätten die deutschen Ortsnamen gekannt und gewusst, dass die Befreiung vorankomme. Heinz stellte das Radio ärgerlich aus. Die Befreiung kommt voran. Aber wo, wann? Die Frage, die alle beschäftigte, war: Wer würde zuerst hier sein, die Russen oder die Briten?
Er stellte den Sendewahlknopf wieder auf die Frequenz des Großdeutschen Rundfunks, löste die Kopfhörer und lötete den Lautsprecherpol wieder an, während durch die offene Dachluke das charakteristische Brummen der englischen Bomber drang. Und dann das Heulen, das immer tiefer sang, zum Ende eines Liedes, bevor einen die Bombe traf. Den Knall hörte man ja nicht mehr, sagten alle. Heinz bezweifelte das. Es konnte ja keiner mehr erzählen, der es erlebt hatte.
Der Kilian schien heute das Hauptziel der Bomber zu sein. Heinz konnte ihn nur noch als flackernden Schemen in Rauch und Blitze gehüllt erahnen.
Wenn es Luftalarm gab, gingen sie im Kilian immer im U-Boot auf Verschlussstation. Das war todsicher. Aber zwischen den tausend Donnerschlägen waren zwei, die anders klangen. Die erste Druckwelle schlug Heinz zu Boden. Seine Ohren waren fast taub, das Foto seiner Eltern fiel von der Wand, an der verschlossenen Tür schienen tausend Teufel zu rütteln, das Radio hatte er unter das Bett gestellt, die Kolophoniumdose und den Lötkolben hatte es vom Tisch gefegt. Wenn er nicht wegen der Kolophoniumdämpfe vorhin auch die Dachluke zum Hof geöffnet hätte, hätte der Luftdruck ihm wahrscheinlich das Trommelfell zerrissen.
Von den unteren Stockwerken hatte er das Klirren des splitternden Fensterglases gehört. Bei den nächsten Paukenschlägen blieb es unten still. Der Luftdruck hatte freie Bahn, weil es keine verglasten Fenster mehr gab. Der Kilian war von hier etwa zwei Kilometer Luftlinie entfernt.
Nach einer halben Stunde hörte es auf. Heinz legte das Stoffbündel mit dem Lötzeug wieder in das Versteck unter der Türschwelle. Er setzte die Kopfhörer wieder auf. And now the shipping forecast issued by the Meteorological Office. Er brauchte die sanfte Stimme, die von friedlichen Küsten trotz meterhoher Brandung, drohenden Orkanen, fremden Küsten erzählte, und sah sich dort mit einer schönen Frau dem Wetter trotzend am Ufer stehen. Das Steinhaus mit brennendem Kamin im Rücken… Humber, Themse, Dover… Low, expected by…
Kiel, 11.April 1945
Ein Paukenschlag war vor dem Aufschlag aufs Wasser direkt vor der Bunkereinfahrt explodiert. Die schützenden Panzerplatten am Eingang hatten sich in Geschosse verwandelt, die das Heck des U-4708 aufgerissen hatten. Die sieben an Bord vermuteten Männer hatten sich in ein Luftloch im Bootsturm retten können. Drei von ihnen konnten sich mit einer Eisenstange aus der verklemmten Turmluke befreien. Karl gehörte nicht zu ihnen. Jetzt lag der stählerne Sarg im Schlick des Bunkerbeckens.
Später erzählte man auf der Werft, dass das U-170 bei Beginn des Angriffs rechtzeitig auf Schottendicht und Verschlusszustand gegangen war. Dann hatte es ohrenbetäubend gebraust, und der Tiefenmesser war auf vierzig Meter ausgeschlagen. Für die Mannschaft war das die Todesnachricht: Auf zwölf Meter belief sich die Tiefe des Bunkerbeckens, danach wären sie also durch den Explosionsdruck achtundzwanzig Meter tief in den Hafenschlick gepresst worden. Sie befassten sich gerade mit ihrem Lebensende, als jemand ungläubig sagte: »Der Zeiger ist wieder auf null.« Es war also der Explosionsdruck, der den Tiefenmesser vierzig Meter hatte anzeigen lassen.
Am Morgen nach dem Bombardement wurde befohlen, den Bunker »aufzuräumen«. Es wurden Bürsten, Schrubber und Zinkeimer mit Kernseife und Wasser verteilt. Schlierende und gezackte Pinselstriche des Todes, klumpige rottonige Flecken, alle Übergänge bis ins Weiße, waren nicht auf, sondern in den Beton gepresst, in jeden noch so feinen Riss, der den Beton millionenfach mikroskopisch zerklüftete. Überreste der Männer, mit denen er gestern hier noch gesprochen, gelacht hatte, Zukunftspläne hatten sie ausgetauscht und gemeinsame Ängste berührt und belacht. Heinz gehörte zu denen, die sich endlos übergaben, noch bevor sie draußen waren. Wenig später hatte jemand die Zwangsarbeiter geholt, die irgendwo anders auf dem Gelände die Trümmer sortierten und nach Blindgängern suchten. Unter Bewachten und Bewachern sah er viele, die jünger waren als er selbst. Heinz vermied es für den Rest Tages, in den Bunker zurückzugehen. Er wusste, dass sich der Anblick der Zwangsarbeiter bei der Arbeit an den Bunkerwänden, umgeben von den Bewachern mit schussbereiten Pistolen und Gewehren, als lebenslange Wunde neben alle anderen, vielleicht doch irgendwann abheilenden Verletzungen seiner Seele graben würde.
Die drei von der Flakmannschaft auf dem Dach des Kilian waren samt Geschütz spurlos verschwunden.
Der Alte war zuletzt gesehen worden, als er gegen einundzwanzig Uhr vom Wohnschiff zum U-Bootbunker ging. Man vermutete, dass er nach dem Fortgang der Arbeiten auf seinem Boot sehen wollte. Heinz hatte unzählige neue Explosionskrater auf dem Weg zum Kilian gesehen. Später hörte er, dass auf dem Kasernenhof in Gaarden ein Brotwagen der Vereinsbäckerei mit Pferd nach einem Volltreffer spurlos vom Erdboden verschwunden war.
Wenn er nicht das Maul aufgerissen hätte, wäre er an Karls Stelle im U-Boot krepiert. Jetzt waren Karl und der Alte tot. Aber da war noch seine Freundin, die Stadtruferin mit der Glocke, aus der Faulstraße. Wenn sie noch lebte. Und die schöne Frau?
Nach Dienstschluss ging Heinz, sein Fahrrad neben sich herschiebend, auf dem Werftgelände herum, trotz der vielen Blindgänger, als ob er den Weg nach Hause nicht mehr finden könnte. Nach jedem Luftangriff hatte er das Bedürfnis, etwas zu suchen. Überall gab es noch kleine Brandherde, ab und zu schlug ihm beißender Rauch entgegen. Das Elektrolager ein paar hundert Meter weiter hatte einen Treffer abbekommen, alles noch irgendwie Verwertbare hatte man schon aus den Trümmern geholt, so hieß es jedenfalls. Heinz vermutete, dass man in dem allgemeinen Durcheinander so manches übersehen hatte. Ein oder zwei Dosen Kolophonium vielleicht. Batteriesätze oder sogar einige Radioröhren. Die KL4-Röhre in seinem Kapsch schien »mies« zu werden. Radioröhren waren immer jede für sich in einer Pappschachtel verpackt, umrollt mit Wellpappe. Das hielt erfahrungsgemäß mehr Luftdruck aus als eine Glasscheibe. Aber leider schien der Druck alles über das Gelände verteilt zu haben. Die Mauern im Stahlfachwerk standen noch, aber Türen und Fenster waren zerdrückt, zerfetzt, zerschlagen. Das Gebäude schien verlassen. Er wollte sich auf sein Fahrrad schwingen und nach Hause fahren. Aber irgendetwas rief ihn von da drinnen. Er stellte sein Fahrrad neben eine leere Türöffnung und ging in das Halbdunkel.
Auf der untersten Stufe der Treppe ins nächste Stockwerk lag ein Arbeitsschuh. Das Metallgeländer hing schräg in der Verankerung. Aus einem oberen Stockwerk hörte er ein tickendes Summen. Ganz fein und leise, es ging im Zischen des Windes durch die leeren Fensterhöhlen unter, aber im nächsten Moment war es wieder da.
Im Geiste sah er dieses konservengroße Getriebe mit den münzgroßen Zahnrädern und den Bakelitverstärkungen vor sich. Unten war eine Aussparung für den kleinen Motor, an dessen Wellenspitze ein kleines Zahnrad war, das in ein größeres Zahnrad am untersten Ende des Getriebes fasste. Der Motor lief mit etwa dreißig Umdrehungen pro Sekunde. Durch die Umsetzung des Getriebes drehte sich der Stift am anderen Ende mit einer Umdrehung pro Stunde. Oder pro Tag. Je nach Zahnradgröße im Getriebe. Der Stift hatte eine kleine Nut, in die der Auslösemechanismus des Sprengsatzes fasste. Wenn die Umdrehung dreihundertsechzig Grad des Stiftes vollendet hatte, wurde der Stromkreis geschlossen. In der nächsten Tausendstelsekunde wurde die Explosion ausgelöst. Heinz hatte ein paar Monate in der Endfertigung für Zeitzünder gearbeitet. Man hörte das Summen des Elektromotors kaum. Es tickte ein wenig, wenn das Getriebe fehlerhaft gefertigt war. Das war schon damals die Regel. Es tickte und summte.
Man hatte an der Entwicklung von Zeitzündern gearbeitet, die auf Tage und Wochen genau einstellbar waren. Das Ticken könnte von einem dieser modernen Geräte stammen. Mit fehlerhaftem Getriebe. Ein sinnloser Sabotageakt in einem zerstörten Werksgebäude. Und der Matrosengefreite Heinz das sinnlose Opfer. Trotzdem stieg er die Treppe hoch ins nächste Stockwerk. Es war ein sonniger Spätnachmittag. Es würde bald wieder Sommer werden. Vielleicht würde auch der Krieg zu Ende gehen. Aber gleich würde nichts mehr da sein. Für alle Ewigkeit der Welt. Gleich bist du tot. Wann würde die schöne Frau ihn vergessen haben?
Als er den linken Fuß in den Flur des ersten Stockwerks setzte, verstummte das summende Ticken. Er entschied sich, nicht erstarrt auf das Nichts zu warten, sondern weiterzugehen. Die Metalltür zum Büroraum gleich rechts im ersten Stockwerk wurde nur noch von einem zerrissenen Scharnier im Rahmen gehalten. Sie fiel aus dem Rahmen, als er sich näherte, und wirbelte den feinen Staub auf, den jede Zerstörung herbeizauberte, diesen Staub, der eigentlich leicht wie die Luft war und bei jedem Windhauch in der Luft schwebte, aber sich auch entscheiden konnte, unsichtbar am Boden zu bleiben, bis es Zeit war, wieder mit der Luft zu verschmelzen. Wenn das Nichts, oder das Jenseits, einen Geruch hatte, dann müsste es dieser sein.
Der Schreibtischsessel war umgeworfen. Das obligatorische Führerbild hinter Glas hing unbeschädigt und akkurat an der Wand. Heinz trat näher, drückte mit einem Finger dagegen, es rührte sich nicht. Es war festgeklebt.
Der Aktenschrank stand offen, alle Akten hingen akkurat in den Hängeordnern. Der Raum war übersät von Glas- und Holzsplittern, einige waren von Blut verschmiert. Keine verkohlten Akten oder Papierfetzen, wie sie nach jedem Luftangriff auf dem Werftgelände zu sehen waren. Neben einer Schreibmaschine, in der ein neues Blatt halb eingezogen war, lag eine Akte. Es schien, als hätte hier alles seine alte Ordnung behalten. Heinz wollte auf die oberste Seite der Akte sehen, als sein Blick in die aufgezogene Schublade fiel. Es sah aus wie ein leicht zusammengedrücktes Ei aus Elfenbein. Es war vielleicht eine Uhr. Oder eine kleine Granate, die zur Tarnung aus Elfenbein gefertigt war. Er nahm das Ei und warf es aus dem Fenster.
Nachdem er es draußen im Dreck wiedergefunden hatte, wischte er es ab und sah es sich genauer an. Möglicherweise war es eine wertvolle Antiquität. Er spuckte mehrfach auf das Ei und wälzte es in einem Haufen Asche, den er in einem kleinen Krater in der Nähe fand. Der Wache würde er erzählen, dass sein Frühstücksei in den Dreck gefallen sei.
Am Werkstor führte der Gefreite Erwin Hoyer die obligatorische Taschenkontrolle durch. Heinz reihte sich in die Schlange der Wartenden ein und öffnete die am Oberrohr des Fahrrads montierte Staukiste. Sie war ursprünglich für das Mitführen von flachen Munitionskisten vorgesehen. Da sah die Torwache immer rein. Damit niemand auf die Idee kam, sein altes Wehrmachtsfahrrad zu beschlagnahmen, hatte er den verstärkten Gepäckträger zum Transportieren schwerer Lasten, wie zum Beispiel Waffen oder Koffer, demontiert und präparierte es regelmäßig mit Lehm und Asche, damit es schrottreif aussah. Er hatte es vorigen Herbst nach einem Bombenangriff am Fördeanleger Seegarten gefunden. So als ob der Besitzer sich auf eine Fähre gerettet oder ins Wasser verabschiedet hätte. Nur den Vorderreifen hatte Heinz flicken müssen.
Hoyer sah flüchtig in die leere Staukiste und klappte sie zu. Heinz’ Rucksack interessierte ihn heute nicht. »Ich habe das gehört mit Karl. Tut mir leid.« Hoyer hatte Heinz und Karl oft zusammen am Tor nach der Taschenkontrolle einen schönen Feierabend gewünscht. »Im ›Reichshallen‹ gibt’s ’ne Sondervorstellung, ›Münchhausen‹, mit Hans Albers. Wir haben für Strom gesorgt. Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch. Tschüss.«
»Das war die Strafe!«, hatte Heinz’ Vater Anfang 1942 gesagt, als das traditionsreiche Ufa-Kino »Reichshallen« an der Holstenbrücke nach wochenlang ausverkauften Vorstellungen der Filme »Jud Süß« und »Der ewige Jude« in einem Hagel von Brandbomben völlig ausgebrannt war. Wenig später eröffnete die Ufa im Festsaal des »Hauses der Arbeit«, vor 1933 Gewerkschaftshaus, in der Fährstraße das »Reichshallen« mit neuer Ausstattung.
Als Heinz eintraf, stand immer noch eine Schlange vor der Kasse, obwohl die Vorstellung schon angefangen hatte. Werbung war nicht nötig gewesen, es hatte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt herumgesprochen: Hans Albers im »Reichshallen«, und das nach dieser Bombennacht. Man hatte wieder einmal überlebt, und man wollte es spüren.
Ein mobiles Dieselaggregat der Wehrmacht stand als Stromversorgung knatternd vor dem Eingang. Die Kassiererin erzählte Heinz, dass der Film eine Kopie aus den zerstörten Ufa-Theater-Lichtspielen in der Holtenauer Straße sei, die letztes Jahr zerstört worden waren. Der Filmvorführer Konrad Pödzke hatte sie aus den U.T. (Ufa-Theater) Lichtspielen während eines Luftalarms noch retten können. Dann war er ein Jahr später bei einem Stromschlag im Vorführraum getötet worden. Berufsunfall. Seine Frau, seit 1943 Garderobenfrau im Kino »Reichshallen«, hatte die acht flachen Blechdosen mit den nummerierten Aufklebern »Münchhausen« vorige Woche im Keller hinter den Kartoffeln gefunden. Den Rest hatte dann »jemand Höheres« von der Werft organisiert, aber der sei seit gestern Nacht verschollen.
Frau Pödzkes Reich, die Garderobe, war ein langer Schlauch mit Holztresen im Keller. So breit wie Heinz’ Mansarde und so lang wie der Kinosaal direkt darüber. Frau Pödzke trug einen dunkelgrauen Kittel, und das hellgraue Haar war zu einem grau-strengen Knoten gebunden.
»Du musst dich beeilen, die Wochenschau fängt schon an«, sagte sie in mütterlichem Ton, nahm sein Fahrrad entgegen und stellte es zu den zehn oder fünfzehn anderen. Die Bügel hingen leer an den Garderobenhaken. Von oben schepperten die Fanfaren.
»Wollen Sie den ›Münchhausen‹ nicht auch sehen?«, fragte Heinz.
»Ich habe den Film damals gesehen im Ufa-Theater, als mein Mann ihn vorführte. Er war mir damals schon zu traurig.«
Heinz hatte Glück. Einer seiner Lieblingsplätze in der ersten Reihe war frei. Die Decke des Kinosaals über den vorderen Sitzreihen war im Winter bei einem Luftangriff getroffen worden. Sie war notdürftig mit ein paar Lagen genagelter Teerpappe geflickt worden, die ersten beiden Sitzreihen waren durch »organisierte« Küchenstühle und Matratzen ersetzt worden. Heinz bevorzugte die Matratzen. Man legte sich einfach lang hin und kriegte nicht, wie sonst auf den Stühlen in den ersten Reihen üblich, einen steifen Nacken. Allerdings konnte es passieren, dass man den Film verschlief. Meistens wurde man aber geweckt, weil das Schnarchen die Sitz- oder Liegenachbarn störte.
Die Wochenschau zeigte die Vereidigung von Volksgrenadieren, denen die Gewehre feierlich von angeblichen Rüstungsarbeitern in die Hände gedrückt wurden. Heinz schätzte das Alter der Volksgrenadiere auf höchstens achtzehn Jahre. In der Eingangssequenz hatte man das Datum der Wochenschau gesehen. Sie war vom 11.Januar. Also fast auf den Tag genau drei Monate alt. Das Licht in den Augen der jungen Volksgrenadiere war sicher schon lange erloschen. Die nachfolgenden Luftkämpfe über dem holländisch-belgischen Luftraum waren auch schon seit vielen Monaten entschieden. Heinz schätzte, dass er in der Wochenschau mindestens zweihundert inzwischen tote Menschen gesehen hatte. Der Wochenschaufilm riss zweimal, das Licht ging jedes Mal an, man war es gewohnt und nahm es mit Gelassenheit. Der Vorführer klebte den Streifen innerhalb von zehn Minuten. Heinz’ Matratzennachbar wandte sich ihm ächzend zu. Es war ein älterer Mann mit fauligem Mundgeruch, ohne Zähne und Haare, der auf die zeigerlose Uhr an seinem dürren Handgelenk zeigte. »Vein Rekorp ifft vieben Minupen.«
Vor dem Hauptfilm gab es eine Pause, in der Heinz auf der Matratze einschlief. Er wachte auf, als Hans Albers mit einer Kanonenkugel in einem Burgturm gelandet war, ihn dabei zerstörte und trotzdem überlebte. Heinz fragte sich, ob das eine Idee der Goebbelsschnauze war. Ein Regieeinfall für den Endkampf. Menschen als Kanonenkugel. Piloten, die ihr Flugzeug als Bombe ins Ziel fliegen würden. Oder sich einfach mit einer Bombe im Rucksack an der befohlenen Stelle in die Luft sprengen würden. Vielleicht war das die Wunderwaffe für den Endkampf, über die im Kilian gerätselt wurde. Die kleinen Zwei-Mann-U-Boote mit dem freundlichen Namen »Seehund«, die auf der Werft produziert wurden, waren vielleicht nur eine Vorstufe.
Dann sah er die schöne Frau auf der Leinwand. Er stand auf und setzte sich erst wieder, als hinter ihm lautstark protestiert wurde. »Du bist nicht aus Glas, Junge!«
»Das fünfte Fenster von links«, hatte Münchhausen auf dem Zettel gelesen, den ihm der Eunuch zugesteckt hatte. Hinter diesem Haremsfenster würde er sie sehen können. War es nicht auch das fünfte Fenster von links in der Sanitätsbaracke gewesen? Die Prinzessin sah aber nicht aus einem Strahlenkranz zersplitterten Glases, sondern ihren Kopf umrahmte ein kranzförmiges, filigran ornamentiertes Gitter im Haremsfenster. Die schöne Frau gehörte dem Sultan. Sie war genauso, wie der Eunuch sie Münchhausen beschrieben hatte: »Ihre Haare schimmern wie Ebenholz. Ihre Augen sind blau wie das Marmarameer. Ihr Mund ist ein Blumenkelch. Und ihre Hände und Füße sind aus Elfenbein.« Eine Frau, die sogar einen Eunuchen um den Verstand brachte.
Es war schon dunkel, als Heinz mit seinem Fahrrad durch die Trümmer seiner Heimatstadt nach Hause fuhr. Ein paar Flaschen Bier klapperten leise im Rucksack. Der Himmel war klar, es würde heute Nacht vielleicht noch einmal Frost geben. Eine Sternschnuppe zog dicht über dem nördlichen Horizont Richtung Holtenau, eine gleißende Lichtspur, von der nach weniger als einer Sekunde nichts mehr zu sehen war. Eigentlich war der Münchhausenfilm eine Geschichte über das Sterben. Das war der Goebbelsschnauze offensichtlich entgangen. »Ich wünschte, immer so jung zu bleiben wie heute, so lange, bis ich selbst ums Altwerden bete.« Das hatte sich der Baron Münchhausen vom Zauberer gewünscht. Sein Wunsch war in Erfüllung gegangen.
Bis jetzt hatte es für Heinz wenigstens mit dem Überleben geklappt. Allerdings wurde es um ihn herum immer einsamer. Wenn er nun der einzige Mensch wäre, der in seiner Heimatstadt nach vielen Jahrzehnten des Krieges überlebte? Ein schrecklicher Gedanke. Der sterbende Diener Christian hatte wenigstens seinen Herrn, den Baron Münchhausen, dem er im letzten Augenblick seines Lebens hatte sagen können: »Komm bald nach, aber lass dir Zeit.«
Würde er, Heinz, das jemandem sagen können, wenn es für ihn so weit war?
Heinz hatte keine Geschwister. Sein halbes Leben hatte er keine Freunde gehabt. Wenn sich jemand für Funkwellen und Radios statt für Kino, Filmstars und Schlager interessierte, worüber sollte man sich denn mit dem unterhalten? Heinz war seinen Schulkameraden unheimlich. Im Schulunterricht wusste er immer alles besser. Seine Mutter konnte auch nie den Mund halten. »Du tust so, als ob jeder Mensch ein Engel ist«, hatte sein Vater zu seiner Mutter gesagt und damit ihre überschwänglich freundliche und wortreiche Art gemeint, mit der sie jeden Menschen begrüßte, der ihr über den Weg lief. »Schnauze halten ist überlebenswichtig, warum begreift ihr das nicht!«, hatte sein Vater mehr als einmal geknurrt. Sein Sohn war nicht so naiv, jeden Menschen für einen Gesandten des Himmels zu halten. Aber dieser altkluge Junge diskutierte mit seinem Vater sogar über den Frontverlauf. Ihm war das Besserwissen nicht auszutreiben, und das war mindestens ebenso schlimm.
Ironischerweise hatte es ihm aber gestern das Leben gerettet. Wenn er seine Schnauze gehalten hätte, wäre der Alte nicht auf sein Wissen über Radios aufmerksam geworden. Er hätte ihn nicht aufgefordert, sein Radio zu reparieren. Und Heinz hätte nach der erfolgreichen Reparatur keinen Sonderurlaub bekommen. Sondern hätte wegen der bevorstehenden Abnahme nach Dienstplan Überstunden machen müssen. Nicht Karl, sondern er würde jetzt im vollgelaufenen Rumpf des U-4708 tot im Wasser schweben.
Er lief die vier Stockwerke in der Tirpitzstraße69 hoch, verschloss hastig seine Tür, öffnete atemlos den Rucksack. Er hatte sich entschieden, das Ei für eine Uhr zu halten.
Er fand zwei Buchstaben, eine Signatur, H.H., ihm fiel nur Heil Hitler dazu ein. Das Gehäuse ließ sich nicht öffnen. Sein Daumennagel passte in den Spalt zwischen Deckel und Gehäuse, aber der Nagel riss ein. Alle Versuche, es durch Schütteln und Abtasten zu öffnen, führten zu nichts. Er drehte die Uhr wie einen Brummkreisel auf dem Tisch. Nichts. Er spielte mit dem Gedanken, den heißen Lötkolben in die glatte Oberfläche zu bohren. Aber das konnte gefährlich werden und den Inhalt zerstören. Es konnte sich auch um eine Schnupftabakdose handeln, die mit Gift gefüllt war.
Es gingen Gerüchte, dass sich die Briten und Amerikaner besonders für Parteiorden interessierten. Der vierzehnjährige Herwich Mischlich hatte ihm neulich im Treppenhaus in voller HJ-Uniform hinter vorgehaltener Hand geraten, seine HJ-Abzeichen nicht wegzuwerfen. Die würden noch einmal sehr wertvoll werden. Dabei hielt er seinen Geigenkasten unter dem linken Arm fest umklammert, so als hätte er Angst, dass Heinz ihn wegnehmen wollte. Heinz hatte ihm hinter vorgehaltener Hand geraten, nicht so ein dummes Zeug zu erzählen, sonst würden sie ihn nach Russee bringen. Mischlich hatte daraufhin den rechten Arm hochgereckt, laut »Heil Hitler« gerufen und war mit trotzig-ängstlichem Gesichtsausdruck die Treppe hinuntermarschiert. Heinz hatte ihm nachgerufen, er solle mehr Geigenstunden nehmen, sein Gequietsche würden die Hausbewohner als Fliegeralarm missdeuten. Und Mischlich hatte unten von der Haustür heraufgeschrien, dass die SS seinen Geigenlehrer endlich abgeholt hätte.
»Ich geh jetzt für den Endsieg aufspielen!«, rief er noch in der geöffneten Haustür, sodass man ihn auf der Straße hören konnte.
Was immer der verrückte Mischlich damit gemeint hatte, Heinz’ HJ-Abzeichen lag sowieso schon seit einem Jahren am Boden der Förde. Eine geheimnisvolle Taschenuhr konnte als besondere Antiquität mehr einbringen als ein HJ-Abzeichen oder mancher Orden.
Als verkaufsförderndes Detail könnte er einflechten, dass sie einem Gestapomann gehört hätte, von dem man nach einem Bombenangriff nur noch einen Stiefel gefunden hätte. Heinz kam der Gedanke, dass es ja auch eine Schnupftabakdose sein könnte, in der ein kostbarer Edelstein versteckt war. In diesem Fall wäre es natürlich dumm, den gefundenen Schatz als schäbige Taschenuhr zu verscherbeln. Er beschloss, an seinen geheimnisvollen Fund nur noch als Schnupftabakdose zu denken. Dann würde er sich auch nicht verplappern, wenn man ihn überraschend danach fragte.
Sie hatten eine Woche gebraucht, um das beschädigte U-170 aus dem Kilian zu schleppen und danach als Notstromversorgung für die Werft zu installieren. Immer mehr neu eingelaufene U-Boote warteten auf Reparaturen. Die Sehrohre waren plötzlich besonders anfällig geworden. Sie hatten Spiel, hakten, schleiften laut oder steckten ganz fest. In der Werft mussten sie »gezogen« werden. Eine vornehme Umschreibung für »vollständig zerlegen und instand setzen.« Die Sehrohre wurden immer öfter ausgefahren, um sich zu vergewissern, man griff nicht mehr an, sondern sicherte sich ab. Es war die Angst, die die Sehrohre kaputt machte. Niemand repariert unsere kaputten Seelen, dachte Heinz. Wie lange würde es dauern, bis er den Krieg vergessen könnte? Vorausgesetzt, der Krieg würde je aufhören, und vorausgesetzt, dass er »dies alles« wenigstens körperlich überlebte.
19.April 1945
Abends hörte Heinz auf Langwelle einen englisch gesprochenen BBC-Bericht. Er verstand jedes Wort, obwohl es in der Schule nie Fremdsprachenunterricht gegeben hatte. Und trotzdem hatte ihm die Schule zu seinen guten englischen Sprachkenntnissen verholfen.
Mit zehn Jahren hatte er in den Kieler Neuesten Nachrichten das Wort »Entente« gesehen. Er hielt es für einen Druckfehler. Es sollte wohl Ente oder Enten heißen. Seine Eltern lachten ihn nur aus. Er fragte seinen Klassenlehrer. Herr Ecks erklärte ihm, dass es ein französisches Wort sei und Harmonie und Vereinbarung bedeute. Das gefiel Heinz, und er beschloss, irgendwann nach Paris zu gehen, um Französisch zu lernen.
An seinem elften Geburtstag fand er in seiner Schultasche auf dem Nachhauseweg ein kleines, aber dickes Buch mit rotem Leineneinband mit dem Titel »Englisch-Deutsches und Deutsch-Englisches Taschenwörterbuch« von den Professoren Köhler und Lambeck. Er vermutete, dass es sein Klassenlehrer, Herr Ecks, war, der es heimlich in einer Pause in die Schultasche gesteckt hatte. Herr Ecks kleidete sich so wie Hans Albers in dem Film »Der Mann, der Sherlock Holmes war«. Und er rauchte auch so eine Pfeife.
Das Taschenwörterbuch wurde Heinz’ Lieblingslektüre. Da er wusste, dass ihn dieses Buch in Schwierigkeiten bringen konnte, las er heimlich darin, immer wenn er allein zu Hause war, oder abends im Bett, solange es das Licht zuließ, und das war im Sommer sehr lange. Es war ein Buch mit einer Geheimsprache, deren Kenntnis einen ins Gefängnis bringen konnte. Es schauderte ihn jedes Mal, wenn er eine neue Vokabel auswendig kannte. Nachdem er das erste Mal auf BBC jemanden Englisch sprechen gehört hatte, ging es sehr schnell. Er sprach die Worte immer nach, erkannte die Vokabel, und seit zwei Jahren war sein größtes Geheimnis, dass er Englisch sprechen und verstehen konnte.
Inzwischen hatte er allerdings gelernt, dass die schöne englische Sprache auch von schrecklichen Dingen erzählen konnte.
Heute sollte es einen Bericht aus Bergen-Belsen geben. Heinz hörte die Glocke einer Grabkapelle, dann erzählte ein Reporter, ständig nach Fassung ringend, er befinde sich im Moment auf einem Hektar Land, bedeckt von Menschen, die weder dem Tod noch dem Leben zu gehören schienen, weil manche starben und wieder andere sich bewegten, obwohl man sie schon für tot gehalten hatte. Eine Mutter habe den britischen Soldaten ihr Kind in einem Stoffbündel entgegengehalten und darum gebeten, ihm Milch zu geben. Dann sei sie weinend weggelaufen. Als die Soldaten das Bündel aus Stoff auswickelten, erkannten sie, dass das Kind seit Tagen tot war. Als der Reporter sagte: »This day at Belsen was the most horrible of my life«, begriff Heinz. Es war so etwas wie das Arbeitslager Russee. Nur unvorstellbar größer. So unvorstellbar groß wie die geplanten Neubauten der Reichshauptstadt Berlin. Alles, was diese Nazis in die Welt brachten, war unvorstellbar groß. Und unvorstellbar schrecklich.
Heinz erinnerte sich an einen Freund seines Vaters, der vor ein paar Jahren zu Besuch gewesen war, ein Lokomotivführer, der hatte vom Zentralen Gleiskreuz Korschen in Ostpreußen erzählt. Auf einem Abstellgleis hatte er einen Güterzug voller Menschen gesehen. Das war Ende Januar bei minus zwanzig Grad gewesen. Ohne Lokomotive. Wer weiß, wie lange schon. Wer weiß, wie lange noch.
»Nun lasst alle Hoffnung fahren«, hatte Karl kommentiert, als sie nach sechsunddreißig Stunden Dienst am Stück am vergangenen Neujahrsabend in Kolophoniumdämpfe eingehüllt, die Bakelitkopfhörer auf den Ohren und mit ein paar Flaschen Eiche-Bier da saßen und das »Bum, Bum, Bum, Buum« eines einsamen Trommlers hörten, das Erkennungszeichen des Deutschen Dienstes der BBC, das sich immer wie die ungesprochene Ankündigung des Weltuntergangs anhörte.
»Beethoven, Schicksalssymphonie. Prost, Heinz!«
Karl war irgendwie gebildet, aber hatte nie darüber gesprochen. »Das ist doch Thomas Mann aus Lübeck!« Karl schüttelte immer den Kopf, wenn Thomas Mann auf BBC seine »Ansprachen an das deutsche Volk« mit den Worten begann: »Dies ist die Stimme eines Freundes.« Als der Schriftsteller sagte: »Die Nazikriege sind im Voraus annulliert«, hatten Karl und Heinz sich ein neues Glas eingeschenkt, »Mann sei Dank« im Chor gesagt, angestoßen und in einem Zug ausgetrunken, ohne ihre Kopfhörer abzunehmen.
Jetzt war Mitte April, und Karl lebte nicht mehr. Der Schriftsteller erzählte heute Abend auf BBC von einem Abkommen, das die Alliierten an einem Ort namens Jalta über das zukünftige Schicksal Deutschlands abgeschlossen hätten. »Es ist nicht die Absicht, das deutsche Volk zu zerstören.«
Aber vielleicht aus Versehen? Heinz fürchtete, dass das alles nur meinte: Tut uns leid, aber der Krieg dauert doch länger, als wir dachten.
1.Mai 1945
Eine Frau hatte es gegen zweiundzwanzig Uhr draußen auf der Straße gerufen: »De Führer is dod, de Führer is dod«, und dabei eine Handglocke geschwungen. Seine Freundin aus der Faulstraße. Aus dem Dachfenster konnte er sie leider nicht sehen.
»The German Radio has just announced that Hitler is dead.« Wenn die BBC es meldete, würde es wohl stimmen, dachte Heinz, als er die Meldung kurz vor Mitternacht hörte.
Nachdem er die Meldung dreimal hintereinander gehört hatte, drehte er am Abstimmknopf den ganzen Frequenzbereich auf Langwelle und Mittelwelle durch. Auf Mittelwelle fand er einen Sender mit einer besonderen Erkennungsmelodie. »Üb immer Treu und Redlichkeit.« Heinz hatte den Eindruck, dass es keine Bandaufnahme war, die dort zu hören war, sondern dass da ein Klavierspieler säße, der die Passage wieder und wieder spielen musste, als käme sie vom Band. So kam es wohl, dass der Klavierspieler immer müder wurde und das Lied immer trauriger und mutloser klang. Ein schräg splitternder Akkord beim Aufschlagen des vom Sendeleiter erschossenen Klavierspielers, das wäre ein glaubwürdiger Abschluss des Tausendjährigen Reiches. Es war die Frequenz des regionalen Senders Flensburg. Man bereitete sich also in Flensburg mit Probebetrieb schon auf die Ankunft des Hitlernachfolgers Dönitz vor. Es war geheim, aber jeder auf der Werft und sogar in den Straßen wusste es: In Plön war jetzt der Sitz der Reichsregierung und das Oberkommando der Wehrmacht, Großadmiral Dönitz als Nachfolger Hitlers. Heinz wusste, dass das Ende des Krieges erst in Sicht war, wenn sich der Nachlassverwalter Dönitz in die äußerste Ecke des Tausendjährigen Reiches, nach Flensburg, verzogen hatte.
2.Mai 1945
Am nächsten Tag erzählte ihm Frau Hoyer im Kolonialwarenladen an der Ecke Yorckstraße, dass diese betrunkene »Stadtruferin« in einem Männermantel die ganze Tirpitzstraße runter bis in die Wik vor den Flandernbunker gelaufen wäre, in dem sich die Kommandantur der »Festung Kiel« verkrochen hatte. Dort hätte sie noch lange ihre frohe Botschaft verkündet und sich dann in der Prinz-Heinrich-Straße vor dem Bunker schlafen gelegt. Heute Morgen habe man sie dort tot aufgefunden. Heinz fragte, ob Frau Hoyer Nachricht von ihrem Sohn habe. Sie schüttelte stumm den Kopf und schenkte Heinz eine Steckrübe und eine halbe Dauerwurst.
In der Nacht stand Heinz wieder an seinem Dachfenster und sah zwei Stunden mit aufgesetzten Kopfhörern einem Luftangriff zu. Auf BBC gab es ein Hörspiel, eine Comedy, mehrfach unterbrochen für Zigarettenwerbung, Reklame für ein Wunderreinigungsmittel für Spiegel und Fensterscheiben und für die neueste Frontmeldung »Splendid news from Moscow: Berlin has fallen.«
Die Marineküche auf der Werft köchelte nur noch Ungenießbares, aber was in der Gerüchteküche brodelte, löffelte jeder gierig. Vormittags hieß es, Kiel sei zur offenen Stadt erklärt worden und der Feind könne die Stadt besetzen, ohne mit bewaffnetem Widerstand rechnen zu müssen. Nachmittags hieß es, das Oberkommando hätte befohlen, Kiel bleibe Festung und müsse bis zum letzten Mann verteidigt werden. So schwappten die Gerüchte wie Ebbe und Flut in einem gleichmäßigen Rhythmus hin und her. Immer weniger Werftarbeiter kamen zur Arbeit in den Bunker. Es waren vor allem die auf U-Boote spezialisierten Arbeiter und Marineangehörigen von den Werften in Ostpreußen, die jetzt auch der Kampf ums Überleben hier in Kiel eingeholt hatte. Sie suchten sich in den Vororten am Ostufer der Kieler Förde Kellerzimmer und, wer Glück hatte, einen freien Dachboden mit warmem Schornstein. Sie hatten Erfahrung mit dem Flüchten und Überleben. Ein Funker von der Schichauwerft in Königsberg, Paul Rogowski, erzählte Heinz, wie er auf Schnellbooten in der Nacht vom 30. auf den 31.Januar aus der eingekesselten Stadt hatte fliehen können. Nachts hatte er in der Funkerkabine die Hilferufe der untergehenden »Wilhelm Gustloff« mitgehört. Der Kapitän hatte Befehl, sich keinem getroffenen Schiff zu nähern, und er hielt sich daran. Rogowskis hochschwangere Frau kam erst eine Woche später mit einem anderen Schnellboot an. Er hatte nicht mehr geglaubt, sie wiederzusehen. Das Boot hatte sie in Pillau abgesetzt, der Kapitän war mit seiner Familie allein weitergefahren. Sie hatte dann irgendwie nach zwei Wochen Kiel erreicht und ihn bei der Arbeit in einem U-Boot auf der Werft wiedergefunden.
Die Besatzungen der reparaturbedürftigen Schiffe und U-Boote mussten sich selbst an die Reparaturen machen. Heinz fragte sich, ob es nicht auch für ihn bald Zeit wurde, sich vor einem drohenden Endkampf in Sicherheit zu bringen.
3.Mai 1945
Der Anblick der Stadt hatte in den letzten Monaten zunehmend dem einer Sterbenskranken geglichen, die in den letzten Zügen liegt. Heute sah es so aus, als ob man vorzeitig zur Leichenfledderei übergegangen wäre. Die Straßen waren übersät von Zertretenem, Weggeworfenem, Zerrissenem. Das Marinekommando hatte vormittags ein paar Versorgungslager freigegeben, und der Stadtkommandant hatte die Verpflegungsämter und Lagerhäuser angewiesen, alles ohne Lebensmittelkarten oder Bezugsscheine zu verkaufen.
Sie stürmten die Lager. Erst verhalten mit Taschen, Körben und Säcken. Dann kamen die Profis mit Blockwagen und Pferdefuhrwerken, später die Lastautos. Auf den Straßen lagen zerfetzte Kleidungsstücke. Heinz kurvte mit seinem Fahrrad zwischen den langen Männerunterhosen, dicken Nachthemden, Strümpfen, Schuhen und Blusen herum, um ja nichts zu überfahren. Es hatte seit gestern nicht geregnet, und ein eiskalter Wind ließ die Kleidungsstücke auf den Straßen den Vorübergehenden flatternd zuwinken. Es war, als ob die Bombentoten auf dem Weg in den Himmel ihre Kleider verloren hätten. Hier lagen also auch irgendwo Karls Sachen. Als Heinz die Tür zu seiner Dachkammer zuschlug, lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Tür, voller Angst, dass die Kleider ihm die Treppen herauf gefolgt wären. Als er seine Jacke vor dem Bett liegen sah, wollte er schreien, aber er würgte sich nur, wie vor ein paar Wochen im Kilian, die Seele aus dem Leib.
4.Mai 1945
Heinz hatte sich entschlossen, sich auf die Suche nach Verwertbarem, Tauschbarem und nach Vorräten zu machen. Die Zeiten waren bisher schon unsicher gewesen, aber was kam, würde Niemandszeit sein.
Ihm war ein Haus hinter der Ecke Walkerdamm/Hopfenstraße aufgefallen. Dort schien niemand mehr zu wohnen, jedenfalls nicht zur Straße hin. Sooft er dort abends vorbeikam, nie war dort Licht. Das Haus hatte trotz der Nähe zum Fördeufer keinen direkten Treffer abbekommen. Allerdings stand nur noch das erste Stockwerk. Darüber hörte es einfach auf, wie abgeschnitten. Das, was von den oberen Stockwerken übrig war, schien direkt auf dem Schutthaufen auf der anderen Straßenseite gelandet zu sein. Das Haus befand sich im Druckschatten des Neuen Anbaus des Thaulow-Museums am Sophienblatt, von dessen Hauptgebäude nur noch die Wände standen. Kurioserweise hingen immer noch ein paar Gemälde.
Heinz öffnete die Haustür. Die Tafel mit den Namen der ehemaligen Bewohner lag zersplittert am Boden. Es stank nach allem, was überhaupt stinken konnte, aber Heinz war das gewohnt. Schließlich stank die ganze Stadt. Im ersten Stock drückte er die angelehnte Wohnungstür auf. Auch hier war das Namensschild entfernt worden. Die Räume kamen ihm ungewöhnlich hoch vor, aber das lag wohl nur daran, dass er eine Dachmansarde bewohnte. In der gekachelten Küche fand er eine Schüssel, daneben lagen eine halbe Gurke und eine Reibe. Auf der hellen Anrichte stand ein Stapel Teller. Porzellanteller. Kleingeschnittenes Gemüse schwamm in einem großen gusseisernen Topf voller Wasser. Aus der Vorratskammer neben dem Fenster nahm er ein Fässchen Sauerkraut, ein Weckglas eingelegte Heringe, zwei Gläser englische Marmelade und verstaute alles in seinem Rucksack. Er wollte das Haus verlassen, aber als er im Flur durch eine halb offene Tür in das Wohnzimmer sehen konnte, zögerte er, als ob er fürchtete, die Bewohner der Wohnung anzutreffen. Oder jemanden, der wie er im Überlebenskampf auf Raubzug war. Das, was er auf den ersten Blick für ein Wohnzimmer gehalten hatte, war eine Bibliothek oder ein Arbeitszimmer gewesen, mit lederbezogenen Sesseln, wandhohen Bücherregalen, dicken orientalischen Teppichen. Das Leder der Sessel war zerstochen, die Regale leer, die Bücher lagen mit teilweise herausgerissenen Seiten auf dem Boden, sie waren nass, es stank nach Urin, der dicke Perserteppich hatte sich vollgesogen. Lexika, Bildbände über griechische und römische Geschichte, große Komponisten, englische Schlösser und Gärten. An den Wänden alte Stiche in dunklen Holzrahmen. Eine große Vase lag zerbrochen am Boden, ein zertretener Strauch verwelkter Blumen, auf den Scherben glaubte Heinz eine englische Landschaft zu erkennen.
Gleich links neben der Tür stand ein moderner Plattenspieler. Ein Telefunken TP76. Ein neuartiger elektrischer Plattenspieler, den er vor Jahren einmal im Schaufenster bestaunt hatte. Daneben auf einem kleinen Tisch ein Radio, mit elegantem Holzfurnier abgesetzt, ein Philips660a, in der Zeitschrift »Funkschau« war es vorgestellt worden, kein Volksempfänger, sondern ein Radio für den »Liebhaber des Schönen und Guten«. Der Plattenspieler hatte keinen Schalltrichter, sondern war durch ein Kabel mit dem Radio verbunden. Gewesen. Das Kabel war zerschnitten. Heinz drehte das Radio herum, um herauszufinden, wie das Kabel des Plattenspielers an die Endstufe des Radios angeschlossen gewesen war. Schade, dass der Strom ausgefallen war.
Er hörte Stimmen. Er sah vorsichtig aus einem der Fenster, das zur Ecke Walkerdamm ging. Ein junger SS-Mann und ein Hitlerjunge marschierten die Hopfenstraße hinauf in Richtung Exerzierplatz. Der Junge schleppte mühsam an einem Maschinengewehr über der rechten Schulter und einem Munitionsgürtel. Über der linken Schulter hing ein Geigenkasten. Als sie direkt am Haus vorbeigingen, sah der Junge plötzlich zum Fenster hoch. Es war Herwich Mischlich. Heinz duckte sich und überlegte, ob er es noch bis zum Hinterausgang schaffen würde. Wenn die beiden ihn hier mit ihrem Maschinengewehr aufstöberten, würden sie kurzen Prozess machen. Mischlichs Triumph. Heinz Lüthje war ein Plünderer. Standrechtliche Erschießung wäre hier der Wille des Volkes, so würde er das seinem MG-Schützen erklären. Als Heinz sich vorsichtig wieder bis zum Fensterbrett erhob, war die Gruppe schon weitergelaufen. Der SS-Mann brüllte Herwich Mischlich an. Wenn es überhaupt Mischlich war. Aber Heinz hatte seine Augen gesehen, die ihn nicht gesehen hatten, weil die Scheibe staubig und blind war und das Außenlicht reflektierte. In Mischlichs Augen war Angst, wie sie nur eine verlorene Kinderseele haben kann.
Sie verschwanden in Richtung Exerzierplatz. Heinz vermutete, dass sie zur Holtenauer/Wiker Hochbrücke unterwegs waren, um dort den Feind am Überschreiten des Kaiser-Wilhelm-Kanals zu hindern. Das letzte Kommando.
Im Plattenschrank dümpelten höchstens zehn Platten verloren in den gelben Papphüllen, Platz war für mindestens hundert. Wahrscheinlich war der Rest schon in den Kanälen des Schwarzmarktes zu einem neuen Besitzer unterwegs. Er zog nach Zufall eine nach der anderen heraus, mal von hinten, mal in der Mitte, mal vorne. Hans Albers, Ilse Werner und natürlich Zarah Leander. »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn.« Wer würde das noch hören wollen?
Die nächste Platte hatte ein zerkratztes Etikett. Er glaubte die Worte »…for the Leader…« zu erkennen. Für den Führer? Der Rest war zerkratzt, absichtlich unleserlich gemacht worden. Er drehte die Schallplatte um. Hier war das Etikett ganz genauso unleserlich gemacht worden. Der Kratzer zog sich bis weit in die Schallrille hinein, und das machte das Musikstück, das sich auf dieser Seite befand, unspielbar. Alle Kratzspuren hatten eine gemeinsame Handschrift. Es waren jeweils vier parallele Linien, die in einer steilen Welle aufstiegen, oben nervös zitterten und das Zittern spiralförmig zur Mitte hin fortsetzten. Dort hörten sie abrupt auf. Es sah aus wie eine Botschaft. Heinz vermutete, dass man es eilig mit einer Gabel gemacht hatte. Er fand noch eine Schallplatte, deren Etikett mit derselben Handschrift unleserlich gemacht worden war.