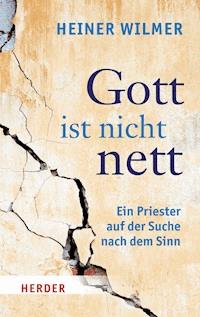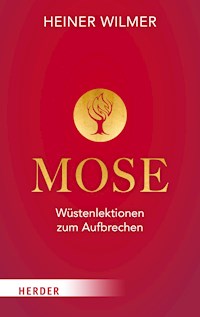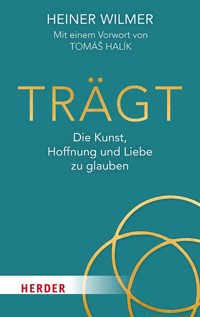
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Frage "Was bringt's mir?" ist zentral und führt zu den Kernthemen des Lebens. Bischof Heiner Wilmer zeigt mit Mut und Verve, was ihm und anderen Hoffnung und Kraft gibt, besonders in Krisenzeiten. Er erschließt spirituelle Ressourcen und macht die Dreieinigkeit einfach und lebensnah greifbar. Sein Buch fragt konsequent, was wirklich trägt. Mit starken Bildern und eingängigen Schilderungen beschreibt er, wie Glaube, Liebe, Hoffnung und Trinität unser Leben bereichern können. Ein Buch, das Mut macht und Hoffnung schenkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Denen, die sich vor Viren und anderem Übel ängstigen
Titelseite
HEINER WILMERMIT SIMON BIALLOWONS
TRÄGT
Die Kunst, Hoffnung und Liebe zu glauben
Impressum
Als Bibelübersetzung ist zugrunde gelegt:Die Bibel. Die Heilige Schriftdes Alten und Neuen Bundes.Vollständige deutschsprachige Ausgabe© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2005
Erweiterte Taschenbuchausgabe 2025
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020Hermann-Herder-Str. 4, 79104 FreiburgAlle Rechte vorbehaltenwww.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich [email protected]
Covergestaltung: Verlag Herder
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN (Print) 978-3-451-03608-8ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83871-2
Inhalt
Vorwort
von Tomáš Halík
Bischof Wilmer zitiert eine ironische Bemerkung: »Wenn man will, dass sich in der Kirche wenig ändert, muss man den Bischöfen nur möglichst viel zu tun geben, sodass sie nicht mehr zum Nachdenken kommen.« (S. 20) Es ist sehr gut, dass Heiner Wilmer zu den Bischöfen gehört, die sich Zeit und Energie zum Nachdenken nehmen können. Das Ergebnis und Beweis dafür ist auch dieses Buch. Es ist zugleich ein Funke der Hoffnung, dass sich in der Kirche etwas ändern wird.
Aus diesem Buch strahlen die Sympathie und das tiefe Verständnis des Autors für die Veränderungen hervor, die das Pontifikat des Papstes Franziskus in der Kirche eingeleitet hat. Ich schreibe diese Worte zu Ostern 2025, als das Leben dieses großen Papstes bereits vollendet ist. Viele große prophetische Träume und Aufforderungen dieses Papstes blieben jedoch unvollendet offen. Ich bin überzeugt, dass die Überlegungen von Bischof Wilmer auch für die nächste Etappe auf dem Weg der Entfaltung und Vertiefung des christlichen Glaubens in unserer Zeit eine Ermutigung und Inspiration sein können.
In unserer Zeit der Krisen und Umbrüche stellt sich der Autor »mit kühlem Kopf und warmem Herzen« die entscheidende Frage: Was ist wirklich wichtig? Was kann uns im Leben zuverlässig tragen? Die Antworten auf diese Fragen schöpft er aus vielen verschiedenen Quellen. Er schöpft aus seiner eigenen reichen Lebens- und Seelsorgeerfahrung, kehrt zu Erinnerungen an seine Kindheit zurück und erzählt von Momenten, in denen er ehrliche Antworten auf die Fragen seiner Angehörigen in ihren schwierigen und schmerzhaften Lebenssituationen suchen musste. Er kehrt mehrmals zu den traumatischen Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zurück, zur Zeit der Covid-Pandemie. Gleichzeitig schöpft er aus einem reichen Schatz an verschiedenen intellektuellen und spirituellen Inspirationen aus Literatur, Poesie, Mystik, Philosophie und Theologie. Zu seinen geistigen Wegbegleitern zählen die bemerkenswerten jüdischen Denkerinnen Simone Weil und Etty Hillesum.
Auf seiner Suche nach einer tragfähigen Grundlage kehrt Wilmer immer wieder zur Dreifaltigkeit der »göttlichen Tugenden« zurück. Er interpretiert sie oft auf überraschende und aufschlussreiche Weise. Zu den Begriffen, die er dabei am häufigsten verwendet, gehören Mut und Risiko.
»Der christliche Anspruch an die Liebe ist nicht klein gedacht. Lieben ist nichts für Feiglinge. Liebe braucht Tat und Kraft und Mut.« Für Wilmer bedeutet Glauben nicht nur »religiöse Überzeugung«, sondern die Kraft aufzubringen, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten: »Hoffen heißt, ein Risiko einzugehen. Hoffen bedeutet, gefährlich zu sein. Hoffen verspricht, getröstet zu werden. Nicht alleine, sondern zusammen.« »Hoffnung ist eben nicht so sehr auf ein Ende ausgerichtet, sondern auf Sinn – und zugleich auf Ewigkeit, die kein Ende kennt. Wenn wir hoffen, gehen wir bewusst das Risiko des Lebens ein. Wir verbarrikadieren uns nicht zu Hause, schotten uns nicht ab von der Welt, sondern packen an. Hoffnung sagt Ja zum Leben mit all seinen Gefahren, Mühen, Freuden, Schönheiten und vor allem Überraschungen. Hoffnung, und das ist das Wunderbare an ihr, umfasst alle Dimensionen des Lebens und des Menschseins.«
In Zeiten der Krise und des Wandels müssen wir uns immer wieder die Frage nach der Identität unseres Glaubens stellen. Wilmer antwortet darauf: Die Identität des Christentums ist nichts Statisches, Unveränderliches. Die Identität des Christentums ist dynamisch. Die Identität des Christentums wird durch Hoffnung geprägt: »Die Hoffnung als Identität bedeutet, dass genau ich hoffe und zugleich nicht auf mich selbst bezogen bleibe.« Das Radikale an der Hoffnung ist, dass sie uns aus der Ich-Haft hinausführt, weil sie darauf beruht, dass jeder Mensch als Kind Gottes bereits selbst erhofft ist: »Wenn wir hoffen, sind wir nicht egoistisch, sondern solidarisch. Zugleich bedeutet Hoffnung nicht Entfremdung, nicht, dass ich mir selbst fremd werde, sondern im Gegenteil: Hoffnung hilft, ich selbst zu werden.«
An Gott glauben bedeutet, Gott zu vertrauen: »Gott vertrauen bedeutet, zu wissen, dass Risiken das Leben prägen und man keine existenzielle Daseins-Versicherung abschließen kann. Gottvertrauen ist geprägt von einer tiefen Hoffnung und nicht von einem notorischen Optimismus, dass alles schon irgendwie gut ausgehen wird. Gott vertrauen heißt für mich, zu wissen, dass das Leben einen Sinn hat, dass ich im Leben einen Sinn habe, dass selbst durch das Scheitern nicht alles sinnlos wird. Gottvertrauen bedeutet nicht, sich entspannt zurückzulehnen und abzuwarten und zu meinen, es werde schon alles glatt gehen, da sei ja noch jemand. Gott vertrauen trägt dann, wenn man Risiken eingeht, weil man sich getragen fühlt, aber verantwortlich bleibt.«
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Bischof Wilmer mit seiner Spiritualität und Theologie, die in diesem sehr lesenswerten Essayband zum Ausdruck kommen, eine Stimme ist, die wir gerade in der heutigen Zeit dringend brauchen.
Tomáš Halík, Prag, Ostern 2025
Was wichtig ist – und was uns drängt
Erst waren es nur leise Laute, die noch nicht ahnen ließen, was sich wenige Meter von mir entfernt abspielte. Ich hatte einen pickepackevollen Tag hinter mir. Viele Gespräche, Video-Konferenzen, Detailarbeit. Ich musste den Kopf freikriegen und raus an die frische Luft, ein paar Meter gehen. Es war noch hell.
Nach Wochen ging ich jetzt wieder vorbei an dem kleinen Lokal, das mit seiner leichten Holzbauweise aus bordeauxroten Brettern, der gläsernen Schwingtür, seinem in meeresblau gefassten Namen »VIVA« und den ganzjährig ausgestellten Strandkörben an den Urlaub an der See erinnern will. Jetzt aber waren die Strandkörbe trotz der recht warmen Abendluft abgedeckt wie im Winter. Vor den gestapelten Korbstühlen ein rotweißes Flatterband. In der Ecke die wenigen Tische, unordentlich verschachtelt, fast wie Gerümpel. Auf dem Boden lag ein Besen. Es war, als hätte man die städtische Strandkneipe wegen heraufziehendem Unwetter kurzerhand geschlossen. Unter den weichen Schuhsohlen spürte ich das harte Kopfsteinpflaster aus Basalt. Wie so oft zog mich mein Blick bereits in die Lucienvörder Straße, hin zu den wunderschönen, weiten Überschwemmungswiesen der Innersten. Erst vor Kurzem hatte ich erfahren, dass der Straßenname an das im Mittelalter aufgegebene Dorf Lutzingeworden erinnert, das sich einst an der heutigen Stelle des Domfriedhofs befand. Nur: Irgendwas war anders an diesem Abend. In dem grünen Wohnviertel mit Kastanien und Linden vor roten Ziegelbauten, kleinen Villen und Fachwerkhäusern sangen die Vögel besonders intensiv. Eigenartig. Es war, als schwirrte die Luft. Im ersten Augenblick konnte ich mir keinen Reim darauf machen.
Bis ich diese Stimme eines Mannes hörte. Er redete nicht und schrie auch nicht. Er sang. Sang so, dass man hören konnte, dass er das nicht zum ersten Mal tat – sang voller Inbrunst. Die Stimme wurde lauter, ich kam offensichtlich näher, dann sah ich einige Leute an einem Zaun stehen. Es sah aus, als würden sie durch den Zaun in den Hof gucken. Unmittelbar hinter dem grauen eisernen Zaun versperrte eine dichte Hecke aus Lebensbaum den Blick in den Hof. Dennoch spähten die Leute durch die Hecke, die Köpfe leicht himmelwärts. Mehr noch als sie linsten, schienen sie zu lauschen, wie gebannt. Ich blieb ebenfalls stehen, in gebührendem Abstand, und hörte plötzlich nicht nur die Stimme des Mannes, sondern weitere Stimmen und dann sogar den Text: »Die Gedanken sind frei…« Erblickte den Mann, wie ein Vorsänger, und viele Nachbarn auf ihren Balkonen oder aus dem Fenster heraus, mit einem Tablet oder Smartphone, vermutlich um den Text zu lesen. »Kein Mensch kann sie wissen…« Je mehr Strophen, desto mehr Stimmen und schließlich fast ein Chor: »Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei: Die Gedanken sind frei.« Ich spürte eine Kraft, die mich ergriff, und ein Gedanke kam mir, der tief in mir etwas anregte, etwas aufbrach: »Wir sind nicht allein.« Dann: »Das gibt Halt. Das hilft weiter.« Und später noch mehr: »Das hat’s gebracht!«
Die verbotene Frage
»Das hat’s gebracht«, damit hängt eine Frage zusammen, die mich zutiefst beschäftigt, weil sie uns überall im Alltag begegnet und oft immer dann, wenn es um existenzielle Dinge geht, etwas argwöhnisch beäugt wird. Sie lautet: »Was bringt’s mir? Was bringt’s uns?« Oder: »Bringt das mich weiter – und wie?« Der Reflex auf diese Fragen ist gern der Zeigefinger, das Kopfschütteln, Hinweise auf Oberflächlichkeit, solche Sachen eben. Nur warum? Mal ehrlich, was soll falsch daran sein? Machen wir doch ständig: Laufen gehen, was bringt’s? Den Dampfgarer verwenden, was bringt’s? Dieses Buch oder jenes lesen, was bringt’s? Und ausgerechnet, wenn es um’s Ganze geht, um unser Leben im Kern, dann ist die Frage verboten? Nein, die verbotene Frage darf und soll gestellt werden: Was bringt’s, wenn wir durch schwere Zeiten kommen und die angenehmen auskosten wollen? Was bringt uns Spaß und Freude, Trauer und Trost? Das sind keine oberflächlichen Fragen, sondern sie zielen auf den Kern ab: unserer Beziehungen, unserer Gesellschaft, unserer Überzeugungen. In diesem Buch soll es also dezidiert darum gehen: Was bringt’s?
Die Eingangsszene, die sich in Hildesheim abgespielt hat, die aber gefühlt in vielen Städten und Ländern dieser Welt hätte stattfinden können, vielleicht in anderen Sprachen und mit Musikinstrumenten, hat sich ereignet in den Tagen der Corona-Krise. Sie ist noch jetzt extrem präsent für mich. Sie erinnert mich auch an die kritischen Zeilen von Ingeborg Bachmann, die sich in ihrem Gedicht Reklamevor über fünfzig Jahren fragte, was bleibt, wenn leere Floskeln und Gute-Laune-Sprüche der Unterhaltungsindustrie keinen Halt mehr geben. Die fragt, wohin wir gehen, wenn es eng wird. Wenn es dunkel und wenn es kalt wird. Was geschieht, wenn wir ans Ende denken. Wenn Totenstille eintritt. Wenn das Reklamegedudel uns Sorgenfreiheit vorgaukelt, auf existenzielle Fragen nicht antwortet, uns einlullt und vertröstet.
Eine der Erfahrungen, die jene Corona-Tage für mich geprägt haben. In diesen Tagen wurden die Arbeiten an diesem Buch abgeschlossen, und so sind es auch die heiteren, die es prägen, neben den traurigen und niederschmetternden. Wir alle haben Erfahrungen in der Krise gemacht, die uns prägen. Schlechte und solche, die wir gerne nicht gemacht hätten und am liebsten vergessen würden. Ich denke an Geschichten hier aus Deutschland oder von meinen Ordensmitbrüdern aus Norditalien. Leid, das jedes Gerede, das Krise immer sofort als Chance sehen will, zynisch wirken lässt. Aber eben auch Erfahrungen, die uns längst vergessene Schätze in der Gesellschaft, den Familien und uns selbst, in unseren Haltungen, Werten und in unserem Glauben, entdecken lässt. Wir müssen in diesen Tagen neue Antworten finden und neue Fragen stellen. Technische und wissenschaftliche, medizinische und gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische, spirituelle und religiöse. Dabei hören und lesen wir in diesen Tagen vor allem eine Frage immer wieder und immer lauter, die für mich auf die Erfahrung am Zaun und der »freien Gedanken« wie unter dem Brennglas auftaucht: Was ist wichtig? Nicht nur irgendwie wichtig. Nein, was ist wirklich wichtig? Für mich persönlich, für meine Familie und meine Freunde, für meine Mitbrüder, für unsere Gesellschaft – für die Menschheit gar und die ganze Welt. Was ist wirklich wichtig? Und geht das zusammen mit: Was bringt’s?
Beide Fragen können in Krisenzeiten und in Umbrüchen besonders dringlich erscheinen. Sie stellen sich aber eigentlich immer. Zum Glück nicht die ganze Zeit laut und aufdringlich, das wäre anstrengend. Sie liegen vielem zugrunde, wonach wir uns instinktiv richten. Es ist gar nicht nötig, sie dauernd explizit herumzutragen. Wir dürfen das Vertrauen in unser Gespür für das Wichtige haben. Nur kann sich das, was wichtig ist, verändern, muss sich sogar. Mit dem Alter, mit neuen Situationen, mit anderen Vorlieben. Aber gibt es dann etwas, was immer wichtig ist? Eine sozusagen unveränderliche Wichtigkeit in unserem Leben? Und wenn ja: Wie kriegen wir sie gefasst, artikuliert, auch überprüft? Auch darum soll es in diesem Buch gehen. Um eine Kern-Wichtigkeit in unserem Leben gewissermaßen. Darum, was uns betrifft in unserem Innersten, uns und unsere Welt zusammenhält oder sie zusammenhalten kann. Wenn das, was wichtig ist, nicht mehr wichtig ist oder verlorengeht, ist es oft, als würde aus uns etwas herausgerissen. Als würde, um Nietzsche zu paraphrasieren, der Stein ins Nichts rollen, als würden wir fortwährend stürzen, »rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten. Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts?«
Was Nietzsche hier formuliert, klingt wie Schreie der Verzweiflung und Orientierungslosigkeit, die im Mark erschüttern. Man kann sich vorstellen, wie sie in Krankenhäusern oder auch einsamen Wohnungen herausbrechen. Nicht nur jetzt – denn nicht die Krise macht oder entscheidet, was wichtig ist. Aber sie zeigt es oft noch eindrücklicher – oder zeigt klarer, was nicht wichtig ist. Deshalb geht es mir auch an dieser Stelle nicht darum, in eine übliche Leier einzustimmen und darüber zu klagen, der Mensch hätte vergessen, was wirklich wichtig ist. Das mag in manchen Bereichen sein. Doch gerade in Corona-Zeiten sehen wir oft, wie intuitiv das antreibt, was wichtig ist. Dass Ressourcen in uns sind, die wir längst vergessen wähnten. Dass Schätze geborgen werden können, die vergraben scheinen. Wir sehen und spüren und erfahren: Es gibt viel, was mich trägt. Und womit ich andere tragen kann.
Nur relevant reicht halt nicht
Auf die Frage »Was ist wichtig?« hätte der in Deutschland geborene US-amerikanische Autor Charles Bukowski mit dem Titel eines Werkes geantwortet: What Matters Most is How Well You Walk Through the Fire – »Am wichtigsten ist, wie gut Du durch das Feuer gehst«,wörtlich übersetzt. Der Titel passt in diesen Tagen besonders. Er passt aber auch für alle Zeiten und Situationen in unserem Leben, in denen wir durch das Feuer gehen. Schmerzhaft und reinigend, das sind zumeist die Attribute, die Feuer zugerechnet werden. Feuer hat aber auch etwas Wärmendes, es vertreibt die Dunkelheit und macht hell, es ist eine Orientierung und ein Anhaltspunkt. Vielleicht wird die Frage »Was ist wichtig?« auch deshalb überhört oder nicht gestellt, weil sie oft so verbiestert scheint. So moralisch und immer mit Seitenhieben gegen andere, denen unterstellt wird, eben auf das Unwichtige zu setzen. Oder weil sie automatisch im Krisen-Trott daherkommt und nicht mit Freuden-Sprüngen. Was wichtig ist, muss nicht nur mit Krise und Herausforderung, mit Leid und Schmerz zu tun haben. Das, was in unserem Innersten wichtig sein kann, steht mindestens genauso für Freude, Kraft, Stärke oder Begeisterung.
Wichtig hat also nicht nur mit Krise zu tun und Schwere, sondern auch mit Leichtigkeit und unserem Leben überhaupt. Man könnte dieses »wichtig« deshalb auch mit einem anderen Wort übersetzen, mit »relevant«. »Relevant« meint »bedeutsam«, das Gegenteil ist »irrelevant«. Ich frage mich oft, was zum Beispiel in Kirche relevant ist und was irrelevant. Was also Bedeutung hat und was nicht. Was, und dies ist eine andere Übersetzung von relevant, wesentlich ist. Man könnte damit sagen: Wesentlich und wichtig im Leben ist das, was relevant ist. Nur: Das reicht nicht. Wenn wir im Leben nur darauf setzen, was relevant ist, entgeht uns Entscheidendes.
In vielen Runden, ob nun in Kirche oder in der Politik, kommt das Wort »relevant« wie ein Mantra vor. Meistens nicht als ermutigendes Mantra. Gerade in Kirche wird oft »Relevanzverlust«, also »Bedeutungsverlust« beklagt. In einem Gespräch vor einiger Zeit mit einem Journalisten über das, was denn noch relevant sei an Kirche und Glaube und auch uns Bischöfen, bekam ich zunächst eine Meinung dazu und dann eine Ergänzung: »Es geht nicht nur darum, was relevant ist. Es geht auch darum, was virulent ist.« In diesen Tagen passt das auf fast schon erschreckende Art und Weise. Deshalb die Fragen: Was ist relevant? Und was ist virulent?
Virulent in dieser Zeit, das meint in erster Linie »ansteckend«, »gefährlich«, »bedrohlich«. Eine andere Bedeutung ist aber auch »dringend« und »akut«. Akut kommt vom lateinischen acutus und bedeutet übersetzt »spitz«, »scharf«. Akut ist etwas, das uns sticht, uns also unmittelbar berührt und betrifft, in diesem Augenblick. Es schneidet durch unsere Gewohnheiten und Routine, so wie das Virus uns unmittelbar betrifft und den Alltag durchschnitten und verändert hat. Dadurch haben wir, oft sogar an Kleinigkeiten, gemerkt, dass etwas vielleicht wichtig ist, aber nicht dringlich. Irgendwann müssen wir es machen, aber jetzt gerade kann es noch warten. Es ist relevant, keine Frage, aber eben nicht virulent.
Die Frage nach Relevanz und Virulenz, nach Wichtigkeit und Dringlichkeit ist eine entscheidende, die alle Bereiche unseres Lebens durchzieht. Theoretisch ist sie auch ganz einfach abbildbar, mit der Eisenhower-Methode, gemeint ist der Weltkriegs-General und spätere Präsident Dwight D. Eisenhower. Sie basiert auf wenig: einem Quadrat mit zwei Achsen, einer Wichtigkeits-Achse und einer Dringlichkeits-Achse. Aufgeteilt in jeweils zwei Felder mit »wichtig/unwichtig« und »dringend/nicht dringend«, man könnte auch schreiben »relevant/irrelevant« sowie »virulent/avirulent«. Die Methode ist simpel und effektiv. Was aber gar nicht so simpel ist, ist die Entscheidung, was nun dringend ist und was nicht, was unwichtig ist und was wichtig. Und dann natürlich: Was ist relevant und virulent zugleich?
Ich erinnere mich an einige Sachen, die ich für relevant hielt und die irrelevant waren. Bei Exerzitien vor wenigen Jahren in einem Karmeliterkloster in Las Batuecas, in einem einsamen Tal in Spanien, völlig abgelegen und karg, ist mir aufgegangen: Weniger ist mehr. Ich will Sachen anpacken, erledigen, anstoßen, doch bringt all das etwas? Mir hat jemand einmal mit ironischem Unterton gesagt: »Wenn man will, dass sich in Kirche wenig ändert, muss man den Bischöfen nur möglichst viel zu tun geben, sodass sie nicht mehr zum Nachdenken kommen.« Das stimmt. Bei den Exerzitien habe ich gespürt, wie wichtig es ist, Sachen einmal ruhen zu lassen. Oder Gedanken, die mich faszinieren, erst einmal sacken zu lassen. Ich spüre, gerade beim Spazierengehen, wie ich eine Freude daran habe, Fragen zu durchdringen und mich intensiv mit ihnen zu beschäftigen. Manchmal ist das gedankliche Spielerei, das darf auch mal sein. Doch wenn ich überlege, was am nächsten Morgen in der Predigt für die Leute vor mir wichtig ist, was sie trägt, dann darf die Spielerei nicht entscheidend sein. Dann geht es vor allem darum, was für die Menschen wichtig ist, was sie direkt betrifft, was eben virulent ist. Ich bin seit mehr als 20 Jahren in Leitungsfunktion. Und gerade jetzt spüre ich, wie relevant und virulent gerade in Leitung Begegnung, direkter Austausch, Augenkontakt ist. Und wie zugleich bestimmte Sitzungen, für die früher unbedingt ein persönliches Treffen her musste, auch ohne gehen. Wie Leitung auch über Leitungen geht. Welche Leitungen funktionieren – und welche nicht. Die Dringlichkeit von Präsenz ist zutiefst christlich, allerdings hat sich die Dringlichkeit von Präsenz verändert. Sie hat in manchen Situationen zugenommen, in anderen ist sie verzichtbarer geworden. Nähe und Distanz haben sich für mich ganz neu ausbuchstabiert, ich habe ein ganz neues Verhältnis dazu bekommen. Wie virulent Nähe sein kann und wie relevant Distanz, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, das stellt sich für mich heute anders dar als noch vor fünf Jahren.
Heißes Herz, kühler Kopf
Die zurückliegenden Erfahrungen von Nähe und Distanz und vor allem auch im Kontext von Leitung und Begleitung haben mir noch etwas gezeigt: Ich bin ehrlicherweise froh, dass nicht alle Dinge im Leben nach diesem Muster relevant und virulent zugleich sind, das wäre ja furchtbar. Ein Mensch im ständigen Alarmmodus, ständig unter Strom. Doch gerade in Krisenzeiten müssen wir uns fragen, was wichtig und dringend ist. Oder, um die Eisenhower-Methode noch einmal heranzuziehen: Was ist wichtig und was müssen wir selbst erledigen? Was können wir nicht aufschieben und auch nicht delegieren? Es betrifft mich jetzt und ganz wesentlich, da gibt’s kein Abwarten und kein Abgeben. Das ist etwas, das mich so sehr angeht, dass es an mir liegt, es anzugehen. Das müssen wir herausfinden.
Noch etwas entspricht dem Charakter des »Virulenten«: Alle sprechen darüber. Das mag auf den ersten Blick nicht zusammenpassen mit dem individuellen Charakter. Doch es sprechen eben alle darüber, also auch Sie und Du und ich. Es geht uns alle an und jeden. Was in diesem Sinne relevant und virulent ist, betrifft jeden von uns und ist in unseren Gesprächen Thema. Vielleicht nicht unbedingt mit der gleichen Bezeichnung, mit derselben Ausgangslage, mit ähnlicher Perspektive. Doch im Grunde spricht jeder darüber. In der Krise, klar, das Virus und seine Folgen. Doch gibt es nicht auch Dinge, Erfahrungen möglicherweise, über die alle sprechen, auch wenn sie sie möglicherweise anders nennen oder einordnen? Egal ob Amerikanerin, Chinese, Deutsche oder Waliser. Ob Zeitungsausträger, Krankenschwester, Bischof oder Arbeitsloser. Ob Atheist, Buddhist oder Jude. Ob Frau oder Mann, Jugendlicher oder Silverager, einfach alle. Gibt es solche Erfahrungen? Ich glaube, die gibt es. Und ich glaube ebenfalls, dass die Krise uns das gezeigt hat und uns zugleich herausfordert, mit Blick auf neue Krisen und auf alte Gewohnheiten ihnen nachzuspüren. Herauszufinden, was das ist; was anscheinend für alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Religion existenzielle Fragen und Bedürfnisse sind – und Dinge, die tragen oder tragen können. Die uns etwas bringen.