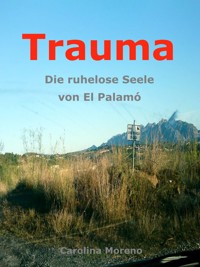
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Artacus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im idyllischen spanischen 602 Seelen-Dorf Santa Medina de Carmita wurde schon seit über zwanzig Jahre kein Verbrechen mehr begangen. Die letzte Straftat, bei der die Policia Nacional ermitteln musste, war der Einbruch von Jugendlichen in einen Tabakwarenladen. Die sind heute längst erwachsen. Dann taucht an einer einsamen Landstraße die Leiche einer jungen Asiatin auf. Niemand kennt die tote Frau oder hat sie je gesehen. Überhaupt gibt es keine Einwohner im Dorf, die nicht von hier kommen. Touristen verirren sich niemals an dieses verlassene Fleckchen Erde im Norden Mutxamels. Die Tote gibt Rätsel auf. Sie ist noch nicht lange tot und zeigt äußerlich keine Merkmale von Gewalt. Ihr Name und ihre Herkunft sind unbekannt, sie hat keine Papiere und keine Handtasche. Wer hat die junge Frau getötet und weshalb? Ein Ermittlerteam aus Mutxamel nimmt die Ermittlungen auf. Es gibt weder ein Motiv noch einen Hinweis auf den Täter. Dann werden drei weitere Frauen als vermisst gemeldet. Und Tomáso wird von einer Frau verfolgt, die er nicht kennt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Trauma
Trauma
Trauma
Die ruhelose Seele von El Palamó
Carolina Moreno
www.artacus.rocks
Impressum
Agencia Artacus, Calle de Peluyo, 19, 28004 Madrid
(Deutschsprachiger Kontakt über o.g. Webseite)
Im idyllischen spanischen 602 Seelen-Dorf Santa Medina de Carmita wurde schon seit über zwanzig Jahre kein Verbrechen mehr begangen. Die letzte Straftat, bei der die Policia Nacional ermitteln musste, war der Einbruch von Jugendlichen in einen Tabakwarenladen. Die sind heute längst erwachsen. Dann taucht an einer einsamen Landstraße die Leiche einer jungen Asiatin auf. Niemand kennt die tote Frau oder hat sie je gesehen. Überhaupt gibt es keine Einwohner im Dorf, die nicht von hier kommen. Touristen verirren sich niemals an dieses verlassene Fleckchen Erde im Norden Mutxamels. Die Tote gibt Rätsel auf. Sie ist noch nicht lange tot und zeigt äußerlich keine Merkmale von Gewalt. Ihr Name und ihre Herkunft sind unbekannt, sie hat keine Papiere und keine Handtasche. Wer hat die junge Frau getötet und weshalb? Ein Ermittlerteam aus Mutxamel nimmt die Ermittlungen auf. Es gibt weder ein Motiv noch einen Hinweis auf den Täter. Dann werden drei weitere Frauen als vermisst gemeldet. Und Tomáso wird von einer Frau verfolgt, die er nicht kennt...
I
Das Scheinwerferlicht des Kleinwagens bricht die schwarze Nacht und macht für einige Meter die karge, sandige Vegetation mit ihren trockenen Bärengrasbüscheln und Sträuchern sichtbar, neben die sich einige Mittagsblumen gesellen, deren Blüten jetzt schwarz aussehen. Ein paar junge Pinien stehen neben dem ein oder anderen verwaisten Eukalyptus. In der Ferne sind einige Olivenhaine zu erahnen, die genauso gut einer Sinnestäuschung des Auges geschuldet sein können, und die schwarz in schwarz im Hinterland der nördlichen Costa Blanca verschwinden. Am Horizont sind die ersten Lichter von El Palamó zu sehen. Nach Alicante ist es nicht mehr weit. Bald wird er daheim sein. Tomáso streckt sich hinter dem Lenkrad und gähnt. In der linken Hand hält er eine Zigarette und in der rechten eine Getränkedose. Das Radio spielt Santana. Er nimmt die Zigarette zwischen seine Lippen, und klopft im Takt der Musik mit der Hand auf das Lenkrad, während er Corazon Espinado laut mitsummt. Der Seat Ibiza gleitet durch die Dunkelheit. Dann steht sie dort. Mitten auf der Fahrbahn. Das Licht der Scheinwerfer öffnet die Dunkelheit wie Epimetheus die Büchse der Pandora. Nach einer Schrecksekunde macht Tomáso eine Vollbremsung. Seine Zigarette fällt ihm aus dem Mund und die Getränkedose fliegt im hohen Bogen auf den Beifahrersitz. Das Auto steht. Hektisch klopft der Fahrer auf seinem Schoß herum. Er findet die Zigarette und drückt sie im Aschenbecher aus, während er mit offenem Mund durch die Windschutzscheibe starrt. Dort sieht er nur die von den Scheinwerfern beleuchtete Dunkelheit.
Tomáso öffnet zögerlich die Autotür und steigt aus. Langsam, wie in Zeitlupe, geht er zum Bug des Autos und zwingt sich dazu, auf den Asphalt zu schauen. Er ist gleichermaßen irritiert wie erleichtert, als er sieht, dass die Frau nicht vor dem Auto liegt. Er atmet zum ersten Mal seit einer Minute bewusst aus. Das Atmen hatte er für einen Moment vergessen. Dann durchzuckt ihn körperlich ein Gefühl der Panik, das seinen Atem erneut stocken lässt, während er langsam drei Schritte vom Auto weg macht, um sich zu bücken und, mit dem Schlimmsten rechnend, unter das Auto zu schauen. Aber das trifft nicht ein. Erleichtert stößt er laut seinen Atem aus. Es ist beinahe wie ein Schrei. Zögernd geht er um den Wagen herum und schaut auf den Boden, als würde er erwarten, dass die Frau dort liegt. Verwirrt geht er den Straßenrand, mit seinen wenigen kargen Büschen, ab. Er geht einige Meter, und ruft nach ihr. Sein erster Ruf nach der Frau klingt leise und ängstlich.
„Hallo?“
Sein zweiter Ruf klingt pressierend flehentlich. Er will, dass sich die Situation auflöst, dass sie auftaucht und sagt, dass alles okay ist, und dass es ihr gut geht.
„Hallo!“
Sein dritter Ruf klingt verzweifelt, und ist lauter als der vorherige.
„Hallo, wo sind Sie?“
Sein vierter Ruf klingt hilflos. Er weiß nicht, was er machen soll.
„Hallo? Ist Ihnen etwas passiert? Sind Sie verletzt?“
Es bleibt still, lediglich das Autoradio spielt weiter. Flach atmend, und als ob er das nicht bereits getan hätte, geht er langsam noch einmal um das Auto herum. Er geht zurück, in die Richtung, aus der er mit dem Seat gekommen ist, sucht die dunkle Straße und die Fahrbahnränder ab, und ruft erneut nach der Frau im weißen Kleid. Aber die Stille nach seinen Rufen bleibt.
Komm schon, komm schon, wo bist Du? Sag' etwas, irgendwas!, hämmert es in Tomásos Kopf, während er in der Dunkelheit nach einem menschlichen Körper am staubigen Straßenrand sucht und sein Herz so laut pocht, dass er seinen eigenen Herzschlag hört. Irgendwo hier muss sie sein. Aber er kann sie nicht finden. Er kämpft gegen eine aufkommende Hysterie an. Ruhig, bleib ruhig..., sagt er leise zu sich selbst.
Sehr langsam geht Tomáso zu dem Seat zurück. Am Auto ruft er noch einmal hilflos „Hallo?“, während er vor dem Wagen steht und noch einmal einige Schritte in jede Richtung macht.
Wie in Zeitlupe setzt er sich in sein Auto und dreht das Radio leise. Er starrt ungläubig vor sich hin, fährt sich mit beiden Händen durch die dunklen Locken und reibt sich die Augen. Ich muss sie überfahren haben, wie kann sie weg sein? Geht es ihm immer wieder durch den Kopf. Aber die Frau ist weg. Zögernd startet er den Motor, wartet noch zehn Sekunden, dann zieht er die Fahrertür zu und fährt langsam los. Den Rest der Strecke legt er in sehr langsamem Tempo zurück.
Er findet keinen klaren Gedanken und kann sich nicht erklären, was gerade geschehen ist. „Was bitte war das?“fragt er nach einigen Minuten laut, obwohl ihn niemand hören kann. Vielleicht ist er einfach nur vollkommen übermüdet, und die Müdigkeit hat ihm einen Streich gespielt und lässt ihn weiße Mäuse sehen. Oder Frauen in weißen Kleidern, die nachts mitten auf der Straße vor seinem Auto auftauchen...
Er ist momentan die meiste Zeit übernächtigt, im Klausuren-Stress und das Feiern in Pepes Club will er sich trotzdem nicht nehmen lassen. So auch an diesem Abend. Aber er ist nicht betrunken. Genaugenommen hat er gar nichts getrunken, außer Cola. Nicht mal ein Bier hat er bestellt. Er hat einen 2 cl Shot spendiert bekommen, aber davon ist man nicht betrunken und bekommt keine Halluzinationen. Er muss einer Sinnestäuschung erlegen sein, denn die Frau vor seinem Auto war auf keinen Fall ein Geist, so viel steht mal fest. Dennoch könnte er schwören, dass genau vor ihm auf der Fahrbahn eine Frau stand. Er hatte sie doch genau gesehen, oder zumindest ihre Silhouette, in der von den Scheinwerfern des Autos ausgeleuchteten Dunkelheit. Sie stand vielleicht nicht genau im hellen Licht des Scheinwerfers, aber dort, wo die Dunkelheit der Nacht auf das Licht des Scheinwerfer-Kegels trifft, irgendwo dort, stand sie. Ja, das könnte er beinahe beschwören. Er weiß, wie sie aussah. Sie hatte langes schwarzes Haar und trug ein weißes Kleid. Tomáso glaubt sich sogar an ihren Gesichtsausdruck zu erinnern. Sie sah asiatisch aus. Und er könnte schwören, für Bruchsekunden in ihr Gesicht geschaut zu haben. Sie hatte ihn mit weit aufgerissenen Augen verängstigt hilfesuchend angeschaut. Er seufzt tief. Was hatte er da gesehen oder glaubte er, gesehen zu haben? Es ist windstill und es kann nicht der bewegte Schatten einer jungen Pinie gewesen sein, die sich im Wind neigt. Und an Geister glaubt er nicht. Aber wo soll die Frau hergekommen sein? Er befindet sich noch immer auf einer gottverlassenen, einsamen Landstraße. Die Fahrbahn hat nicht mal Straßenmarkierungen. Hier ist weit und breit nichts außer karger Vegetation. Es gibt hier weit und breit keine Häuser, und über etliche Kilometer hat er kein anderes Auto gesehen. Er weiß nicht mehr, was er glauben soll. Er ist müde. Es muss eine Sinnestäuschung gewesen sein, eine andere Erklärung hat er nicht. Er hat niemanden überfahren, das ist sicher. Während er sich das vergegenwärtigt, macht er ein Kreuzzeichen, berührt mit seiner rechten Hand die Stirn, die Brust, und die linke und rechte Schulter, obwohl er kein besonders guter Katholik ist. Wenn dort eine Frau gewesen wäre, hätte er sie sehen müssen, nachdem er aus dem Auto gestiegen ist, versucht er sich zu beruhigen. Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Er schüttelt ungläubig den Kopf, so als wolle er das Erlebnis abschütteln, und muss dann unwillkürlich lachen, weil es aberwitzig ist und er gerade die Welt nicht mehr versteht. Hinter El Palamókommen ihm die ersten Autos seit einer halben Stunde entgegen. In wenigen Minuten wird der daheim sein und schlafen können.
Tomáso zieht die Wohnungstür hinter sich zu und lässt seinen Rucksack auf den braun gekachelten Boden im Flur fallen. Durch die geriffelte Milchglasscheibe der Wohnungstür fällt Licht aus dem Treppenhaus in den dunklen Flur der Altbauwohnung im zweiten Stock. Während er in die Küche geht, kommt er an dem Zimmer seines Mitbewohners vorbei. Die Zimmertür steht weit offen und Bruno liegt in seinem Bett und schläft. In der Küche geht er zum Kühlschrank und trinkt einen Schluck Hafermilch aus der Flasche. Er seufzt und wischt sich mit dem Handrücken über den Mund. Der kleine Raum wird nur durch das Licht des Kühlschranks beleuchtet. Er schaut sich um, und denkt sich, dass sie die Küche mal wieder aufräumen könnten. Tomáso stellt die Flasche zurück in den Kühlschrank und verlässt den Raum. Er geht in sein Zimmer, ohne das Licht einzuschalten, streift sich mit den Füßen die Sneakers ab, und lässt sich mit einem lauten Stöhner bekleidet in sein Bett fallen und schläft sofort ein.
Mit leichten, schnellen Schritten verlässt Tomáso das Universitätsgebäude. Der Himmel ist strahlend blau und die Sonne am Nachmittag erbarmungslos. Der Park des Campus mit seinen opulenten, künstlich angelegten Rasenflächen und meterhohen Palmen, ist beinahe menschenleer. Einige Studenten huschen beim Verlassen der Uni schnellen Schrittes von einer Schattenfläche zur nächsten, beinahe so als würden sie unter Dachvorsprüngen Schutz vor niederprasselndem Regen suchen. Als er nach einigen Minuten in die schmalen, schattigen Gassen im Stadtzentrum eintaucht, verlangsamt sich sein Gang. Eilig haben es in Alicante nur die Touristen, aber die meisten sind jetzt am Strand und lassen sich rösten. Die Einheimischen leben das Leben im Hochsommer langsam und suchen den Schatten. Sie sitzen in den Bars in den klimatisierten Innenräumen, während sich die Touristen auf die Terrassen in die pralle Sonne setzen. Die Siesta der kleinen Läden ist allmählich vorüber, die ersten Geschäfte öffnen jetzt, am späten Nachmittag, wieder.
Während Tomáso durch die Gassen schlendert, nimmt er ein leises, grollendes Geräusch wahr, ähnlich dem eines aufkommenden Gewitters. Er schaut verwundert nach oben, aber der Himmel ist wolkenfrei und blau. Womöglich hat ein Flugzeug das Geräusch verursacht, das am Flughafen Alicante gestartet ist. Als er in die nächste Gasse abbiegt, hört er das Geräusch nach wenigen Minuten wieder. Dann vernimmt er ein leises „¡Socorro!“, das wie die dünne, flüsternde Stimme einer Frau klingt, ganz nah und deutlich, und trotzdem sehr weit weg. Irritiert dreht er sich um. Er kann das Geräusch und die Stimme nicht orten und zuordnen. Er dreht sich mehrfach um, sucht die Straße mit seinen Augen nach der Herkunft der Stimme ab und schaut auf die Fassaden der umliegenden Häuser. Diese säumen sich aneinander wie Perlen einer längst vergangenen Epoche, die Patina angesetzt haben, auf einer Perlenkette, eine jede ein Unikat mit einer eigenen Geschichte, in verwaschenen grauen, beigen, vormals weißen, indes vergilbten, resedagrünen und ockerfarbenen Farben, unter denen sich der Putz löst. Aber er sieht nichts, was auffällig wäre, und den wenigen anderen Passanten scheint nichts aufzufallen. Er hebt die Augenbrauen, zuckt irritiert mit den Schultern und geht dann weiter.
Tomáso betritt den kleinen Laden, über dem ein Schild mit der Aufschrift Tabaco angebracht ist, und vor dem ein Aufsteller mit Werbung für die Loteria Nacional steht. Mit einem Päckchen Pueblo blau in der Hand verlässt er den Tabakwarenladen und wechselt einige Meter weiter auf die gegenüberliegende Straßenseite. An der Fruteria bleibt er stehen, schaut sich die Auslage an heimischen Früchten und frisch geerntetem Gemüse an, an dem noch Erde ist, und das in Kisten vor dem Laden drapiert wurde, und überlegt, ob er einige Nisperos kaufen soll. Er spürt eine Hand auf seiner Schulter und zuckt unwillkürlich zusammen. Dann vernimmt er die glockenhelle, fröhliche Stimme der Frau.
„Hallo, Tomáso!“
Als er sich schnell umdreht, schaut er in das strahlende Gesicht von Isabel, die sich ihm nähert und ihm einen Wangenkuss links und einen rechts gibt. Danach kommt auch seine Kommilitonin Verónica aus der Fruteria, die mehrere vollgepackte Papiertüten trägt. Sie begrüßen sich und unterhalten sich über den gestrigen Abend in Pepes Club.
„Wart Ihr noch lange im Club?“fragt Tomáso.
„Nein, wir sind eine halbe Stunde nach Dir gefahren“, antwortet Verónica. „Maris Mutter hat sie abgeholt, kaum nachdem Du gegangen bist, und uns mitgenommen“.
„Wir konnten nicht lange bleiben, um zehn heute früh hatten wir Vorlesung“, wirft Isabel ein.
Tomáso hält einen Augenblick inne. Er grübelt einen Moment, wie er es sagen soll. Verlegen schaut er auf seine Sneakers, dann schaut er die Frauen an und fragt: „Ist Euch unterwegs etwas aufgefallen...?“
Verónica holt eine Aprikose aus einer Papiertüte, putzt sie ab, beißt rein und schaut ihn fragend an.
„Was soll uns aufgefallen sein?“ fragt Isabel neugierig.
Tomáso druckst herum. Dann sagt er leise, ohne zu viel Wichtigkeit in seine Worte zu legen: „Auf der Landstraße...?“
Die Freundinnen schauen sich fragend an. Isabel zuckt mit den Schultern.
„Nö... was soll dort gewesen sein?“ fragt Verónica.
„Ach, nichts...“ erwidert Tomáso, und wechselt betont unauffällig das Thema. „Seid Ihr am Wochenende wieder im Club?“
„Ja, wahrscheinlich schon...“,antwortet Isabel lachend.
„Ist ein toller Club!“, ergänzt Verónica, und beißt ein weiteres Stück von der Aprikose ab.
„Okay, dann sehen wir uns spätestens bei Pepe!“, erwidert Tomáso.
Die drei verabschieden sich mit einer kurzen Umarmung voneinander. Die Frauen winken ihm fröhlich hinterher und er winkt mit einem Augenzwinkern lachend zurück.
II
Camila stellt eine Schüssel mit heißen, dampfenden frittierten Kartoffeln auf den großen Holztisch in der Küche. Neben die Pfanne und die kleine Schüssel mit dem Rosenkohl, die dort schon stehen. Auf dem Tisch stehen sich zwei große blaue flache Teller gegenüber, neben denen Besteck liegt und zwei Trinkgläser stehen. Die kleine, zierliche Frau mit den langen dunkelbraunen Haaren geht zur Türschwelle des Dorfhauses. Ihre Augen schauen sich suchend um. Auf der kleinen Straße aus Pflastersteinen vor der Casita ruft sie laut und resolut.
„Marco?“
„Marco!“
„Komm rein, Essen ist fertig!“
Camila und Marco sitzen sich am Küchentisch vor üppig gefüllten Tellern mit dampfendem Essen gegenüber. Camila gießt Wasser aus einem Glaskrug in beide Gläser, die neben den Tellern stehen. Marco nimmt eine Scheibe Brot aus dem Brotkorb, während er mit der anderen Hand eine überdimensioniert volle Gabel Patatas Fritas mit Knoblauch-Rosenkohl in seinen Mund zu bugsieren versucht. Ein Teil des Essens fällt von der Gabel zurück auf den Teller. Er reißt die Scheibe Weißbrot entzwei und schiebt sich eine Hälfte in den Mund. Dabei tritt er mit seinem rechten Fuß rhythmisch gegen das Tischbein. Camila schaut ihn streng an.
„Wo warst Du?“, fragt sie.
„Bei Pablo. Er hat eine alte Vespa in der Garage, die richtet er her.“
Marco legt die Gabel auf den Teller, streckt beide Arme nach vorne, simuliert das Halten eines Motorrad-Lenkers und imitiert das Geräusch eines Motors.
Camila schaut ihn fragend, mit hochgezogener Augenbraue an, muss dann aber über ihren kleinen Bruder schmunzeln. Sie legt ihre Gabel nieder, tupft sich den Mund mit ihrer Serviette ab und trinkt einen Schluck Wasser aus ihrem Glas.
„Und wo hat er die Vespa her?“
„Gefunden.“
Camila schaut Marco erneut mit hochgezogener Braue an. Der kratzt den Rest vom Essen auf seinem Teller zusammen, schiebt alles auf die Gabel, führt sie sich in den Mund und steht vom Tisch auf. Er geht die wenigen Meter zu dem alten, abgewetzten braunen Sofa hinüber, lässt sich darauf fallen, nimmt die Fernbedienung vom Fernseher, stellt den Ton laut und zappt sich durch die Programme.
Camila isst fertig. Sie nimmt ihren Teller und steht auf.
„Kannst Du nicht wenigstens am Tisch sitzen bleiben, bis ich auch fertig gegessen habe?“
Sie stellt ihren Teller in die Spüle und räumt Marcos Teller und sein Glas vom Tisch.
„Und Deinen Teller in die Spüle räumen?“
Marco steht vom Sofa auf.
„Ja, ja, Schwesterherz...“
Belustigt äfft er Camila wortlos nach. Dann geht er zu ihr, legt seinen Arm um sie, er ist größer als sie, haucht ihr einen Kuss auf die Wange und verlässt das Haus.
„Wo gehst Du hin?“ ruft ihm seine Schwester hinterher.
„Zu Pablo... und vielleicht zu Alfonso!“ ruft er von draußen zurück.
Er zieht seinen Helm auf, setzt sich auf seinen Motorroller und braust mit knatterndem Motor davon.
Es ist später Nachmittag. Camila geht schnellen Schrittes die Straße entlang. Sie hat einen Korb mit Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln geschultert. An der nächsten Weggabelung biegt sie in eine enge Pflasterstein-Gasse ab, die kaum breiter als ein Transporter ist. Die Absätze ihrer Stiefeletten klackern auf dem Kopfsteinpflaster. Keine dreißig Meter vor ihr, auf der linken Seite, prunkt an einer Hauswand das Schild mit der Aufschrift Bar Álvaro. Don Álvaro ruht bereits beinahe so lange auf dem Cementerio, wie Camila auf der Welt ist. Er starb als alter Mann, als sie ein Kleinkind war. Sie kann sich nicht mehr an ihn erinnern. Seitdem, seit mehr als zwanzig Jahren, gehört die Bar Alfonso, der ist inzwischen auch ein alter Mann, aber geändert hat er das Schild nie, und es stört niemanden. Das Leben im Dorf ist so, wie es immer war, heute wie vor zwanzig Jahren. Vor der Bar entdeckt sie Marcos Motorroller.
Camila betritt die Bar. Alfonso steht hinter dem Tresen und putzt in aller Ruhe dieser Welt Gläser. Sie würdigt ihn keines Blickes, rauscht grußlos an ihm vorbei und stürmt auf Marco zu, fasst ihn am Ärmel seines Shirts und will ihn aus der Bar herausziehen.
„Was tust Du hier?“ herrscht sie ihren Bruder an.
„Wie oft habe ich Dir schon gesagt, Du sollst Dein Geld nicht in diesen Bandido hinein werfen?“
Ärgerlich schlägt sie mit der Hand gegen den Spielautomaten, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, vor dem Marco auf einem Barhocker sitzt, und der von lustigen Musiktönen untermalt bunte Bilder von gemalten Früchten rotieren lässt. Sie zieht ihn an seinem Shirt vom Barhocker zur Tür. Marco protestiert leise, aber seine Schwester packt ihn und bugsiert ihn auf die Gasse vor der Bar.
„Wie kannst Du es zulassen, dass er unser Geld in den Automaten wirft?!“, pflaumt sie Alfonso beim Hinausgehen an. Alfonso grinst.
Vor der Bar diskutieren die Geschwister einige Minuten lebhaft. Am Ende lachen beide. Camila setzt den Helm auf, den Marco hinten an seinem Motorroller befestigt hat, um einen Sozius mitnehmen zu können, und gibt ihrem Bruder einen liebevollen Klaps auf den Hinterkopf. Sie steigt hinten auf den Roller auf. Marco startet das Fahrzeug und sie fahren mit knatterndem Motor über das Kopfsteinpflaster davon.
III
Tomáso verlässt das Universitätsgebäude und geht durch die begrünte Parkanlage des Campus. Das Gelände ist riesig und schnellen Schrittes benötigt er beinahe zehn Minuten, um den Campus hinter sich zu lassen. Auf der Straße vor dem Campus-Gelände holt er sein Smartphone aus dem Rucksack, den er leger über der Schulter trägt. Während er durch die Gassen schlendert und in Gedanken versunken mit seinem Handy beschäftigt ist, vernimmt er ein leises Donnergrollen. Dann hört er die Frauenstimme, die hilfesuchend „Socorro...“ flüstert. Irritiert schaut Tomáso auf. Da ist niemand. Er dreht sich um. Nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehen zwei Passanten, sonst ist die Straße menschenleer. Tomáso schaut sich um, er schaut in jede Himmelsrichtung, während er sich langsam einmal um sich selbst dreht. Und dann sieht er die asiatische Frau im weißen Kleid wenige Meter vor sich stehen.
Tomáso starrt die Frau an. Sie steht einfach nur da und sagt nichts. Sie ist jung, vielleicht ein Erstsemester an der Uni, geht ihm durch den Kopf, klein, zierlich. Ihre Haare sind lang, glatt und schwarz. Sie trägt ein leichtes, weißes Sommerkleid. Sie sieht ihn an und schaut ihm ins Gesicht. Ihr Gesichtsausdruck wirkt verloren und hilfesuchend. Das ist die Frau, die vorletzte Nacht auf der Landstraße stand. Tomáso ist sich sicher. Aber das ist absolut unmöglich! Das kann einfach nicht sein. Aber sie ist es! Sie trägt sogar das selbe Kleid wie in der Nacht...
Verwundert schaut er die Frau an, er hat das Gefühl sich nicht bewegen zu können, und er bemerkt, dass er nicht nur schaut, sondern starrt. Sein Herz schlägt schneller. Sie muss denken, dass er ein Verrückter ist, geht es ihm durch den Kopf. Aber so fühlt er sich tatsächlich auch. Das ist vollkommen surreal. Zögernd macht er den ersten vorsichtigen Schritt und geht auf sie zu. „Kneif mich bitte jemand...“ denkt er, oder hat er es leise ausgesprochen? Das kann nicht die Frau von der Landstraße sein. Sie kann es nicht sein. Wahrscheinlich war da nicht einmal eine Frau, und er war nur vollkommen übermüdet und hat sich die Frau auf der Fahrbahn eingebildet. Vielleicht war er im Auto kurz vorm Sekundenschlaf und sein Gehirn hat ihm einen Streich gespielt, damit er wieder wach wird. Es stand auch weit und breit kein anderes Auto an der Landstraße und zu Fuß kommt dort kein Mensch hin. Das muss eine andere Frau sein. Aber weshalb bittet sie um Hilfe und ruft „Socorro“...? Sie spricht ihn nicht an. Und er weiß nicht, was er sagen soll und bekommt kein Wort heraus.
Die Frau geht weg. Tomáso folgt ihr sehr langsam. Sie verschwindet hinter einer Häuserecke.. Als er um die Häuserecke geht, ist die Frau weg. Nur ein alter Mann mit einem Stock geht spazieren. Tomáso steht auf dem Gehweg und weiß nicht, wie ihm geschieht. Er atmet tief durch, lässt sein Handy, das er immer noch in der Hand hält, in den Rucksack gleiten, fährt sich mit beiden Händen durch die braunen Locken und das Gesicht. Er atmet noch einmal tief ein und aus, dann dreht er sich herum und geht. Er muss unwillkürlich lachen. Er lacht laut, während er schneller geht, und ruft heraus: „Ich werde verrückt...!“. Vielleicht sollte er mal ein paar Tage nachts nicht feiern, sondern früh zu Bett gehen und ausschlafen. Wahrscheinlich sieht er wirklich schon weiße Mäuse, und die Frauenstimme kam aus einem Fernsehgerät hinter einem Fenster, und die asiatische Frau wohnt in der Seitenstraße. Sie benötigte offenbar keine Hilfe und hat ihn lediglich angeschaut, weil er sie wie ein Irrer angestarrt hat. Ja, er wird in den nächsten Tagen nicht in Pepes Club gehen und sich etwas Ruhe gönnen. Und bald beginnen die Semesterferien.
Die kleine Bar im Zentrum von Alicante ist so voll mit jungen, fröhlichen, lauten, lachenden, mit Händen und Füßen diskutierenden Menschen, dass kaum noch ein Durchkommen ist. Die meisten Besucher stehen, weil alle Stühle und Barhocker in der violett und schwarz gestrichenen Bar besetzt sind, und einige sitzen in dem vielleicht zwanzig Quadratmeter kleinen Gastraum auf dem Tresen, weil es keinen Stehplatz mehr gibt. Sobald jemand die Bar verlässt, strömen neue Gäste hinein. Alle sind Studenten. Das Chuchuka befindet sich gleich am Busbahnhof, einem beliebten Umschlagplatz für alle, die vom Campus mit dem Bus weiterfahren müssen, und es hat Studentenpreise. Der Duft von Churros, geröstetem Tomatenbrot und Espresso liegt in der Luft. Isabel sitzt auf einem Barhocker und Tomáso steht neben ihr. Sie trinken Tila aus Gläsern. Sie sagt etwas, aber Tomáso kann sie aufgrund der Lautstärke um sie herum nicht verstehen. Er beugt sich zu ihr vor und legt eine Hand an sein Ohr, um sie besser verstehen zu können. Isabel wirft ihre langen blonden Haare zurück und lacht.
„Was?“ schreit er sie an.
„Kino?“ schreit sie zurück.
Tomáso denkt einen Augenblick nach, zuckt mit den Schultern und schreit: „Welcher Film?“Sie beugt sich zu ihm vor. „Na, da läuft doch jetzt...“ Isabel unterbricht. Verónica und Bruno kommen hinzu. Verónica umarmt Isabel von hinten. Die Freunde begrüßen sich mit angehauchten Wangenküssen. Gerardo drängt sich durch das Getümmel zu ihnen und legt seinen Arm um Isabel. Sie schmiegt sich an ihren Freund. Die Fünf diskutieren laut und lachen viel.
„Also, Kino?“ schaut Isabel Gerardo mit großen Augen kokett fragend an.
„Kino!“ erwidert der.
Er schaut Tomáso an und fragt: „Kino?“
Tomáso nickt.
Gerardo zeigt auf Verónica und fragt: „Kino?“
Sie zieht einen Flunsch und antwortet mit ausladender Geste bedauernd: „Ich kann nicht. Ich muss lernen.“
Dann wendet er sich an Bruno: „Kino?“
Der schüttelt lachend den Kopf und erwidert: „Ich hab' was vor...“ .
Bruno ruft seinem Mitbewohner Tomáso zu: „Kann ich Dein Auto für ein paar Stunden haben?“.
„Klar“, erwidert Tomáso.
„Danke, Buddy!“ ruft Bruno, während Verónica sich von ihren Freunden verabschiedet und sich durch die Menschenmenge zum Ausgang schiebt. Bruno verlässt nach ihr die Bar, und kurz darauf brechen auch die anderen auf.
Isabel, Gerardo und Tomáso verlassen das Kino. Sie lassen sich mit der lauten, fröhlichen Traube der anderen Kinobesucher treiben, die sich vor dem Kinépolis nach und nach auflöst, um sich in alle Himmelsrichtungen zu verteilen, scherzen und lachen. Isabel hakt sich bei Gerardo und Tomáso unter. Es ist ein warmer Sommerabend und um halb zehn abends immer noch hell.
Die Drei bewegen sich aus dem Stadtviertel heraus. Die Passanten werden nach und nach weniger und verstreuen sich in den kleinen Seitenstraßen mit ihren Geschäften, Bars und Straßencafés. Sie bummeln untergehakt und gutgelaunt durch Pflasterstein-Gassen, die von alten Häusern mit morbidem Charme umsäumt sind, die bereits ihre Farben verlieren und bei denen bei einigen der Putz von der Fassade bröckelt. Tomáso wird langsamer und schaut in den Himmel, als er ein leises Donnergrollen wahrnimmt. Der Himmel ist blau, wenige weiße Wolken bewegen sich wie in Zeitlupe. Am Horizont ist ein malerisches Orange zu sehen, das sich mit einem neonfarbenen Pink und einem zarten Violett vermischt. Die Dämmerung tritt ein. Aber es ist noch hell genug, um zu sehen, dass keine dunklen Wolken am Himmel zu sehen sind, die ein Gewitter ankündigen. Er runzelt nachdenklich die Stirn.
Die kleine Gruppe schlendert in eine größere Gasse, deren Belag aus alten Pflastersteinen besteht, bei dem der ein oder andere bereits fehlt, und die sie aus dem Labyrinth der engen Gassen heraus, auf den Vorplatz einer kleinen Kirche und in wenigen Fußminuten in ihr Wohnviertel führt. Außer ihnen ist hier niemand. Isabel und Gerardo gehen Arm in Arm. Sie lachen und necken sich. Tomáso geht dicht neben ihnen. Mit einmal Mal bleibt er wie angewurzelt stehen und starrt geradeaus. Einige Meter vor ihm taucht aus der Dämmerung heraus die asiatische Frauim weißen Kleid auf und schaut ihn an. Tomáso fühlt sich wie gelähmt, er kann nicht weiter gehen und bekommt kein Wort heraus. Sein Herz schlägt schneller und sein Mund wird trocken. Er hält den Atem an. Wieder vernimmt er das klagende, eindringliche, ätherische „Socorro...“, und kann nichts tun, außer die Frau entsetzt und verwirrt anzustarren.
Nach wenigen Sekunden, die ihm selbst wie Minuten, vorkommen, zwingt er sich, aus seiner Schockstarre herauszukommen, versucht, ruhig und regelmäßig zu atmen. Er atmet tief durch, macht einen langsamen, zögerlichen Schritt nach vorn, und spricht sie an.
„Wer bist Du?“ ruft Tomáso der Frau zu.
Isabel und Gerardo unterbrechen ihr verliebtes Geplänkel und schauen ihn irritiert an.
„Mit wem sprichst Du?“ fragt Isabel.
„Na, mit der Frau!“ erwidert Tomáso.
„Mit welcher Frau?“ hakt sie nach.
„Na, mit der Frau dort!“.
Er zeigt in ihre Richtung, aber die Asiatin ist verschwunden.
„Habt Ihr sie nicht gesehen?“ fragt Tomáso aufgebracht.
„Nein...“. Gerardo zieht bedauernd die Schultern hoch.
„Nein“, antwortet auch Isabel.
„War sie hübsch?“, scherzt Gerardo lachend.
Isabel knufft ihn mit strengem Blick in die Seite. Er lacht. Die Drei gehen weiter.
„Habt Ihr es gehört?“ fragt Tomáso.
Die beiden anderen schauen ihn fragend an.
„Die Stimme! Das Socorro! Das Donnergrollen!“ schreit Tomáso verzweifelt, und macht eine ausladende Geste gen Himmel, während er sich hilflos einmal um sich selbst dreht.
Isabel und Gerardo schauen ihren Freund verwirrt an und schütteln verneinend die Köpfe.
Tomáso und Bruno sitzen am kleinen Tisch in der Küche ihrer Wohngemeinschaft. In der Spüle stapeln sich Töpfe, Kochlöffel, Schöpfkellen, ein Schneidbrett und ein Nudelsieb. Sie essen Spaghetti mit Tomatensauce und unterhalten sich darüber, was sie in den bevorstehenden Semesterferien machen werden.
„Bleibst Du in den Semesterferien in Alicante?“, fragt Tomáso, während er Hafermilch aus der Flasche in sein Glas schüttet.
Bruno dreht Spaghetti auf seine Gabel, führt sie in seinen Mund. Dann trinkt er einen Schluck Cola aus der Dose.
„Nee, ich muss mal raus“, antwortet er lachend.
Tomáso schaut ihn neugierig an.
„Ich fahre aufs Land, zu meiner Familie“, sagt sein Mitbewohner.
Tomáso nickt. Für einen Moment schweigen sie.
„Und was machst Du?“ fragt Bruno.
„Ich will auch raus, aber wahrscheinlich scheitert's am Geld“, antwortet Tomáso. Dann grinst er Bruno an und sagt: „Kannst mich ja mitnehmen.“
Bruno lacht. Er steht auf und räumt seinen leeren Teller in die Spüle.
„Na, was ist...?“ legt Tomáso scherzend nach.
Bruno steht breitbeinig im Türrahmen und schaut Tomáso grinsend an.
„Glaub mir, Du willst nicht mit auf die Finca. Meine Familie ist...“, er zögert, und betont es dann besonders, „sehr speziell“.
Er dreht sich um und geht. Im Weggehen sagt er heiter, so als würde Tomáso wahrhaft nichts versäumen: „Du würdest Dich nur langweilen, Buddy...“.
IV
In dem weiß gestrichenen Raum mit dem hellem Linoleumboden sind die Fenster geöffnet. Aluminium-Jalousien halten die Sommerhitze von außen ab. Auf drei großen Schreibtischen, die seltsam im Raum verteilt stehen, stehen Computer. An einer Wand ist eine große Flipchart befestigt. An der Tafel hängt das Foto einer asiatischen Frauenleiche. Dass die Frau auf dem Foto tot ist, ist unverkennbar. Mit einem geringen Abstand hängen Fotos von drei weiteren Frauen daneben, über denen jemand „Se buscan“ geschrieben hat. Diese Frauen werden vermisst.
Kommissarin Elena Lòpez Navarro steht nachdenklich vor der Flipchart. Sie tippt mit einem Stift auf das Foto der Toten.
„Wer ist sie? Wo kommt sie her? Niemand kennt diese Frau. Keiner will sie je gesehen haben. Die Kollegen haben in drei an den Fundort angrenzenden Dörfern alle Bewohner gefragt.“
Agente Javier Romero Torres, der Zivilpolizist im Ermittlerteam, schaut erst die Kommissarin an, und dann auf die Flipchart. Er kratzt sich am Kinn und untermalt seine Worte mit einem Kugelschreiber, den er in der Luft bewegt, wie ein Dirigent die Musik mit seinem Taktstock.
„Das ist merkwürdig. Niemand würde von weiter weg kommen, um sie ausgerechnet am Fundort an den Straßenrand zu legen. Wenn er von weiter weg kommt, um die Leiche zu verstecken, will er doch, dass sie nicht gefunden wird. Sonst würde er sich die Mühe nicht machen.“
Er unterbricht für einen Moment, legt dann den Kugelschreiber auf seinen Tisch und macht mit seinen Armen eine ausladende Geste des nicht Verstehens, wobei man meinen kann, dass er leise seufzt, während er ausatmet. Dann fährt er fort.
„Und der hier hat sie einfach am Straßenrand abgelegt. Nicht mal hinter ein Gebüsch. Es muss ihm klar gewesen sein, dass sie schnell entdeckt wird.“
Es entsteht eine kurze Sprechpause, in der alle ihre Gedanken sammeln.
Kommissar Emilio Rodruigez Moreno sitzt breitbeinig auf seinem Bürostuhl aus schwarzem Kunstleder, den er ein Stück weit von seinem Schreibtisch weggeschoben hat. Er rollt mit dem Stuhl ein paar Zentimeter nach vorne, dann wieder zurück. Seine Lesebrille hat er tief unter die Nasenwurzel geschoben und schaut abwechselnd Elena und seinen Kollegen am Schreibtisch zu seiner Rechten über das Gestell seiner Brille an. Er fährt sich langsam mit der Hand durch den üppigen schwarzen Vollbart.
„Außerdem war sie noch nicht lange tot, als sie gefunden wurde, vermutlich keine zehn Stunden, eher weniger... Die Lady war noch fast warm.“
Elena wirft Emilio einen missbilligenden Blick zu.
„Derjenige, der die Frau dort abgelegt hat, kann also nicht von weiter weg kommen... Das würde einfach keinen Sinn machen“, ergänzt Javier.
Es klopft an die Tür des Büros, die sich beinahe im selben Augenblick öffnet. Ein Polizist in schwarzer Hose und weißem Hemd, das um ein oder zwei Knöpfe zu weit geöffnet ist und schwarzes Brusthaar offen legt, kommt herein. Er hält eine transparente Mappe mit einigen Bögen DinA4-Papier in der Hand. Der Polizist macht drei Schritte auf Elena zu und hält der leitenden Kommissarin der Soko El Palamó die Unterlagen hin.
„Noch eine“, sagt er emotionslos.
Elena schaut ihn fragend an.
„Es wurde noch eine Frauenleiche gefunden. Sieht übel aus. Eindeutig Tod durch Fremdverschulden. Sie wurde gefoltert. Sieht nach Ritualmord aus.“
Javier stößt leise ein zischendes Geräusch durch seine Zähne aus, lässt seinen Oberkörper nach vorn fallen, hebt seinen Kopf und schaut den Polizisten an. Auch Elena und Emilio schauen ihn aufmerksam an, während sie versuchen, ihr Entsetzen zu unterdrücken.
„Wo?“ fragt Javier, und strafft seinen Oberkörper wieder.
Elena macht einen Schritt auf den Kollegen zu und nimmt ihm die Unterlagen ab.
„In einem Pinienhain bei Callosa. Wurde regelrecht dort aufgebahrt.“
Elena wirft einen Blick auf das Foto in der Mappe und schaut gleich wieder weg.
Der Polizist ist bleich. Jeder im Raum spürt, dass ihm der Leichenfund nahe geht. Er bemüht sich um Fassung, bevor er leise sagt:
„Die ist schon lange tot. Die Verwesung hat schon eingesetzt. Sie lag schon eine Weile dort.“
Emilio steht auf und nimmt seine Lederjacke von der Lehne seines Stuhls. Die drei anderen schauen ihn fragend an.
„Gerichtsmedizin“, sagt er, und geht zur Tür.
Elena nickt ihm zustimmend zu.
„Ja, auf...!“ erwidert sie, nimmt ebenfalls ihre Jacke und folgt ihm.
Der mit alten weißen und cremefarbenen Kacheln an den Wänden und auf dem Boden geflieste Raum ist kühl und kaum beleuchtet. Durch zwei kleine Oberlichter fällt ein Minimum an Tageslicht herein. Der Raum ist karg. An einer Wand befinden sich zwei Handwaschbecken. Auf einer Seite des Raums steht ein Obduktionstisch. Einige Meter daneben steht ein weiterer Obduktionstisch, auf dem eine Leiche liegt. Über dem Raum liegt eine seltsame Stille. Es ist nicht nur die Stille eines fast leeren Raumes, in dem sich nur drei Menschen befinden, die leise sprechen. Es ist eine besondere Stille, wie die Stille in einer Kirche unter der Woche, wenn kein Gottesdienst stattfindet. Elena, Emilio und der Pathologe stehen neben der toten Frau, die auf dem Tisch liegt. Elena zeigt auf die Wülste, die der Leichnam überall aufweist.
„Was ist das?“
„Messerstiche. Sie hat mehrere hundert Messerstiche überall am Körper“, antwortet der Pathologe neben ihr. „Intra vitam, also ante mortem. Unterschiedlich alt. Keine tiefen Schnittwunden, aber genug davon, dass sie nach und nach viel Blut verloren hat.“
Sie zeigt auf die Füße und die Beine.
„Und das?“
„Da haben schon die Wildschweine an ihr geknabbert“, erwidert der Mann im weißen Kittel. „Post mortem.“
„Todesursache?“ fragt Emilio, der einen Meter hinter den beiden steht und sichtlich blass ist.
„Die Frau ist verblutet. Sie hatte Blutverdünner im Blut. Und sie hatte eine Sepsis. Also, sucht Euch was aus. Sonst wäre sie nach wenigen weiteren Stunden an Dehydrierung verstorben.“
Die toughe, zierlich-sportliche Frau mit dem burschikosen Kurzhaarschnitt, in engen Jeans und klobigen Stiefeln, zuckt kaum merklich für Bruchsekunden zusammen und senkt die Augenlider, um einen kurzen Moment inne zu halten. Speichel sammelt sich in ihrem Mund und ihre Augen werden glasig. Sie kämpft mit einem Würgereiz, und schafft es, ihn zu unterdrücken. Dann schaut sie den Pathologen an und fasst sich wieder.
„Die abschließende Identifizierung der Frau steht noch aus, nehme ich an?“
„Nope. Gebiss haben wir noch nicht final, da ist der Zahntechniker dran, aber DNA ist klar. Das ist Eure Vermisste aus Asturien.“
Elena schaut Emilio ernst und gleichermaßen verwundert an, der senkt seinen Blick und atmet laut hörbar aus. Er geht zum Ausgang. Elena legt dem Pathologen eine Hand auf die Schulter, dann geht sie. Emilio übergibt sich in einem kurzen Schwall in eines der beiden Waschbecken. Als Elena die Gerichtsmedizin verlässt, hört sie, wie der Wasserhahn im Raum hinter ihr betätigt wird und Emilio mehrmals hustet und sich räuspert.
Die beiden Kommissare sitzen im Auto. Elena sitzt hinter dem Steuer, das Fenster ist heruntergelassen, sie raucht eine Zigarette. Emilio hält einen Coffe to go in der Hand, den er sich im Foyer der Klinik am Automaten gezogen hat. Nachdem sie eine Weile schweigend da sitzen, schüttelt der Kommissar kaum merkbar den Kopf.
„Das schwerste Verbrechen, das in Santa Medina de Carmita in den letzten zwanzig Jahren verübt wurde, war der Einbruch von Jugendlichen in den Tabaco-Laden. Die Jungs von damals sind heute erwachsen. Und die Amokfahrt einer dementen 88-Jährigen. Piedad Garcia Gonzáles. Gott hab sie selig! Sie hat ihren Neffen auf dem Zebrastreifen über den Haufen gefahren, weil sie glaubte, er wolle sie ins Altenheim bringen, um sie zu beerben...“.
Elena sieht ihn ernst, mit einer subtil mitschwingenden Belustigung, an.
„Er hatte nur ein gebrochenes Bein. Die Alte wurde vom Richter in ein Altenheimeingewiesen.“
Elena und Emilio schauen sich an. Beide müssen lachen. Dann sagt der Kommissar ernst:
„Und jetzt haben wir innerhalb von vier Monaten zwei Frauenleichen und zwei vermisste Frauen.“
Elena schweigt betroffen.
V
Camila steht in der Küche des alten Dorfhauses mit den rustikalen braunen Bodenfliesen und den weiß getünchten Wänden, an denen bunte Wandteller in allen möglichen Größen hängen, und in dem auch der große Röhrenfernseher vor einem abgewetzten alten Sofa steht, auf dem es sich Marco bequem gemacht hat. Eine Baumwolldecke liegt auf dem Küchentisch, auf dem sie die Wäsche für ihren Bruder und sich bügelt. Die große Schwester hat die Fürsorge nach dem Tod der Eltern für den minderjährigen Bruder übernommen. Sie ist ihm eine Schwester und versucht auch, die Eltern zu ersetzen, so gut sie kann. Es ist nicht immer leicht mit dem kleinen Bruder, beinahe hätte sie ihn, nachdem die Eltern verunfallt waren, in ein Kinderheim gegeben, weil sie glaubte, dem kleinen Jungen mit dem ADHS nicht gerecht werden zu können. Sie hatte es dann doch nicht über das Herz gebracht, und jetzt haben sie sich seit mehreren Jahren schon zusammengerauft. Sie lachen, streiten, diskutieren, und lachen am Ende wieder. Die Wutanfälle von früher hat Marco kaum noch.
Marco dimmt die Lautstärke des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung bis zum Anschlag hoch.
„Marco!“, zischt die große Schwester ihn genervt an. Marco reagiert nicht.
„Marco!“, schreit sie ihn ungehalten an.
Er dreht sich zu ihr um und lacht sie an. Camila macht eine genervte, ausladende Geste.
„Ja, ich mach' ja leiser...“, erwidert er auf ihre Geste.
„Madre mia...“, seufzt sie. Sie schaut ihn mit hochgezogener Augenbraue an und bügelt weiter.
„Der hat es auch geschafft!“, sagt er dann.
„Wer?“, fragt sie.
„Na, er! Al Pacino. Der kommt aus armen Verhältnissen und jetzt ist er ein Hollywood-Star. Ein richtig großer.“
Marco greift in die Holzschüssel mit knusprigen Tacos, die auf dem Wohnzimmertisch steht, und zerbeißt sie absichtlich laut krachend und knackend.
„Vielleicht bin ich eines Tages auch in Hollywood...“.
„Träum' weiter, Brüderchen“, erwidert seine Schwester.
„Was soll ich hier? Es ist langweilig im Dorf.“
Er nimmt noch eine handvoll Tacos.
„Und was soll ich hier arbeiten? Es gibt keine Arbeit.“
„Du könntest wenigstens mal in die Schule gehen, anstatt den ganzen Tag hier rumzuhängen und in die Glotze zu schauen.“
Camila hat längst kapituliert und aufgehört, ihren Bruder zwingen zu wollen, jeden Tag in die Schule im Dorf zu gehen. Seitdem haben auch seine Wutanfälle aufgehört. Sie hat akzeptiert, dass ihr Bruder anders ist als andere Jugendliche in diesem Alter. Da er über sechzehn Jahre alt ist, muss er nicht mehr in den Unterricht, auch wenn er seine Schulzeit eigentlich noch nicht beendet hat.
„Hat Al Pacino auch nicht gemacht“, kontert Marco. „Er ist sogar von der Schule geflogen und hat dann als Karten-Abreißer im Kino gearbeitet. Wusstest Du das?“.
„Nein...“, antwortet Camila gleichmütig und faltet einen Bettbezug zusammen.
„Vielleicht gehe ich auch nicht nach Hollywood... ich gehe nach Madrid und lerne Pedro Almodóvar kennen.“
Seine Schwester schaut ihn genervt an.
„Oder ich gehe nach Murcia...“
„Ja, dann bist Du wenigstens zum Essen wieder zeitig daheim“, lacht Camila.
Marco, der kaum eine Minute still sitzen kann, und diese eine Minute hat tatsächlich höchstens eine Minute, setzt sich auf die Sofa-Kante, die Schüssel mit Tacos auf seinem Schoß, und schaut gebannt auf den Bildschirm. Es läuft eine Szene, in der Al Pacino mit Karl Urban in Hangman – The Killing Game einen Serienkiller jagt.
„Serienkiller sind schlauer als normale Menschen“, sagt er dann.
Seine Schwester schaut ihn befremdet an, schüttelt irritiert den Kopf und muss schmunzeln.
VI
Durch den schwarzen Raum schießen grelle neonfarbene Lichtblitze, die von überall herkommen und nach überall verschwinden. Sie sind nur für wenige Bruchsekunden zu sehen, bevor sie sich im Nichts auflösen. Unter transparenten pinkfarbenen, absinthgrünen, neonblauen und leuchtend violetten Luftballons bewegen sich scheinbar schwerelos Fabelwesen mit menschlicher Silhouette aus einer anderen Welt, zu House, Electro und Dance feiernd, zwischen den Lichtblitzen. Man sieht neongrüne und sonnengelbe Kussmünder ohne ein Gesicht, Brillengestelle in leuchtendem Türkis, Orange und Rosa in Gesichtern, die nicht existent sind, Gesichter, die aus farbigen, fluoreszierenden Punkten bestehen und ein breites neongelbes Grinsen ohne Katze, wie bei Alice in Wonderland. Das Grinsen ohne Katze ruft laut: „Yeahhh, Semesterferien!“ und stößt einen schrillen Pfiff aus. Dicht neben ihr stimmt das leuchtend türkisfarbene Brillengestell ein: „Semesterferien!“. Gläser mit farbigem Inhalt bewegen sich scheinbar frei in der Luft. Die Fabelwesen jubeln, lachen, schreien, immer wieder schweben neue farbige Gläser durch die Dunkelheit. Die Schwarzlichtparty in Pepes Club ist der Kracher, und die Location brechend voll mit ausgelassenen jungen Menschen.
Bruno, dessen Augenpartie mit grüner, blauer und orangefarbener Neonfarbe umrandet ist, die nach unten hin ausläuft, erinnert an das Gesicht eines Drachens. Er holt an der Bar zwei Gläser mit hellblauer Flüssigkeit, die im dunklen Raum leuchtet. Mit den Gläsern in der Hand bahnt er sich einen Weg durch die Partypeoples. Er passiert zwei leuchtend rosafarbene Katzenohren, die mit einem Haarreif aufgesteckt sind. Dazu gehört ein Kussmund in derselben Neonfarbe. Die Katzenohren stehen verloren in dem dunklen Raum und klammern sich an ein Glas mit grüner Flüssigkeit. Bruno drängt sich dicht an der zierlichen Katzenohren-Silhouette vorbei, schaut sie aufmunternd an und zwinkert ihr zu. Der rosa Mund lächelt schüchtern. Er drängt sich an einem neongrünen Brillengestell vorbei, zu dem lange blonde Haare gehören, und ein weißes Bikini-Oberteil, das unter dem Schwarzlicht das weißeste Weiß aller Zeiten fluoresziert. Das grüne Brillengestell hat scheinbar die ein oder andere farbige Flüssigkeit zu viel zu sich genommen, und beschimpft gerade ordinär ihren Freund, ein orangefarbenes Brillengestell, der wie ein begossener Pudel im Raum steht, und klaglos die rigiden Schimpftiraden über sich ergehen lässt. Das grüne Brillengestell gießt dem orangefarbenen Brillengestell eine hellblaue fluorezierende Flüssigkeit über das Hemd, das erst in diesem Augenblick sichtbar wird und Rorschach-artig einen Oberkörper erahnen lässt. Bruno nähert sich der Blondine von hinten. Er steht dicht hinter ihr. Der Blick des Drachens verfinstert sich und wird zu einer verächtlichen Fratze. Sie dreht sich zu ihm um. Bruno schaut der verdutzten Dramaqueen, die in diesem Moment schlagartig nüchtern zu sein scheint, tief in die Augen und grinst sie herablassend an. Er macht mit zwei Fingern eine „Ich hab Dich im Auge“-Geste und drängt sich dann weiter voran durch die feiernden Fabelwesen. Das grüne Brillengestell schaut ihm verwirrt hinterher und scheint den Pudel mit dem orangefarbenen Brillengestell indes vergessen zu haben. Der Drache setzt sich in einer Ecke, in dem gemütliche Sitzpolster zum Verweilen einladen, zu einem kunterbunten fluoreszierenden Schmetterling, der Glitzerpuder auf seinen Flügeln hat, reicht dem filigranen Fabelwesen den Drink, und ist ausnehmend höflich und umsichtig.
Tomáso, der mit zwei neongelben Streifen auf jeder Wange an einen Ur-Einwohner der Aborigines erinnert, steht in der Menge und versucht eine Unterhaltung mit einem Gesicht, das aus lauter farbigen, fluoreszierenden Punkten besteht. Aber es ist zu laut, um sich zu unterhalten. Der DJ hat Electro aufgelegt. Der Sound übertönt jede Unterhaltung. Er hört ein Donnergrollen. Dann vernimmt er dreimal hintereinander ein klägliches, ätherisches „Socorro“. Niemand außer ihm scheint es wahrzunehmen. Er reibt sich die Schläfen, und spürt wie die Übermüdung der letzten Tage und Wochen ihn übermannt. Vielleicht sollte er den Party-Abend allmählich ausklingen lassen. Er sucht seinen Mitbewohner, und findet ihn, immer noch mit dem Schmetterling auf dem alten, abgesessenen, nichts desto trotz bequemen Chaiselongue sitzend, im hinteren Teil des Raumes.
„Lass uns fahren, es ist spät. Wir bringen die Frauen nach Hause“,schlägt Tomáso Bruno vor. Genaugenommen ist es mehr eine Bitte. Er ist an einem Punkt, an dem es bislang gut war und er Spaß im Club hatte, aber jetzt wird es ihm zu viel. Er muss unbedingt schlafen. Der letzte Tag vor den Semesterferien war lang und er ist seit der Früh auf den Beinen, und bald bricht schon der Morgen des nächsten Tages an. Und schließlich muss er auch noch mit dem Auto die halbe Stunde durch die Nacht nach Hause fahren. Dass er schon wieder Stimmen hört, die zu niemandem gehören, gefällt ihm nicht und beunruhigt ihn, und ist ein Zeichen dafür, dass er dringend sein Bett aufsuchen sollte.
„Oh, no! Du willst schon nach Hause?“,antwortet der wenig begeistert. Sie diskutieren kurz, wobei sie aufgrund der Lautstärke im Club schreien müssen. Bruno spricht mit dem Schmetterling. Die beiden stehen auf und folgen Tomáso. Der spricht mit der Frau mit den farbigen Punkten im Gesicht, und die vier verlassen Pepes Club.
Die jungen Leute sitzen im Seat Ibiza von Tomáso, der am Steuer sitzt, weil er am wenigsten getrunken hat. Bruno und er haben ausgemacht, dass einer von ihnen nur so viel trinkt, dass er noch Auto fahren kann, wenn sie gemeinsam in den Club fahren. Und er hatte nur einen Tonic-Longdrink über die ganzen Stunden, nach dem er auch als Fahranfänger noch fahren darf. Bruno sitzt neben ihm und hinten sitzen die Frauen. Das Autoradio spielt laut, Tomáso ist still und konzentriert sich auf das Fahren über die Landstraße, die anderen drei unterhalten sich laut und ausgelassen. Die Straße ist verlassen und dunkel, nur die Scheinwerfer des Autos erhellen sie. Sie wird von unberührter Vegetation umsäumt, in der einige Sträucher, ein paar junge Pinien und gelegentlich ein Eukalyptusbaum aus der sandigen, trockenen Erde wachsen. Und dann mit einem Mal ist sie da. Ohne jede Vorwarnung. Sie steht mitten auf der Fahrbahn. Die Frau im weißen Kleid. Tomáso schreit erschrocken auf und macht instinktiv eine Vollbremsung. Das Auto gerät ins Schleudern, die Frauen auf der Rückbank schreien. Bruno flucht laut. Und dann, binnen Sekunden, steht der Seat im Straßengraben. Seine Front hat sich in eine Pinie gebohrt. Die Motorhaube steht hoch und es qualmt aus dem Motorraum.
Tomáso, Bruno, der Schmetterling und die Pünktchen-Frau sitzen geschockt im qualmenden Auto. Tomáso stöhnt leise, er liegt mit dem Oberkörper über dem Lenkrad. Bruno atmet schwer, er sitzt aufrecht auf dem Beifahrersitz, Blut rinnt unter seinen Haaren die Wange herab. Die Frau mit den Punkten im Gesicht liegt quer auf der Rückbank und hält sich mit beiden Händen den Kopf, und der Schmetterling zu ihrer Rechtet blutet im Gesicht. Sie jammert und fährt sich mit der Hand durch das Gesicht, die auch blutig ist.
Bruno ist der Erste, der etwas sagt. Er stöhnt laut auf, flucht, fasst sich ins Gesicht und sieht Blut an seiner Hand.
„Ey, Alter...“, mehr bekommt er nicht heraus und wischt sich das Blut von der Hand an seiner Jeans ab.
Tomáso schaut Bruno erschrocken an, als er sieht, dass dieser blutet.
„Was verdammt noch mal war das für eine Aktion? Wolltest Du uns umbringen?“, herrscht sein Beifahrer ihn schroff an.
„Die Frau, genau vorm Auto! Habt Ihr die nicht gesehen?“ Tomáso wird hysterisch.
„Sie stand direkt vor dem Auto. Mitten auf der Fahrbahn. Ihr müsst sie gesehen haben!“, schreit er.
„Buddy, tu' Dir und Deinen Mitmenschen einen Gefallen, und geh zum Psychiater“, stöhnt Bruno mit schmerzverzerrtem Gesicht genervt.
VII
Es ist still in dem großen Zimmer des Altbaus mit den eleganten, in Cremefarben gestrichenen Wänden, an denen sich oben weißer Stuck wie eine edle Bordüre absetzt. Die Zimmertür ist von innen mit gestepptem Brokat in einem Karo-Muster, in dem gleichen Creme wie die Wände, gepolstert. Zwei große bequeme Sessel, die sicherlich teuer waren, stehen sich gegenüber. Weit hinten im Raum steht ein überdimensioniert großer ebenholzfarbener Schreibtisch. Die Bücherregale sind aus dem gleichen Holz. Die schweren ockerfarben-rosé gemusterten Vorhänge vor dem Jugendstil-Balkon sind bis auf einen kleinen Spalt in der Mitte, durch den Tageslicht in den Raum fällt, zugezogen. Man hört nur das leise, kaum wahrnehmbare Summen der Klimaanlage. Tomáso sitzt auf einem der Sessel. Ihm gegenüber sitzt der Psychiater, ein untersetzter Mann um die fünfzig, mit dunklem, an den Seiten etwas dunkelgrau meliertem Haar und gestutztem Vollbart, in einer hellen Hose und einem weißen Hemd. Den weißen Arztkittel trägt er offen. Er hat eine Schreibmappe auf dem Schoß und einen Füllfederhalter in der Hand. Der Mann schaut Tomáso an und schweigt.
„Doktor, ich werde verrückt. Ich höre diese Stimme und sehe ständig diese Frau...“, sprudelt es aus Tomáso heraus. „Außer mir sieht sie niemand und hört sie niemand, das kann doch nur heißen, dass ich verrückt werde.“
Das klingt vollkommen irre, denkt er bei sich, und schweigt für einen Moment. Der Mann, der ihm gegenüber sitzt, schaut ihn still an.
„Ich habe mein Auto geschrottet, weil ich sie gesehen habe... Und ich habe meine Freunde in Gefahr gebracht.“
Der Psychiater macht sich schweigend einige Notizen. Tomáso fährt fort.
„Ana musste zwei Tage zur Beobachtung in der Klinik bleiben... Ich hätte uns alle umbringen können. Was ist los mit mir, Doktor?“
Tomáso spricht eine Weile mit dem Psychiater. Er ist derjenige, der spricht. Der Arzt hört ihm zu. Und kritzelt immer wieder etwas auf seinen Block.
„Wir werden in der nächsten Zeit verschiedene Tests durchführen. Eine Schizophrenie können wir schon mal ausschließen“, sagt der Mann im weißen Kittel dann nach fünfzig Minuten.
Tomáso starrt den Psychiater an, atmet erleichtert auf, und lässt sich in den Sessel zurückfallen.
„Na, wenigstens das...“, antwortet er lachend, halb ironisch, halb wirklich erleichtert.
Der Arzt öffnet die cremefarbene Tür seines Sprechzimmers, lässt seinen Patienten hinaus, und schließt die Tür hinter ihm.
VIII
Das kleine rote Cabrio bewegt sich an diesem Sommertag mit dem wolkenfreien blauem Himmel flink über die einsamen kleinen Landstraßen und engen Serpentinen im Hinterland der Costa Blanca. Das Ehepaar mittleren Alters im Zweisitzer spricht Englisch miteinander. Die Frau auf dem Beifahrersitz hält einen kleinen Hund auf dem Schoß. Sie genießen die Fahrt bei langsamem Tempo und schauen sich die wunderschöne Natur im bergigen Hinterland an. Über viele Kilometer haben sie schon kein Haus mehr gesehen, während sie die Straße zwischen Mutxamel und Alicante lang fahren und die heimische Vegetation und die Felsformationen bestaunen. Als sie die alte Villa auf einer Finca erblicken, die hinter Pinien und Korkeichen beinahe versteckt erscheint, sind sie überrascht. Sie können das Haus hinter den Bäumen nur im Vorbeifahren erahnen, und haben die Hoffnung, dass es womöglich ein Restaurante sein könnte. Sie haben Hunger, und beschließen, auf das Grundstück zu fahren, und sich das Haus näher anzuschauen.
In einigem Abstand zu dem großen weißen Haus im Renaissance-Stil, das nach äußerlichem Dafürhalten seine besten Jahrzehnte schon hinter sich hat, und an den Hauswänden beginnt zu verwittern, halten sie an. Sie erkennen sofort, dass es sich nicht um eine Lokalität handelt. Die Villa macht einen unbewohnten Eindruck. Zumindest ist weit und breit kein Fahrzeug zu sehen, und auch sonst nicht zu erkennen, dass hier jemand wohnt. Die Fenster sind vergittert und geschlossen, und mit Vorhängen zugezogen. Hier scheint kein Mensch zu sein. Sicherlich war das mal ein schönes Haus. Sie sind ein bisschen enttäuscht, dass es kein Lokal ist, beschließen jedoch, den Hund noch kurz austreten zu lassen, bevor sie weiterfahren. Der Mann in den blau grün karierten Bermuda-Hosen und dem weißen Polo-Shirt mit dem Emblem eines Golf-Clubs, beschließt, es ihm nachzutun. Er geht ein paar Meter hinter einen Oleander-Busch und erleichtert sich. Die Frau schlendert währenddessen über das brach liegende Grundstück und geht Richtung Haus, um es sich näher anzuschauen. Der kleine weiße Terrier schnüffelt auf dem Grundstück herum und setzt hier und da seine Fähnchen.
IX
Obwohl das Fleckchen strahlend blauer, wolkenfreier Himmel, das man durch das kleine vergitterte Oberlichtfenster durch die Kronen der hohen Pinien und Korkeichen hindurch sehen kann, zu dieser Jahreszeit erahnen lässt, dass es draußen warm ist, ist es hinter dem dicken Gemäuer der alten Villa im Kellergeschoss kühl. Sie trägt nur eine kurze Shorts und ein Spaghetti-Top, und nachts friert sie erbärmlich in diesem Keller. Aber dass ihr so kalt ist, in der Nacht wie am Tage, liegt vor allem daran, dass sie vollkommen entkräftet ist. Ein paarmal glaubte sie schon, dass sie einfach stirbt, dass sie nicht mehr aufwacht, wenn sie sich in dem winzigen, heruntergekommenen Raum, in dem der Putz von den Wänden bröckelt und der von drei dicken Mauern umgeben ist und zur vierten Seite hin vergittert wie eine Gefängniszelle, einfach in den Staub legt und einschläft. Und ein paarmal hat sie schon gedacht, dass das vielleicht besser so ist. Aber jetzt, da sie diesen Hund durch das Fenster sieht, schöpft sie neue Kraft. Als sie das Motorengeräusch des Autos hört, glaubt sie zuerst, es ist ihr Peiniger. Erst als sie den kleinen weißen Hund dort draußen herumlaufen und schnüffeln sieht, wird ihr bewusst, dass ihre Rettung naht. Sie kriecht auf allen Vieren durch Staub, Geröll und Unrat zum Fenster. Sie ächzt. Die großen hellblauen Augen mit den tiefen dunklen Schatten, schauen durch die Gitter des kleinen Oberlichts in die Freiheit. Wenn ein Auto hierher gekommen ist und angehalten hat, und dieser Hund hier ist, müssen hier auch Menschen sein. Sie beobachtet den kleinen weißen Terrier, der ihr vorkommt wie ihr Messias.
Sie will schreien, so laut schreien, wie sie kann, damit sie jemand hört. Aber ihr Mund ist trocken und aus ihrer Kehle kommt nur ein Ächzen. Sie versucht es immer wieder, aber aus ihrem Mund kommt kein Schrei heraus, das lauter werdende Ächzen klingt wie ein Knurren. Sie ist zu entkräftet, um um Hilfe zu rufen.
Mit aufgeschürften, verkrusteten Beinen und Händen kriecht sie durch den Staub und den Unrat in ihrem Käfig, vorbei an leeren Wasserflaschen und Konservendosen und einem leeren Pizzakarton, ganz nah ans Fenster heran, ohne den Hund auch nur einen Augenblick aus den Augen zu lassen. Sie schafft es, sich so weit aufzurichten, dass sie ihre Hand durch das Gitter des Oberlichts strecken kann, bei dem das Fensterglas fehlt, und es gelingt ihr, den Hund anzulocken. Er schnuppert an ihrer Hand. Sie sieht, dass er ein Halsband trägt, und blitzartig kommt ihr eine Idee. Sie rüttelt an den Gittern und schlägt dagegen. Dann berühren ihre Fingerspitzen das Fell des Hundes. Sie reißt ein Stück von dem Pizzakarton ab, und ritzt mit zitternder Hand mit einem kleinen spitzen Stein aus dem Geröll hastig etwas in die Pappe. Wie ein besessener Künstler, der zunehmend Eins wird mit seinem Werk, stößt und ritzt sie frenetisch Buchstaben und Linien in den Pappschnipsel. Ihr Herz schlägt schnell, sie atmet heftig. Eine Welle der Panik überkommt sie, und sie spürt ein Flirren vor ihren Augen. Ihr Kreislauf sackt ab. Womöglich fahren die Leute weg, ohne, dass sie sich bemerkbar machen kann. Sie versucht den Hund wieder zu locken, aber der kommt nicht mehr so nah ans Fenster, dass sie ihn berühren kann. Sie klammert sich mit aller Kraft, die sie hat, am rostigen Fenstergitter fest und zieht sich hoch, so gut sie kann. Sie steht auf Zehenspitzen, und mit so weit wie möglich durch das Oberlicht ausgestrecktem Arm, versucht sie verzweifelt, das Stück Pappe unter das Halsband des Hundes zu schieben, aber er ist zu weit weg und es gelingt ihr nicht.
X
Das Ehepaar geht zurück zu seinem roten Cabriolet. Die Engländerin setzt sich auf den Beifahrersitz. Der Mann steht neben der geöffneten Tür auf der Fahrerseite und pfeift nach dem Hund.
XI
Der Frau im Kellerverlies gelingt es nicht, das Stück Pappe am Hundehalsband zu befestigen. Der Hund schlawenzelt über das Grundstück und entfernt sich. In ihrer abgrundtiefen Verzweiflung wird sie hysterisch und schlägt gegen die Gitterstäbe, will schreien, aber schafft es nicht. Aus ihrer Kehle kommen nur leise, krächzende Worte hervor. In ihrer Panik, dass der kleine Terrier verschwindet, greift sie zu einer geöffneten Konservendose, in der noch ein Lebensmittelrest ist, und schüttet ihn draußen vor das Fenster. Der kleine Kerl kommt zurück. Während er das verstreute Essen frisst, schafft sie es, die Pappe unter das Halsband zu schieben.
XII
Der Hund kommt zum Auto gerannt, springt mit einem Satz in das rote Cabrio und auf den Schoß seiner Halterin. Der Mann setzt sich hinter das Steuer, zieht die Tür zu und startet den Motor. Das Cabrio fährt los. Die Engländer unterhalten sich über die Villa, und wie schade es ist, dass sie mitten in den Bergen dieser beschaulichen Gegend vor sich hin rottet. Dann überlegen sie, ob sie in ihrem Hotel zu Abend essen sollen oder lieber in einem Restaurant. Der weiße Terrier hüpft nach hinten, legt sich hechelnd hinter die Vordersitze und reckt seine Nase in den Fahrtwind.
XIII
Die Kommissare Elena und Emilio und der erfahrene Polizist Javier, die den Kern der SokoEl Palamó bilden, arbeiten in ihrem Büro des Polizeikommissariats in Mutxamel auf Hochtouren, um den grausamen Mord an Letitzia Ana Cavellos Rodruigez aus Asturien und die Herkunft und den Tod der unbekannten Asiatin aufzuklären. Und sie wollen zwei weitere verschwundene Frauen lebend finden. Die Kommissare leben schon immer in Alicante. Emilio kennt die Region um Mutxamel und seine kleinen Dörfer wie seine Westentasche. Er wurde im benachbarten idyllischen Gata de Molinos geboren und ist dort aufgewachsen. Elena kommt aus El Palamó und hat einige Jahre in Valencia gearbeitet, bevor sie das Heimweh nach Alicante zurück verschlagen hat. Javier wurde für die Soko El Palamó aus Madrid abbestellt. Er ist mit seinen zweiunddreißig Jahren der jüngste Ermittler in Mutxamel, und gleichzeitig einer der erfahrensten. Nach seiner Polizeiausbildung studierte er an der Universität in Madrid Psychologie und erwarb wertvolle Qualitäten als Profiler, die indes seine Kollegen in ganz Spanien schätzen, und so kam er in die Provinz, ins Hinterland von Alicante.
Javier steht vor der Flipchart, an der die Fotos der vier Frauen hängen, und fasst die bekannten Fakten zusammen. Er zeigt auf das Foto der entstellten Frauenleiche aus der Gerichtsmedizin, das jetzt neben dem Bild der asiatischen Frau auf der linken Seite der Tafel hängt, und über dem nun nicht mehr „Se buscan“ steht.
„Also, unsere neueste Leiche, Letizia Ana Cavellos Perez, wurde vor vier Monaten von ihrer asturischen Familie vermisst gemeldet, als die sie nicht erreichen konnte. Sie war Studentin der schönen Künste in Alicante und kommt aus elitärem Elternhaus. Das Studium war scheinbar eher so etwas wie eine Beschäftigungstherapie für sie, haben uns die Kollegen aus Asturien mitgeteilt, die mit Freunden der Toten und ihrer Familie gesprochen haben.“
„Schöne Künste?“, Emilio schaut ihn von unten herauf gequält an, während er die beiden Wörter wiederholt und künstlich in die Länge zieht.
Javier macht zwei Schritte zu seinem Schreibtisch, öffnet eine rote Mappe, blättert darin, positioniert seinen Zeigefinger auf der Passage im Text, nach der er sucht.
„Ja, Letizia hat Kunst und Geschichte in Elche studiert. Hier steht es, Miguel-Hernández-Universität Elche, Alicante. Studienfächer Kunst und Geschichte.“
Er schaut Emilio an, der nickt kaum merkbar und verzieht kurz den Mund. Irgendetwas an dem, was Javier sagt, scheint ihn für einen Augenblick amüsiert zu haben.
„Zweites Semester“, ergänzt Javier seine Information, nachdem er noch einmal kurz auf das Blatt Papier schaut. Dann zeigt er auf das Foto der toten Asiatin.
„Die Asiatin ist nach wie vor namenlos, und die Frau wird scheinbar nicht vermisst. Bis jetzt jedenfalls nicht. Wir wissen nichts über sie. Wir haben nur ihre Leiche.“
Elena geht zur Kaffeemaschine und gießt Kaffee in einen Henkelbecher. Emilio isst ein Bocadillo und schaut Javier aufmerksam und erwartungsvoll an. Der zeigt auf das Foto einer dunkelblonden Frau mit dunklen Augen, das rechts auf der Flipchart bei den vermissten Frauen hängt, und fährt fort.
„Die vermissten Frauen sind eine Spanien-Schweizerin, Martha Rüttlin, It-Girl...“





























