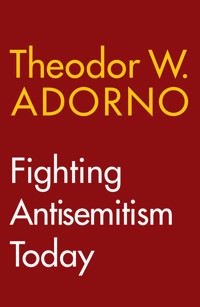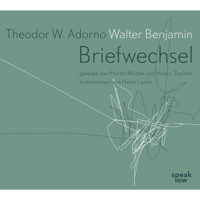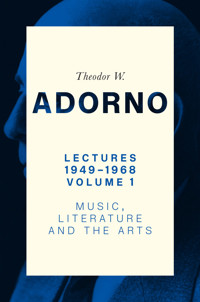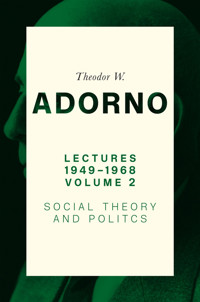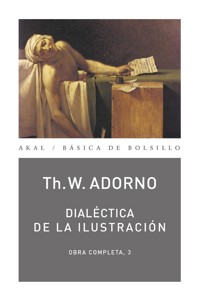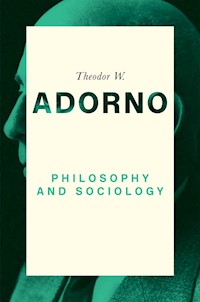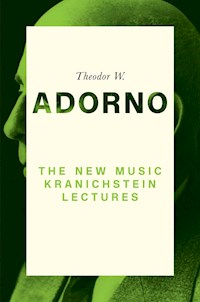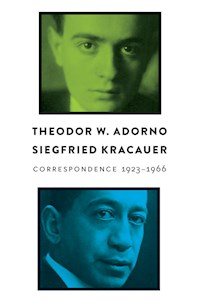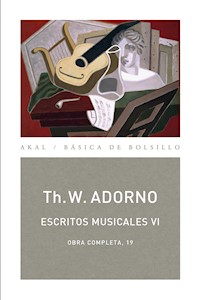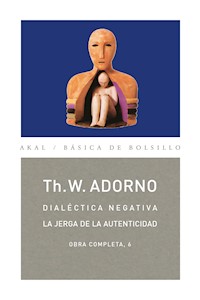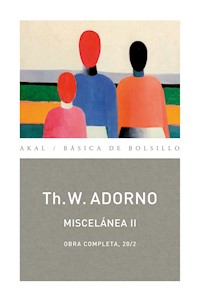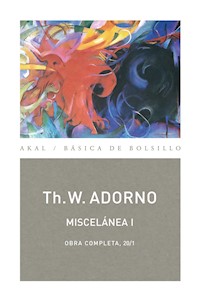13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anfang Januar 1956 notierte Adorno: »Unsere Träume sind nicht nur als ›unsere‹ untereinander verbunden, sondern bilden auch ein Kontinuum, gehören einer einheitlichen Welt an, so etwa, wie alle Erzählungen von Kafka in ›Demselben‹ spielen. Je enger aber Träume untereinander zusammenhängen oder sich wiederholen, um so größer die Gefahr, daß wir sie von der Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können.« Die Bedeutung des motivischen Zusammenhangs seiner Träume legte ihm den Gedanken nahe, eine Reihe von ihnen auszuwählen und zu publizieren. Einer kleinen Sammlung solcher Traumprotokolle, die er für die Veröffentlichung vorgesehen hatte, stellte Adorno folgende Vorbemerkung voran: »Die Traumprotokolle, aus einem umfangreichen Bestand ausgewählt, sind authentisch. Ich habe sie jeweils gleich beim Erwachen niedergeschrieben und für die Publikation nur die empfindlichsten sprachlichen Mängel korrigiert.«
Die erste Separatausgabe ergänzt die bereits publizierten Traumprotokolle um den größten Teil einer umfangreicheren Auswahl, die als Typoskript überliefert ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Theodor W. Adorno
Traumprotokolle
Herausgegeben von Christoph Gödde und Henri Lonitz Nachwort Jan Philipp Reemtsma
Suhrkamp Verlag
Eine Edition des Theodor W. Adorno Archivs
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der Bibliothek Suhrkamp 2018.
© 2005, Suhrkamp Verlag AG, Berlin
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag: Willy Fleckhaus
eISBN 978-3-518-77670-4
www.suhrkamp.de
Inhalt
Traumprotokolle
Editorische Nachbemerkung
Nachwort
Traumprotokolle
Der Traum ist schwarz wie der TodTheodor W. Adorno
Frankfurt, Januar 1934
Im Traum fuhr ich mit G. in einem großen, sehr komfortablen Autobus von Pontresina hinab ins Unterengadin. Der Autobus war gut besetzt, und es fehlte nicht an Bekannten: die weitgereiste Zeichnerin P. und ein alter industrieller Professor samt seiner Frau waren darunter. Die Fahrt aber verlief nicht auf der Engadiner Chaussee sondern nahe meiner Heimat: zwischen Königstein und Kronberg. Bei der großen Kehre geriet der Autobus zu weit auf die rechte Seite, und sein eines Vorderrad hing eine Zeit, die mir lang schien, frei überm Graben. »Das kenne ich schon«, sagte orientiert die weitgereiste Zeichnerin, »das geht jetzt noch ein Stück, dann wird der Autobus umfallen, und keiner wird mit dem Leben davonkommen.« Im gleichen Augenblick stürzte das Gefährt. Dann plötzlich fand ich mich wieder, auf den Füßen stehend, G. gegenüber, beide unversehrt. Ich fühlte mich weinen, indem ich sprach: ich hätte so gern noch mit Dir weitergelebt. Da erst erkannte ich, daß mein Leib völlig zerschmettert war. Mit dem Tode wachte ich auf.
Oxford, 9. Juni 1936
Traum: Agathe erschien mir und sagte vollends traurig: Früher, mein Kind, habe ich dir immer gesagt, wir werden uns nach dem Tode wiedersehen. Heute kann ich dir nur sagen: ich weiß es nicht. –
Oxford, 10. März 1937
Ich fand mich in Paris ohne alles Geld, wollte aber in ein besonders elegantes Bordell, die maison Drouot gehen (in Wirklichkeit ist Hôtel Drouot das berühmteste Auktionslokal für alte Dinge). Ich bat Friedel, mir Geld zu leihen: 200 Francs. Zu meinem größten Staunen gab er sie mir, sagte aber: ich gebe sie dir nur, weil es in der Maison Drouot so ausgezeichnet zu essen gibt. Dort verzehrte ich in der Tat an der Bar, ohne nur ein Mädchen zu sehen, ein Beefsteak, das mich so beglückte, daß ich alles andere darüber vergaß. Es war in einer weißen Sauce.
Ein anderer Traum, früher in der Nacht, bezog sich auf Agathe. Sie sagte: mein Kind, du darfst mir nicht böse sein, aber wenn ich zwei wirkliche Täler besäße, würde ich die ganze Musik von Schubert dafür geben.
London 1937 (während der Arbeit am »Versuch über Wagner«)
Der Traum hatte einen Titel: ›Siegfrieds letztes Abenteuer‹, oder ›Siegfrieds letzter Tod‹. Er spielte auf einer außerordentlich großen Bühne, die eine Landschaft nicht sowohl darstellte, als vielmehr wirklich war: kleine Felsen und viel Vegetation, etwa wie im Hochgebirge unterhalb der Almen. Durch diese Bühnenlandschaft schritt Siegfried dem Hintergrund zu, von jemand begleitet, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Seine Kleidung war halb die mythische, halb modern, vielleicht wie auf einer Probe. Endlich fand er als Ziel seinen Widersacher, eine Gestalt im Reitkostüm: graugrüner Leinenanzug, Reithose und braune Schaftstiefel. Er begann mit diesem einen Kampf, der deutlich den Charakter von Spaß hatte und wesentlich darin bestand, daß er den Gegner, den er schon auf dem Boden liegend antraf, wie beim Ringen herumwälzte, worauf jener sich gern einzulassen schien. Bald gelang es Siegfried, ihn so hinzulegen, daß er mit beiden Schultern die Erde berührte und als besiegt sei’s erklärt wurde, sei’s sich erklärte. Unerwartet aber zog Siegfried aus seiner Jackentasche einen kleinen Dolch, den er darin wie einen Füllfederhalter mit einer kleinen Klammer trug. Er warf den Dolch aus nächster Nähe, wie im Spiel dem Gegner in die Brust. Dieser stöhnte laut, und es wurde offenbar, daß es eine Frau war. Sie lief rasch weg und erklärte, nun müsse sie allein in ihrem kleinen Häuschen sterben, das sei das Allerschwerste. Sie verschwand in einem Gebäude, das denen der Darmstädter Künstlerkolonie glich. Siegfried schickte ihr seinen Begleiter nach mit der Anweisung, ihre Schätze sich anzueignen. Da erschien Brünhilde im Hintergrund, in Gestalt der New Yorker Freiheitsstatue. Sie rief im Ton einer keifenden Ehefrau: »Ich möchte einen Ring haben, ich möchte einen schönen Ring haben, vergiß nicht, ihr den Ring abzunehmen.« So gewann Siegfried den Ring des Nibelungen.
New York, November oder Dezember 1938
Ich träumte: Hölderlin hieß Hölderlin, weil er immer auf einer Holunderflöte spielte.
New York, 30. Dezember 1940
Kurz vorm Erwachen: ich wohnte der Szene bei, die Baudelaires Gedicht »Don Juan aux Enfers« – wohl nach einem Bilde Delacroix’ – festhält. Aber es war nicht stygische Nacht sondern heller Tag und ein amerikanisches Volksfest am Wasser. Dort stand ein großes weißes Schild – das einer Dampferstation – mit der grell roten Inschrift ›ALABAMT‹. Don Juans Barke hatte einen langen, schmalen Schornstein – ein ferry boat (»Ferry Boat Serenade«). Anders als bei Baudelaire verhielt der Held sich nicht schweigend. In seinem spanischen Kostüm – schwarz und violett – sprach er unablässig und marktschreierisch wie ein Vertreter. Ich dachte: ein stellenloser Schauspieler. Aber er gab sich mit den heftigen Reden und Gesten nicht zufrieden, sondern begann Charon – der undeutlich blieb – aufs erbarmungsloseste zu verprügeln. Er erklärte dazu, er sei Amerikaner und lasse sich das alles überhaupt nicht gefallen, man dürfe ihn nicht in eine Box sperren. Ihn grüßte ungeheurer Beifall wie einen Champion. Dann schritt er am Publikum vorbei, das durch einen Cordon von ihm getrennt war. Ich schauderte, fand das Ganze lächerlich, hatte aber vor allem Angst, die Volksmenge gegen uns aufzubringen. Als er zu uns kam, sagte A. ihm etwas Anerkennendes über die sehr begabte Leistung. Seine Antwort, die nicht freundlich war, habe ich vergessen. Darauf begannen wir uns nach dem Schicksal der Personen aus Carmen im Jenseits zu erkundigen. »Micaela – sieht sie gut aus?« fragte A. »Schlecht«, antwortete Don Juan wütend. »Aber Carmen geht es doch gut«, redete ich ihm zu. »Nein«, sagte er nur, aber es schien, als lasse seine Wut nach. Da tutete es acht Uhr vom Hudson, und ich wachte auf.
New York, 8. Februar 1941
Ich war an Bord eines Schiffs, das von Seeräubern geentert wurde. Sie erkletterten es an der Seite, auch Frauen waren darunter. Aber mein Wunsch machte es, daß sie überwältigt wurden. Jedenfalls beriet man in der nächsten Szene ihr Schicksal. Sie sollten alle getötet werden: erschossen und ins Wasser geworfen. Ich erhob Einspruch, aber nicht aus Menschlichkeit. Es sei schade, daß man die Frauen töte, ohne daß man Vergnügen an ihnen gehabt habe. Man gab mir recht. Ich begab mich in den Raum – den niedrigen Konversationssaal eines mittleren Dampfers – wo man die Seeräuber gefangen hielt. Sie saßen in vorgeschichtlichem Schweigen. Die Männer, schwer gefesselt, waren altertümlich gekleidet. Eingelegte Pistolen lagen auf dem Tisch, vor dem Platz eines jeden. Die Bräute waren vielleicht 5 an der Zahl, in moderner Tracht. An zwei kann ich mich deutlich erinnern. Eine war eine Deutsche. Sie entsprach ganz dem Begriff des Halbseidenen, in einem roten Kleid, wasserstoffsuperoxyd-blond wie eine Barfrau, etwas üppig, doch recht hübsch, das Profil ein wenig einem Schaf ähnlich. Die andere war ein entzückendes, ganz junges Mulattenmädchen, ganz einfach in einem braunen gestrickten Wollkleid, wie man sie in Harlem sieht. Die Frauen begaben sich in einen Nebenraum, und ich sagte ihnen, sie sollten sich ausziehen. Sie gehorchten, die Halbseidene machte sich sogleich daran. Nur das Mulattenmädchen weigerte sich. This is the style of the Institute, sagte sie, not the Circus style. Auf meine Frage erklärte sie mir, im Zirkusleben, dem sie angehöre, sei der Körper so sachlich, daß für den nackten keiner sich interessiere. Anders sei es in meiner Umgebung. So lasse meine Schwester (= L) keine Gelegenheit vorbeigehen, so viel wie möglich von sich sehen zu lassen.
Los Angeles, 22. Mai 1941
Wir gingen, Agathe, meine Mutter und ich, auf einem Höhenweg von rötlicher Sandsteinfarbe, wie sie mir von Amorbach vertraut ist. Aber wir befanden uns an der Westküste Amerikas. Links in der Tiefe lag der Stille Ozean. An einer Stelle schien der Fußweg steiler zu werden oder nicht weiterzugehen. Ich machte mich daran, rechts durch Felsen und Gestrüpp einen besseren zu suchen. Nach wenigen Schritten kam ich auf ein großes Plateau. Ich dachte, nun hätte ich den Weg gefunden. Aber bald entdeckte ich, daß überall die Vegetation die steilsten Abstürze verdeckte und daß keine Möglichkeit war, auf die Ebene zu kommen, die sich landeinwärts erstreckte und die ich irrtümlich für einen Teil des Plateaus gehalten hatte. Dort sah ich, beängstigend regelmäßig, Gruppen von Menschen mit Apparaten verteilt, Geometer vielleicht. Ich suchte den Pfad zurück auf den ersten Weg, fand ihn auch. Als ich bei meiner Mutter und Agathe ankam, kreuzte lachend ein Negerpaar unseren Weg, er in breit karierten Hosen, sie in grauem Sportkostüm. Wir gingen weiter. Bald begegnete uns ein Negerkind. Wir müssen nahe bei einer Siedlung sein, sagte ich. Da waren einige Hütten oder Höhlen aus Sand oder in den Berg eingesprengt. Durch eine führte ein Torweg. Wir schritten hindurch und standen, vor Glück erschüttert, auf dem Platz der Residenz zu Bamberg. – Das Miltenberger Schnatterloch.
Los Angeles, 20. November 1941
In der ersten Nacht in Los Angeles träumte ich, ich sei in einem Café – in Paris? – mit einem Mädchen losester Sitten verabredet gewesen. Sie ließ mich warten. Endlich wurde ich ans Telefon in eine Zelle gerufen. Ich rief hinein »kommst du endlich« und irgendetwas Intimes. Mir antwortete ganz von fern eine Stimme »this is Professor MacIver«. Er wolle mir etwas sehr Wichtiges wegen der Kurse des Instituts sagen. Er sagte auch irgendetwas wie »Mißverständnis«. Was er dann mitteilte, verstand ich nicht, noch zu präokkupiert mit dem Mädchen und auch weil die Stimme zu undeutlich zu mir drang.
Los Angeles, Januar 1942
Am Untermainkai in Frankfurt geriet ich in den Aufmarsch einer arabischen Armee. Ich bat den König Ali Feisal mich durchzulassen und er willfahrte. Ich betrat ein schönes Haus. Nach undeutlichen Vorgängen wurde ich in einen anderen Stock gewiesen, zum Präsidenten Roosevelt, der da sein kleines Privatbüro hatte. Er nahm mich aufs herzlichste auf. Aber wie man zu Kindern redet, sagte er mir, ich müsse nicht die ganze Zeit aufpassen und dürfe mir ruhig ein Buch nehmen. Es kam allerlei Besuch, kaum daß ich aufmerkte. Endlich erschien ein großer sonnverbrannter Mann, dem Roosevelt mich vorstellte. Es war Knudsen. Der Präsident erklärte, nun handele es sich um Defense-Angelegenheiten, und er müsse mich bitten hinauszugehen. Ich müsse ihn aber unbedingt wieder aufsuchen. Auf einen kleinen schon beschriebenen Zettel kritzelte er seinen Namen, seine Adresse und seine Telephonnummer. – Der Lift brachte mich nicht ins Parterre zum Ausgang, sondern ins Souterrain. Dort drohte die größte Gefahr. Blieb ich im Schacht, mußte der Lift mich zermalmen; rettete ich mich auf die Erhöhung, die ihn umgab – ich reichte kaum hinauf – so verfing ich mich in Drahtseilen und Stricken. Jemand riet mir, ich solle es auf einer anderen, wer weiß wo gelegenen Erhöhung versuchen. Ich sagte etwas von Krokodilen, aber folgte dem Rat. Da kamen auch schon die Krokodile. Sie hatten die Köpfe außerordentlich hübscher Frauen. Eine redete mir gut zu. Gefressenwerden tue nicht weh. Um es mir leichter zu machen, verhieß sie mir zuvor noch die schönsten Dinge.
In einer der folgenden Nächte:
Ich wohnte mit meiner Mutter einer Aufführung der Meistersinger bei. Der ganze Traum spielte währenddessen, obwohl die schattenhaften Vorgänge auf der Bühne nichts mit denen der Wagnerschen Handlung zu tun hatten, nur einmal glaubte ich den zweiten Akt zu erkennen. Wir saßen vorn in einer der großen Balkon-Proszeniumslogen. Im Hintergrund der Loge befand sich eine größere Gesellschaft, die ich als Frankfurter Patrizier erkannte. Sie begannen einen Tumult, der sich gegen einen großen gut aussehenden Mann im Frack, mit Heldenbrust, richtete, der im Parkett dicht bei einer Parkettloge stand. Ich fühlte mich verpflichtet, an dem Tumult teilzunehmen, und rief dem Herrn irgendeine sehr ehrenrührige Beschimpfung zu. Er suchte von seinen Feinden sogleich mich aus und schrie, ich solle doch herunterkommen, wenn ich es wagte. Ich antwortete, mit einem solchen Hochstapler schlüge ich mich nicht, aber es klang wenig überzeugend. Die Patrizier stürzten die Logentreppe hinunter und fielen über den Herrn her. Unterdessen aber begann die Gunst der festlichen Zuschauer sich gegen mich zu kehren, und ich fand es, im Einverständnis mit meiner Mutter, geraten, die Loge für einige Zeit zu verlassen. Lange Lücke. Dann wieder, aber versteckt, in der Loge. Zweiter Akt. Beim Herausgehen unter anderen Bekannten ein reiches und wichtigtuerisches Mädchen. Es machte mir Vorhaltungen wegen des Herrn im Frack. »Aber Sie müssen ihn doch kennen. Es ist der Bankdirektor X.«
Los Angeles, Ende Mai 1942
Ich träumte, ich solle gekreuzigt werden. Die Kreuzigung fand bei der Bockenheimer Warte, nahe der Universität statt. Der ganze Vorgang war frei von Angst. Bockenheim glich einem sonntäglichen Dorf, totenhaft friedlich, wie unter Glas. Ich betrachtete es auf dem Spaziergang zum Richtplatz mit der größten Aufmerksamkeit. Ich glaubte nämlich, aus dem Aussehen der Dinge an diesem meinem letzten Tag etwas Bestimmtes über das Jenseits entnehmen zu können. Ich erklärte aber zugleich, man müsse sich dabei vor vorschnellen Schlüssen hüten. Man dürfte sich etwa nicht dazu verleiten lassen, deshalb, weil in Bockenheim noch die einfache Warenproduktion herrsche, der dort noch geübten Religion objektive Wahrheit zuzusprechen. Im übrigen hatte ich die Sorge: ob ich am Abend von der Kreuzigung zu einem großen, ungemein eleganten Diner, zu dem ich eingeladen war, beurlaubt würde, sah dem aber mit Zuversicht entgegen.
Los Angeles, Anfang Juli 1942
Der Traum war – oder schien mir im Rückblick – eine lange, ungemein verwickelte Detektivgeschichte, in die ich selber verwickelt war. Ich habe ihn vergessen. Nur der Schluß ist mir erinnerlich. Ich war mit Agathe, die die drei wichtigsten Indizienstücke des Falles hatte. Es waren das eine Spange, ein Ring mit einem Diamanten und eine billige kleine Reproduktion – vielleicht ein Medaillon – eines bekannten Bildes (von Gainsborough oder Reynolds?), das ein kleines Kind in Hellblau, mit einer weißen Perücke, darstellte. Vielleicht hatte es etwas mit Seifenblasen zu tun. Bei Ansicht der drei Indizienstücke war ich überaus beruhigt: sie bewiesen in dem Prozeß meine Unschuld. Da sah ich mir das Kinderbild näher an und entdeckte zu meinem namenlosen Entsetzen, daß es mich selbst als Kind darstellte. Damit war meine Schuld erwiesen und zwar so daß sie darin bestand daß ich jenes Kind – oder überhaupt ein Kind? – gewesen sei. Auf Leugnen ließ ich mich gar nicht ein sondern sagte sofort zu Agathe, jetzt gäbe es nur eines von zwei Dingen: sofortige Flucht und Verstecken, oder Selbstmord. Sie meinte sehr bestimmt, nur dieser käme in Betracht. Vor Angst und Grauen wachte ich auf.