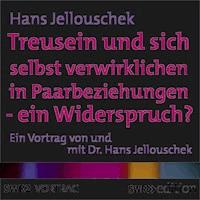1. Kapitel
_____________________
Trennungen und Abschiede in meinem eigenen Leben
1.1 Welche Trennungen ich erlebt und vollzogen habe
Erste Trennung: Von meiner Familie (mit 18 Jahren)
Hier könnte man sogleich sagen: Ab 18 ist es doch normal, dass sich ein junger Mann auf der Suche nach seinem eigenen Leben mehr und mehr von zu Hause löst oder sogar das Elternhaus verlässt. Die Art und Weise, wie ich mein Zuhause verlassen habe und welche Konsequenzen dies für mich und meine Eltern hatte, war aber sehr anders als in den meisten Fällen dieses Alters. Es handelte sich nämlich bei mir um meinen Eintritt in den Orden der Jesuiten, bei denen die Ausbildung mit dem zweijährigen »Noviziat« beginnt, einer Einführung in das geistig-geistliche Selbstverständnis des Ordens und seiner religiösen Praxis. Das bedeutete: Ein Jahr lang überhaupt kein direkter Kontakt mehr zu meinen Eltern, ganz wenig brieflichen Austausch, im ersten Herbst während der »großen«, d.h. dreißigtägigen »Exerzitien«, der grundlegenden spirituellen Schulung des Ordens, gar keinen Kontakt zu Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen. Im zweiten Jahr durften mich die Eltern – ganz selten – besuchen, und vor Beginn meines zweiten Ausbildungsabschnittes, der in Deutschland stattfand (ich bin ja gebürtiger Österreicher), durfte ich die Eltern auf der Durchreise – in meinem alten Zuhause – kurz besuchen.
Warum ich einen so radikalen Trennungsschritt vollzogen habe, wurde mir erst viel später bewusst. Ich hatte als mit großem Abstand Jüngster in meiner Familie eine sehr starke, ja überstarke Bindung an meine Mutter, die Distanz zu meinem Vater hingegen war ziemlich groß. Als ich auf die Welt kam, war er, weil er relativ spät geheiratet hatte und vor mir bereits zwei Geschwister auf die Welt gekommen waren, bereits 47 Jahre alt. Ich habe ihn darum, als ich ihn bewusst wahrzunehmen begann, immer als »alten Mann« und sehr weit von mir weg erlebt. Dazu kam, dass er mich meiner Mutter ganz und gar »überließ«, sodass sie mit mir vollauf beschäftigt war. Weitere Kinder sollten ja keine mehr kommen, und eine andere Geburtenregelung als Abstinenz gab es damals nicht. Meine Mutter als nicht berufstätige und ganz auf Kinder und Haushalt konzentrierte Frau suchte darin ihre Lebenserfüllung. Sie liebte mich ja wirklich sehr, allerdings mit einer Liebe, mit der sie mich auch übermäßig an sich band. Als ich etwas älter wurde, spürte ich das mehr und mehr: Vom Vater als männliche Bezugsperson allein gelassen, an die Mutter zu sehr gebunden…
Zu dieser Zeit ergab es sich, dass ich Mitglied einer Jugendlichen-Gruppe wurde, einer Gruppe von Heranwachsenden, die höhere Schulen besuchten, die in Österreich »Mittelschulen« und deren Schüler »Studenten« genannt werden. Die Gruppe, zu der ich stieß, hieß dem entsprechend das »Katholische Studenten-Werk«. Geleitet wurde es von Mitgliedern des Jesuitenordens. Diese Patres hatten auf dem Hintergrund meiner Familienerfahrung für mich eine große Bedeutung: Sie waren die ersten Männer in meinem Leben, die mir nahe kamen, die mir wichtige, verantwortungsvolle Aufgaben übertrugen, die meine Arbeit schätzten und mir das auch sehr deutlich kundtaten. So ermöglichten sie mir mehr Abstand von daheim, vor allem von meiner Mutter. Ich erlebte mich hier mit eigenen, »wichtigen« Aufgaben betraut, ohne dadurch mit meinen Eltern in größere Konflikte zu geraten. Sie waren ja selber gute Katholiken, und so konnten sie ja nichts gegen dieses Engagement in einer katholischen Jugendgruppe haben. Die Erfahrung mit diesen zugewandten Männern des Jesuitenordens war für mich sicherlich eine wichtige »Resilienz-Erfahrung«, wie man das heute nennt, also eine Erfahrung die manches Fehlende der eigenen Kindheitsgeschichte ergänzen und kompensieren konnte. Allerdings vermied ich dadurch auch, anstehende Konflikte, die für mein weiteres Selbstständig-Werden nötig gewesen wären, mit meinen Eltern auszutragen. So kam es, dass ich – entsprechenden Hinweisen eines Paters über meine eventuelle »Berufung« folgend – in den Orden eintrat. Das war ein radikaler Schritt. Er bedeutete äußerlich eine harte Abgrenzung von den Eltern, vor allem von meiner Mutter, die auch sehr darunter litt, andererseits aber – das wurde mir allerdings erst viel später bewusst – vermied ich damit einewirkliche Ablösung von ihr. Ich vermied nämlich auf diese Weise, mich wirklichinnerlich abzugrenzen. Ich wählte ja, vor allem mit meiner Berufsentscheidung für ein eheloses Leben, einen Weg, der mich meiner Mutter sozusagen erhielt und noch dazu in meinem Milieu sehr angesehen war. Ich hatte dafür auch ein Vorbild in der Familie: Ein Onkel von mir war Benediktiner-Pater und Theologie-Professor. Als solcher wurde er von meinen Eltern hoch verehrt, sodass keiner etwas gegen meinen Weg haben konnte. So trat ich mit 18 ins Noviziat der Jesuiten ein.
Der Ausbildung im Orden verdanke ich viel. Drei Jahre Philosophie-Studium und vier Jahre Theologie – das waren für mich faszinierende Auseinandersetzungen, abgesehen davon, dass mir die Schulung im klaren und logischen Denken auch heute noch immer hilft – nicht zuletzt beim Bücher-Schreiben. Allerdings war sie verbunden mit einer asketischen Lebensweise, für die ich zum damaligen Zeitpunkt und auf dem Hintergrund meiner familiären Erfahrungen einfach nicht reif genug war. Ich hatte zwar mit dem Ordenseintritt einen radikalen Schnitt vollzogen. Aber ich hatte bereits nach den zwei Jahren Noviziat »ewige Gelübde« abzulegen, das heißt, ich hatte mich lebenslang auf »Armut«, »Keuschheit« und lebenslangen »Gehorsam« den Ordensoberen gegenüber zu verpflichten. Armut hieß: Kein eigener Besitz; Gehorsam, die Verantwortung für die eigene Lebensplanung meinen Vorgesetzten zu überlassen, und »Keuschheit«, auf erotische und sexuelle Beziehungen zu verzichten. Das waren aber genau die Bereiche, in denen ich als Jüngster in der Familie, als »Mamas Liebling« und ohne männlich-eigenständiges inneres Modell, wenig Erfahrung hatte und die einzuüben mir jetzt durch meine Ordensexistenz weitgehend verwehrt war.
Diese Problematik wurde mir mehr und mehr bewusst durch meine ebenfalls in der Ausbildungszeit des Ordens vorgesehenen drei Praxisjahre zwischen Philosophie- und Theologiestudium – in einem Internat der Jesuiten in Wien als Erzieher. Und so kam es zum nächsten, zum zweiten radikalen Abbruch in meinem Leben.
Zweite Trennung: Vom Jesuitenorden – erste Heirat
In diesem Internat wurde es meine Aufgabe, an drei Jahren hintereinander die 15/16-jährigen Jungen außerschulisch im Internat zu betreuen. Meine Haupterfahrung dabei war: Diesen Jungs bin ich nicht gewachsen. Was die alles hinter meinem Rücken Unerlaubtes trieben – ich war weder imstande, dahinterzukommen, noch wirksame Maßnahmen dagegen zu ergreifen… So war es zunächst eine große Befreiung für mich, nach diesen drei Jahren mit dem Theologiestudium (in Innsbruck) beginnen zu »dürfen«. Allerdings: Die Vergangenheit holte mich ein. Die Freundschaft zu einem Mitbruder, der auch Psychologe war, erweckte mein großes Interesse an seinem Fach. Die Gespräche mit ihm und die Tatsache, dass ich ständig eine innere Niedergeschlagenheit erlebte – trotz großen Interesses am Studium – ließen in mir zum ersten Mal Zweifel an meiner »Ordensexistenz« wach werden. Hatte ich mit meinem Eintritt den richtigen Lebensweg gewählt? War ich nicht dabei, genau die Erfahrungen zu vermeiden, die für meine Reifung nötig gewesen wären – Eigen-Besitz, Eigen-Verantwortung für mein Leben und Beziehungen zu Frauen? Diese Fragen trieben mich um.
Diese Zeit fiel ja gerade in die streitbaren »68er-Jahre« mit ihren Studentenrevolten und Umbruchversuchen. Auch innerhalb des Ordens rumorte es gewaltig unter den jüngeren Mitbrüdern. Es wurde viel experimentiert, was die Oberen sogar weitgehend großzügig erlaubten. So ergab es sich, dass ich an einem sogenannten »Sensitivity-Training« teilnehmen konnte, einem mehrtägigen gruppendynamischen Kurs, wie es damals gerade »der letzte Schrei« war, der von dem erwähnten Psychologen-Pater veranstaltet wurde. Ich wollte daran teilnehmen, weil ich mich in einem intensiven Austausch mit Laien, Männern und vor allem Frauen erleben wollte, um meine Zweifel zu überprüfen. Ich machte vor allem zwei Erfahrungen, die für mich zentral wichtig wurden: Ich erlebte Menschen, die während dieser Tage über sehr offene Auseinandersetzungen zu einem sehr herzlichen Kontakt zueinander fanden. So etwas hatte ich im Orden kaum kennengelernt. Und vor allem: Ich lernte in der Gruppe eine Frau kennen, Viktoria, die später »meine« Frau werden sollte, und meine Sympathie für sie stieß bei ihr auf Gegenliebe. Das faszinierte mich total. Die Frage, ob der Weg im Orden für mich der richtige Weg war, wurde dadurch nochmals drängender.
Die Hürde zum Austritt war allerdings hoch. So etwas wäre in der Generation meiner Eltern unmöglich gewesen. Ich fürchtete ihre Reaktion. Und auch für mich selber hatte ich große Angst vor einem solchen Schritt. Durch meine »Gelübde« fühlte ich mich vor Gott an die Lebensweise, für die ich mich dadurch entschieden hatte, gebunden. Ich erbat mir eine »Auszeit« vom Orden durch ein Studienfreisemester in Tübingen, was vom Orden großzügig genehmigt wurde. Hier wurde mir immer klarer: Wenn ich nicht die Auseinandersetzung gerade mit meinen zentralen Entwicklungsthemen weiter vermeiden will, muss ich aus dem Orden austreten.
Ich teilte diesen Entschluss meinem dafür zuständigen Vorgesetzten samt meiner Begründung mit. Der akzeptierte das, was auch bedeutete, dass er bereit war, mich von meinen Ordensgelübden zu entbinden, wozu er laut Kirchenrecht die Befugnis hatte. Mir war mit einem Schlag klar: Das ist der richtige Schritt. Allerdings überfiel mich fast zur gleichen Zeit eine ungeheure Angst vor der Zukunft: Werde ich es schaffen? Werde ich in dem, was jetzt auf mich zukommt, nicht hilflos untergehen? Beides, das Gefühl »Es ist der richtige Schritt« und »Aber ich werde es nicht schaffen« führte in eine emotionale Ausweglosigkeit hinein, die mich zeitweise sogar in akute Selbstmord-Gefahr brachte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in Tübingen manchmal herumirrte, bewusst nicht auf den Verkehr achtend und in der »Hoffnung«, von einem Auto überfahren zu werden… Weil ich das dann doch nicht wollte, resignierte ich innerlich und rief wieder beim Ordensoberen an, um ihn zu bitten, meinen Austritt rückgängig zu machen. Aber der war nicht bereit dazu. Er hatte durch unser Gespräch vorher die Stimmigkeit meines Entschlusses offenbar deutlich gespürt. So war ich wieder auf meine Ängste zurückgeworfen, und in diesem Zustand rief ich einen weiteren befreundeten Ordens-Mitbruder an und bat ihn, zu mir zu kommen. Das Gespräch mit ihm machte mir wieder sehr deutlich, wie stimmig der Entschluss zum Austritt angesichts meiner Entwicklungsbedürfnisse zu einem reifen Erwachsenen-Alter war, und es half mir, meine Ängste wieder mehr in den Hintergrund treten zu lassen. So kehrte ich schließlich aus dem Freisemester nach Innsbruck zurück – jetzt nicht mehr als Jesuit, aber doch noch als Student der Theologie an der Universität Innsbruck.
Elf Jahre hatte ich seit Beginn des Noviziats im Orden verbracht. Jetzt stand ich da – immer mit dem Gefühl »Der Austritt war richtig und der einzige Weg«, aber hilflos, weil ohne den haltenden Rahmen, den der Orden mir gegeben hatte. So wurde die Beziehung zu Viktoria, die ich nicht ganz aufgegeben hatte, von Neuem aktuell. Abgesehen von einer »kleinen Verliebtheit« in den letzten Gymnasialjahren hatte ich mit Beziehungen zum weiblichen Geschlecht kurz vor meinem dreißigsten Lebensjahr keinerlei Erfahrung! Ohne dass ich mir dessen bewusst war, belastete ich sie darum sehr mit meiner Unsicherheit, mit meinem Bedürfnis nach Halt und mit meiner völligen Unerfahrenheit in sexuellen Angelegenheiten. Ich klammerte mich an sie – und das war wohl keine sehr gute Grundlage für unsere weitere gemeinsame Geschichte. Dennoch heirateten wir schon im Jahr 1969. Im gleichen Jahr schloss ich mein Studium mit dem Doktor der Theologie ab, und schon ein Jahr später kam unsere erste Tochter auf die Welt. Unsere finanzielle Lebensgrundlage dafür war, dass wir beide damals an der Universität angestellt waren.
Dritte Trennung: Abschied von meiner Heimat Österreich
Vor allem durch die Geburt unserer Tochter bekamen wir sehr schnell Kontakte zu anderen Paaren in ähnlicher Situation, wir hatten eine eigene Wohnung und ich einen angesehenen Beruf als Universitätsassistent. Dennoch war ich nicht zufrieden. Aus verschiedenen Gründen wollte ich keine Hochschullaufbahn einschlagen, und andere Berufe für einen »Laien-Theologen«, der ich jetzt war, gab es damals in Österreich noch kaum. So war ich innerlich auf der Suche nach Alternativen und fand eine für mich, als ich in einem Fortbildungskurs in Erwachsenenbildung einen Bildungsmanager aus einer deutschen Diözese kennenlernte. Die kirchliche Erwachsenenbildung war damals in Deutschland weiter entwickelt als in Österreich, und so entschloss ich mich auf ein entsprechendes Angebot dieses Mannes hin, Abschied von meiner Heimat zu nehmen, mich mit Familie in der Nähe von Stuttgart niederzulassen, und von heute auf morgen alles hinter mir zu lassen, was inzwischen hier entstanden war: vor allem herzliche Kontakte zu anderen Menschen und mein berufliches Ansehen.
Dieser Abschied fiel mir zunächst dennoch nicht schwer: Ich idealisierte die kirchliche Erwachsenenbildung in Deutschland auf unrealistische Weise und meinte, dass ich mit meinem theologischen Doktorat dort – von den »fortschrittlichen« deutschen Katholiken – mit Begeisterung aufgenommen würde. Das war allerdings eine völlige Fehleinschätzung. Gerade in Württemberg, dem Landesteil, für den meine Stelle zuständig war, traf ich in den oftmals vorwiegend evangelisch geprägten Ortschaften immer wieder auf sehr konservative katholische »Diaspora«-Gemeinden, die meine »theologisch-progressiven« Ausführungen nur mit Unverständnis zur Kenntnis nahmen. Dazu kam, dass meine Frau, die wegen des Kindes keinen Beruf mehr ausübte, in dem winzigen Kuhdorf, in dem wir damals eine Wohnung gefunden hatten, ganz allein war. Auch weil ich berufsbedingt viel im Land unterwegs sein musste oder jedenfalls – aus dem Bedürfnis heraus, mich zu bewähren – glaubte, das zu müssen. Dies entfernte uns als Paar immer mehr voneinander. Später konnten wir nach Stuttgart und in die Nähe meiner Arbeitsstelle umziehen, und wir entschieden uns hier auch, ein zweites Kind zu haben, das 1973 als unsere zweite Tochter zur Welt kam, mit der wir sehr viel Freude hatten. Ich begann außerdem eine zweijährige kirchliche Eheberater-Ausbildung, weil ich hoffte, damit näher an die Menschen und ihre Probleme heranzukommen als mit meiner Theologie. Diese Ausbildung enthielt auch viele Anregungen für unsere Beziehung, machte mir aber auch sehr deutlich, wo es bei uns fundamental fehlte. So kam es trotz mancher Erleichterungen und Verbesserungen nicht zu einer nachhaltigen Annäherung zwischen meiner Frau und mir.
Vierte Trennung: Von Frau und Familie
In dieser Zeit – Ende der 60er, Anfang der 70er-Jahre – kamen viele neue Psychotherapie-Ansätze zu uns nach Deutschland und schlugen sich unter anderem in immer beliebter werdenden »Selbsterfahrungsgruppen« nieder. In einer solchen Gruppe lernte meine Frau einen Mann kennen, in den sie sich unsterblich verliebte und mit dem sie Erotik und Sexualität in vollständig anderer Weise erlebte als mit mir. Als sie mir das eröffnete, war ich tief betroffen, niedergeschlagen und wütend zugleich. Ich konnte überhaupt nicht damit umgehen und zog darum Hals über Kopf aus unserer Wohnung aus in ein kleines Appartement in der Nähe. Das war nun die nächste schwerwiegende Trennung: von meiner Frau und von den Kindern. Trennung von der Familie und womöglich Scheidung einer kirchlich geschlossenen Ehe, was ja nun als Möglichkeit auftauchte, das war von meiner Familientradition her eine Unmöglichkeit, noch weit schlimmer als der Austritt aus dem Orden. Und obwohl durch mein Studium »in meinem Kopf« eine liberalere Einstellung dazu entstanden war, spürte ich dieses »Unmöglich!« im Herzen mit unveränderter Wucht. In der Rückschau wurde mir allerdings klar, dass genau solche Erfahrungen wesentlich zur Entwicklung meiner Eigenständigkeit gegenüber meiner Herkunftsfamilie beigetragen haben. Damals allerdings zeigte sich in solchen Erfahrungen nur, wie abhängig ich noch war.
Zum Glück war meine »Noch-Frau« Viktoria von Anfang an bereit, mir Kontakt zu meinen Kindern zu ermöglichen und diesen zu fördern. Ihnen gegenüber hatte ich ja ein besonders schlechtes Gewissen, aber eine andere Lösung als die Trennung sah ich nicht, denn für mich wäre eine Rückkehr nur möglich gewesen, wenn meine Frau die Beziehung zu dem anderen Mann radikal abgebrochen hätte, wozu sie nicht bereit war. Vielmehr entschlossen sich die beiden, zusammenzuziehen, und zwar etwa 200 km weit weg von unserem bisherigen Wohnort. Ich erhielt den regelmäßigen Kontakt zu meinen Kindern zwar aufrecht, hatte aber ihnen gegenüber noch jahrelang ein schlechtes Gewissen.
Eine weitere Folge unserer Trennung war: Ich war nun für meinen kirchlich-katholischen Arbeitgeberin als »getrennt Lebender« zwar noch nicht zu kündigen, aber doch eine »persona non grata« geworden, das hieß vor allem: Mit einer Karriere innerhalb der Kirche und in einer Spezialfunktion als Erwachsenenbildner war es vorbei, und Alternativen außerhalb hatte ich als »Voll-Theologe« ohne Zweitstudium keine. So resignierte ich, blieb bei der Kirche als Arbeitgeber und war einverstanden mit einer Stelle im »Hintergrund«, nämlich als »Pastoralreferent« im Gemeinde-Dienst einer katholischen Pfarrei in einem kleinen schwäbischen Städtchen.