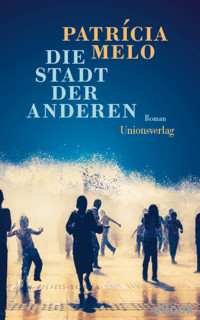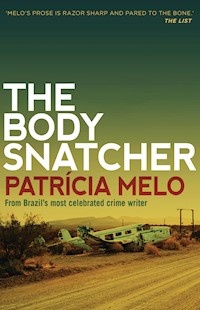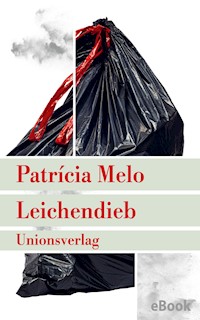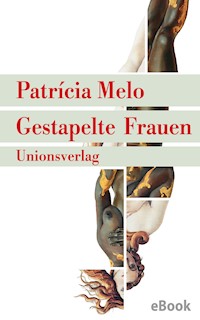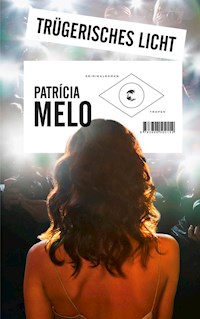
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sensationslust folgt überall den gleichen Regeln: Schön ist interessanter als hässlich, reich spannender als arm, und nichts geht über einen ermordeten Star. Ein abgründiger Krimi über den Kontrast zwischen glamouröser Fernsehwelt und einem Brasilien, das im Chaos versinkt. Tatort São Paulo: Bei einer Theatervorstellung erschießt sich der Serienstar Fábbio Cássio auf der Bühne. Schnell ist der Kriminaltechnikerin Azucena klar, dass dieser Selbstmord in Wahrheit ein geschickt inszenierter Mord ist. Zunächst fällt ihr Verdacht auf die Ehefrau des Toten, die zur Tatzeit Kandidatin einer Reality-Show ist und deren Beliebtheitswerte beim Publikum nach Fábbios Tod in die Höhe schnellen. Und während Azucena noch um das Sorgerecht für ihre Töchter kämpft, wird sie mit einem skrupellosen Mörder konfrontiert, der es am Schluss auf die Ermittlerin selbst abgesehen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Fogo-Fátuo«
im Verlag Editora Rocco, Rio de Janeiro
© Patrícia Melo, 2014, by arrangement with
Literarische Agentur Mertin Inh. Nicole Witt e.K.,
Frankfurt am Main, Germany
Für die deutsche Ausgabe
© 2016 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlag: Herburg Weiland, München
Unter Verwendung eines Fotos von © Robert Daly/Getty Images
Datenkonvertierung von Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50215-2
E-Book: ISBN 978-3-608-10063-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Prolog
Teil I
1
2
3
4
5
6
Teil II
1
2
3
4
5
6
7
8
Teil III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Epilog
Für Jane Belucci, die diesen Weg erleuchtet hat.
Und für Johnny, allezeit.
PROLOG
»Du musst dir die Sterne ringsherum vorstellen«, sagte Fábbio Cássio und zeigte auf den hoch aus dem Gebirge aufragenden Gipfel, der die Landschaft beherrschte. »Ich sage immer: Das ist mein ganz persönlicher Artesonraju.«
Die Journalistin war jung und unerfahren und lächelte, um ihre Unwissenheit zu überspielen.
Sie saßen auf der Veranda des Hauses in Campos do Jordão, wo »die saubere Luft in der Nase kitzelt«, wie Olga sagte, die Mutter des Schauspielers, eine hyperaktive Witwe, die soeben Tee und Mandelkuchen auf dem Beistelltisch platziert hatte. Während sie die beiden bediente, erklärte sie, genau das sei die große Begabung ihres Sohnes: Sterne zu sehen, wo keine waren. »So ist er eben: Wo für uns bloß ein Berg der Serra da Mantiqueira ist, erkennt er das Logo von Paramount Pictures.«
Die junge Frau fand den Tee großartig. Und den Kuchen köstlich. »Erzähl mir mehr von deinem Talent«, bat sie ihn.
»Ich glaube, es kommt daher, dass ich Einzelkind war. Ich bin alleine aufgewachsen«, erwiderte Fábbio. »Mann, ich habe meine Welt immer viel interessanter und bunter gefunden als eure. Die sogenannte Realität. Die Welt der Steuern. Ich hasse Steuern. Ich hasse Autowerkstätten, Baumärkte, all diese Dinge der realen Welt. Inflation, Dow Jones, mir wird schlecht, wenn ich in die Welt der Warteschlangen muss. Das war noch nie meins.«
Olga pflichtete ihm bei: »Ganz und gar nicht.«
»Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Schulfreunde völlig verrückt nach Punky Brewster, dieser Fernsehserie, waren. Kennst du die noch? Ach so, ja, Punky Brewster war vor deiner Zeit. Ich war anders. Ich fand Punky okay, aber mehr auch nicht. Ich bin in den Garten gegangen und hab mir mein eigenes Fernsehprogramm gebastelt, He-Man und seine Gäste, ich habe den Moderator gespielt, He-Man selbst und auch seine Gäste: Die Prinzessin des Universums, She-Ra und alle Masters of the Universe, die ThunderCats und die Kinder aus Dungeons & Dragons, und natürlich Punky Brewster. Ganz zu schweigen von der Chaves-Clique. Ich finde ja, Chaves ist der Charlie Chaplin Südamerikas.«
Er legte eine Kunstpause ein: »Mann, Chaves ist echt der Wahnsinn.« Und dann: »Jahrelang habe ich meine Phantasie trainiert, meine Möglichkeiten ausgelotet. All das ganz spielerisch. Ich war noch keine zehn, da war der Zug schon losgedampft, schon damals war der Schauspieler in mir auf der Suche nach Rollen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich besonders gern die Folge ›Chaves in Acapulco‹ gespielt habe. Du wirst lachen, aber so habe ich mir tatsächlich ein großes Repertoire und eine ganz eigene Spieltechnik zugelegt.«
Die unverhohlene Bewunderung der jungen Frau feuerte den Schauspieler in seinem Überschwang nur noch weiter an. Bewundert, verhätschelt, beobachtet, fotografiert zu werden, all das beflügelte ihn, er fühlte sich so wohl in seiner Haut, dass er sich sogar zu Enthüllungen hinreißen ließ: Seine Fans ahnten ja nicht, dass sich das doppelte B in seinem Namen Fábbio »einer kabbalistischen Eingebung« verdankte, die er nicht erklären konnte. »Denn die Kabbala ist eine echt irre Story, wenn man kein Aramäisch kann, begreift man gar nicht, wie komplex das Ganze ist.« Der Journalistin entfuhr ein »Wow!«. Sie fragte Fábbio, ob er Aramäisch spreche. »Den Luxus gönne ich mir irgendwann«, verkündete er und dachte dabei, dass er zuvor allerdings noch Englisch lernen müsse. »Aber erst, wenn mein Stück abgesetzt wird.«
»Interessant ist ja, dass du früher in Eisen und Feuer: Auf Biegen und Brechen gespielt hast und jetzt in Narrenfeuer auftrittst«, sagte die junge Frau. »Ist Feuer dein Element?«
Was für ein Zufall, darüber hatte er noch gar nicht nachgedacht. Feuer hier wie dort. Doch sein Element war die Luft, sein Sternzeichen Waage. Mit Aszendent Krebs. »Wie Jeff Goldblum, dieser schielende Schauspieler, weißt du? Der Typ ist ein Multitalent: Der Typ singt, der Typ schauspielert, der Typ ist der Hammer. Aber frag dich mal lieber: Womit wird das Feuer geschürt?«
»Mit Holz?«, antwortete sie unsicher. Er lachte. »Holz ist doch kein Element. Ich rede von meinem Sternzeichen. Die Luft der Waage schürt das Feuer – die Luft, der Traum, die Magie. Das Wasser des Krebses dagegen hält das Feuer unter Kontrolle.«
Sie hatte bereits den Anfang des Artikels im Kopf: Sie würde die Wirkung seiner blauen Augen mit einem Schlag mitten ins Gesicht vergleichen. Die Schwierigkeit würde darin bestehen, das elegant auszudrücken. »So viel Schönheit ist einfach unfassbar«, würde sie schreiben. Und seinen Körper so schildern: »Eine makellose Architektur aus Muskeln mit einem Rumpf, der dem Schild eines mittelalterlichen Kriegers gleicht und der wie eine Krone fest auf einem Paar atemberaubender Beine ruht.« Um nicht zu flapsig zu werden.
Sie konnte gar nicht aufhören, ihn anzuhimmeln, was für ein Mann, diese Zähne, diese Freundlichkeit. Und genau diese Art von Bewunderung war es, die »eine Bremse in ihm löste«.
»Das muss es sein«, sagte er. »Du bringst mich zum Reden.« Zum Beispiel war ihm jetzt danach, die Geschichte von dem Vorsprechen zu erzählen, das sein Leben als Schauspieler von Grund auf verändert hatte.
»Alfredo Marcos, der heute der Regisseur von Narrenfeuer ist, war damals für das Casting verantwortlich. Es ging um die Rolle eines homosexuellen Gewerkschaftlers in einer neuen Fernsehproduktion, die ich unbedingt haben wollte, die Serie sollte zur besten Sendezeit bei Rede Espectacular laufen und versprach, ein Riesenerfolg zu werden. Ich wurde zum Vorsprechen eingeladen. Als ich im Studio ankam, standen die Leute bis an die Ecke Schlange. Ich hatte so was noch nie gesehen. Du weißt ja: die Realität, Schlangestehen, ich hasse so was. Ich war total blockiert. Musste fünf Stunden warten, bis ich dran war. Als ich zum Set hineinging, war bereits ein anderer Schauspieler da und erwartete mich. Er legte den Finger auf die Lippen und bedeutete mir, leise zu sein. Da bemerkte ich, dass das Aufnahmeteam schon dabei war zu drehen. Ich wartete ein oder zwei Minuten, bis der Schauspieler sich räusperte, eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche zog und mich fragte, ob ich rauche. Ich verneinte und hatte nicht den geringsten Schimmer, was dort ablief. In dem Moment kam Alfredo Marcos, den ich damals noch nicht kannte, hinter den Kameras hervor und sagte ›Vielen Dank, das Vorsprechen ist für Sie beendet‹. Da stand ich nun in meiner nagelneuen, extra für den Anlass gekauften roten Hose und traute meinen Ohren nicht. In mir brannte der homosexuelle Gewerkschaftler, der auswendig gelernte Text, die einstudierten tuntigen Gesten, ich hatte eine Ewigkeit gewartet, und dann ließ man mich derart auflaufen, dass ich, anstatt mich zu beschweren und nach der Szene zu fragen, die man mir zur Vorbereitung aufgegeben hatte, anstatt zu reagieren und irgendetwas zu tun, mich umdrehte und ging, nicht ohne mich vorher in aller Artigkeit, zu der Dona Olga mich erzogen hat, zu bedanken. Jetzt, wo Alfredo und ich wie Brüder sind, hat er mir gestanden, dass er das mit allen Kandidaten so machte. Er wollte einen Schauspieler, der aufbegehrte, der vehement für seine Rechte eintrat, der ihn dazu zwang, die von dem Produktionsteam vorgeschlagene Szene zu drehen, und da ich nichts dergleichen tat, gelangte er zu dem Schluss, dass ich für die Rolle des Gewerkschaftlers nicht geeignet wäre. Die Lektion, die ich dadurch gelernt habe und weitergebe: Allein der Wunsch, berühmt zu sein, nützt nichts. Ruhm will erkämpft sein.«
Wenn irgendetwas Olga beflügelte, dann war es das Gelächter ihres Sohnes. Wenn er anfing zu lachen, und zwar über das, was sie sagte, wuchsen ihr förmlich noch zwei oder drei Münder mehr, um all ihre Ideen loszuwerden: »Natürlich sind die Regisseure manchmal beeindruckt davon, wie gut jemand aussieht. Dann heißt es: ›Hemd aus, wir drehen.‹ Dann dreht er zweihundert Episoden ohne Hemd, und wenn alles gut läuft, wenn den Hausangestellten – die jetzt keine Hausangestellten mehr sind, weil Brasilien endlich langsam aufhört, eine Sklavenhaltergesellschaft zu sein –, wenn den Telefonistinnen aus den Callcentern sein Gesicht gefällt, seine Rolle, dann steigt er vielleicht zum männlichen Star auf. Mit der Erlaubnis, das und nur das zu sein: der Schönling, der romantische Partner der superattraktiven weiblichen Hauptfigur. Mit ganz viel Glück bekommt er nach zehn hemdlosen Drehjahren eine Rolle als Bösewicht, die im Allgemeinen den Hässlichen vorbehalten bleibt, Sie wissen ja, unbegabten Theaterschauspielern. Aber bevor das geschieht, muss er lange den Guten spielen, muss viel leiden, natürlich aus Liebe, und wenn er das ordentlich macht, wird sich niemand beschweren, wenn er für Joghurt gegen Darmträgheit wirbt. Das ist das Leben eines Fernsehschauspielers. Und wehe dem Seifenopern-Star, der beschließt, sich im Theater an einen Shakespeare zu wagen. In Brasilien wird das nicht akzeptiert. Hören Sie genau zu: Um in diesem Land den Hamlet zu spielen, um als Hamlet gefeiert zu werden, muss man ein grauenhafter Schauspieler sein. Dann ist man ein guter Hamlet. Dann ist man überzeugend. Aber wenn man gut aussieht, nun, dann ist man eben nicht Hamlet. Dann ist man eine Farce. Prätentiös. Gut auszusehen ist das Letzte. Man ist ein Blender. Lachen Sie nicht: Seine Attraktivität ist für Fábbio stets eine Last gewesen. Als Amerikaner wäre er automatisch ein Brad Pitt geworden. So ist das Land, in dem wir leben, selbst ein hübsches Gesicht ist hier von Nachteil.«
Fábbio hörte erst zu lachen auf, als seine Mutter anfing, mit den Theaterkritikern ins Gericht zu gehen. Das war keine gute Idee, dachte er. Aber sie konnte von dem Thema nicht lassen. Sie war es leid, was die Kritiker in den Zeitungen über ihren Sohn schrieben. Sie hatte sie satt.
»Diese Ratten«, sagte sie. »Sie sind doch Reporterin, haben Sie zufällig ein paar dieser Kritiken gelesen? Die haben doch vor nichts Respekt. Sogar den großen Drieu la Rochelle haben sie im Staub zertreten. Der antisemitische Freund von Man Ray, so nennen sie den Autor des Stücks, in dem mein Sohn spielt.«
Die Journalistin war verwirrt. Rain Main? Der Film? Besser, sie fragte nicht nach. Die Frau ihr gegenüber riss zornentbrannt die Augen auf: »Zu behaupten, Fábbio sei lächerlich in der Rolle des Selbstmörders? Warum?«
»Ist es eine Komödie?«, fragte die junge Frau unsicher.
»Liebes Kind, das ist keine Frage des Genres, sondern der Prinzipien. Für diese Neidhammel passt der Gedanke von existentiellem Konflikt, von Selbstmord und Tod nicht mit dem guten Aussehen meines Sohnes zusammen. Fábbio Cássio darf nur der romantische Held in der Acht-Uhr-Seifenoper sein. Er hat glücklich zu sein. Einen Selbstmörder darf er nicht spielen, wir sind schließlich nicht in den Vereinigten Staaten, wo die Marylin Monroes sich im wahren Leben umbringen. Hier tun das nur die Hässlichen. So ticken unsere Kritiker. Das Schlimmste von allem ist, dass dieses Pack tatsächlich die Macht hat, den Erfolg einer Produktion zunichtezumachen. Das sind diese Möchtegernkritiker, diese Läuse der Journaille, die an Universitäten mit so merkwürdigen Namen wie FAMECISP oder ESUCOM studieren und letztlich die Entstehung eines nationalen Broadways verhindern. In Brasilien betreibt die Kritik eine Politik der verbrannten Erde. Ich sage immer zu meinem Sohn: ›Du weißt doch, das Projekt, das in der Schublade liegt und nie vorankommt. Das ist die brasilianische Kritikerseele.‹«
An dieser Stelle beschloss die Reporterin, das Interview zu beenden: »Können wir im Garten noch ein paar Fotos machen?«
In den Händen der in Scharen ins Foyer des Alexandre-Herculano-Theaters strömenden Damen befand sich die Zeitschrift mit Fábbio Cássio auf dem Titelblatt, Seite an der Seite mit seiner Mutter. Auf hochhackigen Schuhen hielten die Wartenden ungeduldig Ausschau nach Olga.
Nicht einmal Cayanne, die dank ihrer Rolle in Die Miezen und die Nerds jüngst zur Berühmtheit aufgestiegene, japanischstämmige Frau des Schauspielers, konnte der Matriarchin die Show stehlen. Olgas Anwesenheit im Foyer gehörte einfach zum Überraschungserfolg der Saison dazu. Niemand wusste, wann genau diese Mode aufgekommen war, aber nun war es so: Den grell geschminkten Frauen, normalerweise das Publikum von Komödien über die letzten Dinge des Lebens, reichte es nicht mehr, Fábbio Cássio live zu sehen. Autogramm und Handyfoto waren nicht mehr genug. Sie mussten sich unbedingt auch mit Olga unterhalten und Fotos mit ihr schießen, um das Programm komplett zu machen.
Deshalb war das Publikum enttäuscht, dass sie an diesem regnerischen Freitag nicht da war. Vorboten der Tragödie, die da kommen sollte.
Gleich nachdem der Schauspieler, gefolgt vom tosenden Beifall der Damen im Publikum, die unisono losklatschten wie eine Sinfonie von Blasen in einem Topf mit kochendem Wasser, die Bühne betreten hatte, entstand eine lange Stille, wie sie im Theater gefährlich werden konnte.
»Was macht der Idiot da bloß?«, fragte sich, befremdet von dem Novum, Alfredo Marcos im Bühnengraben. Einige Leute husteten, die Stühle knarrten, schließlich rief jemand »Anfangen!«. Der Regisseur, der schon das Schlimmste befürchtete, drückte auf den Applaus-Knopf, der in hysterische Ovationen mit den Ausrufen »Schön! Großartig!« mündete, und endlich begann die Aufführung mit einem Mann, der auf der verdreckten Toilette eines Pariser Cafés Drogen nahm.
Einer der anwesenden Kritiker, dessen Meinung über die Aufführung sich durch die Tragödie änderte, schrieb später, »dass da etwas in der Luft lag, das über den Text hinausging und dafür sorgte, dass das beherrschte und eindringliche Spiel Fábbio Cássios dem von Maurice Ronet in Louis Malles Film Das Irrlicht, der auf dem Roman von Drieu la Rochelle basierte, in nichts nachstand«.
Die Wahrnehmung der Regie war eine andere. Bis zur Hälfte der Aufführung war Fábbio unkonzentriert gewesen, hatte stellenweise den Text vergessen und Alfredo Marcos’ Handlungsanweisungen nicht befolgt.
Später stellte sich heraus – und es war Olga selbst, die die Geschichte im Rahmen ihrer Aussage bei der Polizei erzählte –, dass Fábbio an jenem Nachmittag sehr mitgenommen gewesen war vom Tod Godzillas, eines Deutschen Schäferhundes, den Cayanne aus dem Tierheim des Viertels geholt hatte, nachdem der Vorbesitzer ihn hinten ans Auto gebunden und mehrere Häuserblocks weit mitgeschleift hatte.
»Kann der Tod eines Haustiers eine schwere depressive Verstimmung auslösen?«, fragte sich tags darauf die Presse. Fachleute diskutierten über das Thema, spekulierten, doch nichts und niemand konnte erklären, was tatsächlich an jenem Freitagabend vorgefallen war.
Es war zwanzig vor zehn, als Fábbio zum Schlussmonolog des Stücks ansetzte. Der Selbstmord ist ein fast schon vorhersehbares Ende bei einem Text, der mit dem Satz beginnt: »Ich habe mir immer zum Vorwurf gemacht, ich zu sein« und dessen zentrales Thema der Tod ist. Die Zuschauer waren also nicht überrascht, als Fábbio den Revolver aus dem Schrank holte, sich mit dem Rücken zum Publikum gewandt auf den Boden setzte und sich eine Kugel in den Kopf jagte. Dann ging zum letzten Mal das Licht aus und der Applaus brandete los.
Viele Zuschauer waren beeindruckt von der Wirklichkeitsnähe der Szene.
»Ich habe das Blut direkt sprudeln gesehen«, erklärte die Mitarbeiterin eines Callcenters.
Eine in der Mitte der ersten Reihe sitzende Dame war es, die den Alarm auslöste. Ihre Handflächen brannten schon vom vielen Klatschen, als sie den Geruch von Blut wahrnahm. Sie blickte nach unten und bemerkte auf ihrem neuen Kostüm eine rötliche, weiß gesprenkelte, gallertartige Masse. Tage später sollten die Sachverständigen bestätigen, dass es sich dabei um einen Klumpen von Fábbios Gehirn handelte.
TEIL I
1
Es war weder Krebs noch Niereninsuffizienz. Es war auch nicht das Herz. Es war etwas anderes, dachte sie, es waren kostbare zwölf Milliarden Neuronen, die allmählich vernichtet wurden. Und es war auch eine Sinnkrise, die für manche zusammen mit der Rente einsetzte. Die Geschwindigkeit, mit der alles vonstattenging, war erschreckend: Heute noch war man das Familienoberhaupt. Anderntags lief man ziellos in Pantoffeln umher und vergaß Dinge, plötzlich stopften sie einem Tabletten in den Mund, überwachten, was man ausgab und was man aß. Bei ihrem Vater jedenfalls war es so gewesen. Nach und nach war der alte Mann immer gebeugter geworden, war in sich zusammengesunken, war erloschen. Daran würde er bald sterben. Im Grunde genommen starb er bereits. Tag für Tag sah sie mit an, wie er verfiel, gleich einem hundertjährigen Baum, der nur eines gehörigen Sturms bedurfte, damit er umstürzte. Ihre Alarmglocken schrillten bereits seit längerem: Der Tag rückte näher. Sie hasste es, sich das einzugestehen, aber so war es. Aus diesem Grund hatte sie sich diese Reise ausgedacht. Der Vorwand war der achtzigste Geburtstag des Patriarchen gewesen. Doch für sie war es insgeheim eine Abschiedsreise. Sie wollte nicht, dass er ginge, ohne dieses Land, diese Arena gesehen, ohne all diese Sänger gehört zu haben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!