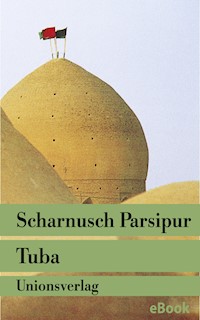
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tubas Lebensweg ist ein Gang durch ein persisches Jahrhundert. Als Tochter eines weltoffenen Gelehrten geboren, durchlebt sie die Stationen des Übergangs von einer absolutistischen Monarchie zu einer weltlichen Gesellschaft bis hin zur islamischen Abkehr von der Moderne. Ihre Schönheit weckt Angst und Argwohn der Männer, ihre innere Kraft durchbricht die Konventionen. Mit traumwandlerischer Sicherheit geht sie durch Gefahren und Wechselfälle, stets der Mittelpunkt und ruhende Pol ihrer Sippe. In ihrem Haus halten die Toten und Lebenden Zwiesprache, und wer es verlässt, kehrt eines Tages verwandelt wieder zurück. In diesem Roman von seltener Fülle und Dichte mischen sich Visionen und Fantasien, das Erlebte entpuppt sich als Poesie und die Legende als Realität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Tubas Lebensweg ist ein Gang durch ein persisches Jahrhundert. Mit traumwandlerischer Sicherheit geht sie durch Gefahren und Wechselfälle, stets der Mittelpunkt und ruhende Pol ihrer Sippe. In diesem Roman von seltener Fülle und Dichte mischen sich Visionen und Fantasien, das Erlebte entpuppt sich als Poesie und die Legende als Realität.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Scharnusch Parsipur (*1946) war wiederholt Verfolgungen ausgesetzt und war in den Achtzigerjahren eine Zeit lang im Gefängnis, wo sie Tuba schrieb.
Zur Webseite von Scharnusch Parsipur.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Scharnusch Parsipur
Tuba
Roman
Aus dem Persischen von Nima Mina
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel Tubâ va ma nâ-ye shab in Teheran.
Die Übersetzung aus dem Persischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.
Der Übersetzer dankt Isabel Stümpel für die Durchsicht der Übersetzung.
Originaltitel: Tubâ va ma’ nâ-ye shab (1989)
© by Scharnusch Parsipur 1989
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Nasrolah Kasraian
Umschlaggestaltung: Heinz Unternährer
ISBN 978-3-293-30705-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 05.01.2023, 10:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TUBA
Erster Teil – Nach sieben langen Dürrejahren regnete es nun schon …Zweiter Teil – Der Lärm der Kinder im Hof war plötzlich …Dritter Teil – Amine Chanom setzte sich neben das Becken und …Vierter Teil – Es war Sommer. Durch das offene Fenster konnte …PersonenregisterWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Scharnusch Parsipur
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Iran
Zum Thema Frau
Zum Thema Arabien
Zum Thema Asien
Dem Andenken meines Vaters
Tuba
Die Keusche, die Kluge, die Vollkommene.
Die Tugendhafte, die Weibliche, die Glückliche.
Die Fromme, die Strenggläubige, die Wohltätige.
Baum, der im Paradies wurzelt und dessen Äste
in das Haus des Propheten reichen.
Erster Teil
Nach sieben langen Dürrejahren regnete es nun schon seit drei Tagen ununterbrochen in Strömen. Tuba bearbeitete mit einem Besen die Wände des Wasserbeckens, um den verkrusteten, siebenjährigen Schlamm abzukratzen. Eimerweise schüttete sie Wasser auf die flache Stufe am Rande des Wasserbeckens, wo man die Füße zu waschen pflegt. Sie goss auch das Gärtchen, um die staubtrockene, dürstende Erde mit erlösender Feuchtigkeit zu tränken.
Die zwei Ehefrauen von Hadschi Mostafa beobachteten durch das Fenster die achtzehnjährige, dreimal von Hadschi Mahmud Khan geschiedene biwe. Die ältere, die vernünftiger und auch erfahrener war, dachte, was wohl passieren würde, wenn der Hadschi plötzlich überraschend heimkäme und die unverschleierte Tuba im Becken sähe. Die jüngere war naiver und schlichteren Gemüts. Sie zögerte, ob sie sich ihr anschließen und bei der Säuberung des Beckens helfen solle. Die ältere hatte schon das Fenster geöffnet, um Tuba anzusprechen, als diese die Arbeit unterbrach und sich umwandte. Sie hatte sich völlig verausgabt, und hätte es nicht geregnet, wäre sie schweißüberströmt. Die ältere Frau Hadschi Mostafas meinte, es sei nicht schicklich, so halb nackt das Becken zu fegen. Wenn nun ein Mann einträte, der Hadschi oder sonst jemand? … Tuba presste die Lippen zusammen und machte weiter. Die Freude an der Arbeit war ihr vergangen. Sie hielt inne und sah sich um. Das Becken war so sauber wie nur möglich. Sie schöpfte mit einer Schale das übrig gebliebene Wasser in einen Eimer, stellte Besen, Eimer und Schale neben das Becken und stieg hinaus. Ihre Füße ließ sie vom Regenwasser waschen. Dann ging sie zu ihrem Zimmer. Sie wusste, dass die beiden anderen sie noch immer beobachteten. Sie schloss die Tür, zog den Vorhang zu, um sich vor den neugierigen Blicken der zwei Ehefrauen Hadschi Mostafas zu schützen, zog ihr Hemd aus und merkte erst jetzt, dass sie über und über mit Schlamm bespritzt war. Sie packte ihre Badesachen zusammen, warf sich den Tschador um und zog den Gesichtsschleier über, nahm das Bündel unter den Arm, schloss das Zimmer ab und ging auf die Haustür zu. Hadschi Mostafas Frauen eilten wieder zum Fenster, und die ältere öffnete es, um Tuba zu fragen, wohin sie denn gehe. Sie gehe in den Hammam, antwortete Tuba, ins öffentliche Badehaus. Wenn Sahra käme, solle man ihr ausrichten, sie solle sie dort abholen. Die ältere wollte etwas entgegnen, denn sie hatte einschlägige Anweisungen vom Hadschi, traute sich aber dann doch nicht. Als Tuba aus der Tür trat, dachte die ältere Frau des Hadschi bei sich, dass sie wohl einmal mehr für Tuba und Sahra würde geradestehen müssen.
Der Nieselregen durchnässte Tuba bis auf die Haut; als sie den Hammam erreichte, tropfte es vom Saum ihres schwarzen Tschadors. Tuba war weder traurig, noch fühlte sie sich unbehaglich. Der Regen war für sie wie eine Erholung gewesen. Während der vier harten Jahre, die sie im Hause ihres Ehemannes verbrachte, musste sie die ständige Beschuldigung, sie sei für die Dürre verantwortlich, über sich ergehen lassen. Hadschi Mahmud Khan, ihr Ehemann, glaubte aufgrund einer Eingebung zu wissen, dass zwischen der Dürre und Tubas Anwesenheit in seinem Haus ein Zusammenhang bestand. Zuerst konnte Tuba die Tragweite dieser Anschuldigung nicht begreifen. Sie war es nicht gewohnt, sich als verfluchtes Wesen zu fühlen. Als Tuba neun Jahre alt war, war ihr Vater Hadschi Adib von der Wallfahrt nach Mekka zurückgekehrt und hatte gesagt, er habe unter der goldenen Dachtraufe des Haus Gottes in Mekka für sie gebetet und ihr ein Leben so lang wie Noahs Leben gewünscht. Das Andenken an den Vater, der in ihren Augen die Welt bedeutet hatte, war ihr teuer. Obwohl groß gewachsen und mit durchdringendem, aufmerksamem Blick, trug er seinen Kopf meist bescheiden gesenkt. Adib, sein Titel, bedeutete, dass er ein Gelehrter war. Tuba wusste dies seit ihrer frühesten Kindheit, seit sie ihre Rechte von ihrer Linken zu unterscheiden gelernt hatte. Ihre Mutter, selbst Analphabetin zwar, wies immer wieder darauf hin, dass der Vater ein Adib war – und ein Adib war ein großer Weiser.
Als der Engländer zu ihnen gekommen war, war Tuba sechs oder sieben Jahre alt. Niemand hatte bis dahin einen Engländer zu Gesicht bekommen, geschweige denn einen Engländer in seinem Haus empfangen, außer Hadschi Adib. Den wahren Hintergrund dieses Besuchs erfuhr Tuba allerdings erst lange Zeit später.
Der Engländer war hoch zu Pferd auf der Straße dahergesprengt. Das Pferd hatte vor Hadschi Adib, der gerade die Straße überqueren wollte, gescheut, so dass der Hadschi zu Boden stürzte. Der Engländer schlug ihm mit seiner Reitgerte ins Gesicht, beschimpfte ihn in gebrochenem Persisch als Dummkopf und Idioten und ritt davon. Asadollah, der Schlächter, der vor seinem Geschäft auf einem Holzblock Fleisch hackte, rannte dem Engländer mit dem Spaltmesser in der Hand hinterher und beschimpfte ihn. Anschließend eilte er zu Hadschi Adib hin, der noch immer im Straßenstaub lag, und half ihm, zusammen mit den anderen herbeigeeilten Ladenbesitzern, auf die Beine. Er musterte ungläubig die rote Spur der Reitgerte im Gesicht des Hadschi, und dieser quälende demütigende Blick würde dem Hadschi bis zu seinem Lebensende keine Ruhe lassen. Die Nachbarn umringten den Hadschi und sahen ihn erwartungsvoll an. Hätte der Hadschi in jenem Augenblick zum Aufstand aufgerufen, wäre es zu einer Rebellion gekommen. Aber er – und das gab er niemals zu – dachte in jenem Augenblick gerade über ein Rätsel in der Lehre des Mullah Sadra nach. Am folgenden Abend wollte er mit seinen Freunden darüber disputieren, und weil er so in Gedanken versunken gewesen war, hatte er das dahergaloppierende Pferd gar nicht bemerkt. Er kam langsam wieder zu sich und nahm die um ihn herum stehenden Menschen wahr. Sein linkes Auge war wohl vom Gertenhieb angeschwollen. Am liebsten hätte er das schmerzende Auge mit einem Tuch zugedeckt, vor dem Wind geschützt. Aber er konnte dies vor den Schaulustigen nicht tun. Also drohte er mit erhobener Stimme, dass er es den Engländern heimzahlen werde, und zwar so, dass man in den Geschichtsbüchern darüber berichten werde. Dann machte er sich entschlossenen Schrittes auf den Weg. Die Ladenbesitzer folgten ihm schweigend. Nach fünf oder sechs Schritten wandte er sich zu ihnen um und versprach, dass der Engländer zur Strafe genau an dieser Stelle, vor ihren Füßen, ausgepeitscht werden würde. Nun sei es aber besser, wenn alle in ihre Läden zurückkehrten. Er selbst eilte davon, und mit jedem Schritt wuchs in ihm die Wut über das Vorgefallene. Als er bei Moschiroddoules Haus anlangte, glich sein Kopf einer roten Rübe, die zwischendurch immer wieder erblasste, um dann wieder rot anzulaufen. Moschiroddoules Diener war zunächst über den gegen die Sitte verstoßenden unangekündigten Besuch erschrocken und führte den Gast in den Empfangsraum des Hauses. Der Adib fühlte sich unbehaglich. Er versuchte, seine Wut zu bezwingen. Der Fußboden war in europäischem Stil mit Teppichen belegt. Ringsum standen fransengeschmückte Sessel mit hohen Beinen. An den Wänden hingen Bilder der Schweizer Alpen und von europäischen Städten. Das Haus verfügte über elektrischen Strom. Ein riesiger Lüster hing von der Decke und erhellte den Raum. Verstört setzte sich der Hadschi auf den Rand eines Sessels. Seine Wut ging langsam in eine Art von Erstarrung und Kraftlosigkeit über.
Schließlich betrat der Hausherr den Raum und entschuldigte sich, dass er ihn hatte warten lassen. Die zwei Männer tranken Tee, aßen Kuchen dazu, und währenddessen rang der Adib fieberhaft nach Worten, um das Geschehene zu schildern. Er traute sich nicht, wie ein Untertan zu klagen; doch war er keine Kämpfernatur, die ihr Recht selbst hätte durchsetzen können. Also erging er sich zuerst weitschweifig darüber, dass die Fundamente des Landes und des Volkes auf den Schultern großer Männer ruhten, zu denen auch die Gelehrten gehörten. Ohne sie käme das Rad des Lebens zum Stehen, die Untertanen würden aufsässig, und die Ordnung gerate ins Wanken.
Moschiroddoule nahm seine Äußerungen mit Interesse zur Kenntnis und pflichtete ihm bei. Worauf ihm der Hadschi unterwürfig den Zwischenfall mit dem Engländer erzählte. Nur mit Mühe konnte er das Zittern seiner Stimme und seiner Hände unterdrücken. Er versuchte zum Ausdruck zu bringen, dass er sich nicht als großen und wichtigen Mann betrachtete. Aber wenn ein Engländer sich anmaßte, ihm, der das Gewand und den Titel eines Gelehrten trug, ungestraft vor den Augen Bekannter und Unbekannter einfach ins Gesicht zu schlagen – wo komme man da hin? Wie würde das gemeine Volk so etwas aufnehmen? Und wo würde das hinführen?
Moschiroddoule erfasste die Dringlichkeit des Anliegen vom Adib auf der Stelle. Auch er wurde zornig. Er erging sich in großen Worten und langen Reden und versprach schließlich, das Problem Seiner Majestät Schah Mosaffareddin vorzutragen und den Engländer durch den britischen Botschafter verfolgen und gebührend bestrafen zu lassen.
Als der Hadschi abends nach Hause zurückkehrte, hatte er sich einigermaßen beruhigt. Er hatte unterwegs der harrenden Menge von seiner Unterredung mit Moschiroddoule berichtet und angekündigt, dass der Vorfall Folgen haben werde.
Einige Wochen später meldete der Engländer seinen Besuch an. Am Tag vorher wurden ohne Ankündigung europäische Sessel und Tische aus Moschiroddoules Haus zum Hadschi gebracht. Moschiroddoules Verwalter meinte entschuldigend, dass die Europäer es nicht gewohnt seien, auf dem Fußboden zu sitzen. Es wäre auch unpassend, wenn der Hadschi sitze und der Engländer stehe, denn so wäre dieser größer als der Hadschi und sähe auf ihn herab.
Dann richtete der Verwalter die Grüße seiner Exzellenz Moschiroddoule aus und erklärte, der Schuldige sei im Übrigen kein Engländer, sondern ein Franzose. Seine Exzellenz habe sich vergebens bemüht, ihn über die britische Botschaft ausfindig zu machen. Ein Engländer habe ihm dann erzählt, er habe eine ähnliche Geschichte über einen Franzosen gehört. Daraufhin habe Seine Exzellenz die Angelegenheit mithilfe der französischen Botschaft verfolgt, und der Schuldige sei gefunden worden. Die Bezeichnung »Engländer« war jedoch an ihm haften geblieben. Auch der Verwalter nannte ihn so.
Ein Diener Moschiroddoules, der mit den Regeln im Umgang mit Europäern bewandert war, hatte sich ebenfalls eingefunden, um den reibungslosen Ablauf der Begegnung zu gewährleisten. Der Engländer musste sich persönlich beim Hadschi entschuldigen. Gespannte Erwartung hielt das Haus vierundzwanzig Stunden lang in Atem.
Die Frau des Hadschi, das Dienstmädchen Morwarid, Tuba und die kleineren Kinder saßen hinter dem Vorhang, der das Empfangszimmer vom Wohnzimmer trennte, um einen Blick auf den Engländer werfen zu können. Der Hadschi lief im Wohnzimmer auf und ab, als es an der Tür klopfte. Moschiroddoules Diener öffnete und führte den Engländer ins Empfangszimmer. Er trug Reitkleider, die Sporen an seinen Stiefeln klirrten bei jedem Schritt. Sein Haar war blond, die Augen blau und seine Haut weiß.
Die Frau des Hadschi wandte sich unwillkürlich Tuba zu, um zu prüfen, ob das Haar ihrer Tochter heller als das des Engländers war. Tuba war nämlich mit blondem Haar auf die Welt gekommen und unterschied sich dadurch von ihren Geschwistern. Das Haar des Engländers war aber heller als das ihre, war goldblond, während Tubas Haar rötlich schimmerte. Tuba jedoch war ganz in den Anblick des Engländers vertieft.
Der Diener brachte dem Engländer Tee und bedeutete dem Hadschi einzutreten. Hadschi Adib schob den Vorhang zurück. Der Engländer erhob sich als Zeichen der Höflichkeit, neigte leicht den Kopf und streckte dem Hadschi lächelnd die Hand entgegen. Dieser gab ihm, dem europäischen Brauch gemäß, die Hand, dann setzten sich beide. Der Engländer hielt eine kurze Rede in seiner Sprache, von der der Hadschi kein Wort verstand. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als mit einem Lächeln auf den Lippen zuzuhören. Dass kein Dolmetscher anwesend war, komplizierte das Ganze. Der Hadschi ging davon aus, dass der Engländer sich bei ihm entschuldigen wollte. Er erwiderte die Rede mit ein paar höflichen, nichts sagenden Sätzen, die mehr oder weniger bedeuteten, er habe die Entschuldigung angenommen, dabei starrte er unverwandt auf die Stiefel des Mannes, der den Teppich betreten hatte, ohne sie auszuziehen. Obwohl er inzwischen einiges über die Umgangsformen der Europäer erfahren hatte, zögerte er, ob es nicht klüger sei, beide Augen zuzudrücken. In diesem Augenblick stand der Engländer auf, zog eine kleine Schatulle aus der Tasche, trat zum Hadschi und legte sie ihm in die Hände.
Der Hadschi blickte verwundert auf die Schatulle. Dann richtete er seine Augen fragend auf den Engländer. Dieser erklärte mit Handzeichen und Worten, er solle die Schatulle öffnen. Der Hadschi hob den Deckel. In der Schatulle lag ein Ring mit einem großen Diamanten. Der Engländer hatte offenbar erklärt, es handle sich um ein Geschenk für die Dame des Hauses, doch der Hadschi, der ihn ja nicht verstand, starrte nur verblüfft auf den Ring. Die Frau des Hadschi indessen hatte den Diamanten blitzen sehen und knuffte unwillkürlich ihrer Tochter in den Rücken.
Der Hadschi wollte den Ring zurückgeben. Er versuchte, dem lächelnden Engländer zu erklären, dass er das Geschenk ablehne, was dieser wiederum nicht verstand. Schließlich musste sich auch der Hadschi der Gebärdensprache bedienen. Er führte den Ring an die Lippen, küsste ihn und drückte ihn an die Stirn. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass er sich bedankte. Dann erhob er sich, überreichte die Schatulle dem Engländer und sagte auf persisch: »Nein! Nein! Niemals! Unmöglich!« Bestimmte Wörter schienen dem Europäer vertraut zu sein. Er versuchte nochmals, dem Hadschi das Geschenk in die Hand zu drücken, doch dieser sträubte sich. Der Engländer zuckte leicht mit den Achseln und steckte die Schatulle wieder in die Tasche. Es wurde Zeit, sich zu verabschieden. Im Stehen sagte er noch ein paar Worte, verbeugte sich abermals leicht vor dem Hadschi. Sie reichten sich die Hand, und der Engländer ging.
Vor dem Haus des Hadschi hatten sich die Ladenbesitzer versammelt. Der Engländer hatte sein Pferd im Durchgang festgebunden. Gelassen zog er sein Reittier hinter sich her und trat gebückt aus dem bescheidenen Haus, um den Kopf nicht am Türrahmen anzuschlagen. Ein ersticktes Raunen ging durch die Menge. Der Engländer saß ruhig im Sattel, ritt ganz langsam die Gasse hinunter.
Die nächsten paar Stunden verbrachte der Hadschi damit, Nachbarn in seinem Hof zu empfangen und ihnen den Verlauf des Ereignisses zu schildern. Die Geschichte von dem Diamanten und die Tatsache, dass der Hadschi ihn zurückgegeben hatte, fand allgemeinen Beifall. Abends beschwerte sich jedoch die Ehefrau des Hadschi, denn das Funkeln des Diamanten hatte es ihr angetan. Der Hadschi, der sonst niemals die Stimme erhob, musste sie lautstark daran erinnern, dass es ihm unmöglich sei, einen Diamanten von jemandem anzunehmen, der ihm ins Gesicht geschlagen hatte. Die Frau war dennoch verärgert und blickte finster drein. Das Ehepaar grollte und stritt sich eine ganze Woche lang.
Nach diesem Vorfall pflegte der Hadschi ein paar Monate regen gesellschaftlichen Umgang. Er wurde mehrmals von Moschiroddoule und anderen großen, bedeutenden Persönlichkeiten eingeladen, die sich gern mit einem Mann umgaben, der für seine Kenntnis der alten Wissenschaften berühmt war. Durch seine gesellschaftlichen Beziehungen lernte der Hadschi auch die modernen Wissenschaften kennen. Er wusste zwar, dass die Erde kugelförmig war, war dennoch erschüttert, als er in Moschiroddoules Haus den runden Globus sah. Er hörte von den Taten Kolumbus’ und anderer Seefahrer. Moschiroddoule erklärte ihm, dass die gegenwärtige Situation kritisch sei: Es gehe darum, entweder zu Europäern zu werden – oder in den Dienst der Europäer zu treten.
Die fieberhafte Unruhe dieser Besuche legte sich aber bald. Zum einen war der Hadschi von Natur aus nicht gesellig, zum anderen erlaubten ihm seine begrenzten finanziellen Mittel nicht, Gäste einzuladen und sie zu bewirten. So kehrte er wieder in die eigenen vier Wände und zu seinen Bücherkisten zurück. Die Episode mit dem Engländer versank allmählich in den Tiefen seines Bewusstseins. Sein Durst nach den Lehren des Mullah Sadra und des Scheichs der Mystik hatte im Lauf der Zeit etwas nachgelassen. Eigentlich hatte er sich schon seit Langem nicht mehr damit befasst. Am frühen Abend legte er also sein Gelehrtengewand an, ging im Garten auf und ab und sinnierte über die Kugelgestalt der Erde. Es war nicht Kolumbus’ Reise, die er aufregend fand, sondern die Tatsache, dass dank der Kugelform der Erde plötzlich ein Engländer in seinem Haus stand, dass er für ihn europäische Möbel bereitstellen und europäisch gerahmte Bilder an den Wänden aufhängen musste. Und all das, weil die Erde rund war! Bei Moschiroddoule hatte er einige von diesen Europäisierten kennen gelernt. Er mochte sie nicht, doch es gab sie, und ihre Anzahl nahm von Tag zu Tag zu. Ja, die alte viereckige Erde und der runde Himmel darüber. Jetzt soll nun also die Erde rund sein – und der Himmel vielleicht viereckig! Nein, nicht viereckig: Der Himmel war rund! Jedes Kind weiß das. Rund und blau! Also öffnen sich die Abwasserschächte auf der anderen Seite der Erdkugel gen Himmel, und die Toten liegen nicht unter der Erde, sondern hängen in einem Haufen Staub und Steinen zwischen Erde und Himmel! Die Erde, Ursprung und Nährmutter, dreht sich, und der Himmel steht still. Oder doch nicht?
In seiner Jugend, während seiner Studienzeit und auch noch später hatte der Hadschi geglaubt, der Himmel sei mit der Erde vermählt. Er mochte die schlafende Erde, besonders im Herbst und im Winter. Im Winter, wenn der Schnee alles zudeckte, dachte er an die schlafende Dame Erde. Mit dem plötzlichen Hereinbrechen von Donner, Blitz und Regen im Frühling begann neues Leben in ihren Adern zu pulsieren. Im Herbst – dem Frühling der Mystiker, wie seine Meister ihn gelehrt hatten – pflegte der Hadschi durch die Felder zu streifen. Die Erde, diese reine, ruhige, reglose Dame! Ohne es zu wissen, war er in sie verliebt und spürte den Drang, sie zu beschützen. Letztlich würde es aber doch die Erde sein, die ihn in sich aufnahm, ihn zu Staub werden ließ. Dennoch stellte der Hadschi sich in Gedanken als ihren Beschützer vor. Bei der Vorstellung, dass er ein erhabeneres, mächtigeres Wesen war als die Erde, erreichte seine innere Erregung den Höhepunkt. Ohne Zweifel, die wache, die schlafende, die immer reglose Dame brauchte ewigen Schutz. Und wer war in der Lage, sie in ihrer unendlichen Fülle zu beschützen? Jemand, der die Erde an Größe übertraf! Dann wiederum überkam den Hadschi eine süße und zugleich bittere Trauer über seine lächerliche Winzigkeit. Damals kursierten Gerüchte über die runde Beschaffenheit der Erde und ihr Begrenztsein. Die Liebe, die er für die Erde empfand, veranlasste den Hadschi, diese Gerüchte zu ignorieren. Vielleicht war das der Grund, warum er den Anschluss an die modernen Wissenschaften verpasst hatte. Da er mit niemandem über die neuen Wissenschaften disputierte, wurde er mit der Zeit zu den Vertretern der alten Richtung gezählt.
Wenn er jeweils von der Schule nach Hause zurückkehrte und am Keller vorbeiging, lauschte er dem eintönigen, gedämpften Klappern, das die teppichwebenden Frauen der Familie erzeugten. Das Anschlagen der Wollkämme löste einen zarten Rhythmus aus, der mit der Folge der Jahreszeiten – Frühling, Sommer, Herbst und Winter – zu harmonieren schien. Der Hadschi beschützte auch die Frauen. Vor ihrer Größe empfand er keine Furcht. An der unendlichen viereckigen Dimension seiner eigenen vier Wände hatte auch er seinen Anteil: der viereckige Garten, den er von seinem Vater geerbt hatte; die rechteckigen Blumenbeete; das achteckige Wasserbecken. In der Tiefe seines Bewusstseins gab es einen absoluten Mittelpunkt, um dessen unsichtbare Achse sich das Himmelszelt ununterbrochen drehte.
In den Wirren des Heratkrieges, als das Land von Flüchtlingen überflutet und von Hunger und Inflation heimgesucht worden war, hatte sich der Hadschi gewünscht, nur für einen Augenblick seinen Körper ausstrecken zu können, so dass er die viereckige Fläche der Erde vollständig bedeckte. Hätte er sie doch nur für einen Moment liebevoll und dennoch brutal beherrschen können, wären alle Kriege beendet worden. Das Volk hätte sich beruhigt, jeder wäre seiner Arbeit nachgegangen, und es wären keine Hungersnöte mehr ausgebrochen. Von nun an brauchte er der Dame Erde nur zu befehlen, und sie würde gehorchen. Sie würde gebären oder nicht, den Himmel regnen lassen oder nicht, sie würde Früchte tragen – aber immer nach seinem Befehl.
Sein altersschwacher Vater hatte ihm die Sorge für ein paar Frauen übertragen, die zumeist im Kellergeschoss mit Teppichweben beschäftigt waren. Die Familie stammte aus Kaschan und lebte im Einklang mit den Traditionen. Seine Brüder waren ebenfalls in der Teppichbranche tätig, er aber hatte sich der Wissenschaft geweiht. Wann immer er mit einem Ja Allah das Haus betrat, stoben die Frauen davon und versteckten sich. Der Hadschi genoss es, wenn sie vor ihm stumm den Kopf senkten. Er bestimmte ihr Leben, ohne je über den Grund seiner Macht nachzudenken. Er vergab die Mädchen an Ehemänner, holte für die jungen Männer Frauen ins Haus und verheiratete sie. Derweil er das Leben anderer regelte, verbrachte Hadschi Adib selbst seine jungen Jahre ohne Frau. Er war sich jedoch nicht bewusst, dass er mit der Erde verheiratet war, und gestand sich nicht ein, dass er sich vor ihr fürchtete. Er fürchtete ihre Gesetzmäßigkeiten, die für ihn voller Willkür waren. Er fürchtete die Hungersnöte. Als er im Alter von fünfzig Jahren eine des Lesens und Schreibens unkundige Frau heiratete, genoss er ihre Unwissenheit. Ein scharfer Blick genügte, und die Frau nahm schweigend ihren Platz ein. So konnte sich das Rad seines Lebens ungestört weiterdrehen.
Nach dem Zwischenfall mit dem Engländer kam er während seiner langen Meditationen im Garten endlich zu einem Schluss: »Sie werden ihr Schamgefühl verlieren.« In Wahrheit befand sich die Dame Erde weder in schlafendem noch in wachem Zustand, sondern drehte sich, wie endlos und aus den Fugen geraten, um sich selbst. Dadurch kam es zum Wechsel der Jahreszeiten, zu Überschwemmungen und Dürrekatastrophen. Das Klappern der Wollkämme nahm für ihn eine andere Bedeutung an. Der Hadschi sagte sich: Sie denken! Das war ein Schlag mehr für ihn. Es war wie damals, als er den Globus zum ersten Mal gesehen hatte. Er dachte: Du weißt nur zu gut, dass die Erde rund ist. Warum dann diese Panik? Diese Erkenntnis stürzte ihn noch tiefer in die Abgründe des eigenen Bewusstseins. Er hatte in älteren Texten gelesen, dass bereits griechische Philosophen die Kugelgestalt der Erde vermutet hatten. Er wusste, dass auch einige persische Gelehrte zu dieser Erkenntnis gekommen waren. Der Hadschi wusste dies alles, und trotzdem beharrte er in seinem Innersten auf der Vorstellung von der Rechteckigkeit der Erde.
Er setzte sich an den Rand des Wasserbeckens und stützte den Kopf in die linke Hand. Er musste herausfinden, aus was für einem selbstsüchtigen Grund er auf der Viereckigkeit der Erde beharrte. Ungeduldig versuchte er, den Gedanken an die schlafende Dame Erde zu verdrängen. Es gelang ihm nicht. Wer hatte einst behauptet, Sklaven seien sprechende Werkzeuge? Endlich hatte der Hadschi etwas gefunden, womit er die Vorstellung von der schlafenden Dame Erde verdrängen konnte. Wer hatte das gesagt? War es nicht ein Römer gewesen? Der Hadschi zog die Augenbrauen hoch. Er konnte sich nicht erinnern. Sein Gedächtnis ließ ihn im Stich. Wer hatte gesagt, man solle die Bücher schließen und in die Schule der Natur gehen? Auch daran konnte er sich nicht mehr erinnern. Wozu das ganze Lesen, sagte er sich seufzend.
Auf der Erde hasteten Ameisen in geordneten Reihen. Der Hadschi versperrte einer Ameise mit seinem Zeigefinger den Weg. Sie blieb stehen, bewegte ihre Fühler und kroch an Hadschis Finger hoch. Jetzt, da die Erde offenbar rund war, erhielt alles eine andere, eine neue Bedeutung. Die Ameise krabbelte verwirrt am Finger des Hadschi auf und ab. Sicher hatte der alte Meister Moulana Dschalaleddin Mohammad recht: Die Natur strebt eine stufenweise Entwicklung an und befindet sich ständig im Werden. Kann aber auch die Ameise denken? Vielleicht verfügt sie über eine Art Verstand, wer weiß. Nicht alles, auch nicht der Verstand, kann Hadschi Adib allein vorbehalten sein. Er legte seine Hand auf die Erde, und die Ameise schloss sich hastig der Reihe ihrer Gefährtinnen an, und es schien, als ob sie ihnen aufgeregt etwas mitteilte. Manchmal blieb eine vor ihr stehen, bewegte die Fühler, dann gingen sie rasch auseinander. Der Hadschi lächelte. Vielleicht tauschten sie Informationen über eine rosafarbene Wand aus, die sich bewegt. Auch wenn sie denken konnte, die Ameise besaß bestimmt keine Vorstellung von ihm, Hadschi Adib. Doch wie auch immer: Sie war in der Lage, seine Existenz wahrzunehmen.
Der Hadschi ging zum Ameisennest und betrachtete den kleinen Hügel. Und wie steht es mit der Erde? dachte er. Kann auch sie denken? Ist das der Grund, warum sich der Planet Erde dreht, mit allem, was er enthält? Alle Dinge, die er enthält, können einzeln und eigenständig denken und drehen sich vielleicht ebenfalls, so wie ihr tiefer Ursprung: die Erde. Dennoch, ein Baum stellt eine Einheit dar und muss über einen angemessenen Verstand verfügen. Und die einzelnen Teile wiederum, die aus ihm eine Einheit machen, sind ebenfalls in der Lage, selbstständig zu denken. So zieht es die Wurzeln in die Tiefe, und die Äste wachsen, einem Trugbild folgend, in die Höhe. Jeder Teil ist ein Ganzes, und seine Bestandteile wiederum bilden kleine Ganzheiten.
Der Hadschi wusste, dass er sich nicht um die Gedanken der Erdpartikel zu sorgen brauchte. Manche Gesetzmäßigkeiten dieser lebenden und sich drehenden Existenz waren ihm klar. Wenn man im Frühjahr Veilchen anpflanzt, dann kann man im Frühling mit einem Gartenbeet voller Blumen rechnen. Das Veilchen kann für sich denken, genauso die Erde und das Wasser. Zusammen erzeugen sie ein beseelendes Gemisch. Der Hadschi dachte: Ich bin alt geworden, und er spürte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte. Es blieb nicht mehr viel Zeit, um über Entwicklung, über Metamorphosen, über den Geist und die Gedanken der Erdpartikel zu sinnieren, über die Erde in ihrer Ganzheit, über den Verstand des Baumes in seiner Ganzheit und den Verstand der einzelnen Bestandteile des Baumes. Er stellte sich vor, dass sie alle in ihrer kleinen Partikelwelt mehrere Exemplare eines Hadschi Adib enthielten, eines Moschiroddoule, eines Engländers, die sich gegenseitig bekämpfen. Er lachte. Asadollah, der Fleischer, würde auch dort ständig Fleisch hacken. Er lachte wieder.
Das Klappern der Wollkämme setzte plötzlich aus. Der Hadschi hörte das Gemurmel der Frauen nicht mehr. Die Sonne hatte den Zenit noch nicht erreicht. Während der Hadschi noch immer am Becken saß und seinen Kopf in die eine Hand stützte, beugte er sich langsam vor und blickte durch den spitzen Winkel zwischen seinem Oberarm und seinem Kopf zum Keller hinüber. Die Frauen hatten sich flüsternd unter dem Fenstergitter versammelt. Irgendetwas sagte dem Hadschi, dass sie sich über ihn unterhielten. Er erinnerte sich, dass er gelacht hatte. Er hatte laut und hemmungslos in einer für ihn unwürdigen Weise gelacht! Die Frauen kannten ihn nicht so. Er stampfte mit dem rechten Fuß leicht auf. Sie denken! Sie dachten leider, und zwar nicht wie Ameisen, wie die Bestandteile des Baumes oder die Partikel der Erde, nein: Sie dachten wie er auch. Über den Gelehrten Mullah Sadra allerdings würden sie niemals nachdenken. Er zuckte nochmals zusammen, weil ihm einfiel, dass sie durchaus über ihn nachdenken könnten. Hatte nicht damals, in seiner Kindheit, eine anmaßende Frau riesiges Aufsehen erregt? Es hieß, sie sei eine Prostituierte. Es hieß aber auch, sie sei weise. Jede Menge Gerüchte wurden über sie herumgereicht! Der Hadschi erinnerte sich an jemanden, der seinem Vater gegenüber jene Frau ehrfürchtig als »göttliches Zeichen« bezeichnet hatte.
Die Frauen flüsterten und kicherten hinter den hölzernen Fenstergittern. Typisch weibliche Albernheit, dachte der Hadschi verächtlich. Jetzt versetzt wohl die eine der anderen einen kräftigen Stoß in die Brust, die prallt gegen die Wand und lässt sich kichernd zu Boden fallen. Dann wird sie versuchen, ihr den Kopf in den Bauch zu rammen. Und wenn gerade kein Mann zu Hause wäre, würden sie sich kugeln vor Lachen. Manche von ihnen hatten durchgedreht, weil sie keinen Mann gekriegt hatten. Aber es ließ sich einfach kein Mann für sie finden. Der Hadschi war ihr Ernährer, und er kannte niemanden, der einigermaßen ein Auskommen hatte. Und wenn sich doch jemand fände und alle seine Schützlinge das Haus verließen? Wer würde dann die Teppiche weben? Er konnte doch keine fremden Frauen ins Haus bringen. Nein, es würde ihn nicht wundern, wenn sie es zwischendurch miteinander trieben. Angewidert presste der Hadschi die Lippen zusammen und schlussfolgerte: Ja, die Erde ist rund, Frauen denken, und sie werden bald jegliches Schamgefühl verlieren.
Eine kleine Wolke bedeckte die Sonne, eine plötzliche Windböe wirbelte Staub auf. Der Hadschi grübelte weiter: So weit wird es kommen. Sobald sie entdecken, dass auch sie einen Verstand besitzen, werden sie Staub aufwirbeln! Der ehrwürdige Gelehrte aus Schiraz hatte recht. Auf nichts mehr war Verlass in dieser vergänglichen Welt.
Jetzt erst wurde ihm klar, warum die Erde viereckig sein musste, warum sie für statisch gehalten wurde, warum jedem Mann das Recht zustand, einen Zaun um sein Stück Erde zu ziehen. Wenn man dieses Stück Erde sich selbst überließ, würde es sich zu drehen beginnen und alle in Staunen versetzen. Dann würde alles in Unordnung geraten!
Verärgert schaute der Hadschi zum Keller hinüber, und das Gemurmel der Frauen verstummte auf der Stelle. Er hörte ihre schnell zum Webstuhl trippelnden Schritte. Die Wolke war inzwischen weitergezogen. Der Hadschi empfand eine Mischung aus Erniedrigung, Wut und Angst. Bestimmt würde der Engländer ihnen eines Tages alle diese neuen Erkenntnisse beibringen. Jener Schamlose, der seine Frau mit einem Diamantring beschenken wollte! Mit welchem Recht eigentlich?
Der Hadschi ging auf das Haus zu. Doch auf einmal blieb er stehen und wandte sich nach seiner Tochter um, die neben dem Wasserbecken saß und mit dem kleinen Finger im Wasser schnippte, um die Fische an die Oberfläche zu locken. Ihr blondes Haar sah zerzaust und ungekämmt aus. Es schimmerte im Tageslicht in zarten Regenbogenfarben. Er musste dem Engländer zuvorkommen, müsste seine Tochter selbst unterrichten, und zwar in allem. Seine Frau zählte nicht. Sie war ein hoffnungsloser Fall. Nicht aber die kleine Tochter mit ihrer Begabung und ihren verblüffenden Fragen. Er rief Tuba zu sich, und die Kleine lief zu ihm hinüber. Er nahm sie bei der Hand und ging mit ihr ins Haus. Der Hadschi setzte sich ihr gegenüber und sagte, von nun an werde er sie unterrichten. Sie begannen mit dem Koran und dem Alphabet, lasen im Golestan. Der erste persische Satz, den das Mädchen lesen lernte, würde für immer in ihrem Gedächtnis bleiben: »Tuba ist ein Baum im Paradies.«
Das Kind lernte, dass die Erde rund sei. Noch nie hatte es über die Form der Erde nachgedacht. Ihr Vater hatte ihm von der Wallfahrt nach Syrien einen Globus mitgebracht. Es verging eine Woche voller unruhiger Fragen, bis es begriff, wie alle die großen Gegenstände auf dieser kleinen Kugel Platz finden konnten. Vor allem aber musste es lernen, wo Russland und wo Preußen liegt, dass England sich auf einer kleinen Insel am Ende der Welt befindet, dass dort die Menschen blond waren wie Tuba und sich nach dem Stuhlgang nicht waschen und aus der Nähe übel riechen. Auch die Russen stanken, aber die Preußen, die hatte Gott der Allmächtige wohlriechend geschaffen. Die Franzosen schließlich waren geruchsneutral.
Anhand des Geruchssinns trichterte der Hadschi seiner Tochter politische Zusammenhänge ein. Je genauer das Kind seinen Vater beobachtete, desto mehr unbestimmte Zweifel erwachten in ihm, die es jedoch nie äußerte. Allmählich begann Tuba unbewusst ihre zarten Lippen zusammenzupressen wie der Hadschi, als sei sie ständig damit beschäftigt, ein schwer wiegendes Problem zu lösen. Ihre Augen füllten sich mit dem Glanz, der in den Augen ihres Vaters leuchtete. Sie hielt den Kopf geneigt, und ihr Blick verlor sich in der Ferne.
Als ihr Vater starb, vergaß sie das Lachen für immer. Sie war zwölf Jahre alt.
Es gibt Männer auf der Welt, die prophetische Visionen haben. Sie werden von Frauen geboren, die keusch und tugendhaft sind wie die Jungfrau Maria. Der Hadschi hatte unter allen heiligen Frauen die Jungfrau Maria als Vorbild gewählt. War sie nicht jungfräulich schwanger geworden? Wie die Dame Erde, die mit dem Himmel verheiratet war? Dieser Vergleich ging ihm nicht aus dem Sinn.
Gott der Allmächtige hatte Maria im Bad durch den heiligen Geist geschwängert. Der Engel war ihr in Gestalt eines Mannes erschienen. Maria hatte das Haus Gottes sauber gehalten, den Garten gegossen und war immer gehorsam gewesen. Sie erschrak und bedeckte ihren entblößten Leib vor dem Fremden. Der Engel pflanzte die göttliche Gabe, den Samen, in ihren Bauch. Durch die Geburt des Kindes entfernte sich Maria von Gott, wie es der Engel vorausgesagt hatte. Wenn Maria vorher paradiesische Speisen erhalten hatte, musste sie nun die Datteln von den Palmen schütteln.
Der Hadschi las seiner Tochter die Koransure Marjam fünfmal vor, bis sie die arabischen Wörter auseinander halten konnte und deren Bedeutung verstand. Er versprach ihr fünf Goldmünzen für ihre goldene Halskette, wenn sie die Sure auswendig lernte.
Tuba gab dem Vater ihr Wort. Sie brauchte eine Woche, um die Sure auswendig zu lernen. Sie versprach ihm, dass sie es niemals zulassen werde, dass die Liebe zu einem Menschen – und sei es ihr eigenes Kind – ihre Liebe zu Gott ersetze.
Durch den Tod des Vaters blieb ihre Ausbildung unvollendet. Den Koran waren sie schon mehrmals durchgegangen. Sie kannte auch Auslegungen mehrerer Suren. Die Bücher Golestan und Bustan hatte sie ebenfalls gelesen und konnte rund ein Dutzend Hafez-Gaselen auswendig. Vom Zeitpunkt des Todes ihres Vaters an bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr war sie hauptsächlich mit zwei Dingen beschäftigt: Mit dem Knüpfen von Teppichen für ihre Aussteuer, und wenn ihr noch Zeit blieb, legte sie sich auf den Rücken und wartete, dass ihr ein Engel Gottes erscheinen und den göttlichen Samen in ihren Bauch pflanzen möge. Als das älteste Kind der Familie war sie sehr rasch erwachsen geworden, und als einzige gebildete Person im Hause hatte sie anstelle ihres Vaters eine Art Führungsrolle übernommen. Die Mutter hatte keine eigene Meinung, ihre Brüder und die einzige Schwester, die von frühester Kindheit an sehr fromm war, gehorchten ihr widerspruchslos. Die kleinere Schwester betete seit ihrem siebten Lebensjahr und fastete seit dem neunten. Tuba war überzeugt, dass sie, Tuba, das Kind Gottes zur Welt bringen werde, wenn sie tagtäglich den Hof sauberfegte und aus Liebe zu Gott Teppiche knüpfte. Sie betete und fastete und kümmerte sich nicht um die anderen Dinge des Lebens.
Jeden Donnerstagabend besuchte sie Hadschi Mahmud, ein Neffe ihres Vaters, setzte sich hinter den Netzvorhang, und die Jungen, die gerade aus der Schule kamen, stellten sich höflich vor ihn hin und berichteten über ihre Fortschritte. Hadschi Mahmud erkundigte sich nach dem Befinden der Frauen und schob eine kleine Tüte mit dem wöchentlichen Haushaltsgeld unter dem Vorhang durch. Seit Hadschi Adibs Tod waren nun zwei Jahre vergangen, und die Familie seiner Witwe hatte einen neuen Freier gefunden. Aber immer, wenn Tubas Mutter mit Hadschi Mahmud über diese Angelegenheit sprechen wollte, erblasste sie und begann zu stottern.
Tuba beobachtete, wie ihre Mutter sich schminkte und die Augenbrauen mit Weideblättern färbte, wenn sie der Freier zusammen mit ihren Familienangehörigen besuchte. Den Mann hatte die Witwe noch nie gesehen, dennoch zog sie sich festlich an, band ein neues Kopftuch um, legte Wangenrot auf und machte sich schön. Der Freier saß neben dem Vorhang im Empfangszimmer, die Mutter und ihre Verwandten im Zimmer nebenan. Der Freier sprach durch den Vorhang. Er erzählte vom Leben in der Armee, wo er als Major diente. Er berichtete von seinem Kavallerieregiment und dass er demnächst ins Feld ziehen werde. Alles, was er erzählte, kam ihnen unerhört spannend vor, und die Frauen hörten ihm fasziniert zu. Seine Anwesenheit wirkte auf die Stimmung von Tubas Mutter wie eine frische Brise im heißen Sommer. Die Frau saß hinter dem Vorhang und verhüllte ihr Gesicht mit dem Kopftuch. Ab und zu brach sie hinter vorgehaltener Hand in Lachen aus, schämte sich dann vor ihren Verwandten und Kindern. Um ihre Verlegenheit zu verbergen, bückte sie sich und tastete nervös den Teppich ab, als wolle sie ein unsichtbares Stäubchen auflesen. Tuba nahm sich vor, ihrer Mutter zu Hilfe zu kommen.
Eines Donnerstag abends setzte sich auch Tuba hinter den Vorhang in der Absicht, das Problem ihrer Mutter in die Hand zu nehmen. Da wurde ihr plötzlich klar, dass dies wesentlich komplizierter war, als sie es sich vorgestellt hatte. Hadschi Mahmud war ein allzu finsterer Mensch, als dass man ein derart heikles Gespräch mit ihm hätte führen können. Vor allem aber pflegte er sich hauptsächlich mit den Brüdern zu unterhalten. Als die Tochter eben zum Sprechen ansetzte, räusperte sich Hadschi Mahmud und sagte, da sei noch etwas, was er der Frau Mutter zu sagen habe.
Die Witwe wurde blass, blickte verlegen zu ihrer Tochter hinüber, die ihr ernst zunickte, und brachte nur ein einziges Wort heraus: »Bitte!«
Hadschi Mahmud erklärte, dass nun fast drei Jahre vergangen seien, seit ihr Mann – Gott segne ihn! – diese Welt verlassen habe; sein Haus werde inzwischen von Sahra Chanom, der ältesten Frau, verwaltet. Seine ständigen Besuche im Haus des verstorbenen Hadschi Adib würden zu Gerede Anlass geben. Sahra Chanom könne aber seine Gemahlin werden, falls sie das wolle. Durch Ehestand wäre mahramijat zwischen ihnen gegeben, und die täglichen Probleme ließen sich gemeinsam leichter bewältigen.
Die Mutter brachte kein Wort hervor, kratzte sich mit zitternden Fingern im Gesicht. Tuba indes hatte einen Entschluss gefasst: Sie antwortete anstelle ihrer Mutter und erklärte ruhig, es habe bereits jemand aus der Familie um die Hand der Mutter angehalten; beim gegenwärtigen Stand der Dinge könnte eine Absage zu Familienzwist führen. Sie, Tuba, wäre aber bereit, sich mit ihm zu verehelichen.
Unwillkürlich musste der dreiundfünfzigjährige Hadschi Mahmud an seine eigenen Töchter und Söhne denken, die alle älter waren als Tuba. Nach endlosen Minuten peinlichen Schweigens sagte der Hadschi mit einer Stimme, die ausnahmsweise nicht hart, sondern eindeutig unsicher klang, die verehrte Tochter des verstorbenen Hadschi sei wohl viel zu jung für ihn. Tuba erwiderte schlicht, das sei für sie kein Hindernis. Die Intimität mit einem ihr angetrauten Mann sei ihr außerordentlich wichtig.
So wurde Tuba in einer nüchternen Zeremonie Hadschi Mahmuds Frau, um anschließend in seinem Hause vier eisige Jahre zu verbringen. Der Hadschi hatte sich bis zum Augenblick der Vereinigung in der Hochzeitsnacht einzureden versucht, dass ihr vielleicht ein Makel anhafte. Doch sie war vollkommen. Sie war vierzehn Jahre alt, sie war für ein Mädchen außergewöhnlich gebildet, sie war selbstsicher – sie hatte sogar selbst um die Hand des Mannes angehalten. Sie war schön und, was noch ungewöhnlicher war, sie war blond, was ihn zusätzlich beunruhigte: Wenn sich das herumspräche, würden sich andere Männer in sie verlieben. Er glaubte, ihre Jugend und ihre Schönheit mit der Waffe der Strenge unterdrücken zu können. Er gönnte ihr kein einziges zärtliches Wort und behandelte sie lieblos. Nur einmal ließ er sich gehen und sagte: »Dein Haar ist golden«, doch er korrigierte sich gleich und fügte nüchtern hinzu: »Wie ein bronzener Samowar.«
Die politischen Unruhen im Zusammenhang mit der konstitutionellen Bewegung störten den sozialen Frieden. Der Hadschi dachte ständig an die Russen und an die Engländer. Es herrschte akute Nahrungsmittelknappheit. Als guter Geschäftsmann hatte er die Speicher rechtzeitig gefüllt. In seinem Haus gab es genug Mehl. Dennoch war er zutiefst beunruhigt über die angeheizte politische Lage. Es regnete selten, und wenn, dann zu wenig. Die Menschen starben zu Hunderten an Typhus und Hunger. Und an allem war Tuba schuld. Warum? Sie wusste es nicht.
Wenn eine Frau ein gutes Omen hat, dann bringt sie Glück und Segen ins Haus. Mit Tuba aber waren Hunger und furchtbare Katastrophen übers Land gekommen. Es gab drei Dinge auf der Welt, die der Hadschi hasste: die Engländer, die Russen und Tuba! Von Zeit zu Zeit ließ er sie dies auch spüren, insbesondere das mit dem Regen. Für ihn bestand zwischen dem Regen und Tuba ein Zusammenhang. Eine Frau mit gutem Omen brachte Regen. Der Regen aber blieb aus.
Tuba wurde jeglicher Verantwortung enthoben. Alle Aufgaben wurden von Sahra erledigt, der ältesten Frau im Hause des Hadschi, die er persönlich mit seinem schwarzen Diener verheiratet hatte. Sahra war eine besonnene, gewissenhafte Person, während Tuba tagelang zusammengekauert in einer Ecke ihres Zimmer kniete und ins Leere starrte. Im Gegensatz zu den Haushalten anderer Kaschanis befand sich in Hadschi Mahmuds Kellergeschoss keine Teppichwerkstatt. Tuba traute sich im Übrigen nicht, in den Keller oder in die Speicher zu gehen. Sie fürchtete sich vor den Rügen ihres Mannes. Sahra, die die Launen ihres Herrn kannte, erlaubte Tuba keine Freiheiten. Tubas erste Kochversuche wurden vom Hadschi derart harsch getadelt, dass sie keinen weiteren unternahm.
Ihr Kindheitstraum vom göttlichen Samen verwandelte sich in ein Gefühl der Erniedrigung. Sie war Gott nicht einmal Regen wert!
Die Nächte zum Freitag waren für Sahra ein großes Fest, für Tuba hingegen eine Qual. Donnerstag abends kam Qasem nach Hause, der während der Woche im Laden des Hadschi im Basar schlief. Sahra pflegte zu sagen, in der Nacht zum Freitag hätten sogar die Toten frei. Donnerstag abends wurde ein üppigeres Essen als sonst gekocht. Sahra und Qasem durften ihr Esstuch im Zimmer von Tuba und dem Hadschi ausbreiten. Eigentlich legten sie keinen besonderen Wert auf dieses Zeremoniell. Für sie war es einfacher, ohne viel Umstände in ihrer Kammer oder in der Küche zu essen. So aber mussten sich die Frauen zuerst schminken; dann wurden zwei Esstücher ausgebreitet, auf der einen Seite das für den Hadschi und Tuba, auf der anderen Seite das für Sahra und Qasem. Das Abendessen wurde zumeist schweigend eingenommen. Manchmal erzählte der Hadschi erbauliche Geschichten von den Taten großer, bedeutender Männer. Zwischendurch nutzten Sahra und Qasem die Gelegenheit, um über die Ladenbesitzer und die Basaris zu witzeln. Der Hadschi räusperte sich jeweils und tat so, als hätte er die Bemerkungen überhört. Dann wurden die Gedecke abgeräumt, Sahra machte das Bett für ihren Herrn bereit, sagte gute Nacht und ging zu ihrem Ehemann. Nach einem hastigen Beischlaf murmelte der Hadschi schnell ein Gebet, drehte seiner Frau den Rücken zu und schlief ein.
Um Mitternacht erwachte das Haus wieder. Die Badesachen waren am Abend zuvor bereitgelegt worden. Qasem und Sahra trugen die Bündel mit den Badeutensilien Tubas und des Hadschi auf dem Kopf. Qasem ging mit einer Laterne in der Hand voraus. Hinter ihm folgten der Hadschi, dann Tuba und zuletzt Sahra. Zum Morgengebet waren sie wieder zu Hause.
Freitags kamen die Söhne und Töchter des Hadschi mit ihren Ehefrauen, ihren Ehemännern und Kindern zu Besuch, wie es die Tradition verlangte. Einmal im Monat besuchten der Hadschi und seine Frau Tuba die Familie nach einer festgesetzten Reihenfolge. Tuba empfand die Besuche als langweilig und ermüdend und musste all ihren guten Willen zusammennehmen, um sie durchzustehen. Von ihrem Vater hatte sie gelernt, alles im Leben ernst zu nehmen, und das Leben an der Seite von Hadschi Mahmud vertiefte diese Eigenart nur noch. Mit der Zeit blickte sie ständig vergrämt und mürrisch drein. Obwohl sie noch zu jung war, um andere einzuschüchtern, strahlte sie Kälte aus. Oftmals, wenn sie stundenlang allein und untätig in ihrem Zimmer in einer Ecke gekauert war, schlug ihr Verdruss in Melancholie um. In den ersten vier Jahren ihrer Ehe hatte sie noch kein Kind zur Welt gebracht. Sie ahnte nicht, dass der Hadschi absichtlich eine Schwangerschaft verhütete. Er wollte schlicht kein Kind von Tuba. Der bloße Gedanke, eines Tages zu sterben und eine schöne, junge Witwe mit Kindern zu hinterlassen, machte ihm Sorgen. Schon oft hatte er in der Nacht vor Tubas Zimmertür gezögert, doch die Furcht vor einer Schwangerschaft hatte ihn immer wieder umkehren lassen. Tuba, die einst vom göttlichen Samen geträumt hatte, war nun der Qual der Unfruchtbarkeit ausgeliefert.
Außerhalb des Hauses herrschten Hunger und Typhus, aber davon wusste Tuba nichts. Sie verließ das Haus nur Freitag nachts, um ins Badehaus zu gehen, und einmal im Monat besuchte sie ihre Familienangehörigen. Dort bekam sie weder ausreichend zu essen, noch konnte sie lange bleiben, denn der Hadschi sah seine Frau ungern als Kostgängerin eines »fremden Mannes«, wie er Tubas Stiefvater bezeichnete.
Mit der Zeit belasteten wirtschaftliche Sorgen auch die Familie des Hadschi und verschärften die Probleme im Haus. Manchmal murmelte er: »Wenn du nur ein gutes Omen hättest«, führte den Satz aber nicht zu Ende. Tuba trug sich manchmal sogar mit dem Gedanken an Selbstmord, weil sie durch ihr vermeintlich Unheil bringendes Wesen dem ehrwürdigen Mann nicht noch mehr Schaden zufügen wollte. Andere Male wiederum ließen sie seine Anschuldigungen kalt. Wenn er aber finster vor ihr stand und auf sie herabsah, dann wäre sie am liebsten im Erdboden versunken.
Es kam der Tag, an dem der Hadschi ihr tatsächlich eine Aufgabe zuwies. Zum ersten Mal in ihrem vierjährigen Eheleben wurde zu Hause Brotteig bereitet, um ihn zum Bäcker zu bringen. Es war mittlerweile unmöglich, sich allein auf die Straße zu wagen. Sahra war gerade nicht da, weil sie im Haus der Tochter des Hadschi bei einer Entbindung half.
Der viel beschäftigte Hadschi, dem solche Dinge eher peinlich waren, hieß Tuba, Qasem zur Bäckerei zu begleiten. Der große Schwarze hievte das Tablett mit den Teigkugeln, die mit einem Tuch zugedeckt waren, auf den Kopf. Tuba ging hinter ihm her. In den Straßen zu flanieren, das war Tuba bisher unbekannt gewesen. Sie achtete daher kaum auf Qasem. Im Grunde war der riesige Schwarze auch gar nicht auf die Rückendeckung durch eine zierliche Achtzehnjährige angewiesen.
Es war etwa elf Uhr an einem Frühlingstag des Dürrejahres. In der Luft lag flimmernder Staub. Am Eingang des kleinen Basars hatte sich eine größere Anzahl von Menschen um einen Stand versammelt, wo Reis mit Bohnen feilgeboten wurde. Man beschuldigte sich gegenseitig des Diebstahls, und es schien so, als ob die Auseinandersetzung in eine mörderische Prügelei münden werde. Am Ende des kleinen Basars, in der Nähe des Kupferschmieds, saß ein etwa sechsjähriger Junge im Schneidersitz mit dem Rücken zur Mauer. Sein Kopf war nach vorn geneigt, und er bewegte sich wie ein Uhrpendel hin und her. Er wiederholte im Rhythmus seiner Bewegung eintönig: »Hunger, Hunger!«
Er war schon ganz heiser, doch seine Stimme war in der Menge deutlich zu hören. Als Tuba am Kind vorbeikam, verlangsamte sie den Schritt, musste aber sogleich hinter Qasem herrennen, denn sie hatte ihn fast aus den Augen verloren. Ohne ihn würde sie niemals nach Hause zurückfinden. Sie kannte die Stadt überhaupt nicht. Die beiden gelangten zu der engen Gasse, wo sich die Bäckerei befand. Die Menschen davor bildeten eine lange Schlange. Auch hier herrschte Tumult, und jeder klagte und jammerte. Qasem ging am Haus vorbei, bog in eine Gasse ein und anschließend in eine kleine Sackgasse. Er blieb vor einer morschen Tür stehen, an der die Farbe abblätterte, und klopfte an. Eine Frau, die den Tschador um die Hüfte geschlungen und das Kopftuch wie eine Waschfrau um das Haar gebunden hatte, öffnete und trat wortlos zur Seite. Sie gingen hinein. Es war das Haus des Bäckers. In einer Grube mitten im Hof befand sich ein zusätzlicher Backofen. Qasem erklärte, die Frau des Hadschi bleibe da, er werde in zwei Stunden vorbeikommen, um das Brot abzuholen.
Die wortkarge Frau nickte. Tuba setzte sich an den Rand des Wasserbeckens und beobachtete sie aufmerksam. Dutzende Teigfladen lagen vor der Frau ausgebreitet. Sie klatschte die Teigballen zwischen den Händen flach, während ihre Tochter sie an die erhitzte Wand des röhrenförmig eingelassenen Ofens klebte.
Die zwei arbeiteten pausenlos, ohne miteinander zu reden. Tuba, der nichts anderes übrig blieb, als dazusitzen und zu warten, sah ungeduldig und müde dem emsigen Tun zu. Es dauerte länger als geplant, und auch Qasem, der inzwischen zurückgekehrt war, musste warten. Unterwegs hatte er etwas Brot und Käse für Tuba eingekauft.
Endlich war es soweit. Die Bäckersfrau und ihre Tochter banden die Brote mit einem dünnen Seil auf dem Tablett fest und bedeckten sie wieder mit einem Tuch. Trotzdem konnte man die Brote darunter erkennen. Die Bäckersfrau warnte Tuba und Qasem beiläufig vor dem Mob, und schon standen sie wieder auf der Straße. Vor der Bäckerei herrschte immer noch Tumult. Die Menschen schimpften und fluchten und waren offensichtlich noch aufgebrachter als am Vormittag. Tuba eilte hinter Qasem her. Sie gelangten zum Basar und an dem Jungen vorbei. Er saß da, stumm. Tuba blieb vor ihm stehen. Der Kopf lag auf seinen Knien, die leeren Augen starrten auf die offenen Hände in seinem Schoß. Tuba kniete nieder, um das Kind genauer zu betrachten. Es regte sich nicht. Qasem drängte zum Weitergehen. Tuba bat Qasem, das Tablett auf den Boden zu stellen. Sie zerrte ein Fladenbrot unter dem Tuch hervor, legte es dem Kind in die Hand, drückte sanft seine Finger zu einer Faust. Aufgeschreckt vom plötzlichen Lärm um sie herum, schaute sie zu Qasem auf. Eine wütende Menge, die zu allem bereit war, umstand das Tablett, fiel dann kurzerhand über die Brote her. Die Menschen stürzten sich aufeinander, fielen zu Boden, Qasem brüllte, prügelte und steckte selbst einiges ein. Vom Brot war bald kaum noch etwas übrig geblieben, und Qasem rannte wutschnaubend hinter den Räubern her.
Vom Vorfall unberührt, wandte sich Tuba wieder dem Jungen zu. Er machte keine Anstalten, das Brot zu essen. Tuba kniete wieder hin und beugte sich vor, bis sie dem Kind ins Gesicht sehen konnte. Seine Augen waren offen, der Blick war noch immer starr auf seine Hand gerichtet. Eine Männerstimme sagte: »Er ist tot.« Tuba war fassungslos. Der Mann fügte hinzu, der Kleine sei vor ungefähr zwei Stunden gestorben, man warte auf den Leichenwagen. Und schon kam der Wagen quitschend angefahren.
Tuba hob den Kopf. Der Wagen hielt am Straßenrand an. Ein junger und ein älterer Mann standen links und rechts auf dem Trittbrett. Im Wagen lagen schon mehrere Leichen, seitlich ragten die Beine eines Toten hervor. Der jüngere sprang herunter, ging auf das Kind zu, packte es und trug es zum Wagen. Es hielt noch immer das Brot in der Hand. Er setzte das Kind auf die Ladefläche und versuchte, seinen Körper zu strecken. Die Leiche fügte sich aber seinen starken Händen nicht. Der ältere meinte, er solle sich die Mühe sparen, der jüngere gehorchte wortlos.
Der Wagen fuhr an. Tuba lief hinterher. Durch das Rütteln des Wagens auf der holprigen Straße schwankte das tote Kind hin und her – wie vorhin, als es noch gelebt hatte. Langsam näherten sie sich dem Grabmal des Reinen. Tuba wandte den Blick von dem Kind und betrachtete die neue Umgebung. In der Nähe des Grabmals hielt der Leichenwagen wieder an, um eine Männerleiche aufzuladen, die in einer engen Seitengasse gelegen hatte. Sie wurde auf die anderen Leichen geworfen, und der Oberkörper des Kindes sackte nach rechts. Der jüngere Totengräber, der glaubte, Tuba sei mit dem Kind verwandt, richtete den kleinen Leichnam wieder auf. Sie fuhren nun auf dem Friedhof der Vierzehn Reinen zu einem Massengrab. Außer Tuba gab niemand den Toten das letzte Geleit.
Die Männer legten die Leichen ins Grab, eine nach der anderen. Es war die Zeit der Hungersnot, und man sparte sich die traditionellen Bräuche. Sie versuchten nochmals, das Kind zu strecken, doch der Leichnam sperrte sich dagegen. Der jüngere Totengräber sah verärgert zu Tuba hinüber. Er wollte von ihr wissen, was mit dem Kind anfangen. Tuba aber war wie erstarrt! Als sie nicht reagierte, versuchte der Mann nochmals, den kleinen Körper gewaltsam zu strecken. »Lasst ihn los!« befahl eine schallende, durchdringende Stimme am Rande des Grabes. Tuba und die Leichenträger drehten sich um. Ein Mullah stand auf der anderen Seite des Grabes. Der Mann gab seine Bemühungen auf und legte das Kind in der hockenden Haltung ins Grab.
Sie schaufelten die Grube zu. Das Kind verschwand nach und nach unter der Erde. Tuba stand auf der einen, der Mullah auf der anderen Seite des Massengrabes. Im Licht der untergehenden Frühlingssonne wirkte der Grabhügel dunkel und glatt. Die Totengräber waren mit ihrem Wagen abgezogen. Tuba stand noch immer am selben Fleck. Sie versuchte, an den Tod zu denken, und stellte sich zugleich vor, sie hätte eben ihr eigenes Kind begraben. Der Mullah kniete neben dem Grab nieder, stützte die Hand auf die Erde und sprach ein Gebet.
Er hob den Kopf und forderte die junge Frau auf, ebenfalls zu beten, anstatt um die Toten zu trauern, denn sie seien die Erlösten. Tuba setzte sich gehorsam hin, wusste aber nicht, was sagen. Mit einem Mal hatte sie alle Gebete vergessen. Sie fühlte sich so unbedeutend, so unwissend, als sei sie gerade erst auf die Welt gekommen. Der Mullah sprach von der großen Hungerplage, die die Menschen tötete. Manche führten das Schicksal ins Feld, um die Hungersnot zu erklären. Was sie nicht kannten oder nicht kennen wollten, war die eigentliche Ursache des Hungers. Über Jahrtausende war der Hunger von menschlicher Macht beherrscht und bewältigt worden, weil die Ursache bekannt gewesen war. Nun starben aber die Menschen, weil sie die Ursache nicht mehr kannten.
Der Mullah meinte, Ursache für die Hungersnot sei die geistige, nicht die materielle Armut der Menschen. Tuba hörte ihm zu, während die Dunkelheit ihren schwarzen Schleier über dem Friedhofsgelände ausbreitete.
Als er schwieg, erinnerte sich Tuba bange an den vor ihr liegenden Heimweg. Sie brach wortlos auf und schlug die Richtung ein, die sie für die richtige hielt. Sie ging durch Staub und Kies, ohne den Weg zu kennen, musste immer wieder einen Bogen um Gräber machen. Auf einmal standen zwei Männer vor ihr; sie stanken widerlich nach Alkohol, und der eine schwankte. Er packte Tuba am Arm und versuchte aus seinem unsicheren Stand heraus, ihr den Schleier vom Gesicht zu reißen. Der Zweite zog ihr hinterrücks den Tschador vom Kopf. Dann zog auch der Zweite an Tubas Gesichtsschleier. Sie zerrten an ihrem Haar; Tuba wehrte sich verzweifelt und fiel auf die Knie. Da hörte sie auf einmal die durchdringende Stimme vom Grab her: »Ihr Schurken, ihr Bastarde!« Und dann folgte eine schallende Ohrfeige. Die beiden Männer ließen schleunigst von Tuba ab. Der eine brachte mit zitternder Stimme bloß hervor: »Scheich Khiabani!« Und machte sich taumelnd und so schnell er konnte aus dem Staub. Der Zweite versuchte hastig, Tubas Tschador aufzulesen und ihr wieder umzulegen. Ein Fausthieb Khiabanis traf ihn in den Rücken: »Verschwinde!« Auch er verschwand in der Dunkelheit. Scheich Khiabani wandte Tuba den Rücken zu und bat sie, sich zu verhüllen. Noch ganz benommen schlang Tuba den Tschador um Kopf und Schultern. Sie suchte vergeblich nach ihrem Gesichtsschleier. Khiabani anerbot sich, Tuba nach Hause zu begleiten. Er ging zwei Schritte hinter ihr. Sie wechselten unterwegs kaum ein Wort miteinander. Der Mullah musste allerdings feststellen, dass Tuba den Weg gar nicht kannte.
Qasem stand mit einer Laterne vorn an der Gasse. Als er Tuba kommen sah, schlug er sich mit der linken Hand an den Kopf und murmelte düster, der Hadschi gebärde sich wie ein wütender Löwe und habe ihn geschlagen. Er zeigte ihr die blutende Oberlippe und meinte, sie habe sich ungehörig benommen. In der Mitte der Gasse angelangt, stießen sie auf Sahra, die sich beim Anblick von Tubas unverschleiertem Gesicht mit den Fingernägeln die Wangen wundkratzte. Auch sie schlug sich auf den Kopf und rief: »Gott gib mir den Tod!« Vor der Tür erwartete sie der zornige Hadschi mit einer Rute in der Hand, hasserfüllt blickte er in das entblößte Gesicht seiner Frau, die im schwachen Laternenlicht in ihren staubigen Tschador gewickelt vor ihn trat. Bevor er sich rühren konnte, traf sein Blick den Mullah. Tuba sah, wie in seinen Augen die Wut der Verwunderung wich. Wie einer der zwei Angreifer auf dem Friedhof stieß auch er hervor: »Scheich Khiabani!« Sein Zorn war auf einmal so schnell verflogen wie der letzte Schnee im Frühling. Er nahm eine ehrfürchtige Haltung an; Sahra nutzte die Situation, um Tuba ins Haus zu stoßen. Scheich Khiabani sagte: »Seien Sie unbesorgt, Hadschi, Ihre Frau Tochter war auf dem Friedhof. Da es schon dämmerte, dachte ich, es sei besser, sie nach Hause zu begleiten.«
Sahra hatte sich hinter Tuba ins Haus geschlichen. Sie hörte gerade noch, wie der Hadschi Qasem beauftragte, den Gästeraum für den Empfang von Scheich Khiabani vorzubereiten. Scheich Khiabani nahm die Einladung offenbar an. Tuba atmete auf, denn sie hatte jetzt Zeit, noch einmal gründlich über alles nachzudenken, bevor sie dem Hadschi unter die Augen trat.





























