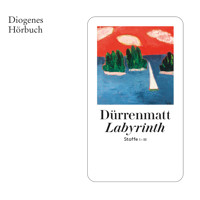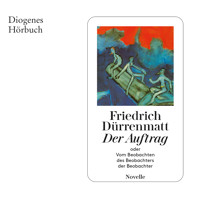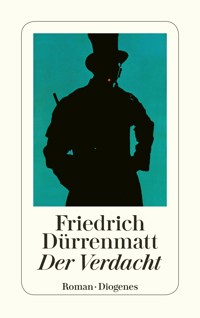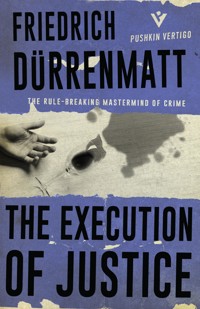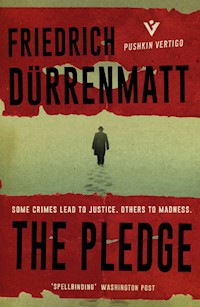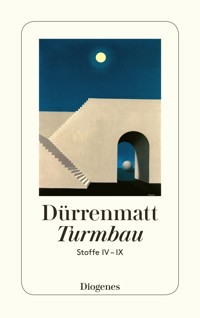
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ›Stoffe‹ spürt der große Dramatiker und Denker der Beziehung zwischen Erleben, Phantasie und Stoff nach, auf der Suche nach einer Dramaturgie der Phantasie. In ›Stoffe‹ mischen sich Dichtung und Wahrheit, Autobiographisches, Politisches, Philosophisches und große Erzählkunst in überwältigender Vielfalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Friedrich Dürrenmatt
Turmbau
Stoffe IV–IX
Begegnungen
Querfahrt
Die Brücke
Das Haus
Vinter
Das Hirn
Diogenes
Turmbau Stoffe IV–IX
[ca. 1964–1990]
Der Versuch, die Geschichte meiner Stoffe zu schreiben, verlangt ein neues Überdenken. Begonnen nach einer Krankheit, in einer Hotelhalle im Unterengadin im Juni 1969, war ich wohl allzu gedankenlos, naiv, allzu voreilig. Den alten Stoffen nachspürend, war das Gefühl nicht zu unterdrücken, allzu vieles vernachlässigt zu haben. Ich strich das Geschriebene durch, fing immer wieder von neuem an. Das ist zwanzig Jahre her, und ich sitze wieder hinter den Stoffen. Fragmente haben sich angehäuft, Entwürfe, aber auch Zweifel. Aus den wenigen Seiten, die in Schuls entstanden sind, ist ein Manuskriptdschungel herangewachsen. Ein Einfall rief einen anderen, eine Erinnerung eine andere und eine Assoziation eine weitere hervor. Der Versuch, die Geschichte meiner ungeschriebenen Stoffe zu schreiben, zwang mich, die Geschichte einiger meiner geschriebenen Stoffe zu rekonstruieren. Indem ich meine alten Fabeln aufgriff, griff ich mich selber auf, allzusehr bin ich mit meinen Stoffen verwoben und in sie eingesponnen. Mein Irrtum, mein Schreiben sei dem gewachsen. Allzu leichtfertig ließ ich mich auf ein Unternehmen ein, dessen Ende nicht abzusehen war. Es ging mir wie mit dem Turmbau zu Babel, den ich einmal plante und begann: ich mußte ihn abbrechen, um mich von ihm zu befreien. Was blieb, sind seine Trümmer.
Begegnungen
Die Vorstellungskraft ist nicht a priori wie unsere Denkformen, sondern ›a posteriori‹. Die Vorstellungskraft benötigt die Erinnerung, um die Gegenwart zu begreifen, ohne Erinnerung an die Vergangenheit wäre die Gegenwart ein sinnloses aus dem Nichts auftauchendes und ins Nichts sinkendes Geschehen. Aber da sich keine Gegenwart mit der Vergangenheit völlig deckt, kommt die Vorstellungskraft ohne die Fähigkeit, Assoziationen zwischen Ähnlichkeiten zu bilden, nicht aus, ohne diese Fähigkeit fände sie sich in der Gegenwart nicht zurecht und auch ohne Logik nicht, die erst die Kontinuität der Zeit durch die Verknüpfung von Ursache und Wirkung schafft. Sind die Erinnerung, die Assoziation und die Logik gleichsam die Werkzeuge, womit die Vorstellungskraft arbeitet, so ist keines dieser Werkzeuge ohne Vorstellungskraft möglich. Sie sind der Vorstellungskraft immanent. Die Erinnerung, die von der Vorstellungskraft in die Gegenwart geschwemmt wird, ist eine von der Vorstellungskraft umgestaltete Vergangenheit, und nicht nur sie: Die Vorstellungskraft erhält in uns zwar durch ihre immanente Logik die Kontinuität des Erlebens, aber ergreift auch das Mögliche, so sehr, daß oft das Mögliche das Wirklich-Gewesene verdrängt. Ob etwas nur möglich gewesen wäre, ist manchmal in der Erinnerung wichtiger als das, was wirklich war, so daß allzu leicht das in der Vergangenheit Mögliche mit dem, was wirklich war, verwechselt wird. Nicht nur die Ideologie verfälscht die Geschichte, noch mehr die Vorstellungskraft. Ist die Erinnerung das Fundament, so ist die Möglichkeit das Tummelfeld der Vorstellungskraft. Ihre Lust, sich auszutoben, siegt über die Last, genau zu sein. Da aber die Vorstellungskraft nicht nur rückwärts, nach der Vergangenheit, ausgerichtet ist, also der Erinnerung zugehört, sondern ihre noch größere Macht der Zukunft gegenüber entfaltet, und weil diese als das noch nicht Wirkliche nichts als reine Möglichkeit ist und das Mögliche sowohl alles Erwünschte als auch alles Unerwünschte bedeuten kann, gerät die Vorstellungskraft allzu leicht in Widerspruch zu sich selbst, Hoffnung und Furcht sind gleich stark, und es kommt zu einem Stopp, weshalb auch dasjenige, was uns in der Zukunft allein gewiß ist, der Tod, so wenig in unserem Bewußtsein eine Rolle spielt. Dabei sind wir wie keine Zeit vor uns mit den Toten konfrontiert, mit ihren Gespenstern eigentlich: die alten Filme zum Beispiel, die im Fernsehen gezeigt werden, sind voll von Toten. Oft erschrecke ich, wenn ich Schauspieler sehe, die in meinen Stücken gespielt haben und schon lange gestorben sind, und kommen Massenszenen in den Filmen vor, denke ich, wer lebt wohl noch von denen? Chaplin taucht immer wieder aus dem Nichts auf, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Clark Gable, wie oft steigen sie aus dem Totenreich, wir sind an Gespenster gewöhnt. Aber auch an jene der Politiker. Immer wieder schreit und fuchtelt Hitler, macht Churchill sein V-Zeichen, schaut Stalin auf die defilierenden Massen hinunter. Wir verdrängen den Tod. Wir leben, als ob wir unsterblich wären, obgleich wir ihm immer wieder begegnen.
Sein Verhalten war wie immer gewesen, es fiel meiner Frau und mir nichts auf, wir feierten unseren einunddreißigsten Hochzeitstag, und es wurde spät, ein Freund aus Deutschland war gekommen, er diskutierte über Politik, und ich hing meinen Gedanken nach, draußen in der milden Oktobernacht liefen die beiden Tiere umher oder lagen, der alte Schäferhund, nun schon schwerfällig geworden, und die junge, elfmonatige Hündin. Nur einmal kam der Hund herein und erbrach Wasser, nicht viel, meine Frau wischte den Steinboden auf, sagte »aber, aber, was machst du denn«, wir machten uns keine weiteren Gedanken, schlossen die Schiebetür zur Terrasse, ich beteiligte mich nun auch an der Diskussion, öffnete eine neue Flasche Wein. Später hörte ich ein- oder zweimal die Hündin kurz winseln, dann war es wieder ruhig, und als der Gast sich verabschiedet hatte und wir in der Morgendämmerung ins Wohnhaus hinübergingen und in die Schlafzimmer hinauf, bemerkte ich, daß im Treppenhaus nur die Hündin auf ihrem Lager war. Ich ging zur Küche hinunter und in den Garten, dann die Straße hinab, auch hier war er nicht zu finden, ich stieg zu meinem Atelier hinauf, in mein Arbeitszimmer, wieder ins Gartenhaus hinunter, wo wir die Nacht verplaudert hatten, nichts, durchsuchte den ganzen Garten, bis ich, wie zufällig, zwischen den Blättern eines Strauches neben der Terrasse etwas Helles sah. Der Hund hatte sich eine Grube gegraben und lag tot darin, er hatte sich selbst verscharrt. Ich meldete es meiner Frau, die schon im Bett lag. Sie erhob sich, trat in einem Hausmantel in den grauhellen Morgen hinaus, ich folgte ihr. Am Himmel waren noch einige helle Sterne zu sehen, über dem See lagerte ein weißes Nebelband. Meine Frau kniete zum Hund nieder. Sie deckte ihn mit einer dunkelgrünen Decke zu, wie aus Furcht, er könnte frieren. Er hatte sie immer besonders treu bewacht; wenn ich eine Nacht durchschrieb, hatte er sich vor ihrem Bett hingelagert, betrat ich gegen Morgen mein Schlafzimmer, sah ich ihn durch die Tapetentür sich erheben, worauf er zu mir herüberkam, um durch meine Schlafzimmertür zu seinem Lager zu trotten, war er doch ein selten mächtiger Schäferhund und nur in den letzten Jahren schwerfällig geworden. Ich telefonierte Hans Liechti, dem Wirt des ›Rocher‹, in einer Viertelstunde war er bei uns. Meine Frau erhob sich, nahm die Decke weg, inzwischen war der Nebel vom See den Berg hinaufgestiegen, der Morgen zurück ins Graue verschwommen und wieder zugedämmert. Liechti trug den schweren Kadaver die Treppen hinauf. Wir legten ihn in den Kofferraum und fuhren in einen Morgen hinein, der sich, je höher wir kamen, aufgoldete. Ich fuhr, neben mir Liechti, schweigend, massig, würdig. In Montmollin, einem kleinen Juradörfchen, brach die Sonne durch. Wir hatten Mühe, die Abdeckerei zu finden. Es dauerte eine Weile, bis uns jemand entgegenkam, den wir fragen konnten. Endlich ahnten wir vage den Weg. Wir gelangten auf eine Hochebene, dahinter erhob sich ein düsterer bewaldeter Bergrücken. Bei einem einsamen Bahnwärterhäuschen mußten wir wieder fragen, fuhren dann gegen den Wald, an dessen Rand wir die Abdeckerei fanden, halb Fabrikanlage, halb Schuppen, mit einer großen Rampe. Die Sonne schien grell, alles wirkte wie eine überbeleuchtete Bühne, der Wald wie eine Kulisse. Wir hupten, liefen um die Anlage. Endlich hinkte ein Mann herbei, verschlafen, mürrisch, ohne daß wir wußten, woher er eigentlich gekommen war. Wir bringen einen Hund, sagten wir. Er wies stumm auf die Rampe, hinkte wieder davon, verschwand irgendwo. Liechti öffnete den Kofferraum und hob den Hund auf die Rampe. Nun lag er da, ein großes schwarzes Tier, die Unterseite des Körpers und jene der Rute weiß, die Läufe ocker, die zwei Flecken auf der Stirn und beidseits der Schnauze von der gleichen Farbe. Der Hund lag da, wie er oft im Schlafe gelegen hatte, aber etwas fehlte und machte den Anblick schrecklich. Ein maßloses Staunen drang in mich herein, einen Augenblick lang, der ewig zu währen schien, einen Todesaugenblick lang eben – auch bei weit erhabeneren Augenblicken, beim Anblick meiner toten Eltern etwa, hatte ich dieses Gefühl nicht, dieses plötzliche Aufheben der Zeit –, auch weiß ich nicht, warum sich dieses Gefühl gerade in dieser trostlosen Abdeckerei einstellte und seitdem nicht mehr, auch beim Anblick des toten Varlin nicht, drei Wochen später. Wir saßen bei seiner Frau in der Küche. Irgendwo im Haus winselte sein Hund. Ein Arzt führte mich ins Sterbezimmer. Er lag im Sarg. Der Arzt riß das Laken herunter. Ein wilder Kopf starrte mich an, der Mund weit geöffnet, die Augen in dunklen Höhlen versunken. Es war, als würde das Leben, erstarrt im Jetzt des Todes, die Schöpfung auslachen. Dann zwängte sich etwas durch meine Beine, verschwand im Dunkel des Raumes, es war sein Hund. Vielleicht habe ich darum eine Woche später im ›Rocher‹ bis tief in die Nacht hinein aus dem Gedächtnis eine Zeichnung um die andere von dieser unbändigen Leiche entworfen und die letzte mit Kaffee bemalt. Ich spürte, daß sich in meiner Erinnerung zwischen sie und mich der Hund auf der Rampe der Abdeckerei schob als Sinnbild des Todes selbst, und nun bewacht er meine tote Frau, war er doch ihr Hund. Ich war durch die Tapetentür in ihr Zimmer gegangen, weil ich dachte, sie schliefe – ich hatte sie eben noch ruhig atmen hören –, und ich wollte die Kerze löschen, die sie hatte brennen lassen. Ich fand meine Frau halb auf dem Bett sitzend, zur Seite gesunken, die Augen geschlossen und das Gesicht friedlich. Ich war nicht beunruhigt. Ich dachte an eine Ohnmacht, ich hatte sie oft so vorgefunden. Ihr Blutdruck war niedrig, und hin und wieder hatte sie Anfälle von Unterzucker, und nun hatte sie eine heftige Grippe gehabt, noch vorgestern über neununddreißig Grad Fieber, während ich mit dem Direktor und zwei Dramaturgen des Schauspielhauses über Achterloo verhandelte. Ich bettete ihre Beine hoch, den Kopf tief, massierte sie, rief meinen Arzt in Bern an, der mir Ratschläge gab, massierte sie wieder, schlug ihr auf die Wangen, ihr Leib war heiß, und auch, als ich einem Arzt in Neuchâtel telefonierte, und als er kam, war ich nicht sonderlich beunruhigt. »Regardez, docteur«, sagte ich zu ihm, »elle est comme morte.« »Elle n’est pas comme morte«, antwortete er nach einem kurzen Blick auf meine Frau, »elle est morte.« Dann untersuchte er sie gründlich. Ich lief im Schlafzimmer herum und glaubte es nicht. Der Arzt blieb ruhig, bedauerte, den Tod feststellen zu müssen. Wir gingen ins Nebenzimmer, der Arzt hatte noch einige Fragen, füllte ein Formular aus, blätterte in einem Heft, das er mitgebracht hatte, sagte, er suche nach der amtlichen Bezeichnung, nach dem Namen des Todes – auch Tode haben ihre Namen –, und als der Arzt gegangen war, rief ich noch einige Male meinen Arzt in Bern an, ob meine Frau nicht scheintot sei. Ich berührte sie immer wieder. Sie wurde kälter, doch nie so kalt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber entsetzt war ich nicht. Was sich ereignet hatte, hatte sich zwischen zwei Menschen ereignet. Bei aller natürlichen Trauer war es mir, als hätte mich meine Frau ärgern wollen, als hätte sie mir einen Streich gespielt, der gegen ihre Absicht zu weit gegangen war. Dann wieder bewunderte ich sie, weil sie so schmerzlos sterben konnte, einen »Sekundentod«, wie mir der Arzt erklärt hatte. Nicht daß der Schrecken fehlte, besonders am anderen Tag, mitten im Januar, eine strahlende Sonne gegen Mittag, als man meine Frau in den Sarg legte, als ihre Arme erstarrt in der Luft steckenblieben. Man mußte sie in den Sarg zwängen. Zum Begreifen, daß meine Frau tot war, kam Groteskes: Die beiden Männer des Beerdigungsinstituts, ein großer Dicker und ein kleiner Magerer, waren wie einer Filmklamotte entsprungen, ich mußte an ›Dick und Doof‹ denken. Sie bemühten sich, den Sarg das Treppenhaus hinunterzuschaffen, bald stand er auf dem Kopf, bald auf den Füßen, aber all das gehörte zur grausamen Welt zwischen den Menschen. Was auch geschah, war ohne Bitternis, ein Leben war zu Ende, und die Tote reihte sich dorthin ein, wohinein sich der, der zurückblieb, auch einmal reihen würde. Eine Ordnung vollzog sich. Doch nur scheinbar. Von außen. Von innen: Ich bewegte mich im Unwirklichen. Ich kam von der Vorstellung nicht los, meine Frau würde sich mit Lichtgeschwindigkeit von mir entfernen, jede Sekunde dreihunderttausend Kilometer, achtzehn Millionen Kilometer jede Minute, mehr als tausend Millionen jede Stunde, aber nicht nur von mir entfernte sie sich, auch ich entfernte mich von mir selber, wir sanken beide dahin in einem lichtschnellen Fall, stürzten gemeinsam in die Erinnerung hinab, und dann war es wieder ich, der sich entfernte, vom Zeitsturm weggeschleudert. Ich raste der Zukunft entgegen, statt daß sie auf mich zuraste. Was zurückblieb, war kristallisierte Erinnerung: eine Frau und ein Mann, die sich einmal geliebt hatten und die nun Vergangenheit waren. Doch bin ich schon längst ins Nichtdarstellbare abgedriftet, Gefühle lassen sich nicht beschreiben, der Tod ist nur von außen darstellbar und stellt sich nur von außen dar, sei es als ferne ausgefranste nelkenähnliche Wolke, im Sternbild des Stiers, der Überrest einer Sonne, sei es als weiße tonartige Scherben in einem Plastiksack, der Inhalt einer Urne, sei es als ein toter Hund auf der Rampe einer abgelegenen Abdeckerei.
Querfahrt
Im Frühling 1943 kehrte ich verwahrlost und krank von einer Stadt nach einer anderen zurück. Von Zürich nach Bern. Ich verließ eine formlose Ansammlung von Kirchen, Banken, Kultur- und Bildungsstätten, von Zunft-, Waren-, Geschäfts- und Mehrfamilienhäusern, Mietskasernen, klassizistischen und Gründerjahrpalästen, Villen, Gaststätten, Pinten, Abstinentenlokalen des Frauenvereins, Fabriken, Depots, Ateliers, Gewerbebuden, alles wie hingeschüttet um einen schmalen See und die Hügelzüge hinauf, die ihn umgeben. Hochhäuser waren noch verboten, die Massagesalons wagten noch nicht zu inserieren, der Strich war durch die Verdunkelung teils gefördert, teils behindert. Der See mündet in ein Flüßchen. An seinen Ufern finden sich Reste einer Altstadt, deren Bürger ihren Bürgermeister köpften. Im Mittelalter. Jetzt kacken auf sein Denkmal Möwen. Dann treibt das Flüßchen am trostlosen Bahnhof vorbei, vor dessen Haupteingang ein noch mächtigerer Herrscher steht als der geköpfte Bürgermeister, ein heimlicher König der Gründerjahre, Alfred Escher, auch von Möwen bekackt, eine Aktentasche zu Füßen. Er wurde nicht geköpft. Nur Möwen sind gerecht. Hinter dem geschmacklosen Landesmuseum vereinigt sich das Flüßchen mit einem zweiten und verliert sich gemeinsam nach der geschmackbildenden Kunstgewerbeschule in Gegenden, wohin ich damals nie vorgedrungen bin. Ich flüchtete in eine Stadt zurück, aus der ich kaum ein Jahr zuvor geflüchtet war: ein ebenso sinnloses Unternehmen wie jetzt die Rückkehr. Beide glichen den Irrwegen, die eine Ratte in einem künstlichen Labyrinth eines Labors unternimmt: Sie weiß weder, daß sie sich in einem Labyrinth, noch, daß sie sich mit dem Labyrinth in einem Labor befindet. Sie rennt herum, von Irrweg zu Irrweg, ihr Herumirren macht sie rebellisch, ohne daß sie genau weiß, gegen wen sich ihre Rebellion richtet, vielleicht daß sie sich einen Rattengott vorstellt, der sie diesem Labyrinth überlassen hat und den sie nun verdammt: denn es ist für diese Ratte unmöglich, auf die Wirklichkeit zu stoßen, wohinein ihre Rattenwirklichkeit gebettet ist, eine Wirklichkeit, die wiederum Wesen umfaßt, die nicht Ratten sind, sondern Menschen, die sie, diese vereinzelte, im Labyrinth herumhuschende Ratte, beobachten, um irgendwelche für Ratten und Menschen gleicherweise gültigen Gesetze zu finden, so daß, weil diese Menschenwirklichkeit wiederum labyrinthisch ist, sich zwei ineinander geschachtelte Labyrinthe ergeben, ja drei, vier oder noch mehr ineinander geschachtelte Labyrinthe, wenn die Ratten beobachtenden Menschen ebenfalls unter der Beobachtung von Vorgesetzten stehen, die ihrerseits wiederum usw. Nicht umsonst diese Metapher. Meine Eltern waren über die Irrwege ihres Sohnes ratloser denn je, schien ich doch weder eine Zukunft anzustreben, die ihnen einleuchtete, noch überhaupt eine, ich strapazierte ihr Gottvertrauen gewaltig. Ich erholte mich langsam. Ich bezog eine geräumige Mansarde, die zum Mietshaus gehörte, das meine Eltern im Parterre bewohnten, in einer Art Villa. Ich malte später die Mansarde aus, auf der abgeschrägten Wand über meinem Bett eine wilde Kreuzigung, an der großen Wand skurrile Figuren, am Kamin in der Mitte des Raums eine Salome mit dem Kopf Johannes’ des Täufers, an der Decke das Antlitz der Medusa. Das Haus stand an einer breiten verkehrswichtigen Straße, lautlos in der Nacht, weil die Stadt verdunkelt war, nur von ferne manchmal, in mondlosen Nächten, traumartig, über die Alpen herüber, das dumpfe Grollen der Bomben, die auf Mailand fielen. In wenigen Minuten war man auf dem Land: weite Felder, Wälder; einmal, als ich gegen drei Uhr in der Nacht aus dem Fenster schaute, stand mitten auf der vom Vollmond beschienenen Straße ein Reh. Auch hörte ich jede Nacht Schritte vorbeihinken, aber es gelang mir nie, den Hinkenden zu erblicken, wenn ich schrieb oder zeichnete, hinkte er durch mein Schreiben oder Zeichnen, stürzte ich zum Fenster, waren die Jambenschritte schon verhallt. Wenn ich schlief, ging es mir ebenso, das Hinken weckte mich, aber ich kam zu spät, beugte ich mich aus dem Fenster. Für eine Familie aus der Nachbarschaft kam ich zu früh. Sie kletterte, fünfköpfig, Vater, Mutter und drei Kinder, im Pflaumenbaum im Garten hinter der Villa herum, erstarrte, als ich heimkehrte, wie Riesenpflaumen im Baumgeäst im Morgengrauen. Ich störte sie ebensowenig wie den Vagabunden, der auf dem Kanapee in unserer offenen Veranda zu übernachten pflegte. Nur das erste Mal flüchtete er, als ich ihn in der Frühe überraschte, später winkte er mir nur zu und blieb liegen. Ich war gern in diesem Haus. Vieles erinnerte mich ans Dorf, nicht nur die Nähe der Wälder, auch der Gemüseladen schräg gegenüber, dessen Inhaber einen ebenso handlosen Arm besaß, womit er die Salatköpfe auseinanderschob, wie der Gemüsemann unseres Dorfes.
Im Herbst fuhr ich ins Wallis. Ich wollte die Komödie beenden, an der ich in Zürich herumgeschrieben hatte, an einem wilden Durcheinander von lebenden Toten und toten Lebenden, mit einer funktionierenden Weltuntergangsmaschine am Schluß. Ein Riesenknall. Ich richtete mich in einem kleinen Dorf ein, über dem Logis meiner Freundin, die dort mit ihren Eltern in den Ferien weilte. Das Dorf bestand aus kaum zwanzig primitiven Holzhäusern. Es klebte an einem steilen Hange hoch über dem Val d’Hérens. Irgendwo unterhalb des Dorfes, im Wald versteckt, jenseits einer Schlucht, tief gegen Evolène hin, eine Kapelle. Vom Dorf aus schien die weitverzweigte Gebirgsgegend mit einigen kleinen pyramidenähnlichen Bergen in der Talsohle und den Nebentälern, die sich zwischen den Massiven verliefen, eine Mondlandschaft zu sein. Tagsüber war das Dorf still. Kaum daß ich jemanden sah: eine alte schwarzgekleidete Frau, einen Mann, der mich schweigend betrachtete, ein davonhuschendes Kind. In der Nacht herrschte ein geheimnisvolles Treiben: Lastwagen kamen und gingen. Im Land waren die Lebensmittel kontingentiert. Schwarzhandel rentierte. Ich kümmerte mich nicht darum. Ich schrieb verbissen, entschlossen, mit dem Stoff Schluß zu machen, ihn aus meinen Gedanken herauszuoperieren. Ich verknappte die Sprache, strich die Szenen zusammen, schrieb neue mit bösen Liedern, verwarf das Geschriebene wieder, begann von neuem. Ich habe seither nie anders gearbeitet.
Ich schrieb nachts, es ist auch heute noch meine beste Zeit. Tagsüber, wenn wir nicht nach Evolène hinunterstiegen, las ich in dieser kargen, trockenen, in meiner Erinnerung braunen, unatmosphärischen und unbarmherzigen Landschaft, wo es immer noch heiß wie im Hochsommer war, die dschungelhaften Bücher Jean Pauls, herausgegeben von der Deutschen National Literatur, solide Bände, die ich in der Stadtbibliothek von Sion aufgestöbert und mitgeschleppt hatte. Ich las bald trotzig, bald wütend, unvermittelt, dann tagelang nicht mehr, erschöpft vom Verfasser, kam wieder ein Stück weiter, war begeistert oder wollte begeistert sein – man betrügt sich leicht selber –, fand bedeutende Stellen, dann verlor sich die Handlung aufs neue in einem Gestrüpp eigenartiger Käuze und unübersichtlicher Nebenhandlungen. Noch fand ich mich zurecht, versuchte zäh, die Übersicht zu behalten, doch ein Unterbruch der Lektüre – und ich war verloren. Je weiter ich vordrang, desto unübersichtlicher wurde sie. Ich schlug mich mit Jean Pauls Einfällen und Ausfällen herum wie mit Wolken von Fliegen. Dazu eine verschlungene Sprache voller Anspielungen, die ich oft nicht verstand, ferner Bemerkungen über Anspielungen, die ich nicht verstanden hatte. Lesen wurde zur Geheimwissenschaft, im Fremdwörterbuch hätte nachgeschlagen werden müssen, es war keines vorhanden, ich kam mir ungebildet vor; dann stieß ich wieder auf Sätze, die mich begeisterten. Mir ging auf, daß ich an einen der größten Schriftsteller unserer Sprache geraten war, an ein Genie, warum nicht. Aber seine Käuze und die Städtchen, Nester, Kaffs und Kleinresidenzen, wo sich seine Handlungen abspielen, sind nicht dargestellt, sondern kommentiert. Die Einfälle jagen sich, doch mit den Einfällen die Kommentare, und da die Helden und Heldinnen sich selber kommentieren und sich handeln lassen statt zu handeln, wird das Kommentierte wiederum kommentiert, und so, ad infinitum, decken schließlich die Kommentare alles zu. Doch mehr als der Titan beeindruckte mich Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel. Die Handlung ist nachträglich kaum mehr zu rekonstruieren, schon die Namen bereiten Schwierigkeiten. Die Menschen können bei Jean Paul nicht Meier, Müller oder Blaser, auch nicht Strauß, Kohl oder Schmidt heißen: Der Armenadvokat Firmian Stanislaus Siebenkäs ist mit einer Wendeline Lenette Egelkraut verheiratet. Siebenkäs hat einen Freund, von dem er nicht zu unterscheiden ist, Heinrich Leibgeber (das genügt Jean Paul nicht, er näht immer doppelt, auch bei Doppelgängern: Siebenkäs heißt eigentlich Leibgeber, Leibgeber Siebenkäs). Außerdem kommen eine Nathalie und ein Everard Rosa von Meyern vor (also doch beinahe ein Meier), ein Studienrat Stiefel, ein Obersanitätsrat Oelhafen, der Frühprediger Reuel und der Fürst von Liechtenstein. Die Ehe des Armenadvokaten ist unglücklich, eine verworrene Erbschaftsangelegenheit spielt hinein, macht eine Reise nach Bayreuth notwendig, damals noch ohne Wagner, dafür mit einer jener langweiligen Geliebten, wie sie nur die deutsche Literatur zustande bringt. Jean Paul selber mischt sich ein: indem Siebenkäs als Verfasser der ›Papiere des Teufels‹ gefeiert wird, die wiederum von Jean Paul stammen; endlich das für mich Entscheidende, Wichtige: die Parodie des Todes und der Auferstehung. Siebenkäs inszeniert mit Hilfe seines Doppelgängers sein eigenes Sterben, stiehlt sich nachts aus dem Haus, während sein Freund den Sarg mit Steinen füllt, zunagelt und beerdigen läßt. Ein Jahr später kehrt Siebenkäs als Leibgeber zurück, findet das Grab seiner Frau, nun Wendeline Lenette Reuel, und an seinem Grab seine Geliebte, die den Auferstandenen erkennt. Alles gerät ins Zweideutige, die Reden bekommen einen doppelten Sinn: Blasphemisches vermischt sich in meiner Erinnerung mit Groteskem, Sentimentalität mit Brutalität, Unwirkliches mit Möglichem, und Striche wären nötig. Eine Prosa, die man nur einmal lesen kann, zum ersten Mal. Doch nicht nur bei Jean Paul. Ob nun Richard III. Lady Ann seine Liebe gesteht, ob Stubb im Moby Dick in das Innere eines verwesten, dahintreibenden Pottwals steigt, Ambra zu gewinnen, ob der norwegische Seemann mit seinem Schiff in den Wirbel des Mahlstroms gesogen wird, ob Reimboderl in Nestroys Robert der Teuxel sich schlagartig von einem Menschen von besonderer Gutmütigkeit in ein Ungeheuer verwandelt, oder was uns auch immer beim Lesen oder Sehen unmittelbar begeistert, erweist sich am stärksten in der Erinnerung, weil es sich in ihr potenziert und zu etwas Subjektivem wird, zu mehr als Text, zu etwas, das wir darum auch im Text nicht mehr wiederfinden, das uns enttäuscht, wenn wir es wiederlesen oder wieder auf der Szene sehen, wie eine zu oft gehörte Symphonie: Auch finde ich immer wieder, lese ich doch noch einmal, sei es aus Laune oder aus schlechtem Gewissen, in meiner alten Jean-Paul-Ausgabe, im Genist seiner Prosa Motive, von denen ich glaubte, ich hätte sie vor Zeiten einmal gefunden. Es ist, als hätte der große Hexenmeister sie mir untergeschoben. Die Literaturgeschichte hat, nachträglich gesehen, etwas Kontinuierliches, und nicht nur sie. Jede Geschichte. Das Neue scheint sich aus dem Alten zu entwickeln, um selber alt zu werden und Neues hervorzubringen. Die Geschichte verlockt, hinter ihr Gesetze zu vermuten. So entwickelt man denn auch in der Literaturgeschichte einen Schriftsteller aus einem anderen, entweder als Nachfolger oder als Gegensatz; von den dogmatischen Kriterien ganz zu schweigen. Doch die Literatur vermag auf einen Schriftsteller nur einzuwirken, wenn sie in ihm Assoziationen auf seine existentielle Problematik auslöst. Jean Pauls Auferstehungsparodie im Siebenkäs erinnerte mich an Lazarus, der in seiner Gruft mit »einem Stein darauf« schon »stinkt«, der herauskommt, »gebunden mit Grabtüchern an den Füßen und Händen, und sein Antlitz verhüllet mit einem Schweißtuch«, dieses Wunder des Jesus von Nazareth, der dabei immer wieder »im Geiste ergrimmte und sich selbst betrübte« mit seinem schnöden Ende: »Bindet ihn auf und lasset ihn gehen« samt der darauf folgenden Groteske: »Aber die Hohepriester trachteten danach, daß sie auch Lazarus töteten«, und ich hatte mir vorgestellt, die Hohepriester würden Lazarus immer wieder töten, und Jesus müßte ihn immer wieder erwecken, ich sah den armen Lazarus nach der zwanzigsten, dreißigsten Wiedererweckung jammernd aus dem Grabe kommen: »Mein Gott, jetzt lebe ich wieder.« Wie auch immer, gleichgültig in welcher Form (es gab eine Kinderbibel, illustriert von Cornelius) ich von dieser Auferstehung erfahren habe, sie beschäftigte mich schon früh, fragte ich doch meinen Vater, als ich im Dorf einen Nachbarn aufgebahrt gesehen hatte, ob denn der auferstandene Lazarus hätte glauben können, daß er tot gewesen sei. Ich weiß nicht mehr recht, was er antwortete, aber ich spürte, daß die Frage ihn verlegen machte. Ich stellte sie ihm auch später, als wir in die Stadt gezogen waren. Vielleicht weil ihn die Frage störte. Söhne sind grausam. Wie aber Jean Paul zu seinem Motiv gekommen ist, kann kaum rekonstruiert werden. Er war weniger ein Erfinder als ein Finder, ein unermüdlicher Leser und Exzerpierer. Er füllte Folianten mit Zitaten und gelesenen Einfällen, er plünderte alles aus, Literatur, Theologie, Philosophie, Wissenschaft. Hinter seiner Parodie des Todes und der Auferstehung mag eine durch die Handlung erzwungene Lösung oder irgend etwas irgendwo Gelesenes und Notiertes stehen, alles Geschriebene ist für Jean Paul nur Material zum Schreiben, das er sich aneignet, indem er es ausgräbt.
Nicht umsonst erinnert mich Jean Paul an die Ruinenstädte Yukatans. Ich kraxelte auf einem Mayatempel herum und blickte über eine Buschlandschaft kleiner Hügel, zwischen ihnen eine ›umgekehrte Baustelle‹: Nicht eine Pyramide oder ein Observatorium wurde errichtet, sondern von Archäologen freigelegt, denn jeder dieser Hügel war eine vom Buschteppich überwucherte Ruine. Es kam mir vor wie ein Film, den man rückwärts laufen läßt, wie etwa der Film, den man von der Sprengung des Basler Stadttheaters drehte, es wurde von der Explosion hochgerissen, zerbrach, löste sich in eine Steinwolke auf, die niederprasselte, sich auflöste, wieder zusammensetzte, aufprasselte, eine Steinwolke formte, zusammensetzte, niedersetzte: So schien mir in Yukatan die Zeit ab- und zurückzuspulen. Die Mayas waren vom Tiefland von Honduras aus nach Guatemala und Yukatan vorgedrungen, hatten Stadt um Stadt gebaut, unbekümmert darum, daß der Dschungel, kaum gerodet, die Städte wieder überwucherte. Die Mayas wanderten weiter, bauten neue Städte, ließen sie wieder überwuchern, die Spanier landeten, wurden festlich empfangen, die Konquistadoren metzelten die Gastgeber nieder, der Dschungel und das Buschgenist deckten die ausgeplünderten und niedergebrannten Städte zu, die Mayas, die sich gerettet hatten, durch Zufall oder weil sie als Sklaven gebraucht wurden, dämmerten dahin, kleine verlumpte mongolische Menschen, ihrer Vergangenheit und ihres Sinns beraubt, während die Kathedralen ihrer Eroberer zerfielen, und nach Jahrhunderten werden jetzt die Städte wieder vom Wurzelgeflecht befreit, schälen sich aus dem Dorngestrüpp. Überfiel mich beim Anblick der emsig rodenden Archäologen zuerst das Gefühl, es wäre schön mitzuhelfen, anzupacken, sich durch das Genist der Zeit zurückzuroden, so lähmte mich der Gedanke an die Sinnlosigkeit der Geschichte, es sei denn, man sehe ihren Sinn darin, Ruinen zu hinterlassen. Ich gab auf, wie ich die Lektüre Jean Pauls aufgegeben hatte. Ich kletterte die Ruinen hinab, an einer bizarren Mayaplastik vorbei, die sich plötzlich bewegte. Es war ein Leguan.
Als ich nach mehr als fünfzig Jahren C. das Wallis zeigte, fand ich das Val d’Hérens meiner Erinnerung nicht mehr. C. fuhr mich Weinberge hinauf. Tief unten lag das Rhonetal, das Val d’Hérens verengte sich, fast senkrecht fiel es von der Straße hinunter, Hunderte von Metern, als befänden wir uns in einer schattigen engen Schlucht, dann weitete es sich, tief unten der Talgrund, doch stellte sich der Eindruck des Mondartigen nicht ein. Überall Ferienhäuser, auch im Dorf, wo ich Jean Paul gelesen hatte. C. parkte den Wagen, und wir tauchten ins Gold der Lärchenwälder. Bleibt nur das Unbewältigte in der Erinnerung zurück? Vom Val d’Hérens, das sich gleichsam zu etwas schemenhaft Unbarmherzigem zusammenkochte, Jean Paul. Immer wieder beschäftige ich mich mit ihm. Immer wieder lege ich ihn beiseite. Begeistert und verärgert, daß ich wieder an ihm scheitere, und ich schreibe immer noch an den Stoffen, die ich begann, bevor ich 1969 nach Yukatan flog. Und der Leguan? Starrte ich mich nicht selber an, als ich ihn erblickte? Und ist es mir nicht, wenn ich zurückdenke, als sehe ich in einen Spiegel, worin Jean Paul mich beschreibt? Wie hießen die Menschen, die ich damals schrieb? Vogeltritt, Tretebalg, Letzermann, der Lustmörder Nabelpfiff und Doktor Zwölf. Und einer stellte sich vor: »Ich heiße Nacht. Schauen Sie in mein Gesicht.« Er nimmt seine Nase ab und stellt sie vor sich auf den Tisch. »Ha ha! Sind Sie erschrocken, haben Sie eine lustige Grimasse gemacht.«
Stoffe brauchen Zeit und suchen ihren Ort, wo sie zum ersten Mal auftauchen, konzipiert werden. Lazarus, von Jean Paul wiederum aus dem Grabe beschworen, blieb in meiner Phantasie, weste in ihr, weigerte sich zurückzusteigen. 1959 wurde ich ins ›Waldhaus Vulpera‹ im Unterengadin verschlagen. Der Kurarzt versuchte das für mich geeignete Insulin zu finden. Mein Tes-Tape-Streifen wurde grün, wann ich ihn auch bepinkelte, wie streng ich auch Diät hielt, wie hartnäckig ich auch herumlief, stets den gleichen Weg: in eine kleine Schlucht hinein, dann über einen Steg zur rechten Seite der Schlucht, ihr entlang, und dort, wo die Schlucht zum Tal wurde, über eine Holzbrücke zur linken Talseite zurück, diese hoch und über den Berg steil den Wald wieder zum Kurhaus hinunter. Alles war vergeblich, und ich fühle noch immer die Wut hochsteigen, wenn ich im Wald den grün gewordenen Tes-Tape-Streifen ins Unterholz warf, eine Wut, von der ich weiß, daß sie sinnlos ist, weil sie ohnmächtig ist, und die mich gerade deshalb von Zeit zu Zeit überfällt und überfiel wie damals und schon oft vorher: Der Tod hat für mich ein grünes Gesicht. Auf diesen sich ständig wiederholenden Spaziergängen, bei denen ich mehr lief als ging, fielen mir Die Physiker und Der Meteor ein, wobei ich nicht zu sagen wüßte, welcher der beiden Stoffe mir zuerst einfiel, doch erscheint es mir wahrscheinlicher, daß es der Nobelpreisträger war, der neue Lazarus, der immer wieder stirbt und immer wieder aufersteht und der doch nicht an das Wunder zu glauben vermag, das sich an ihm ereignet, der in seiner Todesraserei alle vernichtet, die in sein Sterben geraten: »Wann krepiere ich denn endlich!« Warum mir Die Physiker auch noch einfielen, vermag ich nicht zu sagen, es sei denn, mein grüner Tes-Tape-Streifen erinnerte mich an das Orakel, das Ödipus, von Korinth kommend, in Delphi so verwirrte, daß er nach Theben und in sein Schicksal flüchtete, indem er Laios erschlug und Iokaste heiratete, statt sich vorzunehmen, nie einen Mann zu töten, der sein Vater, und nie eine Frau zu heiraten, die seine Mutter sein könnte. Aber Ödipus kehrte nicht mehr nach Korinth zurück, obgleich er nach Delphi zur Pythia gekommen war, weil er zweifelte, daß in Korinth König Polybos und Periboia seine Eltern wären, doch auf einmal zweifelte er nicht mehr: Sein Schicksal war seine Kopflosigkeit. Möbius in den Physikern weiß wie Ödipus sein Schicksal nicht durch ein Orakel, sondern weil er sich als Wissenschaftler denken kann, was ihm droht. Wie Ödipus will auch Möbius seinem Schicksal entgehen, die Ausnutzung seiner Forschung durch die Technik, er flüchtet wie Ödipus, wie dieser wählt er den falschen Weg, er flüchtet ins falsche Irrenhaus, die verrückte Irrenärztin hält ihn für normal statt verrückt und nützt seine Entdeckungen aus. Wem der TesTape-Streifen grün wird, weiß sein Schicksal auch, und weil ich es wußte, war ich nun in Vulpera und lief immer in die gleiche Schlucht hinein und den gleichen Berg hinauf und hinunter. Zwei Jahre später schrieb ich Die Physiker, fünf Jahre später den Meteor. Ich begann, hielt inne. Ich war wieder einmal unsicher. Herkules und der Stall des Augias, eines meiner Lieblingsstücke, war kein Erfolg gewesen. Ich sehe immer noch Steckel, den Regisseur, die junge Schauspielerin, welche die Iole spielte, endlos mit ihrem Monolog über die Bühne hetzen: Hopp! Hopp! Es machte sie immer unsicherer. Ein Schriftsteller kam mit seiner Frau nach Neuchâtel zu Besuch. Ich war schon entschlossen, den Meteor aufzugeben. Das Ehepaar war zerstritten. Er erzählte sein neues Stück, das vom Schauspielhaus schon angenommen worden war. Seine Frau war dagegen. Ich ging in der Bibliothek auf und ab, hörte zu und wunderte mich, daß vom Schauspielhaus ein solches Stück angenommen worden war und gespielt werden würde und sagte plötzlich: »Jetzt schreibe ich ihn doch.« Womit ich den Meteor meinte, was das Ehepaar nicht begriff, da es nichts vom Meteor wußte. Steckel spielte ihn dann. Grandios. Sein ›Hopp‹ hatte ich ins Stück hineingenommen. Doch Der Meteor und Die Physiker sind nicht die einzigen Stoffe, die mir im ›Waldhaus Vulpera‹ einfielen. Schon drei Jahre vor meiner Kur hatte es mich einmal in dieses gespensterhafte Hotel verschlagen, auf zwei oder drei Tage, zum Filmproduzenten Lazar Wechsler, der in der Hotelhalle hofhielt, ein Mächtiger, der an einer leichten Parkinson litt, die ihn zwang, seinen gewaltigen Schädel schräg und ruhig zu halten, neben ihm, in einem ebenso mächtigen Lehnstuhl ebenso mächtig seine Gattin, alles strömte Macht aus von ihm, er war wie von Sklaven umgeben. Er hatte mich im Frühling in seine Wohnung in der Voltastraße in Zürich gebeten, er müsse mich dringend sprechen. Es war wie ein Befehl gewesen, und ich wußte eigentlich nicht, warum ich ihm Folge leistete, ich wußte, wer er war, mit dem Medium Film hatte ich mich erst einmal beschäftigt, sogar ein Treatment begonnen, es war nichts daraus geworden, der Regisseur vermochte den Film nicht zu finanzieren, aber ich war wieder einmal ausgeschrieben, Der Besuch der alten Dame, Die Panne, Abendstunde im Spätherbst waren kurz nacheinander entstanden. Ich fuhr mit meinem Wagen nach Zürich, um mir die Zeit zu vertreiben, ein Freund begleitete mich, wir bummelten durch eine Frühlingslandschaft, blühende Kirschbäume, ich wich von der gewohnten Route ab, fuhr über Wynigen, Huttwil, Sursee, endlich durch ein großes Dorf, wir übersahen, daß wir damit in eine Sackgasse gerieten, war doch die Straße vom Dorfe gegen Zürich gesperrt. Wir fuhren in einer Wagenkolonne, es war Mittag, an der Straße standen Kinder, ein etwa achtjähriger Knabe rannte mir vors Auto, ich stoppte, auch die Wagen hinter mir, ein Italiener ergriff den Knaben, rannte mit ihm über die Straße ins Haus eines Arztes. Ich stieg aus, die Kinder schrien, »er ist hineingerannt, er ist hineingerannt«, der Fahrer hinter mir, ein Bauer, kam zu mir, sagte, er habe sich noch über mich geärgert, er habe gedacht, ob wohl der durch das Dorf schleichen wolle, ich wartete, alle warteten, »er ist hineingerannt, er ist hineingerannt«, schrien die Kinder immer noch, immer wieder, die Autos vor mir fuhren weiter, ich fuhr mit dem meinen aufs Trottoir, der Bauer hinter mir auch, »er ist hineingerannt, er ist hineingerannt«, schrien die Kinder unentwegt, doch schon weniger geworden, ich ging zum Arzt, Mietshaus, zweiter Stock. Nicht schlimm, sagte der Arzt, aber er lasse das Kind zur Beobachtung ins Spital bringen. Ich kehrte wieder zum Wagen zurück, wann denn endlich die Polizei komme, fragte der Bauer. Die Kinder hatten sich verzogen. Ein Auto hielt, ein Mann stieg aus, besichtigte meinen Wagen, die Straße, wies sich als Fahrlehrer aus. Wann denn die Polizei komme, fragte ich. Der Fahrlehrer zuckte die Achseln. Ob er meinen Wagen fahren dürfe, fragte er, ich nickte. Die Straße war nun fast leer, Mittagsruhe, wir standen verlassen da, der Bauer, mein Freund, der Fahrlehrer, ich, drei Wagen, der Fahrlehrer fuhr mit dem meinen davon. Ein Rettungswagen kam, zwei Sanitäter holten den Knaben ab, ein stilles, ernstes, weißes Gesicht. Der Rettungswagen fuhr wieder davon. Die Szene wirkte immer gespenstischer. Die leere Straße, das leere Dorf, mehr eine Kleinstadt, die Mittagshitze. Der Fahrlehrer brachte meinen Wagen zurück. Das Auto sei in Ordnung, sagte er, nur die rechte Bremse etwas zu hart angezogen, aber das brauche niemand zu wissen. Dann fuhr er wieder davon. Er solle doch auch gehen, sagte ich zum Bauern. Er müsse Zeuge sein, sagte der Bauer, ich sei langsam gefahren. Endlich kam ein Polizist, gegen ein Uhr. Auf einem Velo. Stieg ab. Ein Kind sei mir in den Wagen gerannt, sagte ich, im Spital zur Beobachtung. Das wisse er, sagte der Polizist, er sei informiert, ging zum Bauern, nahm ihn auf die Seite, machte sich Notizen. Der Bauer ging zu seinem Wagen, rief mir zu, alle seien langsam gefahren, kein Mensch könne etwas dafür, fuhr davon. Der Polizist betrachtete die Straße. Warum da keine Bremsspuren seien, fragte er. Ich sei langsam gefahren, sagte ich. Ob ich überhaupt gebremst hätte, wollte er wissen, natürlich, sagte ich, mißtrauisch geworden. Er starrte auf meinen Wagen, ging um ihn herum, untersuchte ihn, starrte mich an. Sie haben keine Beule, sagte er. Ich begriff nicht. Keine Beule vorne, wiederholte er. Nein, sagte ich und schaute hin, ich hab keine Beule. Gestern, sagte der Polizist, sei ihm auch ein Kind ins Auto gerannt. Es sei tot, und er habe vorne eine große Beule. Ich könne von Glück sagen, daß ich keine Beule habe. Ich könne weiterfahren. Ich war die ganze Zeit ruhig gewesen, nun plötzlich, bei diesem seelenruhigen Polizisten, der leicht verärgert über seine Beule sein Fahrrad bestieg und klingelnd um die Ecke bog, kam der Schock, aber ich mußte weiter. Ich bemerkte erst jetzt, daß ich den falschen Weg eingeschlagen hatte. Ich fuhr wieder zum Dorf hinaus und erreichte auf Umwegen Zürich und traf verspätet Wechsler in seiner Wohnung. Er strahlte etwas ungemein Wohltuendes aus, wie ein gnädiger König. Wir saßen uns in seinem großen Wohnzimmer gegenüber, ich in einem Ledersofa dem seinen gegenüber, es war Raum zwischen uns, hin und wieder, fast in gleichmäßigen Zeitabständen, erhob er sich und ging ins Nebenzimmer, offenbar in sein Büro, um in kurzen Abständen wieder zurückzukehren; als ich ihm folgte, in einen Gedankengang vertieft, den ich entwickelte, sah ich in diesem Büro einen Mann hinter einem Schachbrett sitzen, der wie vom Schicksal zusammengefaltet wirkte: Wechsler spielte, während er sich mit mir im Wohnzimmer unterhielt, mit einem alten Freund im Nebenzimmer Schach. Wechsler hatte schon viele Filme produziert, er hatte die PraesensFilm gegründet, ich liebte die Filme nicht, die er produzierte. Es waren schweizerische Alibifilme, und ich war entschlossen, ihm das zu sagen, aber durch den Unfall und durch sein Mitgefühl war ich dazu nicht fähig, so daß ich eigentlich widerwillig seinen Vorschlag annahm, für ihn eine Filmerzählung zu schreiben. Ich machte mich an die Arbeit, doch rechnete Wechsler nicht mit der Zeit, die ich brauchte, und ich nicht mit der Eile, mit der Wechsler vorging. Er glaubte, ich schreibe ein Treatment, ich begann eine Erzählung zu schreiben. Um über ihr Ende wenigstens in Form einer Skizze verfügen zu können, ließ er mich durch seinen Fahrer nach Vulpera holen, wo er zur Kur weilte, hatte Wechsler doch reichlich voreilig alles engagiert, Regisseur und Schauspieler. Ich schrieb eine Nacht durch, während des Arbeitens fiel mir erst ein, wie der Stoff eigentlich zu schreiben wäre, aber Wechsler wollte auf meinen Vorschlag nicht eingehen, aus dem Stoff wurde Das Versprechen,