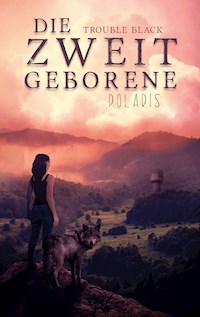7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Welt? Die will mich nicht. Die Dämonen? Noch weniger! Ich bin so verloren wie schon lange nicht mehr. Bis er kam. Thomas. Ich weiß nur eins und das ist, dass ich ihn nicht zerstören will, er ist viel zu gut für diese Welt, doch wie es aussieht, werde ich sein Untergang sein. Der Untergang von allem und jedem, so wie es momentan aussieht. Mein Name ist Lucy Fairchild und ich bin hier, um die Welt zu zerstören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
»Ich habe es geschafft,
ich habe den Zauber gebrochen.«
- Bonnie Bennett
(The Vampire Dairies)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1 : Von Jägern und Toten
Kapitel 2 : Von einer Bewerbung und einem Mädchen
Kapitel 3 : Von Arbeit und gruseligen Männern
Kapitel 4 : Von Dates und Leeren Kühlschränken
Kapitel 5 : Ihr Name ist Tamara
Kapitel 6 : Von Dates und Entführungen
Kapitel 7 : Von einem Wolf und einer komischen Begegnung
Kapitel 8 : Ihr Name ist Aylin
Kapitel 9 : Von Waffen und Drohungen
Kapitel 10 : Von Lilly und Tonka
Kapitel 11 : Von Thomas und Wölfen
Kapitel 12 : Von geplanten Morden und Versprechen
Kapitel 13 : Von einem Biss und einem Blutbad
Kapitel 14 : Von Lucy Fairchild und Tamara Reynolds
Kapitel 15 : Shayne und ein Wolf
Kapitel 16 : Von Büchern und einem eifersüchtigen Wolf
Kapitel 17 : Von Aylin, Nate und Poppy
Kapitel 18 : Von Sekt und einer Kette
Kapitel 19 : Von Sekt, Wein und einem Jäger
Kapitel 20 : Von einer Jacke und einem Schwert
Kapitel 21 : Tamara
Kapitel 22 : Von Wölfen und Höllenhunden
Kapitel 23 : Von Fee und Bienen-Königin
Kapitel 24 : 16 Jahre später
Kapitel 25 : Der Name ist Dovelynn Reynolds
Kapitel 26 : Sein Name ist Henry und nein, wir sind nicht zusammen!
Kapitel 27 : Die Erklärung
Kapitel 28 : Von Blut und Herzen
Kapitel 29 : Lucy
Kapitel 30 : Von Wahrheiten und Tod
Epilog
Prolog
Man hörte nur das leise Klappern von Besteck auf Porzellan und das gelangweilte Tippen meiner Finger auf die dunkle Tischplatte vor mir, wie ich diesen Tisch doch hasste.
Ich schaute zu dem anderen Ende des Tisches, mein Vater löffelte genüsslich seine Suppe. Wie ein König thronte er am anderen Ende des Tisches, ein dunkler, großer, grausamer König. Zufrieden mit der Welt und sich, denn er hatte das bekommen, was er wollte, oder zumindest glaubte er das. Wütend schnaubte ich, wie konnte er nur etwas essen, mir war ja selbst ganz furchtbar schlecht. »Margret, ist alles okay?«, fragte meine Mutter mich lächelnd in dem krampfhaften Versuch, ihre kleine, perfekte Welt aufrecht zu erhalten. Ich schnaubte erneut, das Schnauben klang viel zu laut in der bedrückenden Stille des Raumes, natürlich war nicht alles okay, nicht nach all dem, was mein Vater mit mir vorhatte. Nicht nachdem, wie sie mich über Jahre behandelt hatten. Wie sie mich jetzt immer noch behandelten!
»Ist das dein Ernst? Ihr wollt mich zwangsverheiraten, nur weil ich schwanger bin. Von einem One-Night-Stand?«, schrie, nein brüllte, ich wütend, ich war aufgestanden, da ich keine weitere Sekunde an diesem Tisch in dieser Stille verbringen konnte. Verbringen wollte. Allein schon der Gedanke, mit diesen Menschen, nein Monstern, auch nur noch eine Sekunde länger verbringen zu müssen, schmerzte mich. Ich musterte meine Eltern angewidert, Robert und Luisa Fairchild waren eindeutig verrückt. Einfach und unwiederbringlich verrückt!
Nicht einmal der Teufel könnte die beiden und ihr Verhalten gutheißen. Wütend stapfte ich los in mein Zimmer, ich würde lieber mit weißen Haien speisen, wobei ich die Mahlzeit wäre, als mit den beiden auch nur noch eine Sekunde freiwillig verbringen zu wollen. »Margret, bleib stehen!«, doch ich blieb nicht stehen, ich wollte nur noch raus hier. Weg von diesen Monstern! Am besten so weit weg, wie ich nur konnte. Ein anderes Land klang auf einmal doch sehr verlockend, warum hatte ich bloß die Uni in Hamburg abgelehnt, die mich vor drei Jahren aufgenommen hätte? Ach, ja richtig! Mein Vater hatte das nicht gewollt! »Komm sofort zurück, Fräulein!«, brüllte mein Vater mir hinterher, er hatte bestimmt wieder ein ganz rotes Gesicht so wie immer, wenn er wütend wurde, doch ich hörte gar nicht auf ihn.
Ich stapfte hoch in mein Zimmer und verschloss die Tür hinter mir, ich drehte mich um, als ich ein Lachen hinter mir hörte. Es konnte niemand in meinem Zimmer sein!
Doch als ich mich umdrehte und mein Zimmer genauer unter die Lupe nahm, fiel mir auf, dass mitten im Raum ein junger Mann stand. Ein mir bekannter junger Mann. »Leon ...«, geschockt starrte ich auf den Jungen im Alter von 20 Jahren, zumindest ging ich davon aus, dass er 20 war. Wir hatten, als wir uns in dem vollen Club kennengelernt hatten, nicht wirklich Interesse am Reden gehabt. Der Dunkelhaarige hatte seine Hände in den Vordertaschen seiner engen schwarzen Jeans vergraben und grinste mich an.
Wie war der Vater meines Kindes hier bloß hereingekommen? Ich schaute schnell zur Seite, doch das große Fenster war geschlossen und die babyblauen Vorhänge hingen immer noch offen an den Seiten der Fensterbank, auf der auch immer noch all meine Mini-Kakteen standen, und zwar genau da, wo sie hingehörten. Und selbst wenn er es versucht hätte, er wäre gar nicht erst zu meinem Fenster, was im zweiten Stock ist, hoch- gekommen, da der alte Kastanienbaum letztes Jahr, als es so gestürmt hatte, gefällt werden musste. Weil er sonst möglicherweise auf das Haus gefallen wäre. Und woher zur Hölle wusste er, wo ich wohnte? Er wusste ja noch nicht einmal meinen Nachnamen. Außer meine beste Freundin Katie hätte ihm das erzählt. Aber soweit ich wusste, kannten sich der Dunkelhaarige und die Platinblonde nicht einmal. Leon kam einige Schritte auf mich zu.
Auf dem ebenfalls babyblauen Teppich hörte man seine schwarzen, schweren Stiefel, die sehr an Soldatenstiefel erinnerten, nicht einmal. »Hallo Margret, es ist schön, dich wiederzusehen.«, er grinste mich, wenn möglich, noch breiter an und wenn ich ehrlich war, machte mir das Angst. Auf einmal kam er mir viel bedrohlicher vor als damals in dem Club, in den meine beste Freundin mich geschleift hatte, weil es ihr Geburtstag war. »Woher weißt du, wo ich wohne? Hat Katie dir das verraten und wie bist du hier hereingekommen?«, ich verfluchte innerlich meine Stimme, die bebte und mich wie ein ängstliches kleines Mädchen klingen ließ, was ich eindeutig nicht mehr war.
Aber ich war alleine mit einem wildfremden Typen in meinem Zimmer! »Oh Margret, ich weiß sehr viel, wie zum Beispiel, dass das Kind in deinem Bauch ein Mädchen wird und mir helfen wird, frei zu sein.« Bitte was?! Wie zur Hölle sollte er das wissen, ich wusste es ja selbst erst seit einer Woche. Sofort begann mein Gehirn, sich Theorien auszudenken, zum Beispiel, dass er bei dem Frauenarzt arbeitet, zu dem ich gegangen war und er sich meine Akte angesehen hatte. Aber selbst das erklärte nicht, wieso er hier war, in meinem Zuhause, in meinem Zimmer. Er hatte kein Recht, hier zu sein.
»Was, was meinst du, mit frei sein?«, ich wich zurück, doch schon bald spürte ich die Türklinke in meinem Rücken, die Kälte der Klinke half mir nicht gerade, mich zu entspannen. Innerlich fluchte ich über meine eigene Dummheit, die Tür abgeschlossen zu haben, denn wenn ich ehrlich war, wollte ich nur noch wegrennen! Ich wollte weg von meinen Eltern und auch weg von Leon und das so schnell wie möglich. Warum musste ich auch diese bescheuerte Tür einfach abschließen?
»Ich, meine Hübsche, bin Lucifer höchstpersönlich, ich werde dieses Kind brauchen, um die Hölle zu öffnen, damit all meine Untertanen endlich auf die Erde kommen können und das geliebte Spielzeug meines Vaters vernichten können.«
Ich konnte nicht anders, ich lachte. Der Typ war doch durchgeknallt, einfach verrückt. Verrückter ging es gar nicht. »Du«, ich konnte mich vor Lachen nicht halten, »du bist verrückt. Sowas von verrückt.«, doch er schien mich nicht ernst zu nehmen, ganz im Gegenteil, er kam mir immer näher, so nah, dass nur noch ein paar Zentimeter zwischen uns waren und ich zu ihm aufsehen musste, seine dunklen Augen bohrten sich in meine, ich war gefangen in seinem Blick.
Doch dann hörte ich das Hämmern an der Tür und die Stimme meines Vaters. »Margret, mach die verfluchte Tür auf und zwar sofort!«
Ich schaute panisch zu Lucifer, oh Herr im Himmel, wie bescheuert es klang, er musste definitiv verrückt sein, eine andere Erklärung gab es einfach nicht. Er gehörte bestimmt in eine Nervenheilanstalt. Aus der er ausgebrochen war, oh Gott, wie schrecklich, sie hatte ihr erstes Mal nicht nur betrunken, sondern auch mit einem Verrückten gehabt. So verrückt wie er war, gehörte er 100 prozentig in eine Klapse! Doch genau dieser Verrückte grinste mich nur an und lehnte sich immer weiter in meine Richtung.
Seine Lippen waren viel zu nah an meinem Ohr und sein Atem kitzelte mich, als er sprach.
»Na los, mach die Tür auf, es wird dich nicht retten. Niemand kann dich retten!« Bei seinen Worten stellten sich meine Nackenhaare auf und am liebsten wäre ich vor ihm davongerannt, denn nun musste ich mir eingestehen, dass ich Angst vor ihm hatte. Panische Angst, um ehrlich zu sein, denn er war unberechenbar. Schnell tastete ich nach dem Schlüssel, der irgendwo hinter mir sein musste und drehte diesen, so schnell es ging, um, ich schaute wieder zu dem Mann vor mir, doch er war verschwunden, so als hätte es ihn nie gegeben. Für eine Sekunde fragte ich mich, ob ich ihn mir nur eingebildet hatte.
Oder vielleicht hatte meine Eltern mir auch etwas ins Essen gemischt, zutrauen würde ich es den beiden. Schnell trat ich von der Tür zurück, als mein Vater die Tür mit Gewalt aufstieß. Ich bekam sie zum Glück nicht in den Rücken oder sonst wohin, denn die weiße Tür knallte mit einem lauten Krachen gegen die cremefarbene Zimmerwand, es war ein Wunder, dass kein Loch in der Wand zurückblieb, schließlich hatte mein Vater die Tür mit so einer Gewalt aufgestoßen. Nur ein paar Sekunden später stand ich vor meinem wütenden Vater. Nun war ich mir nicht mehr so sicher, wer mir mehr Angst machte, die Lucifer-Halluzination oder mein Vater. Ich zitterte und wich zurück, als mein Vater dann auch noch die Hand hob, um mich zu schlagen, senkte ich bloß meinen Blick, mein Vater hatte mich schon oft geschlagen. Es war nichts Neues mehr für mich. Immer wenn ich eine schlechte Note nach Hause gebracht hatte als Beispiel oder als ich aus Versehen zu lange bei Katie geblieben war. Fünf Minuten zu lange! Eigentlich hatte er immer einen Grund gefunden, egal ob es nun eine Note war oder einfach nur ein Krümel am Boden, den ich nicht schnell genug weggemacht hatte. Oder wenn Gott es ihm im Alkoholrausch befohlen hatte, da ich eine Sünderin war. Seine Faust erwischte mein Gesicht und ich schrie auf, für einen kurzen Moment sah ich nur Sterne und der Schmerz war unbeschreiblich, es war, als wäre ich von einem Zug getroffen worden. Ich war mir sogar ziemlich sicher, dass ich ein Knacken hörte. Ich stolperte einige Schritte zurück, als er noch einmal ausholte.
Meine Mutter betrat den Raum und schaute zwischen uns hin und her. »Robert, nicht! Was sollen die Nachbarn nur denken!« schrie sie auf, doch mein Vater schien sie nicht einmal zu hören, denn dieser hatte mich fokussiert und folgte mir, als ich noch weiter zurückstolperte.
Ich lachte kalt auf, während ich mir meine bestimmt schon blaue Wange hielt, natürlich dachte meine Mutter zuerst an den Ruf, der zerstört werden könnte. Er holte erneut aus und erwischte diesmal mein rechtes Auge.
Wenn es möglich war, war der Schmerz noch schlimmer als bei dem Schlag davor. Eigentlich hatte mein Vater mich immer in die Rippen oder den Rücken geprügelt. Er hatte immer darauf geachtet, nicht mein Gesicht oder meinen Hals zu verletzen, da ja sonst die Nachbarn das sehen könnten oder meine Lehrer in der Schule, die ja Fragen stellen könnten, die mein Vater nicht beantworten wollte. Mit einem Knacken brach meine Nase, der verrückte Mistkerl hatte mir meine Nase gebrochen. Mein Auge schmerzte und tränte, aus meiner Nase spritzte nur so das Blut und mein Kiefer fühlte sich auch ziemlich bescheiden an.
Meine Mutter packte seinen Arm, als er erneut ausholte. »Genug! Robert, es reicht. Du hast genug getan. Oh mein Gott, Herr im Himmel, was werden die Nachbarn nur sagen?«, sie zog ihn aus dem Raum und führte ihn aus dem Haus. Ein Sparziergang beruhigte ihn eigentlich immer. Oder aber eine große Flasche Whisky.
Noch an dem Abend packte ich meine Sachen und verschwand aus der Stadt. Das meiste Geld meiner Eltern nahm ich mit.
Einige Jahre später
Die Augen der Frau hatten sich mit Panik gefüllt.
Das kleine Mädchen weinte bitterlich. »Mummy, was ist los?« Es zerriss der Frau das Herz, ihren kleinen Engel so zu sehen. Vor allem, da sie wusste, dass sie nichts tun konnte, zumindest nichts, was ihr großartig helfen konnte. Aber sie musste jetzt stark sein für ihren kleinen Engel. Sie fuhr ihrer Tochter durch die blonden Locken.
»Shhh, Lucy, du musst jetzt leise sein, okay?«, die Frau zitterte, diese Wesen jagten die beiden jetzt schon eine Weile. Zuerst hatte Margret nur gedacht, dass sie sich die Wesen einbildete. Es nur ein Hirngespinst war, doch das war es nicht. Damals, als Lucifer ihr gesagt hatte, wer er war, hatte sie ihn ausgelacht, nun waren seine Schergen hier, um ihr kleines Mädchen von ihr wegzuholen, das Lachen war ihr vergangen. Sie musste es nur aus dem Gebäude schaffen und hinaus auf die belebte Straße, zumindest redete sie sich selbst das ein.
Doch keiner der beiden sollten es schaffen. Die Tür flog auf und ein Wesen trat auf die beiden zu, es sah aus wie ein Wolf, der auf zwei Pfoten ging, er hatte sogar einen Schwanz, der leicht hin- und herschwang. Doch wo die Ohren des Tieres sein sollten, waren nur zwei Hörner, die sich in die Luft wanden. Zudem hatte er Hände, die nur sehr behaart waren. Doch anstelle von Fingernägeln hatte es lange, schwarze Klauen. Das Wesen schmiss den Kopf in den Nacken und öffnete sein Maul, aus dem ein sehr menschlich klingendes Lachen kam. Ohne dass eine der beiden es merkte, öffnete sich unter den beiden ein Portal und sie wurden verschlungen.
Die beiden landeten auf einer freien Fläche, nichts war um sie herum, nur die Dunkelheit, selbst der Boden war schwarz, so als wäre die Erde unter ihnen verbrannt. Und der Gestank, es roch komisch, so als hätte jemand verfaulte Eier und eine Menge Silvesterkracher hier losgehen lassen. Man hörte ein grauenhaftes Knurren und drei pechschwarze, riesige Hunde schritten auf die beiden zu.
Die drei Hunde waren um die fünf Meter groß, ihre Pfoten hatten Klauen, die den Krallen einer Katze glichen und ihre Zähne waren so lang wie das Bein eines großen Kindes.
Die Zähne waren gekrümmt wie bei einem Säbelzahntiger. Verzweifelt schob die Frau ihr Kind hinter sich. Komplette Panik schnürte ihre Kehle zu. »Ich will, dass du rennst, egal was du hörst, dreh dich nicht um, hast du mich verstanden? Du drehst dich nicht um, du rennst einfach weiter.« Sie versuchte, einen möglichst starken Gesichtsausdruck zu haben und betete, dass ihr Engel nicht die Angst in ihren Augen sah oder das Zittern ihrer Hände bemerkte.
Die Kleine nickte schüchtern und drehte sich um, um loszurennen. Erstaunlicherweise ließen die Hunde die Kleine machen, sie versuchten sie nicht aufzuhalten oder ihr gar hinterher zu rennen.
Doch sie stürzten sich keine fünf Sekunden später auf die Frau.
Die Kleine eilte bis zu einem Felsbrocken, hinter den sie sich hockte und alldem mit Tränen in den Augen zuguckte. Sie konnte den Blick nicht von ihrer Mutter abwenden, die von den drei Tieren auf brutalste Art und Weise angegriffen und getötet wurde. Nein, sie wollte all das nicht sehen, sie wollte weggucken und die Augen schließen, doch sie konnte nicht. Die blauen, mit Tränen gefüllten Kinderaugen verfolgten das Spektakel geschockt.
Die Hunde drehten sich, nachdem sie mit ihrer Mutter fertig waren, in ihre Richtung und streckten die Nase schnüffelnd in die Luft.
Das Mädchen zitterte panisch, ihr Herz schlug so laut, dass die Kleine sich wunderte, weshalb die Hunde sie nicht hörten.
Sie hörte das Grollen der riesigen Tiere, als diese immer näher auf ihr Versteck zukamen. Doch ein Heulen rief die drei zurück, sie drehten sich weg und rannten davon.
Die Kleine lugte vorsichtig hinter dem Felsen hervor, hinter dem sie sich nun doch verkrochen hatte, ihre Augen starrten auf den Körper ihrer Mutter, den toten Körper ihrer Mutter. Vorsichtig, aus Angst, dass die Monster wiederkommen würden, schlich sie auf ihre Mutter zu, weinend schmiss die Kleine sich gegen ihre Mutter und verbarg ihr Gesicht in der Schulter der Frau.
Die Kleine konnte es nicht glauben, ihre Mum war tot ... TOT ... T…O…T! Als sie auf einmal eine Hand auf ihrem Kopf spürte, sie schaute zu ihrer Mum. »Mummy, alles wird wieder gut.«, flüsterte die Kleine mit tränenverschleierter Stimme. Sie wusste nicht, ob sie sich selbst nur versuchte, Mut zuzureden, oder ob sie wirklich daran glaubte, doch ihre Mutter legte nur eine Hand an die Wange ihres kleinen Kindes. Zitternd sprach die Frau,
»Du musst stark bleiben, Lucy, hast du mich gehört? Du bist so ein tapferes Mädchen. Du bist mein Engel, Lucy Fairchild, hast du mich gehört, Lucy? Du darfst nie so werden wie dein Vater, denn du bist gut, ein unglaublich guter Mensch!«
Dann fiel der Kopf der Frau zurück. Ihre Haare sahen auf dem Boden aus wie gefallener Schnee. Wunderschön und unberührt. Margret Fairchild sah unglaublich schön aus, selbst im Tod sah sie aus wie ein gefallener Engel. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen, zumindest für Lucy, die Kleine wusste nur, dass ihre Mutter weg war und das für immer.
Sie war jetzt alleine.
Lucy hörte etwas und schaute dorthin. Tap, tap, tap, doch die Kleine sah nichts. Angst durchfuhr sie, Angst, dass die Monster wieder da waren, um sie zu fressen.
»Wer auch immer hier ist, geh weg.«, schrie die Kleine panisch in der Hoffnung, dass die Monster verschwinden würden. Sie hörte ein Lachen und wich zurück, naja, sie versuchte zurückzuweichen, doch sie konnte ihre Mutter hier nicht allein zurücklassen.
Ein Mann trat aus den Schatten und ging auf sie zu. »Shh, meine Kleine, alles ist gut, du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt bist du sicher, niemand kann dir hier unten etwas antun.«, lächelte Lucifer und zog seine kleine Tochter hoch in seine Arme.
Sie traute dem fremden Mann nicht, er war bestimmt auch ein Monster, ein Monster, das einfach nur menschlich aussah. Er trug die Kleine weg, diese schrie nach ihrer Mutter und versuchte, sich gegen den fremden Mann zu wehren. Sie schlug und biss nach ihm, während sie versuchte, sich aus seinen Armen zu winden. Sie konnte ihre Mutter doch nicht allein lassen. Was war, wenn sie aufwachte? Und Lucy wäre nicht da, sie hätte bestimmt schreckliche Angst. Doch der Mann trug sie immer weiter fort von ihrer Mutter.
KAPITEL 1 Von Jägern und Toten
Die Blätter raschelten, als ich immer schneller über den unebenen Waldboden rannte. Ich hörte meine Verfolger, sie atmeten schwer, fast so schwer wie ich selbst, und das ein oder andere Mal hatte ich das Gefühl, dass sie mir viel zu nahe kamen.
Meine Füße verloren den Halt auf den nassen Blättern und ich fiel einen Abhang hinunter. Ich landete auf dem nassen Boden und die wenige Luft, die ich noch in den Lungen hatte, wurde mir aus meiner Brust gepresst.
Ich spürte Schmerzen in meinem Rücken und meine Hände und Knie bluteten. Ich musste aufstehen, ich sollte hier weg und das ganz schnell. Sie waren mir sowieso schon viel zu nahe. Ich quälte mich auf meine Knie und wimmerte auf, als sich Dreck in meine Wunde drückte. Ich war doch sonst nicht so schwach, aber jetzt gerade fühlte ich mich grauenhaft schwach und alleingelassen. Ich stand auf und taumelte einige Schritte. Meine Finger streiften einen Baum und sofort hielt ich mich an diesem fest in der Hoffnung, meinen Gleichgewichtssinn wiederherzustellen. Als ich sie hörte, sie schlitterten den Abhang hinunter, sie lachten, als sie mich sahen. Sie hatten ja schließlich keine Angst vor mir, in ihren Augen war ich nur ein kleines, unbedeutendes Mädchen. Und wie sah ich denn schon aus, meine Haare warn voller Dreck und ich hatte sie schon einige Tage nicht mehr gebürstet. Zudem waren meine Anziehsachen dreckig und nass. Ich sah also alles in allem echt unmöglich aus.
»Ich hatte von der Tochter des Teufels mehr erwartet.«, grinste einer, als sie auf mich zukamen, bereit, mich zu töten.
Es waren insgesamt fünf Jäger, die um mich herumstanden. Alle in schwarz gekleidet, alle mit unglaublich grausamen Augen. Augen von Mördern, sie machten mir Angst. Meine Finger krallten sich in die dicke Baumrinde hinter mir. Ich spuckte vor dem Sprecher auf den Boden. »Fick dich!«
»Hey, Jam, sie ist echt heiß für einen Dämon.«, grinste einer der anderen dümmlich. Sie waren allesamt noch lange nicht auf dem Level eines professionellen Jägers angekommen.
Was ihr ihre Angst nahm. Das hier vor ihr waren Hobbyjäger. Und der nächste Satz von einem der Volltrottel bestätigte ihre Vermutung noch.
»Kannst sie ja ficken.«, grunzte einer.
Ich drückte mich noch weiter gegen den Baum und versuchte, mich vor diesen Männern zu verstecken. Denn ich hatte echt keinen Bock auf eine Vergewaltigung, danke, aber ich verzichte! Dieser Jäger, der meinte, dass ich heiß war, Jam oder so, kam auf mich zu und strich mir eine meiner goldenen Haarsträhnen hinter mein Ohr.
Ich trat nach ihm und er wurde nach hinten geschleudert, leider nicht so weit, wie ich es gerne gewollt hätte. Aber der Kerl war auch größer und schwerer als ich. Ich war nicht klein, aber der Typ war zumindest in der Breite das Doppelte von mir. Doch mein Rücken schmerzte unglaublich, als ich diesen gegen die raue Baumrinde gepresst hatte, durch mein dünnes weißes Sommer-T-Shirt spürte ich die raue Rinde noch einmal besonders intensiv, als ich mit dem Bein ausgeholt hatte, ich schrie vor Schmerz auf und ich hasste mich dafür. Dafür, dass mich diese Männer schreien hörten.
Sie lachten. »Ich hatte wirklich mehr von dir erwartet, Püppchen!«, grinste dieser Jam. Er war hoch gewachsen, seine braunen Haare hatten so einen grauenhaften Haarschnitt, die Seiten kurz und oben etwas länger, den man gefühlt an jedem zweiten Typen sah. Ich schaute diese geschockt an. Einer zog ein Messer und ging auf mich zu, er zitterte leicht. Tränen brannten in meinen Augen, nicht aus Angst, sondern wegen des Schmerzes, ich glaube, ich habe mir etwas gebrochen. »Bitte, bitte, nicht. Ich bin doch auch ein Mensch!«, flehte ich mit der besten Klein-Mädchen-Stimme, die ich hinbekam. Dieser stoppte und schaute mich an, er schien ein neuer, noch unerfahrener Jäger zu sein, wahrscheinlich war er noch nicht ganz ausgebildet, falls er denn überhaupt je eine Ausbildung gemacht hatte.
Ich grinste, er würde diese Ausbildung nie beenden. Denn ich packte seine Hand, drehte sie und rammte ihm sein Messer mit seiner eigenen Hand in die Brust. Er starrt mich geschockt an, sein Mund zu einem stillen Schrei verzogen. Ich zog ihn zu mir, »Mein Vater hat mich gelehrt, niemals auf das Flehen eines Mädchens zu hören!«, seine Augen weiteten sich, während ich ihn zu Boden fallen ließ, er wird schon bald tot und vergessen sein. Nicht mehr als eine weit entfernte Erinnerung.
Der Älteste der Männer schrie laut, »WILLIAM«, und weinte, dann schaute er mich an und zog ein Gewehr. Na, ganz toll!
Er schoss auf mich, doch ich duckte mich gerade noch rechtzeitig, während ich an dem Baum vorbeihuschte, schon rannte ich los. Meine Füße flogen über den Boden, doch ich schrie auf, als eine Kugel mich am Bein streifte. Ich schaffte es, noch einige Schritte weiter zu stolpern, meine Hand an der Wunde, bevor ich zu Boden fiel, wimmernd zog ich mich weiter zu einem großen Baum, hinter dem ich mich verstecke.
Ich hörte die Jäger lachen, als sie mich erneut fanden.
Bis auf der eine, der immer noch traurig wegen seines Sohns, Bruders, Freundes? war. Genau der kam auf mich zu und packte meine Haare, er riss mich an meinen Haaren auf meine Beine. »Du hast meinen Sohn umgebracht!«, zischte dieser, Bingo, es war der Sohn, ich schaute ihn nur mit einem blutigen Grinsen, das ich mir nicht verkneifen konnte, an.
»Es war Selbstverteidigung. Er wollte mich töten!«, knurrte ich zurück, ich wusste, dass ich Züge meines Vaters hatte, schließlich hatte er mich großgezogen und Dämonen waren nun mal nicht für ihre Barmherzigkeit bekannt. Grausame Züge, die ich nie gewollt hatte, deswegen tat mir der Junge nicht leid, zumindest nicht so doll, wie er mir eigentlich leidtun sollte. Genau deswegen fühlte ich auch keine Reue, dieser Junge bedeutete mir nichts! Es war ein Mittel zum Zweck gewesen.
Genug seiner Männer hatten meine Freunde umgebracht, ich sah es eher als Rache und als Selbstverteidigung, als irgendetwas anderes, es war gerecht gewesen! Der Alte zog ein Messer. Er grinste.
»Ich bin froh, dass du zur Hälfte ein Mensch bist, somit bist du einfacher zu töten als diese Dämonen!« Ich wollte schreien, doch bevor er mich aufspießen konnte, wurde er von mir weggerissen. Ein mir vertrauter Dämon packte den Mann unterm Kinn und riss ihm den Kopf ab, die anderen reagierten erstaunlich schnell, dafür, dass sie keine Profis waren.
Sie zogen ihre Messer, rammten sie in die menschliche Hülle. Okay, vielleicht waren sie doch keine Profis, denn jeder wusste, dass man einen Dämon nicht so töten konnte, er würde einfach zur nächsten Hülle springen. Am besten ging es wirklich immer noch mit einem Exorzismus, damit schadete man in den meisten Fällen nur dem Dämon und nicht der Hülle. Tja, und der Dämon brachte gerade alle nacheinander um. Sie alle waren tot, ich starrte geschockt auf die Gestalt, die in der Mitte dieses Leichen-Kreises stand und mich ansah. Es war ein Dämon, der auf mich zukam, seine eigentliche Hülle lag irgendwo in dem Kreis aus Leichen. »My Lady.«, hauchte er und sah mich geschockt an. Dann sah ich es, fünf Messer steckten in seiner Brust. Er würde davon nicht sterben, aber zurück in die Hölle geschickt werden. Ich keuchte leicht auf und stolperte auf den Dämon zu. So gut es nun einmal mit einer Wunde ging. Doch der Dämon fiel um, kurz bevor ich ihn erreichen konnte. Er wurde zurück in die Hölle geschickt. Wahrscheinlich hatten sie die Messer in irgendetwas gesteckt, Weihwasser oder Salz, also wirklich solche Amateure, aber ich sollte mich nicht beklagen, wären sie echte Jäger gewesen, hätte ich das Ganze wohl nicht überlebt. Also dankte ich dem Dämon, während er im Sterben lag. Da er die Hölle erstmal nicht wieder verlassen würde und zudem höchstwahrscheinlich gefoltert werden würde, da, was auch immer er erledigen sollte, nicht erledigt hatte. Ich stolperte über die Leichen und eilte weiter, ich musste aus diesem verfluchten Wald.
Der Schmerz bei jedem meiner Schritte war grauenhaft und ich verlor immer mehr Blut. Ich überlegte tatsächlich, ob ich mich nicht einfach hinlegen sollte und nie wieder aufstehen sollte.
Selbst das schien eine bessere Option, als auch nur noch einen Schritt mehr zu tun. Doch dann sah ich die Straße, taumelnd lief ich mithilfe meiner letzten Kraftreserven auf diese zu. Ich fiel auf die Straße, vor mir hielt mit quietschenden Reifen ein Auto. Eine Frau rannte panisch auf hohen Absatzschuhen auf mich zu. Sie packte mich und riss mich hoch, sie legte einen meiner Arme um sich, sie trug einen dunkelblauen Hosenanzug, zumindest sah er in dem blassen Licht ihrer Autoscheinwerfer dunkelblau aus. Der Stoff unter meinen Fingern ist angenehm warm und weich. Ihren einen Arm legte sie um meinen Rücken, ich schrie auf.
»Tut mir leid. Keine Angst, ich bringe dich ins Krankenhaus, du wirst schon wieder.«, sagte sie, auch wenn sie verzweifelt klang. Sie klang so am Ende, wie ich mich fühle. Es kam mir so vor, als würde sie versuchen, sich selbst Mut zuzureden und nicht mir. Sie setzte mich ins Auto und ich wimmerte leise auf, als das feine Leder meinen Rücken berührte. Dann stieg sie ins Auto, sie atmete mehrfach tief ein und griff Halt suchend nach dem Lenkrad. Ich konnte sehen, wie ihre Fingerknöchel weiß hervorstanden, ihre Hände zitterten trotz des festen Griffes leicht, endlich fuhr sie los. Alles um mich herum wurde langsam schwarz. Ich war in Sicherheit fürs erste.
Ich schaute mich verwirrt um. Ich stand auf dieser Lichtung, ich grinste, während ich in den Bach sprang, mir war es ehrlich gesagt egal, dass ich noch meine Anziehsachen trug. Die könnten sowieso ein Bad vertragen, außerdem war das Wasser angenehm kühl. Es tat gut, endlich den ganzen Dreck und Schweiß loswerden zu können. Erst da fiel mir auf, dass mein Bein nicht mehr wehtat und als ich runterguckte, um nach der Wunde zu gucken, war sie verschwunden, nur ein kleiner, dunkelroter Blutfleck blieb auf meiner blauen Jeans zurück. Etwas verwirrt rieb ich die Stelle, wo die Kugel mich erwischt hatte. Der dunkelrote Fleck löste sich dank des Wassers auf, doch ich spürte immer noch keinen großen Schmerz, allerhöchstens ein unangenehmes Zwicken. »LUCY.« Ich hob blitzschnell meinen Kopf und schaute auf die Braunhaarige, die dort am Rand des Baches stand in einem weißen Kleid und mich mit überkreuzten Armen wartend anstarrte, so als hätte sie schon des Öfteren nach mir gerufen.
»Oh. Hallo, Alina war es, oder?«, ich wusste, dass es irgendetwas mit A war, aber den genauen Namen wusste ich auch nicht mehr.
»Aylin.«, verbesserte sie mich. »Oh, sorry, ich bin nicht gut darin, mir Namen zu merken, nicht nur deinen, sondern generell Namen. Ich hatte Glück, dass ich Tamis Namen behalten konnte!«, plapperte ich, während ich mich aus dem Wasser zog, auch wenn ich gar nicht das angenehm kühle und vor allem saubere Wasser verlassen wollte.
Aylin lief schon voraus, da ich ihr anscheinend zu langsam war. Sie ging auf die Brücke zu und setzte sich, ihr Kleid spielte ihr dabei leicht um die Knöchel und ließ sie wunderschön aussehen, vor allem als das Sonnenlicht zwischen den Bäumen hindurchfiel und ihr Haar begann, leicht rötlich zu schimmern. Ich ließ mich eindeutig weniger elegant neben sie fallen. »Du hast dich lange nicht blicken lassen, Ayli, Tami und ich haben auf dich gewartet ...«
»Es heißt Aylin und nicht Ayli, außerdem hatte ich etwas zu tun!«,grollte sie sichtlich von meinem Verhalten genervt.
»Wow, Tiger, schon okay!«, murmelte ich und schaute sie grinsend an, ich liebte es einfach, jemandem auf die Nerven zu gehen. Ich ließ mich nach hinten fallen und blinzelte in die Sonne.
»Es tut gut, keine Schmerzen mehr zu spüren ...«
»Du liegst im Koma, diese Frau versucht, dir das Leben zu retten. Du darfst noch nicht sterben, du solltest aufwachen!«, zischte Aylin. Ich schaute sie leicht verwirrt an.
»No shit,Sherlock! Aber eigentlich würde ich gerne hierbleiben, hier habe ich, bis auf dich, niemanden, der mich nervt … Ich glaube, ich bleibe ganz einfach hier!«
»Nein, Lucy, du musst aufwachen! JETZT!«, knurrte Aylin mich mit Nachdruck an. Alles um mich herum verschwand und langsam öffnete ich meine Augen. Sofort durchzuckte mich ein heiß brennender Schmerz.
Es dauerte einige Wochen, bis ich wieder auf den Beinen war. Wortwörtlich gemeint. Eins hatte ich aber im Krankenhaus gelernt, ich hasste Krücken.
Mit dem Geruch von Tod und Krankheit kam ich klar, aber absolut nicht mit kranken Menschen! Doch die Ruhe tat mir gut, es beruhigte mich und ich konnte überlegen, ob ich in New Orleans bleiben wollte. Die Antwort war Nein. Die Menschen und Feste waren bunt, schön und laut, was im Endeffekt der Grund war, warum ich überhaupt nach New Orleans gekommen war. Aber dort tummelten sich die übernatürlichen Wesen nur so. Und wo es Übernatürliche gab, gab es auch Jäger.
Ich strich über die weiße, steife und eigentlich ungemütliche Decke, währenddessen schaute ich mir die verstaubte, von Spinnweben überzogene Lampe, deren weißes Licht kaum merklich flackerte, an der Decke an.
»Miss Stark, Sie werden noch ein paar Probleme mit dem Laufen haben wegen des Streifschusses, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Die Polizisten haben die Leichen gefunden.« Ich hatte der Polizei alles erklärt, also nicht wer ich bin oder was ich getan hatte, sondern was sie mir antun wollten. Weshalb der Jüngste von ihnen einige Meter weiter tot da lag als die anderen. Ich sollte eigentlich auch noch zur Polizei, damit alles über mich auch überprüft werden konnte. Ich würde ganz bestimmt nicht gehen, da könnte ich genauso gut in einem kunterbunten Outfit und einem Megafon durch die Straßen rennen und brüllen: »Ich habe die Leute umgebracht und gelogen, hier, verhaftet mich doch bitte und wenn ihr schon dabei seid, bringt mich doch gleich um.«
Aber solange sie das nicht wussten, galt ich als kleines, unschuldiges Opfer! Ich versuchte mich an einem schwachen Lächeln, während ich dem Arzt in die eisblauen Augen guckte, wobei ich hochgucken musste, da er ja über mir stand.
Allerdings war der Arzt noch sehr jung und zumindest schien ich ihn nervös zu machen. Was mich beruhigte, »Danke. Mr. Jones ...«, murmelte ich, als ich mich wieder an seinen Namen erinnerte. Nach einer weiteren Woche wurde ich entlassen. Eigentlich warteten die Polizisten auf mich vor dem alten Krankenhaus, zumindest sah ich den Streifenwagen mit angestellter Sirene, als ich aus dem Fenster des dritten Stockes schaute. Ich nahm den anderen Ausgang und schaute kein einziges Mal zurück. Nur meinen gelben Regenmantel nahm ich mit. Zum Glück kam die hiesige Polizei nicht darauf, auch den Flughafen zu checken. Ich hatte mir einfach ein Flugticket mit einer gestohlenen Visa-Karte von einer gewissen Frau Rosewelt besorgt.
Der armen alten Dame war das Portmonee heruntergefallen, was ich ihr aufgehoben hatte.
Während sie sich tausend Mal bedankt hatte und mir sogar 10€ geschenkt hatte, hatte ich ihr die Karte gestohlen, ohne dass sie es bemerkt hatte. Die Visa-Karte hatte ich danach bei dem Info-Schalter abgegeben und gesagt, dass ich sie gefunden hatte. Ich war ja nicht total böse und verdorben!
KAPITEL 2 Von einer Bewerbung und einem Mädchen
Ich hatte ein halbes Jahr gebraucht, um die abtrünnigen Dämonen, die mich jagten, abzuschütteln und/oder zu töten, auch wenn ich die meisten einfach zurück in die Hölle schickte, um dann Reißaus zu nehmen. Nun hatte ich mich vor drei Monaten in Chicago niedergelassen. Die kleine, heruntergekommene Ein-Zimmer-Wohnung hatte eine nicht funktionierende Fußbodenheizung und war auch sonst mit den kahlen, weiß-gelben Wänden nicht grade der Hingucker.
Allerdings waren die Möbel vom Vorbesitzer noch dringeblieben, was ein Pluspunkt war. Somit hatte ich ein noch schönes und funktionierendes Bett, das ein Regal mit angebaut hatte, in das ich über den Tag mein graues Bettzeug stopfen konnte. Auf der Fensterbank, die direkt neben dem Bett war, hatte ich meine neu gekauften Minikakteen gestellt. Die babyblauen Vorhänge ließ ich eigentlich immer offen an beiden Seiten des Fensters hinunterhängen, auch wenn die Aussicht aus dem Fenster auch nicht toll war, die graue Fassade einer Firma.
Was ich aber auch noch mochte, war die Topfpflanze, die von der metallenen und alt wirkenden Gardinenstange hinunterhing. Der dunkelblaue Topf mit dem Giftefeu verlieh dem Fenster einfach etwas Schönes. Der Röhrenfernseher stand auf dem kleinen weißen Regal, das mein Schlaf- von meinem Wohnzimmer trennte.
Das gelbe Ledersofa mit den grauen Kissen war nicht meine erste Wahl gewesen, aber ich musste mir kein neues kaufen, also war das schon einmal ein Pluspunkt! Zudem hatte das kleine Bad eine Dusche und keine Badewanne so wie meine letzte Unterkunft, im Gegensatz dazu lebte ich jetzt richtig gut. Ich eilte über den grauen Asphalt, der eindeutig schon bessere Tage gesehen hatte. Der Asphalt war von Rissen und Löchern geziert. Meine Absätze hinterließen ein lautes Geräusch auf der menschenleeren Straße. Bis es begann zu gewittern.
»Himmel noch eins!«, murmelte ich wütend vor mich hin. Seit drei Monaten lebte ich nun schon in Chicago, hatte es mir etwas außer Armut gebracht? Naja, ich war dem Tod oder Vergewaltigungen durch Abtrünnige entkommen, aber dafür zu verhungern war auch nicht gerade das Beste. Wer wollte denn schon eine 18-Jährige einstellen, die nichts aufzuweisen hatte, außer dass ich die Prinzessin der Hölle war, niemand, und genau das war mein Problem. Ich wünschte mir langsam, aber sicher, dass ich den Bus genommen hätte, zumindest zurück, doch nicht einmal die 3,30$ hatte ich aufbringen können.
Und ich wurde genau deswegen vollgeregnet, meine Jacke hielt nichts mehr ab und auch meine Schuhe waren nicht mehr wasserdicht. Mal ganz von meiner hautfarbenen Strumpfhose abgesehen, die nun dank des Regens noch mehr an meiner Haut klebte.
Miserabel gelaunt betrat ich also den Laden, Brunos stand in fetten roten Buchstaben auf dem Dach des roten Backsteinhauses, es war klein und war zwischen zwei grauen, leblosen Hochhäusern eingequetscht. Mein Make Up war verwischt von dem Regen und das einzige, was mein schwarzes, schlichtes Kleid, das mir bis zu den Knien ging, vor dem Tod bewahrt hatte, war die lange gelbe Regenjacke, die meiner Mutter gehört hatte und vom Alter gezeichnet war, dementsprechend war sie an einigen Stellen schon gar nicht mehr so sonniggelb, sondern eher schmutziges gelb. Sie hatte keine Kapuze mehr, da die Kapuze vor einigen Jahren abgerissen war.
Die Kapuze war dann bei dem Umzug von Illeno nach New Orleans dann verloren gegangen, da ich sie nie wieder an die Jacke genäht hatte.
Ich schaute mich in dem kleinen Café um. Die Tische waren in verschiedenen Abständen zueinander aufgebaut, sie boten meistens Platz für drei oder vier Personen.
An den großen Fenstern gab es Sitzbänke, die mit blauem oder rotem Stoff überzogen waren. Der Tresen war nichts Besonderes, er bestand aus dunklem Holz, auf der rechten Seite standen einige Barhocker, auf die man sich setzen konnte, wenn man wollte. Auf der linken Seite stand die Kasse, daneben standen einige Tabletts, auf denen Kuchen und Kekse standen.
In einer Ecke saß ein alter Mann mit seinem Enkel, ansonsten war nichts los. Eine füllige Frau mit schmutzigen blonden Haaren stand hinter der Theke, sie war gerade dabei, sich eine Zigarette anzuzünden. Sie trug eine weiße Bluse, die anscheinend schon mal bessere Tage gesehen hatte.
Sie trug dazu eine rote Schürze, die Kaffeeflecken aufwies, zögerlich trat ich auf die Frau zu und räusperte mich. Die Frau schaute von ihren Fingernägeln auf, die das einzige Gepflegte zu sein schien, sie hatte die Zigarette schnell zurück hinter ihr Ohr geklemmt, als sie die Ladentür gehört hatte, wie sie hinter mir ins Schloss fiel. Sie grunzte, »Was willste?«
»Lucy Fairchild, sehr erfreut, ich habe mich bei Ihnen beworben!«
»MARVIN!«, brüllte sie wütend, zumindest klang es für mich wütend, sollte sie gar nicht wütend sein, wollte ich nicht wissen, wie sie klang, wenn sie wirklich sauer war, durch den ganzen Laden.