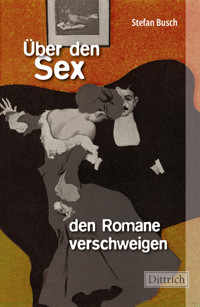
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Wenn Romane vom Sex der Liebenden nicht explizit erzählen, füllt die Vorstellungskraft des im Leben und Lesen erfahrenen Publikums die Lücken. Einst durften Autoren wie Flaubert und Fontane nichts zeigen, sie fanden aber Wege, die verbotenen Akte vor aller Augen geschehen zu lassen. Und heute, wo anything goes gilt und das Angebot an erotischen Bildern reichlich ist? Auf welche Spiele mit der Liebe einigen sich aktuelle Romane mit ihren Leserinnen und Lesern? Dieser schwungvolle Essay betrachtet das Spiel und seine Regeln mit Witz und unterhaltsamen Seitenblicke auf die Weltliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Busch
Über den Sex, den Romane verschweigen
Stefan Busch
Über den Sex,den Romane verschweigen
© Dittrich Verlag in der Velbrück GmbH Verlage, 2025
Meckenheimer Str. 47 · 53919 Weilerswist-Metternich
www.dittrich-verlag.de
Printed in Germany
ISBN 978-3-910732-50-6
eISBN 978-3-910732-86-5
Satz: Gaja Busch, Berlin
Covergestaltung: Katharina Jüssen, Weilerswist
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Write what you like, then imbue it with life and make it unique by blending in your own personal knowledge of life, friendship, relationships, sex, and work. Especially work. People love to read about work.
Stephen King: On Writing
Inhalt
Das Geheimnis der fehlenden Stellen
Ein Maß solcher Dinge: Das Lieben des Odysseus
Fehlanzeigen: Über Leerstellen und ihren Sex-Appeal
In flagranti – Dantes Purgatorium der Liebe
Die Kunst, vom Sex nicht zu erzählen, wenn schon das Schweigen zu viel ist
Wie alle sehen, sieht man nichts: Emma Bovarys Vögelei im Fiaker
Kontrolliert und ausgelassen – die zeitlosen Formen der Ellipse
So Sachen: Courage und Ökonomie beim dezenten Herrn Fontane
Schach von Wuthenow – Die kurze Stunde der Debaucherie
L’Adultera – Artisten in der Treibhauskuppel
Irrungen, Wirrungen – »Landpartie (mit Übernachtung!)«
Die drei Auslassungszeichen und der springende Punkt
Wenn es die Sprache verschlägt: Der Fall der Anna Karenina
Zu viel des Guten? Wie neuere Romane sich in Zurückhaltung üben
Literatur
Zitatnachweise
Das Geheimnis der fehlenden Stellen
Mysteriöses und oft sehr Trauriges geschah jenseits der holländischen Sandstrände und österreichischen Berge, bis wohin ich in den Sommerurlauben schon vorgedrungen war. Im Wohnzimmer vor dem Plattenspieler sitzend hörte ich immer wieder Heinos Lieder über diese andere, geheimnisvolle Welt. Dort verloren Mütter ihre Söhne an die See und Männer ihre treulosen Frauen an wen oder was auch immer, woraufhin sie – also: die Männer – mit Caramba und Carajo endlich wieder in die Hafenkneipe ziehen durften. Später, das spürte ich, würde auch ich entdecken und am eigenen Leib erfahren, wovon da gesungen wurde. Vieles wirkte düster und bedrohlich, aber es schien in der Welt der Erwachsenen nicht nur Bedrückendes zu geben, wenn auch von manchen dieser schönen Dinge irgendwie nicht offen gesprochen und gesungen wurde. So liefen in den Berghütten, die ich ja schon gesehen hatte und die eigentlich gar keinen so geheimnisvollen Eindruck machten, rätselhafte Dinge ab:
In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen,
In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen,
In der dritten Hütte hab’ ich sie geküsst –
Keiner weiß, was dann geschehen ist.
Sitzen, essen, küssen – was kommt danach? Im Laufe der Jahre kam Licht in dieses Mysterium, aber lange Zeit hielt mich die okkulte letzte Zeile gepackt. Sie war ungereimt. Wenn man etwas ausgefressen hatte, hielt man die Klappe und erzählte den Eltern nicht, dass sie ja nicht wüssten, was man getan hatte. Und der Mann schien mit etwas nicht herausrücken zu wollen, sang jedoch vor allen Leuten, dass sie, wie alle anderen auch, keine Ahnung hätten, was da schließlich noch alles passiert war. Es musste etwas Angenehmes gewesen sein, denn er hatte offenbar gute Erinnerungen an das Geschehene, behielt sie auf eine seltsame Weise jedoch lieber für sich.
Des Sängers verschmitzte Andeutung eines grande finale hatte Methode. Rhetorisch und also sehr ernsthaft betrachtet kombiniert das Lied vom blauen Enzian und den ro-ro-roten Lippen an dieser Stelle die Figuren der Aposiopese und der Paralipse: Der »Redner« verliert zuerst scheinbar den Faden und bricht den Satz ab, dann verleiht er dem, was nach dem Gedankenstrich kommt, zusätzliche Bedeutung durch ebenfalls nur scheinbares Verschweigen dessen, was gerade dadurch betont wird, aber ohnehin allen klar ist und auch sein soll. Keiner weiß es, nur alle: In der dritten Hütte (oder doch erst in der vierten?) hatte Heino Sex mit dem Schweizer Madel. Seltsam, aber so ward es gesungen.
So mancher Hitparade-Schlager war auf Schlüpfrigkeit gestimmt. Von Liebe war das Singen und das Schunkeln, aber gemeint war und verstanden wurde immer etwas mehr. Schmierig war’s, aber nicht schwierig: »Manchmal möchte ich schon mit dir«, »Nur eine Nacht dauert die Kur«. In einer Hinsicht zumindest standen Roland Kaiser und Daliah Lavi vor der gleichen Herausforderung wie die Romanciers des 19. Jahrhunderts. Mit Blick auf Anna Karenina notierte Milan Kundera, dass in den Romanen jener Zeit die Liebe auf das Feld beschränkt war, »das sich zwischen der ersten Begegnung bis zur Schwelle des Koitus erstreckte«, und diese Schwelle habe eine »unüberwindliche Grenze« des Erlaubten dargestellt. Doch der Sex gehörte dazu, damals wie zu den Zeiten der Hitparade. Wenn von ihm nicht offen geschrieben und gesungen werden durfte, mussten andere, notwendigerweise etwas umständlichere Formen der Verständigung gefunden werden.
»Um den Sex breitet sich Schweigen«. So Michel Foucaults vielzitierte Formulierung über die Zeit, die als die Viktorianische bekannt ist, und ganz ähnlich stellte Kurt Vonnegut fest: »Victorians misrepresented life by leaving out sex.« Falsch darstellen oder verdrehen kann man Sachverhalte aber nur, wenn man über sie kommuniziert, und kollektives Beschweigen setzt das von allen Gewusste voraus. Wenn jedoch etwas unausgesprochen und fortgelassen ist, von dessen Existenz alle wissen, entwickeln die Kommunikationsteilnehmer große Fertigkeiten, mit den offensichtlichen Lücken nach allgemein anerkannten Regeln umzugehen. Die Leerstellen werden markiert, und das Fehlende wird ergänzt.
Wie also gingen in jenen Jahrzehnten Autoren vor, die von ihrer Zeit und dem Leben darin erzählten, das nun einmal in Wort und Tat ohne Sex nicht zu haben ist? Dass es bei ihm »Schilderungen« gebe, wies Theodor Fontane entrüstet und völlig zu Recht von sich. In seinen Romanen jedoch sind Ehebrüche und andere Liebesakte Teil der erzählten Handlung, sie werden sozusagen live, wenn auch sorgsam kaschiert, vor den Augen der Leser vollzogen. Die Lösungen, die Autoren und Autorinnen angesichts der Gemengelage von Gesetzen und Zensur, von ästhetischer Sensibilität und sittlichem Empfinden, aber auch von Publikumswünschen und ökonomischen Erwägungen fanden, unterschieden sich von Roman zu Roman. Die Lage war prekär, doch selbst Tolstoi kam um Sex und sehr beredtes Schweigen darüber nicht herum.
Diese Probleme gehören der Vergangenheit an. Seit einigen Jahrzehnten hat niemand mehr Grund, sich mit andeutenden Auslassungen in alten Romanen oder auch nur mit der verklemmten Andeuterei der Schlagerwelt zufriedenzugeben. Vom weltweiten Angebot wird reger Gebrauch gemacht. Was den Pornografiekonsum angeht, nehmen die Deutschen eine führende Position im internationalen Ranking ein. Selbst im Tatort, dem wöchentlichen Länderspiegel deutscher Befindlichkeiten, gibt es nun mehr zu sehen als weiland Schimanski in der Dusche und mit Handtuch um die Hüften. In der Literatur wurden mehr oder weniger breit und gekonnt ausgeführte Sexszenen zur Regel. Am unteren Ende der Dichterskala ist nur das Eine zu holen, aber spannend wird es gerade dort, wo der ästhetische Anspruch an Texte und die Erwartungen der Kunstschaffenden an sich selbst hoch sind. Dann besteht nämlich beträchtliche Gefahr, dass die Darstellung der Liebeshandlungen missglückt, und es kann heiter werden.
True to style machen die Briten daraus eine jährliche Show. Seit 1993 wird von der Zeitschrift Literary Review der Bad Sex Award für herausragende Leistungen bei der Produktion geschmackloser und überflüssiger Sexszenen in ansonsten zumindest soliden Romanen verliehen. Großmeister Tom Wolfe sowie Wortschmied und Schmerzensmann Morrissey zählen zu den Preisträgern. John Updike darf selbstverständlich nicht fehlen. Zwar gelang es ihm trotz mehrfacher Nominierungen in keinem Jahr, die Konkurrenz entscheidend zu unterbieten, 2008 erhielt er aber immerhin eine Auszeichnung für seine literarische Lebensleistung. Manchen Autoren und Autorinnen gelingt der Sprung auf die Shortlist, weil in den einschlägigen Passagen ihrer Werke die Maßstäbe für die Größe von Körperteilen fehlerhaft erscheinen; ebenfalls gute Aussichten für eine Nominierung eröffnen die unter Originalitätsdruck geschehenen Fehlgriffe bei der Auswahl der Metaphorik. Die sprachlichen Bilder sollen nämlich sowohl die Ekstase der Akteure erfahrbar machen als auch künstlerisch überzeugen. Das folgende, eher harmlose Beispiel stammt aus dem 2019 für die Bad Sex-Auszeichnung nominierten Roman City of Girls von Elizabeth Gilbert:
Then I screamed as though I were being run over by a train, and that long arm of his was reaching up again to palm my mouth, and I bit into his hand the way a wounded soldier bites on a bullet.
Es darf als sicher gelten, dass diese Vergleiche zuvor noch nicht verwendet worden waren, um den Leserinnen und Lesern weibliche Empfindungen auf dem Höhepunkt eines Liebesaktes nahezubringen. Leicht löst der anspruchsvolle Wunsch, dass die Vorgänge heftig, die literarischen Mittel aber apart sein sollen, ein zweischneidiges Schwert aus, bei dem der Schuss nach hinten losgeht.
Vor einigen Jahren legte Rainer Moritz mit seinem Buch Matratzendesaster eine kommentierte Sexstellenrundschau für die Gegenwartsliteratur vor. Für eine Reihe von Autoren konstatiert Moritz eine post-agonale Vermeidungs- oder Verweigerungshaltung, was Sex in ihren Texten angeht. Sie schildern keinen Sex, nicht – oder weniger – aus Prüderie, sondern entweder, weil Sex nicht mehr länger als Baustein einer Befreiungstheologie überhöht wird, oder um sich dem Leerlauf der Überbietungen und des modischen Zwangs zu Novitäten zu entziehen. Seit dem großen sexuellen Aufbruch in den sechziger Jahren wurde es in der Literatur zunächst möglich, dann beinahe verpflichtend, den Körpersäfteaustausch der Protagonisten zu beschreiben. Einige wenige Autoren und Autorinnen waren vielleicht versucht, entzogen sich aber dem Trend. So fasste Max Frisch den Entschluss, die Finger davon zu lassen, nachdem ihm seine Schreibexperimente in dieser Richtung als missraten erschienen. Der alternde Martin Walser hingegen entschied sich, noch einmal mitzumischen. In Angstblüte (2006) findet sich folgender stichomythischer Wechselgesang:
Hast du den Steifen drin.
Ich habe den Steifen drin.
Ist deine Fotze scharf auf meinen Schwanz.
Meine Fotze ist scharf auf deinen Schwanz.
Bist du nichts als eine geile Fotze.
Ich bin nichts als eine geile Fotze.
Soll der Schwanz dir die Fotze vollspritzen.
Der Schwanz soll mir die Fotze vollspritzen.
Man beachte das Fehlen der Fragezeichen in den männlichen Partien des Zeilengestöhns – ein Kunstgriff, mittels welchem die Funktion dieser Sprechakte adäquat erfasst wird, die ja nicht wirklich auf Informationsvermittlung abzielen. Moritz’ Blütenlese ist eine unterhaltsame Lektüre. Zwar bleibt unklar, nach welchen Kriterien die Darstellungen sexueller Vorgänge denn als verfehlt gelten sollen, aber man fühlt sich mit dem Conférencier dieser literarischen Peepshow durchweg einig. Besonders überzeugend ist das auf schlichtem Alltagswissen beruhende Kapitel Sie rissen sich die Kleider vom Leibe, welches die Phrasendichte routinierter Sexschilderungen vorführt, indem das ekstatische Geschehen kontrastiert wird mit skeptischen Überlegungen zu Reißverschlüssen, Schnallen, Haken und anderen mehr oder weniger verborgen lauernden Tücken der Bekleidungsobjekte. Nicht zuletzt die akute Phrasengefahr löst in der Gegenwartsliteratur eine Tendenz zur »Sexbeschreibungsverweigerung« aus, um die es im abschließenden Kapitel gehen wird.
So schön schlecht und erheiternd viele Beschreibungen von Sex auch sein mögen, sie liegen außerhalb des Themas dieses Büchleins, das sich damit vielleicht um die Hauptattraktion bringt. Was »deftige Stellen« angeht, wird es so ziemlich bei den oben zitierten Passagen bleiben, je nach Perspektive leider oder zum Glück. Hier geht es nicht um Sex, von dem zu viel oder schlecht erzählt wird, sondern im Gegenteil um Sex, von dem nicht erzählt wird. Was auch nicht immer funktioniert und ebenfalls gut oder schlecht sein kann. Wie im Leben kein Sex auf Dauer keine Lösung ist, so kommt auch die Literatur nicht ohne Liebesleben aus. Das gilt jedenfalls dann, wenn es für das Verständnis des Erzählten darauf ankommt, ob – und möglicherweise wie – die Figuren Sex miteinander haben.
Im Folgenden geht es also um solche literarischen Erzählungen, in denen das Wissen um Geschlechtsakte der Figuren – im schönsten Falle: deren Liebesaktivitäten – einerseits entscheidend dafür ist, dass die Leser ein schlüssiges Verständnis des Geschehens entwickeln können, dieser Sex andererseits aber nicht erzählt wird, im Text also keine oder so gut wie keine Erwähnung findet. Es gibt dort also keine »Stellen«, und die Leser müssen sich die körperliche Liebe der Figuren mehr oder weniger konkret vorstellen, um zu einem sinnvollen Verständnis des Textes zu gelangen. Sie müssen annehmen, dass bestimmte Figuren sich miteinander im Bett oder andernorts vergnügt haben, oder zumindest, dass auf irgendeine Weise Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Die Mitarbeit der Leser ist gefordert: Sie – erwachsene, im Leben und Lieben erfahrene Menschen – müssen ihre Vorstellungskraft und ihr Wissen davon, wie die Welt und die Akteure darin funktionieren, bei der Lektüre einsetzen.
Das Publikum ist grundsätzlich immer in der Lage und gerne bereit, mitzuspielen und das Ungesagte zu ergänzen; die Autoren setzen diese Kompetenz voraus und starten, steuern oder manipulieren die Kollaboration. In einer Variante einigen sich die Parteien kultiviert darauf, dass alles sich von selbst verstehe und es keiner weiteren Worte bedürfe. Diese vertrauensbildende Maßnahme nutzte Heinrich von Kleist in Die Verlobung von St. Domingo an einer Stelle aus, an der die Leser eigentlich schon nichts und niemandem mehr etwas glauben sollten. Dort ist dem jungen Offizier die »einnehmende Gestalt« des Mädchens aufgefallen, man kommt sich gesprächsweise näher, und schließlich überkommt auch sie »ein menschliches Gefühl«. Es folgt der Satz, der distinguierte Einvernehmlichkeit herstellt, wenn auch in betrügerischer Absicht: »Was weiter erfolgte, brauchen wir nicht zu melden, weil es jeder, der an diese Stelle kommt, von selbst liest.« Kleist machte hier von einer soignierten Konventionalität Gebrauch, um die Leser zu umgarnen und das Aufkommen von Distanz und Misstrauen zu verhindern.
Erzählungen, die gänzlich verhindern wollen, dass sich der Mechanismus zur Decouvrierung erotischer Bedeutungen bei den Lesern in Gang setzt, müssen einen erheblichen Aufwand betreiben. Schon das geringste Indiz, dass Sex stattgefunden haben könnte, löst nämlich einen Verdacht und eine Suche nach Beweisen aus. Das beste Beispiel findet sich wiederum bei Kleist. Eingangs seiner Erzählung Die Marquise von O… steht der am schwersten befrachtete Gedankenstrich wohl nicht nur der deutschen Literatur. Die Vergewaltigung, die sich hinter diesem Zeichen verbirgt, muss allen verborgen bleiben, damit die Geschichte überhaupt funktioniert. Dass der Abbruch des mit »Hier –« begonnenen Satzes die Lösung erfolgreich zu verbergen vermag, liegt am umfassenderen Täuschungsmanöver des Erzählers, der den Lesern nahelegt, die syntaktische Unordnung als ein Mittel zur Wiedergabe des tumultuarischen Kriegsgeschehens zu verstehen. Nur mittels Mord und Totschlag kann das Vorstellungsvermögen der Leser vom Sex ab- und auf andere Bahnen gelenkt werden. Darunter geht es nicht, wie wir im Abschnitt über Dante sehen werden. Dieser scheiterte so zwangsläufig wie wunderschön bei dem Versuch, ein im Inferno auf ewig sich liebendes Paar von dessen sehr irdischen Vorgeschichte zu lösen.
Eine abschließende Bemerkung noch zur Klärung der Ausgangslage. Bei den sexfreien Stellen, die wir betrachten werden, muss es sich um geschlechtliche Akte von Figuren in konkreten Situationen des Plots handeln. Ohne eine solche Einschränkung liefe es auf die Vermutung einer globalen konspirativen Veranstaltung hinaus. Die Weltliteratur bestünde nämlich »aus einer Verschwörung des Schweigens, mit einer unvorstellbaren Fülle unterdrückten Materials«, wenn die Dar- oder Klarstellung sexueller Handlungen überall dort verlangt wäre, wo von mehr als einer Generation von Akteuren erzählt wird. Dann enthielten uns selbst die Geschlechterkataloge der Genesis etwas vor, was für das Verständnis notwendig wäre.
Dies sind die Geschlechter Sems: Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arphachsad, zwei Jahre nach der Sintflut, und lebte darnach 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arphachsad war 35 Jahre alt und zeugte Salah und lebte darnach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
Und so fort über die Abfolge und Verzweigungen der Stammväter hinweg. Hinter diesen Aufreihungen verbargen sich mythologische Vorstellungen und ein politisch-theologisches Programm. Die Rhetorik zielte aber nicht darauf ab, etwas ungesagt zu lassen, was für das Verständnis unumgänglich zu ergänzen wäre. Zudem darf als sicher angenommen werden, dass die biblischen Genealogien noch bei niemandem einen erotischen Frisson ausgelöst haben, so wenig wie in unseren Tagen ein Schriftstück aus dem Einwohnermeldeamt Vorstellungen darüber in Gang setzen wird, wie es bei der Zeugung der urkundlich genannten Person zugegangen sein mag.
Ein Maß solcher Dinge: Das Lieben des Odysseus
Gesetze können zwar festlegen, dass die Verbreitung von Pornografie oder Obszönitäten verboten ist, unter den Bedingungen liberaler Staatlichkeit bereitet es aber größte Mühe zu bestimmen, ob im Einzelfall ein Straftatbestand vorliegt. Es läuft dann in der Regel auf die Frage hinaus, ob das strittige Objekt ein Mach- oder noch – oder schon – ein Kunstwerk ist. Das ist die Stunde der Experten und der Gutachten. Wenn es so genau aber nicht kommt, reicht die poetische Definition der Pornografie völlig aus, die Reiner Kunze in Die wunderbaren Jahre formulierte: »In der Pornografie kommen Menschen vor, weil die Geschlechtsteile Füße brauchen.«
In diesem entspannten Sinne soll hier die Frage behandelt werden, wann es sich in Romanen um eine Leer- statt einer Sexstelle gehandelt hat. Wann soll der Sex, der zur Handlung notwendigerweise hinzugedacht werden muss, als verschwiegen gelten? Oder, anders herum, wie explizit müssen Texte werden, damit es sich nicht um eine Auslassung, um eine Ellipse, handelt? Die Aufgabe lautet demnach zu bestimmen, was als das erzähltechnische Äquivalent eines minimum viable product gelten soll, als eine minimally explicit sex scene also. Wie ist diese Einheit von 1 MESS festzulegen? Statt nun terminologische Abwägungen und historische Relativierungen vorzutragen, sei im Folgenden von der sehr irdischen Liebe des Odysseus zu Penelope erzählt.
Lange Zeit galt es als ausgemacht, dass sich die starken Männer der homerischen Epen abseits der Schlachtfelder wie unreife Kinder verhalten. Anders aber als bei Kindern sei bei ihnen keine Entwicklung zu beobachten. Immer wieder entbrennen die Helden in Racheverlangen und Wutanfällen; sie brausen auf und töten im Zorn; dann wieder sind sie todtraurig und ziehen sich schmollend zurück. Keine Entwicklung der Charaktere, kein Lernprozess durchziehe den Verlauf der Ereignisse. Stets gehen sie, nach dieser Sichtweise, ganz im gegenwärtigen Geschehen auf und sind am Ende, auch am eigenen, immer noch die, als die sie anfangs samt ihren schmückenden Beiwörtern den Hörern vorgestellt wurden.
Wir wissen heute, dass dies nicht stimmt, für die Odyssee noch weniger als für die Ilias. In beiden Epen ist es die Liebe, die ausgewählten Figuren ihre Tiefendimension verleiht. In der Ilias bereut Helena ihre Untreue und kehrt zu Menelaos zurück. Die beiden, schrieb vor wenigen Jahren ein Homer-Forscher, »leben jetzt als glückliches Paar« wieder daheim in Sparta. Angesichts der blutigen Ereignisse, die Helenas zwischenzeitlicher Partnerwechsel zum schönen Paris ausgelöst hatte, erinnert das zwar an Roland Beiers berühmte Karikatur von 1990, die einen mäßig resignierten Karl Marx zeigte mit Händen in der Hosentasche und der Sprechblase »Tut mir leid Jungs! War halt nur so’ne Idee von mir …«. Das homerische Epos aber meinte es nicht zynisch.
Zehn Jahre lang belagert das Heer der Griechen das befestigte Troja; weitere zehn Jahre dauert die anschließende Irrfahrt des Odysseus bis zur Rückkehr in die Heimat Ithaka. Ganz zu Beginn wird uns Odysseus vorgestellt als zwar göttergleich, aber auch leidend im sehnsüchtigen Verlangen nach der Heimat und der geliebten Penelope:
Alle die andern, soweit sie dem jähen Verderben entkommen, waren bereits zu Hause, entronnen dem Krieg und dem Meere; ihn allein, der vor Sehnsucht verging nach Heimkehr und
Gattin,
hielt die Nymphe Kalypso zurück, die Göttin, die Herrin,
in dem Grottengewölbe, drauf brennend, er werde ihr Gatte.
Dies klingt hier zwar, als habe Odysseus die gesamte Zeit seit der Einnahme Trojas auf der Insel der Kalypso verbracht, doch handelt es sich ebenfalls nur um eine Episode, wenn auch um eine von mehreren Jahren. Insgesamt sind es drei Frauen, denen der Held, an der Heimkehr gehindert von Poseidon, auf seiner Irrfahrt begegnet und die seine große Liebe auf die Probe stellen. Der Dichter des Epos tat alles, um die teils widerstrebenden mythischen Überlieferungen zuzurichten auf die eine Liebe des Odysseus zu Penelope. Der Königstochter Nausikaa entsagt der Held, auch wenn es eine royale Traumhochzeit gewesen wäre; mit der Zauberin Kirke geht er auf Geheiß des Hermes ein Zweckbündnis ein; und die Nächte mit Kalypso sind für Odysseus freudlos und wechseln ab mit Tagen, an denen er schwermütig über das Meer in die Ferne schaut.
Das Epos gibt uns zu verstehen, dass es mit Kirke zwar zu einem Geschlechts-, aber nicht zu einem Liebesakt kommt. Nur die Zauberin spricht von einer Vereinigung »in Lager und Liebe«; seitens des Helden aber ist von Liebe keine Rede. Zunächst verlangt er, auf Hermes’ Anweisung, dass sie ihre bedrohlichen Fähigkeiten nicht einsetzen wird, erst dann ist er zum Vollzug des Rituals bereit:
Als sie aber geschworen den Eid, ihn zu Ende geleistet,
da bestieg ich das überaus schöne Lager der Kirke.
Das Verhältnis von Kirke und Odysseus bleibt überraschend sachlich, von Eros kaum eine Spur. Das wird anders sein mit Kalypso. Mit ihr verbindet ihn mehr, aber auf Dauer nicht genug, um ihn die Liebe zu Penelope vergessen zu lassen. Mehrere Jahre verbringt er mit der Halbgöttin auf ihrer Insel Ogygia, doch mit zunehmender Dauer nagt die Sehnsucht nach der Heimat und der sterblichen Gattin immer stärker an ihm. Die aussichtslos liebende Kalypso wird schließlich von Hermes gemahnt, Odysseus nun endlich ziehen zu lassen, denn dies sei der Wille der Götter. Daraufhin findet sie den Geliebten
an der Küste sitzend; und niemals wurden die Augen
trocken ihm von Tränen; das süße Leben verrann ihm,
der um die Heimkehr klagte, denn nicht mehr gefiel ihm
die Nymphe.
Freilich, die Nächte schlief er, wenn auch nur unter Zwange, in dem Grottengewölbe, nicht wollend bei ihr, die es wollte.
Die Lust ist ihm lange schon vergangen. Die liebende Kalypso wird schon Mittel gekannt haben, um den Liebhaber auf Fahrt zu bringen. Sie weiß jedoch bereits, dass es vergeblich sein wird, auch wenn sie noch einmal versucht, ihn zum Bleiben zu bewegen, indem sie ihm die bevorstehenden Leiden und Gefahren der weiteren Fahrt vor Augen stellt. Wüsste er, was da noch kommt, würde er das Bleiben und die Unsterblichkeit vorziehen. Dann
bliebst du wohl hier am Ort und würdest das Haus mit mir
hüten
und unsterblich sein, wie sehr du begehrst, deine Gattin
wiederzusehn, nach der du dich sehnst stets alle die Tage.
Und, nicht zu vergessen, da wäre noch etwas. Sie hat ja wohl einiges zu bieten:
Sicherlich bin ich ihr nicht unterlegen, so darf ich mich rühmen nicht an Gestalt, nicht an Wuchs, da sich’s für sterbliche Frauen durchaus nicht ziemt, mit unsterblichen sich zu messen im
Aussehn.
Er gibt ihr Recht. Er schmeichelt der zeitlos Schönen, bekennt ihr aber, dass er trotz allem in die Welt der Menschen und zu seiner Menschenliebe zurückkehren möchte.
Mächtige Göttin, sei mir deshalb nicht böse! Ich weiß ja
Selber ganz genau, dass die kluge Penelopeia
Minder an Aussehn und Größe erscheint für den, der sie
ansieht.
Sie ist ja sterblich, du unsterblich, und nie wirst du altern.
Doch er kann nicht bleiben. Heimweh und Liebe vermischen sich in ergreifender Weise. Im Kino wäre dies ein mit Streichermelodien unterlegter Moment, in dem die Zuschauer mit den Tränen kämpfen. Dieses offene Gespräch bringt Klärung ins verfahrene Verhältnis zwischen Odysseus und Kalypso, und auch seine Lust wird wieder rege.
Und sie gingen beide ins Innre des Grottengewölbes
Und genossen die Liebe, beieinander verweilend.
Man weiß, wie es ausgeht. Nachdem Odysseus, wieder daheim in Ithaka, die prassenden Freier beseitigt und sich Penelope zu erkennen gegeben hat, begibt sich das wiedervereinigte Paar »voller Freude zur Stätte des altehrwürdigen Bettes«, und dort genießen sie die »Wonnen der Liebe«. Fast wie ein abschließender Spaß wirkt die Kalypso-Episode in dem Bericht des Geschehenen, den Penelope in der Nacht ihrer Wiedervereinigung von Odysseus zu hören verlangt. Auch als Erzähler ist er verschlagen; mehrdeutig manövriert er sich durch die Gefahr. Von ihrem wiedergefundenen Gatten erfährt Penelope
wie er zur Insel Ogygia kam und zur Nymphe Kalypso,
welche ihn zurückhielt, drauf brennend, er werde ihr Gatte,
in dem Grottengewölbe und ihn ernährt und versprochen,
unsterblich ihn zu machen, nicht alternd über die Jahre;
doch sie konnte nie das Herz in der Brust ihm bereden.
Wir erfahren nicht, ob Penelope ihm dies als die volle Wahrheit abnimmt. Sicher, das Angebot der Unsterblichkeit schlug Odysseus aus zugunsten seiner Liebe zur Gattin und ihrem vergänglichen Leib. So möchte er verstanden werden. Dass er das Angebot zum Genuss des göttlichen Leibes nicht ebenso standhaft zurückwies, bleibt ungesagt. Doch dieser erzähltechnische Dreh des listenreichen Odysseus liegt außerhalb unseres Themas.
Die Liebesepisoden in der Odyssee benennen eindeutig und offen die sexuellen Aktivitäten. Wo Liebe das Verhältnis prägt, wird nicht nur ein gemeinsames Lager bestiegen, sondern die Paare genießen ihre Vereinigung und ihre Körper; weitere Einzelheiten der Liebeshandlungen oder gar individuelle Vorlieben und Praktiken werden nicht genannt. Homers Schilderungen des sexuellen Vergnügens eignen sich deshalb zur Festlegung eines ›Normalnull‹ auf einer Skala, mit der sich literarische Darstellungen körperlich vollzogener Liebe einordnen lassen. Mehr Details sind jederzeit möglich, aber nicht notwendig; weniger hingegen liefe auf Verbergen hinaus.
Wenn Erzählungen sich in diesem Bereich bewegen, steht dies einer erotisierenden Wirkung nicht entgegen. Die Vorstellungskraft der Leser wird in Gang gesetzt, aber durch keine Details festgelegt oder gar gegängelt. Peter Handke, der sich bekanntlich von Homer herzuschreiben bemüht, argumentierte mit diesem Effekt gegen den Vorwurf, er wirke arg prüde und seine Bücher seien in Liebesdingen saft- und kraftlos. Nichts sei doch erotischer als die ganz der Liebe gewidmeten Nächte bei Homer, und von solchen sei zum Beispiel in Mein Jahr in der Niemandsbucht die Rede. In der entsprechenden Passage dort gesteht der Erzähler zunächst, bei der Darstellung der phyischen Liebe seiner Figuren mit Wortfindungsschwierigkeiten geschlagen zu sein, versucht aber sogleich, diese Not in einen erotischen Zugewinn zu verwandeln:
Nie habe ich gewußt, mit welchem Zeitwort von der Körperliebe erzählen. Am nächsten kam jenes Verb aus der Odyssee, wo es von Mann und Frau heißt, daß sie miteinander ›ruhten‹, oft ›die ganze Nacht‹, ›bis in die Morgenröte hinein‹. Und so hatte auch ich immer wieder mit dieser Frau geruht.
Es sei dahingestellt, ob solche Passagen die Kritik entkräften. Zwar gesteht Handke 1 homerisches MESS als optimal zu, strebt es selbst aber nur indirekt an, über den Umweg einer Anrufung des Meisters. Dafür muss es Abzüge geben: Es werden maximal 0,5 MESS erreicht. Im Abschlusskapitel werden wir auf Handkes erzählerische Abstinenz oder wenigstens Retizenz in sexualibus zurückkommen.
Fehlanzeigen: Über Leerstellen und ihren Sex-Appeal
In einem Essai über einige erotische Verse in Vergils Aeneis verlieh Michel de Montaigne seinem Erstaunen darüber Ausdruck, dass die Menschen ohne Zögern und Hemmungen über gewalttätige und verbrecherische Geschehen sprächen, es aber nicht ohne Herumdruckserei abgehe, wenn das Thema der Geschlechtsakt sei, »dieser so natürliche, nützliche, ja notwendige Vorgang«. Aber solche Auslassungen und Indirektheiten stünden der Verständigung offenbar nicht im Weg, denn die Worte, »die am wenigsten in den Mund genommen« werden, seien »zugleich die bekanntesten und am besten verstandnen«. Es gebe einfach niemanden, dem die verschiedensten Bezeichnungen für das Sexuelle »minder geläufig wären als das Wort Brot«. Wo also gedruckst, ge- und verschwiegen wird, erschließen Hörer und Publikum mühelos, wovon da nicht die Rede ist. Offenbar sind alle jederzeit bereit, Unanständiges anzunehmen und herauszuhören.
Und so kommt es doch immer heraus. Sex lässt sich nicht verstecken und verschweigen, zumindest gilt das für die Literatur. Wenn die Leser auch nur den geringsten Grund für die Annahme haben, dass es unter den Figuren der imaginären Welt zu sexuellen Handlungen gekommen ist, dann werden sie das gesamte Geschehen mit diesem Verdachtsmoment abgleichen. Gibt es weitere Hinweise? Klingen Formulierungen nach Ausflüchten? Läuft da noch was im Verborgenen? Wir sahen schon, welchen mörderischen Aufwand Kleist in Die Marquise von O… betreiben musste, um die Leser von der unwahrscheinlichen, aber korrekten Spur abzubringen, die der beühmte Gedankenstrich gelegt hatte. Welche kleinsten Details reichen nämlich als Indizien nicht aus, um die Figuren der vollzogenen geschlechtlichen Beziehung zu überführen! Lange Zeit haben sich die Thomas-Mann-Forscher mit der Frage geplagt, ob Hans Castorp und Clawdia Chauchat im Zauberberg denn nun oder nicht. Der Konsens am Ende der Debatte lautet: Sie haben. Der Beweis: ein Bleistift, dessen Retournierung Clawdia erbittet und dessen vollzogene Rückgabe einige Seiten später bestätigt wird.





























