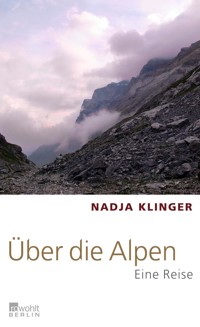
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Alpen sind eine der letzten mythischen Großlandschaften Europas, eine mächtige Grenze, die den Kontinent von jeher in Nord und Süd teilt. Nadja Klinger hat sich auf die Reise gemacht, um die Aura einzufangen, die dieses gewaltige und sagenumwobene Gebirge umgibt, aber auch um die Spuren nachzuzeichnen, die der Mensch in den Alpen hinterlassen hat. Sie durchquert das Gebirge zu Fuß, vom nördlichen Bodensee zum südlichen Lago di Como. Auf legendären Straßen wie der halsbrecherischen Via Mala und auf traumschönen Saumwegen, entlang von Schluchten wie jenen, an denen Hannibal einst mit seinen Elefanten scheiterte, und über Pässe, wie sie schon Napoleon mit seiner Armee bezwang. Sie begegnet ruppigen Wirten, philosophischen Bergverstehern, Heidi – und Alpentouristen, die keine Natur ertragen. Das außergewöhnliche Reisetagebuch einer mutigen, oft wagemutigen und stets für alle Eindrücke offenen Suche nach den Bergen und dem, was der Mensch aus ihnen gemacht hat, indem er über sie erzählte, indem er sie eroberte, besiedelte und veränderte. Eine Hommage an eine einzigartige Landschaft und das Dokument einer ungewöhnlichen Reise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Nadja Klinger
Über die Alpen
Eine Reise
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Zitat
Vorm Losgehen
Erster Tag: Von Berlin nach Lindau am Bodensee
Zweiter Tag: Von Lindau nach Eugst
Dritter Tag: Von Eugst nach Appenzell
Vierter Tag: Von Appenzell auf die Ebenalp
Fünfter Tag: Auf der Ebenalp
Sechster Tag: Von der Ebenalp nach Wildhaus
Siebter Tag: Von Wildhaus nach Amden
Achter Tag: Von Amden auf die Tannenbodenalp
Neunter Tag: Von der Tannenbodenalp zum Ober Murgsee
Zehnter Tag: Vom Ober Murgsee nach Elm
Elfter Tag: Von Elm nach Ilanz
Zwölfter Tag: In die Ruinaulta
Dreizehnter Tag: Von Ilanz auf den Glaspass
Vierzehnter Tag: Vom Glaspass nach Thusis
Fünfzehnter Tag: Von Thusis nach Donat
Sechzehnter Tag: Von Donat in die Rofflaschlucht
Siebzehnter Tag: Von der Rofflaschlucht nach Cröt
Achtzehnter Tag: Von Cröt nach Juf
Neunzehnter Tag: Von Juf nach Soglio
Zwanzigster Tag: Von Soglio nach Chiavenna
Einundzwanzigster Tag: Von Chiavenna zum Lago di Como
Quellen
Für Markus Grieshaber,
den Drogisten von Wildhaus,
und natürlich für Heidi.
«Ach ja! Ich bin schon öfters einer begegnet. Und dös muß ich sagen, die haben mir allweil gefallen. Ich bin net gut auf d’ Weiberleut z’reden. Aber wann ich merk, daß eine ihr Freud an der lieben Natur und an die Berg hat, da lupf ich mein Hütl net ungern. A bißl Grechtigkeit muß der Mensch auch bei den Weiberleut gelten lassen.»
Förster Kluibenschädl in Ludwig Ganghofer:
«Das Schweigen im Walde». (1899)
Vorm Losgehen
Wenn ich erzählte, dass ich im Sommer 2009 vom Bodensee zum Lago di Como, von Deutschland über die Alpen nach Italien gehen will, stellte man mir stets die gleiche Frage: Wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter? Ich wusste es nicht. Bis heute, da ich von der Reise zurück bin, weiß ich es nicht.
Ich will es auch nicht wissen.
Maßeinheiten sind der Versuch, sich eine Vorstellung zu machen. Das Gebirge zu fassen zu kriegen, und zwar auf gewohnte Weise. Maßeinheiten machen das Gebirge kleiner.
Ich habe Kraft gebraucht, um durch die Alpen zu gehen, Ausdauer und Wagemut. Der größte Aufwand jedoch bestand darin, mich auf die Alpen einzulassen. Zu fragen und nach Antworten zu suchen. Zu sehen.
Dennoch stecken in der Geschichte meiner Reise viele Zahlen. Der Mensch hat Jahrtausende gebraucht, um ins Gebirge vorzudringen. Er hat die Höhe der Berge gemessen und die Länge der Gletscher. Der Mensch hat in den Alpen Krieg geführt und unzählige Opfer verschuldet. Heute zählt er die Passagiere der Skilifte, die Übernachtungen in Hotels und Herbergen, sorgt für ein gewisses Verkehrsaufkommen und misst die Verschmutzung der Luft. Das Gebirge hat all die Zahlen nicht hervorgebracht. Es hat die Menschen nicht eingeladen, sich am Berg niederzulassen, und es hat ihnen das Leben dort nicht leicht gemacht. Das Gebirge ist einfach nur da.
Wenn ich mir etwas für die Alpen wünschen könnte, dann wäre es dies: dass der Mensch sie als die mächtige, natürliche Grenze begreift, die mitten in Europa steht und den Kontinent in Nord und Süd teilt. Dass er sich dieser Grenze respektvoll nähert. Dass er innehält und nach angemessenen Wegen sucht, ehe er sich daranmacht, sie zu überschreiten.
Erster Tag:
Von Berlin nach Lindau am Bodensee
Samstag, den 15.August
Die Stadt sagt nichts. Sie döst im schmeichelnd fahlen Morgenlicht und atmet eine dieser würzigen Sommernächte aus, die Berlin so attraktiv machen. Sie hat Tauben zum Gurren einbestellt. Die Vögel sind schmutzig, grob und grau, aber sie sind mein Zuhause. Soll ich’s mir anders überlegen?
Seit Monaten rüste ich zum Aufbruch. Ich habe mir vorgestellt, wie es ist, die Alpen zu überschreiten, und versucht, die Vorstellung nicht wieder zu verlieren, während ich mich mit der Route beschäftige. Ich habe mir eine Ausrüstung angeschafft, habe «korrosionsbeständige» und «ermüdungsresistente» Aluminiumwanderstöcke mit «integriertem Dämpfungssystem», mit «Neopren gefütterten Systemschlaufen» und «Vari-Flexspitze» gekauft. Mit einer Liste an Wichtigkeiten in der Tasche bin ich an den mit Farben und Stimmen gefüllten Straßencafés vorbeigegangen. Ich konnte mir problemlos vorstellen, in der Stadt zu bleiben. Gestern Abend habe ich Helm, Seil und Biwaksack in meinem Rucksack verstaut. Draußen ging ein Gewitter los. Die Straßenbäume warfen eine große Ladung Laub ab. Plötzlich war Herbst. Und mein Gepäck viel zu schwer.
Ich bin jetzt die Besitzerin einer schwarzen Daunenweste, die das Talent hat, sich im Rucksack ganz klein zu machen, am Körper jedoch riesigen Komfort zu entfalten. Bald werde ich sie nur noch «mein Wohnzimmer» nennen. Ich besitze einen Hüttenschlafsack, der in meine Hosentasche passt. Ich besitze hauchdünnes Papier, das sich in Seife verwandelt, wenn ich draufspucke. Sollte ich mich verlaufen, kann ich in meinem reißfesten roten Biwaksack übernachten, den ich so weit zuziehe, dass nur noch mein Gesicht rausguckt. Ich werde auf dem Rücken liegen, in den Himmel schauen, und wenn der Scheinwerfer des Hubschraubers mich berührt, werden auf meinem Kokon vier Buchstaben aufleuchten: HELP. Meine Retter brauchen nicht einmal zu landen. Sie müssen bloß den Biwaksack, in dem ich liege, an einem Seil befestigen, um mich zu bergen.
Lieber nicht.
Wenn die Wasserflaschen gefüllt sind, dürfte der Rucksack zwölf Kilo wiegen. Die Haustür kracht hinter mir zu. Der erste Schritt fühlt sich anders an als der zweite, der dritte, der vierte… Es geht los.
***
Aus der Ferne betrachtet, bestehen die Alpen aus unzähligen Höhenlinien in Braun, Schwarz und Blau, die auf den Schweizer Wanderkarten Erdboden, Geröll und Gletscher anzeigen. Die Linien krümmen sich, sind mit Zahlen versehen, halten mal mehr und mal weniger Abstand. Sie teilen einem mit, ob man einen Hang hinauf oder steil bergab muss. Die Alpen bestehen aus Felsblöcken, Moränen und Einschnitten. Es gibt Höhlen, Schlipfe und Dolinen. Es liegt einiges im Weg, und es gilt vieles zu beachten. Einschnitte spalten den Gesteinskörper mitunter sehr tief. Höhlen bieten nicht zwangsläufig Schutz. Wo ein Schlipf ist, bewegt sich die Erde. Möglicherweise. Bei Regen. Wie stark muss es regnen? Manchmal rutscht ein ganzes Dorf ab. Das Gebirge bürgt für nichts. Es bietet Erfahrungen, aber kein sicheres Geleit.
Unter den Alpweiden im Oberen Toggenburg verbergen sich unzählige Dolinen. Große Löcher im Erdboden münden in trichterförmige Röhren von mehreren Metern Durchmesser, die bis zu einem halben Kilometer tief in die Erde reichen. Wenn die Bauern das Weideland von Geröll befreien, werfen sie die Steine in die Dolinen und lauschen, wie sie im Fall gegen die Bergwände schlagen. Sie hören es donnern.
Einmal passieren Heidi und ich bei Nebelwetter den Toggenburger Höhenweg. Wir gehen langsam, weichen den Dolinen aus und bleiben dicht beisammen. Aus der Ferne betrachtet, handelt es sich bei den sogenannten Donnerlöchern eben bloß um Löcher.
Warm ist es an diesem Tag, rasch geht unser Wasservorrat zur Neige, und plötzlich haben wir keinen einzigen Tropfen mehr. Die Alpen bestehen auch aus Quellen, Bächen und Flüssen. Nicht aber dort, wo Regen und Schmelzwasser über Dolinen ins Erdinnere entschwinden. Vor einiger Zeit hat man verschiedene fluoreszierende Farbstoffe in die unterirdischen Höhlengewässer im Oberen Toggenburg gekippt. Dann hat man wochen- und monatelang in den Quellen der näheren und weiteren Umgebung nach dem leuchtend bunten Wasser gesucht. Man fand es, alle Farben vermischt in einer einzigen Quelle, südlich der angrenzenden Gebirgskette. Aus der Ferne betrachtet, sind die Alpen nicht mehr als das, wozu unser Vorstellungsvermögen ausreicht.
***
Der ICE bremst, rollt ein Stück, bremst wieder, hält. Der Zugführer meldet einen Schaden am hinteren Triebkopf. Einer der Reisenden im Großraumwagen erhebt die Stimme. Er spricht die Worte «hinterer Triebkopf» in einem Atemzug mit dem Wort Eschede aus. In Eschede hat sich vor Jahren ein verheerendes Zugunglück ereignet. Ein anderer Mann meint, der Triebkopf sei nicht schuld gewesen. Ein Dritter erzählt von einem ICE, der kürzlich arglos durch die Bundesrepublik gerast ist. Nahe der Stadt Offenbach signalisierten ihm die entgegenkommenden Züge, dass sein hinterer Triebkopf lichterloh brennt. Ein vierter Mann mischt sich ein. Er ist sich sicher, dass wir nichts zu befürchten haben. Unterdessen lese ich in einer Zeitschrift, dass Männer im Dunkeln besser hämmern. Frauen wiederum treffen bei Licht die Nagelköpfe mit größerer Zielsicherheit als Männer. Allerdings sei schlechte Beleuchtung heutzutage die realistische Heimwerkerbedingung.
Nach einer Stunde Bremsen, Rollen, Bremsen stehen alle ICE-Reisenden auf dem Bahnhof von Ulm. Ulm hat alle Anschlusszüge fahren lassen. Ulm hat sich auch entschieden, keine Bänke für Wartende aufzustellen. Nur Heidi und ich sind auf unerwartete Zwischenfälle eingerichtet. Wir fläzen uns auf den schmuddeligen Bahnsteig und trinken lauwarmen Prosecco aus der Dose.
Heidi ist bei mir, weil ich Ehrfurcht habe. Weil ich ins Unbekannte will. Weil vier Augen mehr sehen als zwei. Weil Alleinsein gefährlich werden kann. Sie heißt nicht wirklich so. Ihr echter Vorname hat Grazie. Aber in der spröden Natur oberhalb der Vegetationsgrenze hat er nichts verloren. Wenn ich den Namen rufe, zerrt der Wind dran, reißt ihn in Stücke und schleudert ihn an eine Felswand. Heidi hingegen ist eine robuste Buchstabenkonstruktion. Einmal ruhen wir beim Alpenüberqueren auf einem sonnigen Kamm aus. Das üble Wetter staut sich in den Schluchten unter uns, gerade haben wir uns über eine graue Wolkendecke gekämpft. «Das ist alles sehr beeindruckend», sagt Heidi, «aber es kann nicht mein Herz erweichen.» Tage später sucht sie nach einem stundenlangen, steilen Aufstieg über schlechtmarkierte Hänge zwischen riesigen Kuhfladen auf einer hohen Alp einen Platz zum Frühstücken. Sie findet einen Stein, setzt sich drauf, isst aber nicht, sondern heult plötzlich los. «Es ist… so… schön», schluchzt sie. Heidi ist stabil, aber auch dünnhäutig. Ein Name wie ein Berg.
Lindau hat ebenfalls einen passenden Namen. Er bedeutet «Insel, auf der Lindenbäume wachsen». Die historische Altstadt steht nicht auf dem Festland, sondern auf einer Insel im Bodensee. Kursschiffe brechen von hier ins österreichische Bregenz und nach Rorschach in die Schweiz auf. Eine prächtige Mauer aus Südtiroler Sandstein umschließt das Lindauer Hafenbecken. Die Schiffe werden durch eine enge Ausfahrt zwischen zwei steinernen Sockeln manövriert. Auf einem steht der einzige Leuchtturm von ganz Bayern, ein Seezeichen, das sein Signal in die Berge sendet. Auch der sechs Meter hohe steinerne Löwe, der auf dem anderen Sockel thront, dreht seiner Stadt den Rücken zu und blickt, auf seine riesigen Vorderpranken gestützt, hinüber ans andere Seeufer, den Nordrand der Alpen.
In der kleinen Lindauer Bahnhofshalle hängt das Gebirge in einer Vitrine. Orte, die auf unserer Wanderkarte dicht beisammen liegen, sind auf der Reliefkarte durch riesige Erhebungen voneinander getrennt. Manchmal weiß man über etwas Bescheid, aber wenn man es tatsächlich so vorfindet, erschrickt man doch.
Ein- bis zweihundert Millionen Jahre ist es her, da trieben auf der Erdkugel die Afrikanische und die Europäische Platte auseinander. Ein riesiges Meer entstand. Auf dem Boden lagerten sich Sedimente ab. Zweihundert Millionen Jahre später driftete die Afrikanische Platte wieder nach Norden zurück. Das Meer wurde gestaut und die gewaltigen Sedimentschichten zu einer Gesteinskette zusammengeschoben. Immer weiter driftete die Afrikanische Platte, bis sie sich mit der Europäischen verkeilte. Unter dem gewaltigen Druck und der großen Hitze, die dabei entstanden, wurde das Gestein verfestigt und zusammengefaltet. Es bildet den heutigen Alpenhauptkamm. Und immer noch drückt die Afrikanische Platte, schiebt Sedimentdecken übereinander und formt die Alpen zu einem Hochgebirge, das wie Plissee auf dem Europäischen Kontinent liegt. Um es von Nord nach Süd zu überqueren, muss man in andauerndem Auf und Ab die Falten überwinden.
Im Juni 1858 kam der bayrische König MaximilianII. mit einem Tross aus Kammerdienern und 42Pferden in Lindau an. Die Stadt begrüßte ihn mit einem Spalier von Fackelträgern, das sich vom Bahnhof über die Hafenmauer bis zum Leuchtturm und zum Löwen hinzog. Der 57-jährige Monarch mit dem gezwirbelten Oberlippenbart, unter dessen hoher Stirn sich häufig nervöser Kopfschmerz breitmachte, war viel in seinem Land unterwegs. Dieses Mal brach er zu einer Tour von Lindau nach Berchtesgaden auf, am nördlichen Alpenrand entlang, vorbei an wackeren Menschen, die ein Leben in den Bergen zu meistern hatten. Er war Politiker. Das Wohlergehen seines Volkes, Brauchtum und Tradition lagen ihm am Herzen, denn dieses Herz schlug für einen großen Plan: Er wollte die Selbständigkeit Bayerns im Deutschen Bund durchsetzen. Genau wie Politiker heute zog auch Maximilian nicht allein los. In seinem Gefolge hatte er starke Generäle, die beim Aufstieg die Führung übernehmen sollten, Gelehrte standen für kluge Gespräche zur Verfügung. Der Dichter Friedrich von Bodenstedt dokumentierte die Reise für die Öffentlichkeit.
Maximilian war aber auch ein Wandersmann. Niemand in der königlichen Reisegruppe vermochte es, die merkwürdige Gangart nachzuahmen, in der er Alpenwege passierte, ohne sich mit Matsch vollzuspritzen. Auch bei sintflutartigen Regenfällen hielt er sich an den Marschplan. In den Nächten schlief er tief und fest, selbst wenn ein Sturm das Gasthaus schüttelte. Bei Schönwetter brach der König sehr früh auf und stieg auf einen Berg. Wie heute bei Sommertouren von Kanzlerkandidaten wartete auch damals das Volk schon am Hang und schwenkte die Hüte. An den Dorfstraßen, über die der König zog, trällerten Lehrer mit ihren Schulklassen Lieder. Mitten auf dem Weg wurden Blumenbeete angelegt, sodass der Tross die Pferde umlenken musste. Wein wurde spendiert und Hutzelbrot. Was der König selbst nicht aß, hat man eingepackt und mit herzlichen Grüßen der Königin mitgegeben. Eines Abends formierten sich an einem Berg im Oberallgäu die Untertanen zu einem riesigen M.Jeder zündete eine Fackel an, dann lief der leuchtende Buchstabe auf MaximilianII. zu.
«Ich habe schon manche schöne Reise in ferne Länder gemacht, deren Eindrücke überraschender und gewaltiger auf mich gewirkt haben, aber keine, die mir so andauernd innige Befriedigung gewährt hätte wie diese durch meine heimischen Berge und Wälder, die mir samt ihren Bewohnern größtenteils von früh auf schon so gut bekannt waren, dass ich kaum etwas Neues sehen konnte», diktierte der König dem mitreisenden Dichter, «und doch ist mir diesmal alles in ganz neuem Reiz erschienen, wie ein liebes Buch, in dem man schon oft geblättert und das man nun zum ersten Mal Zeit gefunden, im Zusammenhang zu lesen und in traulicher Gesellschaft seine Gedanken darüber auszutauschen.»
Zweiter Tag:
Von Lindau nach Eugst
Sonntag, den 16.August
In der hageren, grauhaarigen Dame in Wanderhose, die am frühen Sonntag als Einzige schon im Speisezimmer des Hotels sitzt, als wir es betreten, steckt ein wenig von dem tapfer tourenden Bayernkönig. Sie hebt die Kaffeetasse, als wäre Champagner drin, und jodelt uns einen Morgengruß entgegen: «Ich schlafe überall besser als zu Hause!»
Ich habe geträumt. Ich war auf einer Insel und kam nicht weg. Man wollte mir kein Schiffsticket verkaufen. Ich habe geschimpft und gefleht, aber niemand konnte mich hören. Es konnte mich auch niemand sehen. Die ganze Nacht habe ich mich verausgabt, um zu beweisen, dass ich existiere. Auch Heidi hat kaum geschlafen, weil vor ihrem Fenster im Parterre die Lindauer Inseljugend zugange war. Für heute sind 35Grad angesagt. «Na ja, Sie beide sind ja gut beisammen», sagt die Wandersfrau.
Wegen meiner schlechten Erfahrungen in der letzten Nacht übernimmt es Heidi, im Hafen die Schiffstickets zu kaufen. Wir setzen uns ins Heck. Von der «Staten Island Ferry» kennt man es so: Die besten Plätze sind hinten, und die Passagiere fahren rückwärts durch die New Yorker Bucht, um lange genug auf die Insel Manhattan zu schauen. Auf unserem Kursschiff jedoch blicken alle in Fahrtrichtung. Der Bodensee schlägt Wellen, und die Wellen da ganz hinten, die sich nicht bewegen, das sind die Alpen. Die Insel Lindau, der Abmarsch- und Abfahrtort mit dem prächtigen Hafentor, ist schon vergessen. Nach einer guten Stunde Fahrt hockt Rorschach am Südufer. Kanton St.Gallen, vierhundert Meter über dem Meeresspiegel, der Hafen eine einzige Kaimauer, schmucklose Schiffsanlegestellen. Wer die Stadt nicht sofort wieder über das Wasser verlässt, muss ins Gebirgsvorland, bergauf.
Im Sommer 1884 kam Emil Jannings in Rorschach zur Welt. Er wurde Schauspieler und eroberte die Berliner Bühnen. Das Königliche Schauspielhaus feierte ihn, er gehörte zum Ensemble von Max Reinhardt am Deutschen Theater, drehte Stumm- und Tonfilme für die UFA. Den Urlaub verbrachte er im Salzkammergut am Alpennordrand, in St.Wolfgang. Er drehte bereits in Hollywood, als er in seinem Urlaubsstammlokal einen kleinen Gag machte, aus dem eine große Geschichte wurde. Sie nimmt ein glückliches Ende, anders als Jannings’ eigene Geschichte.
Das «Weiße Rössl» in St.Wolfgang, wo er sich Ende der zwanziger Jahre mit einem Berliner Revueproduzenten zum Essen traf, war Schauplatz in einem banalen Lustspiel, das seit der Jahrhundertwende aufgeführt wurde. Es handelte von den Urlaubsabenteuern eines Berliners in den Bergen. Jannings, der bald schon, 1929, im Hollywood Roosevelt Hotel den allerersten Oscar der Filmgeschichte verliehen bekommen würde, hatte in dem Stück einst eine kleine Rolle.
«Jrünen Aal mit Jurke!», brüllte er jetzt am Wolfgangsee durchs ganze Lokal.
«Führn wir nich!», rief der Kellner zurück.
Der bullige Schauspieler zeterte und polterte, betreten starrte sein Gast zur Tischplatte. Jannings schmollte. Lautstark verkündete er: «Wär’ ma doch lieber nach Ahlbeck jefahrn!»
Das war peinlich, aber es war nur der Bühnendialog. Der Revueproduzent nahm ihn mit nach Hause.
Im November 193o wurde im Großen Schauspielhaus am Berliner Gendarmenmarkt sein Singspiel uraufgeführt. Es spielt am Wolfgangsee im Talkessel unter Alpengipfeln aus Pappmaschee. Ein Wasserfall rauscht, Ziegen meckern, Sennen, Hirten, Jäger und Schützenmädels tragen Trachten, Rechtsanwälte und Fabrikanten reisen von weit her zum Urlaub an, und eines Tages taucht sogar Kaiser Franz JosephI. auf. Es geht um Liebe und darum, ob Träume wahr werden. Es geht um Sigismund, den die Damen begehren, obwohl er doch gar nichts dafür kann, dass er so schön ist. Nur Bertolt Brechts «Dreigroschenoper» wurde im deutschen Sprachraum häufiger aufgeführt als das Singspiel «Im weißen Rössl». Es lief auch in London, Paris, Rom und am Broadway und wurde mehrmals verfilmt.
Der Wolfgangsee und Emil Jannings’ Stammlokal müssen seither die Vorstellung ausbaden, dass an einem Ort mit großartiger Naturkulisse das Glück quasi vor der Tür steht. Das Glück ist so tröstlich wie trügerisch. In den dreißiger Jahren waren den Nationalsozialisten die Alpen deutsche Heimatkulisse, Hitler regierte demonstrativ auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden, und die Aufführung des «Rössl» wurde verboten, weil auch jüdische Autoren beteiligt waren. Es gibt ein Foto aus dem Jahre 1938, da spaziert der NS-Propagandaminister durch St.Wolfgang. Die Menschen schauen aus den Fenstern, sie winken, Hitlergrußarme ragen ins Bild, und dicht an Joseph Goebbels’ Seite schreitet sichtlich genussvoll Emil Jannings im Jankerl. Weil er in Propagandafilmen der Nazis mitgewirkt hatte, verboten ihm die Alliierten nach Kriegsende, je wieder in Deutschland aufzutreten. Er soll ein trauriger Mann gewesen sein, bevor man ihn 1950 am Wolfgangsee zu Grabe trug.
***
Hinter Rorschach zeigt der gelbe Wegweiser auf eine Wiese. Der Weg versinkt im kniehohen Gras. Heidi war mal Pfadfinderin, im Ruhrgebiet. Sie sucht. Der Weg taucht nie wieder auf.
Wir finden andere Wege und diskutieren darüber, ob es die richtigen sind. Wir haben keine Karte – heute noch nicht. Weil das hier nur Voralpenland ist, weil wir Gewicht sparen wollten, weil, weil, weil. Im Wald liegen gefällte Bäume. Die Kabine eines Forstarbeitergefährts ist mit roten Sofatrotteln behängt, hinter der Frontscheibe stehen ein Plastiktannenbaum mit Weihnachtskugeln und ein Namensschild: Böckli. Heidi stülpt sich einen lustigen grünen Hut über den Kopf, ich beschäftige mich im Gehen mit meinem Rucksack, lockere die Riemen, verlagere die Last von den Schultern auf den Rücken und von dort auf die Hüften. Heidi setzt den Hut wieder ab. Dann setzt sie ihn wieder auf. Es ist unvorstellbar heiß. Zwei gelbe Wegweiser nennen den gleichen Zielort, zeigen aber in unterschiedliche Richtungen. Wir diskutieren heute öfter. Bei Heidi wird allmählich eine Tendenz erkennbar: Sie entscheidet sich immer für den Weg, der nicht bergauf geht.
Hinter Heiden, einem Dorf im Kanton Appenzell Ausserrhoden, das vierhundert Meter über dem Bodensee liegt, blicken wir zurück: Die Luft flimmert, in der Ferne glitzert das Wasser. Von dort her kommen wir zu Fuß! Wir jubeln, bis wieder ein Schild am Wegesrand steht. Es zeigt zurück. Rorschach 2:15 h. Wir sind schon über drei Stunden unterwegs.
Ein Mann und eine Frau, die mit Teleskopwanderstöcken auf Sonntagstour sind, führen uns bis nach Nasen. «Nassen» nennt der Mann die kleine Ansiedlung von Häusern und Kühen, obwohl gar kein Doppel-s in dem Wort ist. Eine Stunde später lernen wir, dass wir Eugst, unseren Zielort, «Eugscht» aussprechen müssen, damit die zwei Frauen, deren Hintern aus den Rabatten eines Vorgartens ragen, überhaupt aufschauen. Sie werden sich nicht einig, hinter welchem der grünen Hügel, die vor uns liegen, das «Landgasthaus Hörnli» steht, das scheinbar «Hörndli» genannt werden muss. Mit ausgestreckten Armen schlagen die Frauen Schneisen in die Luft. Sie reden in einer Sprache, die aus vielen Wörtern wie «öchst», «uffe», «egli», «udli», «igschtli» besteht. Wir verstehen sie nicht. Sie probieren einen hochdeutschen Satz: «Immer grad drauf zu.»
Immer grad drauf zu geht unsere Route durch das Appenzeller Land. Sie führt durch sumpfiges Gelände und über eingezäunte Viehweiden. Einmal ist tatsächlich eine Spur zu erkennen – erst führt sie direkt in einen Bach, dann finden wir sie wieder nicht mehr. Am Nachmittag laufen wir mitten durch den Garten eines einzeln stehenden Hauses. Leute mit Kaffeetassen kommen auf uns zugelaufen. Wir sollen nur immer drauf zugehen, sagen sie.
Abenteuer ist das Ergebnis schlechter Planung. Natursportartikelvertreiber, Leute aus der Werbebranche, Referenten von Diavorträgen, Projektmanager behaupten unermüdlich, das hätte der norwegische Polarforscher Roald Amundsen gesagt. Er war 1911 als erster Mensch am Südpol. Wer etwas Besonderes geleistet hat, darf der Nachwelt einen Spruch hinterlassen. Ich sage: Denke niemals, dass du gleich am Ziel bist!
Es kann nicht mehr weit sein bis Eugst, eine Steigung noch, da stehen Kühe auf dem Weg. Sie glotzen. Dann löst sich eine aus der Herde und rennt auf uns zu. Wir türmen durch wadentiefen Mist, krauchen mit den Rucksäcken unter einem Elektrozaun hindurch und krabbeln auf allen vieren einen Hang hinauf, bis wir eine Straße erreichen. Sie steigt in Serpentinen an. Ein Cabrio kommt angefahren, bremst und umkurvt uns weiträumig. Unsere Schritte schmatzen auf dem Asphalt, wir hinterlassen matschige Spuren.
***
«Hat einer Erfahrung mit Mutterkühen und Wanderern?», fragt in einem Schweizer Internetforum ein Hirte, der im Sommer Kühe hüten will. Man empfiehlt ihm, die Tiere vor Touristen zu schützen. Vor Handyklingeln, Blitzlichtfotoapparaten, plärrenden Kindern. Es gibt eine Vielzahl entsprechender Warnschilder auf dem Markt. Man rät dem Mann, sich zusätzlich zwei Zeitungsartikel zu kopieren. Die Überschriften: Wieder tödlicher Unfall mit Mutterkühen und Ich bangte um mein Leben.
Viele Bauern in den Alpen halten ihr Milchvieh nicht mehr traditionell im Stall. Mutterkühe und Kälber werden im Sommer mit dem Hirten auf die Alp geschickt, denn Fleisch-, Milch- und Käsekonsumenten legen Wert auf artgerechte Tierhaltung. Auf ihren Ausflügen in die Berge erleben die Konsumenten dann, dass artgerechte Haltung Wesen hervorbringt, die sich ebenso artgerecht verhalten. Auf den Weiden stehen keine harmlosen, gemütlich wiederkäuenden Tiere, sondern scheue Rinder, die sich zuweilen wild gebärden. Einst haben sie viel Zeit mit dem Menschen im Stall verbracht. Sie wurden angesprochen und angefasst, versorgt, getrieben, gemolken. Auf der Alp brauchen sie den Menschen nicht. Er dringt in ihr Leben ein. Sie greifen ihn an, um ihre Kälber zu verteidigen.
Eines Sommers vor ein paar Jahren wurde ein erfahrener Alphirt im Safiental, durch das wir Ende des Monats kommen werden, von zwei Mutterkühen angegriffen. Sie drückten ihn zu Boden und trampelten auf ihm herum. Ehe der Hund des Hirten die Kühe wegtreiben konnte, war das Bein des Mannes vom Knöchel an zertrümmert, ein Schulterblatt und sämtliche Rippen gebrochen, die Lungen und das Brustbein gerissen. Er konnte gerade noch so viel Luft holen, um den Namen des Flurstücks, auf dem er sich befand, in sein Mobiltelefon zu sprechen. Nach drei Stunden fand ihn die Rettungsflugwacht. Er lag neben seinem treuen Hund, und im dicken Nebel ringsum brüllten die aufgebrachten Kühe.
Der Unfall war einer von vielen Unfällen mit Mutterkühen in Graubünden. Seit Jahren debattieren Hirten, Bauern und Fachleute des Kantons darüber, wie sie verhindert werden können. Zunächst ging es darum, welche Fehler die Hirten machen. Ringen sie um das Vertrauen der Tiere? Lassen sie die frisch gekalbten Kühe in Ruhe und beobachten sie sie nur mit dem Feldstecher aus der Ferne? Haben sie die Papiere gründlich gelesen, auf denen der Bauer das Befinden und den Charakter jeder seiner Kühe beschreibt? Den Bauern wiederum wird vorgeworfen, dass sie sich im Winter im Stall nicht genug darum bemühen, die vernachlässigte Beziehung zur Kuh wieder zu intensivieren. Dass sie, anstatt die Tiere zu striegeln, zu kraulen und an der Schwanzkuppe zu kratzen, ihren Nebenjobs nachgehen.
Es gibt Möglichkeiten, hier und da etwas besser zu machen, und es gibt die Realität. In der Realität ist genau das Fleisch jener Rinderrasse, die auf der Alp am häufigsten aggressiv auffällt, auf dem Markt das beliebteste. In der Realität geht es um Höchstpreise und Absatztermine. Um «Bio Beef». Um möglichst viele Tiere mit möglichst wenig Aufwand, um den Produktionsfaktor Kuh, mit dem die Bauern längst nicht mehr so viel Gewinn machen wie früher. Sie verdienen nicht einmal genug Geld, um von der Alpwirtschaft leben zu können. In der Realität bekommen Schweizer Bergbauern finanzielle Unterstützung vom Bund. Die Direktzahlungen richten sich nach der Anzahl der Tiere, die jedes Jahr Anfang Mai gezählt werden. Wer am Zähltag pro Kuh auch ein Kalb auf den Berg schickt, bekommt mehr Geld. Um das zu schaffen, müssen die Jungtiere im Juli oder August des Vorjahres auf der Alp geboren werden. Auf unwegsamem Terrain sind die abkalbenden Kühe mit dem Hirten allein. Sie ziehen sich von der Herde zurück und lassen sich auch unter starken Schmerzen nicht anfassen, selbst wenn sie die Geburt allein nicht zustande bringen. Mitunter holen die Hirten Kälber aus einem Tobel oder unter Büschen hervor, weil die Mutterkühe, die sie dort zur Welt gebracht haben, nicht mehr an sie herankommen. Sind zwanzig Mutterkühe in einer Herde, machen sie mehr Arbeit als die 160 weiteren Rinder. Und dann werden die Hirten auch noch angegriffen. «Ich will meine Gesundheit nicht für die Agrarpolitik riskieren!», schreibt eine Hirtin in der Internetdiskussion, die auch Jahre nach dem Unfall im Safiental noch anhält.
***
Am späten Nachmittag geben uns Erwin und Walter, die Wirte vom «Hörnli», Zitronenbrause, Kaffee und ein kleines Zimmer unter der Dachschräge. Wir nehmen es in Beschlag wie jeden Schlafraum in den kommenden Wochen; wir breiten uns aus, behängen Möbel, Griffe, Vorsprünge, Fensterflügel mit unseren Sachen. Die Socken auf dem Fensterbrett dampfen.
Walter deckt einen Vierertisch am Hang neben dem Haus. Zu hören ist die Hintergrundmusik, die wir bald nur noch dann bemerken werden, wenn sie ausbleibt: Kuhglocken. Barbara setzt sich zu uns und bestellt zwei Gerichte. Dann erscheint Beat, ihr Mann. Er darf sich für eines der beiden Essen entscheiden. Er nimmt das Messer, zieht eine Linie mittendurch und schaufelt sich mit der Gabel auf die Linie zu. Dann schaut er rüber zum Teller seiner Frau.
Beat und Barbara aus Bern sind schon seit Jahrzehnten ein Paar. Sie reisen viel. Beats Gesicht ist sonnenbraun, die kurzen Haare und der gestutzte Bart sind weiß. Er sieht aus, als hätte es auf ihn geschneit. Barbaras dunkle Haare sind knabenhaft kurz. Barbara kennt den Weg, den sie morgen gehen. Barbara schaut unterwegs auf die Karte. Wahrscheinlich hat sie die Marotte mit dem Essen eingeführt. Wo immer sie einkehren, bestellen die beiden verschiedene Gerichte, verspeisen jeder die Hälfte und tauschen dann. «So lernt man viel mehr von der Welt kennen», sagt sie. Er sagt: «Es ist wichtig, mit dem Messer eine Grenze zu ziehen.» Wenn ihm ein Gericht sehr gut schmeckt, kämpft Beat an der Grenze mit der Versuchung, seiner Frau etwas wegzuessen.
Wenn der Schweizer eine Reise tut, muss er immer erst einmal über Berge. Dass es ihm die Natur nicht leicht macht wegzukommen, hat ihn scheinbar drauf gebracht, dass die Heimat von Bedeutung ist. Beat und Barbara lassen beim Reisen das eigene Land nicht aus. Sie wandern durch die Alpen, fahren Ski in Davos oder Zermatt. Ich habe noch nie einen Deutschen getroffen, der die Fensterläden und Blumenkastendekorationen aller Regionen seines Landes unterscheiden kann. Der abends durch ein Dorf kommt, stehenbleibt und lauscht, wenn alte Holzrollos an Lederriemen heruntergelassen werden. Wir gehen im Dunkeln zurück ins Haus. Weit unter uns bewegen sich Lichter. Schiffe schwimmen über den Bodensee. Wir schauen und schweigen, Beat hält Barbara im Arm.
Das «Hörnli» wurde Mitte des 19.Jahrhunderts gebaut. Eugst war eine Ansiedlung von kaum zehn Häusern, die wie Zierrat an grünen Hängen pinnten. Bis ins Jahr 1945 gab es hier keinen Strom. Man konnte das Alpenvorland überblicken, und wenn es irgendwo brannte, rief das «Hörnli» die Feuerwehr. Als Erwins Großvater es 1932 kaufte, war es ein armseliges Wirtshaus mit vier Tischen. Auf dem Tisch, der am dichtesten beim Kachelofen stand, wurden die Kinder gewickelt, wurde die Wäsche gebügelt und die Küchenarbeit verrichtet. Großmutter Frieda führte ein «Spezereilädeli» und saß oft am Webstuhl im Keller. Ihr Mann verkaufte vor der Haustür an der Straße Petrol. Abends fanden sich die bettelarmen Bauern aus dem Appenzellerland ein und versoffen ihr einziges Geld. Der Großmutter taten die Familien leid. Sie richtete ein Trinkerschuldbuch ein. Mit Heuen, Grasmähen und Mistkarrenstoßen konnten die Bauern die Zeche begleichen. Auch heute noch darf, wer knapp bei Kasse ist, für Erwin und Walter bügeln, Fenster putzen oder Zimmer aufräumen, anstatt zu zahlen.
Bis vor zwei Jahren waren der weißhaarige Erwin und der dunkelhaarige Walter, deren Frisuren sich auf die gleiche Weise aus der Stirn zurückziehen, als wären sie Vater und Sohn, Pflegefachmann und Dreher. Sie haben die niedrigen Zimmer des «Hörnli» für Öbernachte (Übernachtungen) zu kleinen Schlafgemächern ausgebaut. In der engen Küche bereitet Erwin Hörnli, die traditionellen Teigwaren, mit Feigen, Tomaten, Ghackets (Hackfleisch), Käse und Apfelmus zu. Walter umsorgt die Gäste, organisiert Lesungen, Schneeschuhwanderungen und Feschte (Feste). Was sie im Landgasthaus treiben, nennt man heutzutage Quereinstieg. Dabei ist es alles andere als das. Es ist Erwins kleine Familiengeschichte, die Geschichte des Appenzellerlandes, die große Geschichte der Alpen. Aber ins «Hörnli» kommen nicht viele Gäste, denn Eugst hat kaum Höhenmeter, und es gibt weder steile Skihänge noch Seilbahnen. Wenn Walter im Garten das Abendessen serviert hat, fährt er mit dem Auto kilometerweit in ein Altenheim, um dort als Nachtwächter Geld zu verdienen. Erwin hat ein anderes Haus im Auge. Es hat nichts mit seiner Familie zu tun, sondern steht in einer Gegend, in der es mit dem Fremdenverkehr vielleicht besser läuft. Der Mensch muss zusehen, wo er in der großen Geschichte bleibt.
Dritter Tag:
Von Eugst nach Appenzell
Montag, den 17.August
Erwins Wegbeschreibung reicht für eine Viertelstunde. «Keine Karte», hat er gesagt, «Karten gehen Umwege, direkt zur Tür raus, immer drauf zu, gar nicht zu verfehlen, oben in der Wiese steht ein Bauernhaus.»
Es ist ein praller Sommermorgen, unverschämt grün. Wir steigen direkt vorm «Hörnli» den Hügel hinauf, Erwin steht unten und winkt, das Geschirrtuch über die Schulter geworfen, bis wir hinter der Kuppe sein Blickfeld verlassen haben. Man sollte es nicht glauben: Das Bauernhaus sehen wir nicht. Unsere Sinne wurden an Straßen, Nahverkehrsnetzen, Ampel- und Hausnummernsystemen geschärft. Dies aber ist eine Landschaft aus namenlosen Erhebungen, eine schiebt sich vor die andere, drei Schritte reichen, und man hat einen neuen Ausblick. Die Einheimischen nennen sie «chaotisches Appenzeller Hügelland». Wege gibt es, einer davon führt in den Wald, dort wuchert er zu. Dickicht, Wasser, Moor, irgendwann wissen wir, dass wir ihn nicht mehr unter den Füßen haben.
In einer vom Vieh zerstampften und zerzausten Niederung entfalten wir dann doch die Karte. An welcher Stelle in dieser Welt aus Schraffuren, Zeichen, Linien und Marschrichtungszahlen befinden wir uns? Über uns steht ein Holzhaus. Ein kastenartiges Auto fährt vor. Wir kraxeln hinauf. Das grüne Gefährt rostet. Die Reifenprofile sind mit getrocknetem Schlamm verstopft. Hunde springen vom Laderaum und toben über die Alp. «Milch?», fragt der alte Mann, der aus dem Auto steigt. Er bringt einen Plastikeimer aus der Hütte, der überschwappt, Gläser, setzt alles auf der Kühlerhaube ab. Sein graues Haar steht dicht und ungemäht auf dem Kopf. Seine Augen liegen zwischen tiefen Falten, wie Sonnenblenden wuchern darüber die Brauen. Er hat riesige weiße Zähne, ein T-Shirt für alle Tage und seine treuen Jeans.
Gäbris, Gais, Sammelplatz, Guggerloch, Appenzell. «Jaja, die Orte gibt’s.» Er nickt und schenkt uns ein. Heidi breitet die Karte auf der Kühlerhaube aus. Der Alte schert sich nicht drum und zeigt durch die flimmernde Luft nach Südwesten. Hinter runden bewaldeten Bergen des Kantons Innerrhoden zeichnet sich ein schroffes Massiv ab. Der Alpstein ist Teil der Appenzeller Alpen. Sein höchster Gipfel gilt als geographischer und geologischer Alpennordrand.
«Säntis», sagt der Alte. «Zweieinhalbtausend.» Und gleich neben dem Berg, in der Hütte auf dem Rotsteinpass, da lebe seine Tochter.
«Wo sind wir?» Heidi pocht auf die Karte.
«Milch?», fragt der Alte.
Sie lässt sich nachschenken.
Ein Zeigefinger, dessen Hautfurchen mit dem gleichen Farbton verstopft sind wie die Reifenprofile und auf dessen Kuppe nur noch der Rest eines Fingernagels lebt, rutscht über das Papier. Er zieht weite Kurven, biegt urplötzlich ab, stoppt, rutscht weiter, stoppt erneut.
«Hier», sagt der Alte.
«Danke!», sagen wir und setzen mit dem Stift ein Kreuzchen an die Stelle. Es ist der Ausgangspunkt unserer Alpenüberquerung mit Wanderkarte.
«Immer schön an die Sonnencreme denken!», sagt der Alte.
«Klar!», sagen wir, bevor wir durchs Appenzellerland irren.
Wir werden immer besser. Wir sprechen mit der Karte. Entwickeln ein Gefühl für Strecken, drehen uns an jeder Wegkreuzung geschickter als an der vorherigen. Merkwürdigerweise können wir die Landschaft auf der Karte kaum wiedererkennen. Nie treffen die Wege auf dem Papier im gleichen Winkel aufeinander wie in Wirklichkeit. Wir queren Straßen, die nicht eingezeichnet sind. Wir vertun Zeit, um ein Haus zu finden, das zu dem Haus auf dem Papier passt. Schließlich finden wir nichts mehr von dem, was die Karte ankündigt. Nicht den Bachlauf, nicht das ansteigende Flurstück, nicht mal die Eisenbahnlinie. Auch das Dickicht in Marschrichtung ist nicht eingezeichnet. Dahinter hellt das Land auf. Am Horizont: der Bodensee.
Heidi flucht. Dreimal hat der Alte ihr nachgeschenkt. Die Milch hat so gut geschmeckt! Sie hätte es wenigstens ahnen können: Er hat sie besoffen gemacht.
Wozu soll er wissen, wo auf der Landkarte sein Haus steht? Er hat das Wetter und die Jahreszeiten. Es gibt keinen Grund, sich geodätisch zu verorten. Ich höre noch sein Lachen. Der Wind hat es uns hinterhergetragen, als wir den Hügel mit der Hütte verließen. «Itaaalien! Hahaha! Bis Italien wollen die!»
***
Die Gesteinsbarriere, die mitten in Europa steht und quer von Ost nach West verläuft, ist gut achthundert Kilometer lang. Ihr geologischer Rand besteht aus steilem Kalkmassiv. Wie eine Festungsmauer grenzt er das Gebirge vom Umland ab, lässt nur am Alpeninnenbogen beim Lago Maggiore und am Südostrand zwischen Graz und Wien eine Lücke. Die Alpen teilen den Kontinent in Nord und Süd. Sie erheben sich gen Himmel, halten die Wolken auf, den Wind, bestimmen über das Wetter in Europa, das Antlitz der Jahreszeiten. Sie fangen die Niederschläge ab, speisen die Flüsse, die zu breiten Strömen anschwellen und in alle Richtungen ins europäische Tiefland fließen. Der Hinterrhein entspringt im Rheinwaldgletscher und vereint sich mit dem Vorderrhein, der vom Gotthardmassiv kommt. Gemeinsam fließen sie in den Bodensee. Die Rhone entsteht aus dem mächtigen Rhonegletscher. Der Inn, der mit dem Donauwasser ins Schwarze Meer strömt, kommt vom Piz Lunghin beim Malojapass, von wo sich auch Flüsse ins Mittelmeer und in die Nordsee aufmachen.
Nur die Gebirgsmitte, der mächtige, bei der Alpenentstehung doppelt überformte Hauptkamm, ist noch härter als der Alpenrand. Er besteht aus kristallinem Gestein, aus Gneisen und Graniten, die sich steil aufrichten, Wasser ins Unterirdische abfließen und trockene Hochplateaus entstehen lassen. Obgleich der Mensch in dieser Gegend kaum sein kann, fasziniert sie ihn am meisten. Er misst die Gipfelhöhe und listet die 82Viertausender auf. Er krönt den 4807Meter hohen Montblanc zum Sieger, vergibt den zweiten Platz an die Dufourspitze, die mit einer Höhe von 4634Metern aus dem Monte-Rosa-Massiv ragt, und den dritten an das Matterhorn mit seinen 4477Metern. In Alpenländern, die keinen Gipfel auf dem Siegerpodest haben, krönt der Mensch die höchsten Berge: in Deutschland die Zugspitze, in Österreich den Großglockner, in Jugoslawien den Triglaw.
Auch die Naturkräfte, die in der Region des ewigen Eises und Schnees wirken, sind faszinierend. Wo der Boden dauerhaft gefroren ist und im Sommer nur oberflächlich taut, bilden sich Gletscher, mächtige Eisströme, welche die Landschaft umgestalten. Wasser, das am sonnigen Tag in die Rillen und Poren des Berges dringt, friert nachts und sprengt das Gestein. Das Geröll wird vom Gletscher abtransportiert oder bleibt als riesige gefrorene Schutthalde am Fuße der Felswände liegen. Der Mensch, den das so fasziniert, ist zugleich daran schuld, dass weltweit die Permafrostböden tauen. Dass in den Alpen ganze Bergschutthänge in Bewegung geraten.
Jenseits des Hauptkamms bis hin zum kalkigen Rand besteht das Gebirge größtenteils aus weichen Sedimenten. Flüsse haben große inneralpine Längstäler gegraben. Eiszeitliche Gletscher haben die Täler erweitert, Passübergänge ausgehobelt, Terrassen geschaffen, Boden bildendes Moränenmaterial angeschleppt. Die Eiszeit hat die Alpen für den Menschen bewohnbar gemacht. Man könnte auch sagen, sie hat ihn hinterhältig angelockt. Denn genau an den Stellen, an denen er nun lebt, sind die Alpen für ihn auch besonders gefährlich.
Nach dem Ende der Eiszeit tauten die Hänge und brachen. Übersteile Talflanken entstanden. Bergstürze stauten Flüsse zu Seen. Der Mensch hat viele Namen an die vielen Gebirgsgruppen verteilt: Glarner Alpen, Berner Alpen, Walliser Alpen, Allgäuer Alpen, Rätische Alpen, Julische Alpen, Dolomiten… Er weiß, dass er es überall mit unterschiedlichen Bergen zu tun hat. Dass Nord- und Südhänge sich zuweilen so wenig ähneln, als gehörten sie nicht zu ein und demselben Berg. Dass in verschiedenen Alpenregionen auf gleicher Höhe völlig unterschiedliche Bedingungen herrschen können. Und vor allem weiß der Mensch: Wo das Gebirge locker ist, erodiert es leicht. Er forscht zielstrebig und berechnet genau. Er ersinnt Schutzmaßnahmen, verhält sich vorsichtig. Für die Alpen ist die letzte Eiszeit gerade eben erst vorbei und befindet sich immer noch auf dem Rückzug. Deshalb stürzen bis heute Berge.
Auch wenn dieses Hochgebirge nicht so aussieht: Es ist noch jung. Es ist keine feststehende Sache. Abtragung und Ablagerung dauern an, die Gebirgsbildung ist nicht beendet. Der typische Charakterzug der Alpen ist die Unstetigkeit. In einer jugendlichen Mischung aus labilen Gesteinsschichtungen, steilem Relief, hohen Niederschlägen, kurzer Vegetationszeit und ausgeprägten Temperaturextremen laufen viele Naturprozesse sprunghaft ab. Doch nur Biologen und Alpenexperten nennen das schlicht «Störungen». Andere Menschen sagen dazu «Naturkatastrophen». Für die Alpen ist es überhaupt nicht katastrophal, wenn sich Bergstürze, Muren, Hochwasser, Lawinen und Stürme ereignen. Es liegt in ihrer Natur.
Vieles ist im Gebirge nicht so, wie es scheint. Wenn der Mond einen wunderschönen Ring trägt, verschlechtert sich das Wetter; das phantastische Morgenrot zählt zu den unguten Aussichten. Die Bise weht im Sommer trocken und warm, im Winter ist sie eiskalt und feucht. Der Mistral sucht die Menschen im Süden mit der Kälte des Nordens heim. Der Alpenföhn, ein Fallwind, der als warmer Sturm fegt und riesige Wolkenballen vor sich her walzt, ist nicht nur eine meteorologische Angelegenheit. Er macht die Menschen gereizt und lustlos, verursacht Nackenschmerzen und Migräne, Gliederzerren, Muskelverspannungen, Magenbeschwerden, Herzrasen und Seitenstechen. Johann Wolfgang von Goethe soll ihn gespürt haben, als er auf seiner Reise nach Italien Ende des 18.Jahrhunderts am Alpenrand in Mittenwald aus der Kutsche stieg. Wer in der bayrischen Hauptstadt nicht unter dem Föhn leidet, gilt dort nicht als echter Münchner.
«Fühlen Sie sich beobachtet und überwacht? Verspüren Sie plötzlich ein Gefühl der dumpfen und ungezielten Wut? Haben Sie das Bedürfnis, etwas zu zerstören? Haben Sie unbestimmte Mordgedanken?», fragt der Kabarettist Jörg Maurer aus Garmisch-Partenkirchen in seinem 2009 erschienenen Alpenkrimi «Föhnlage». In dem Buch wird munter gemordet und eine Leiche nach der anderen verscharrt. Den Einfluss des Fallwindes betrachtet das Gericht als mildernden Umstand. Maurer erklärt: «Die Föhnfühligen sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich auf der Straße erkennen und diese temporäre Behinderung als Sensibilisierung verstehen.»
Die Alpen sind ein mythenreiches Gebirge. Sie bieten die Kulisse für schaurige und für schöne Geschichten. Da sind die Gletscher, die sich zwanzig Zentimeter pro Tag talwärts bewegen und gleichzeitig stillstehen. Denn die Gletscherstirn, das untere Ende, schmilzt ab und speist den Gletscherbach. Eine Schneeflocke, die in der Höhe auf einen zehn Kilometer langen Eisstrom fällt, braucht über hundert Jahre, bis sie unten ankommt. Da sind die Lawinen. Abstürzende Schneemassen, gegen die der Mensch etwas auszurichten versucht, seit er die Alpen zum ersten Mal betrat. In den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts hat man bei Davos in der Schweiz ein Schneelabor eingerichtet, in den Vierzigern wurde daraus das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Auf dessen Internetseite gibt es täglich eine Lawinenprognose. Die Neigung eines Hangs, Festigkeit und Gewicht von Schnee und Eis, die Beschaffenheit des Untergrunds, das Vorkommen an Bäumen und Geröll sowie Schneefallmenge, Sonne, Windrichtung und Temperatur sind wichtige Komponenten. Mittlerweile weiß man über Lawinen gut Bescheid. Doch berechenbar sind sie nach wie vor nicht.
Schon ein Stein, der sich aus einer Felswand löst, kann den «weißen Tod» auslösen. Oder ein Tannenzapfen, der vom Baum fällt. Ein kantiger Skischwung. Ein Schrei. Der Mensch fürchtet sie alle: Locker- und Festschnee-, Trocken- und Nassschneelawinen. Am meisten graut es ihm vor der Schneestaublawine. Sie rast orkanartig zu Tal, faucht und pfeift, erzeugt einen Sog, der schon Unheil anrichtet, bevor die Opfer unter ihren Schneemassen begraben werden. Was am Ende geschieht, ergibt wieder mythische, nahezu unglaubliche Geschichten. Menschen, die in Lawinen geraten, versuchen, sich mit Schwimmbewegungen an der Oberfläche zu halten. Die Verschütteten bemühen sich, nicht in Panik zu geraten, Kräfte und Atem einzuteilen. Lawinenhunde schnüffeln am Schnee. Suchtrupps befolgen ein striktes Sprechverbot, um horchen zu können. Lange, biegsame Metallsonden werden ins Weiß gestoßen, doch nur wer nicht länger als fünfzehn Minuten und nicht tiefer als zwei Meter verschüttet liegt, hat überhaupt eine Chance, mit dem Leben davonzukommen.
Zu den Alpengeschichten gehören auch die der Pflanzen und Tiere. Wie eine Armee erobern Bäume die Berge. Laubwälder, die am Alpensüdrand von prächtigen Edelkastanien angeführt werden, schaffen es nicht allzu weit bergan und werden bald von Nadelgehölzen verstärkt. Von den Weißtannen zum Beispiel, geduldigen Bäumen mit aufrechtstehenden Zapfen, die mitunter zweihundert Jahre als kleine Gewächse im Waldschatten ausharren und sich dann ganz plötzlich, wenn der Wind ein paar Bäume umgeworfen hat und Licht einbricht, hoch aufrichten. Von Schwarzkiefern mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die es gut in Kalkböden aushalten. Je weiter es bergan geht, desto mehr Laubgewächse lassen sich zurückfallen. Schließlich schreiten die Nadelgehölze fast allein voran, immer noch in geschlossener Front, angeführt von besonders hartnäckigen Exemplaren. Den Lärchen sieht man nicht an, dass sie zäh genug sind, um als letzte Vertreter ihrer Gattung der Waldgrenze entgegenzustreben. Im Frühling tragen sie hellgrüne Nadelkleider, die sich im Herbst ins Goldgelbe verfärben. Im Winter werfen sie die Nadeln ab und halten sich dennoch wacker in vorderster Front. Weil sie viel Licht brauchen und Nebel nur schlecht ertragen können, agieren sie vor allem auf der Alpensüdseite. Bei Meran soll ein Exemplar stehen, das 2300Jahre alt ist.
Die knorrigen Arven hingegen, auch Zirbelkiefern genannt, haben breite, windzerzauste Kronen, die von kantigen Nadeln besetzt sind. Man sieht ihnen an, was sie sind: heldenhafte Gebirgsbäume. Sie geben alles, doch sie ergeben sich nie. Ein Vogel hilft ihnen dabei. Der Tannenhäher hat dunkle Flügel, die ihn ziemlich hoch tragen. Sein brauner Körper ist mit weißen Flecken übersät. Den ganzen Sommer und Herbst über sammelt er fettreiche Arvennüsse, vergräbt rund hunderttausend im Boden, um sich im Winter davon zu ernähren. Seine Fähigkeit, sich seine Tausende Verstecke zu merken, sichert ihm das Überleben. Doch die Natur hat ihm auch Nachlässigkeit mitgegeben. Und so wachsen aus all den Nüsschen, die er jedes Jahr unter der Erde vergisst, junge Arven.
Zwischen 1800 und 2200Metern Höhe befindet sich die Waldgrenze. Hier bleiben die Bäume urplötzlich stehen. Nur einzelne Exemplare, die Pioniere dieser Baumarmee, schlagen sich weiter durch: als verkrüppelte Gewächse, die ihre abgestorbenen Äste wie Krallen in Richtung Gipfel recken. «Waldkampfzone» wird der schmale Streifen genannt, auf dem der Berg mit Hilfe von Wind und Wetter auch den letzten Baum von sich abschüttelt und schließlich nur noch Zwergsträucher und alpinen Rasen leben lässt. Die Föhren, bescheiden aussehende Nadelbüsche, auch Latschen genannt, harren noch eine ganze Weile an steilen Schutthängen, in Lawinen und Steinschlagbahnen aus. Dort oben, wo kaum Humus zur Verfügung steht, wo heftige Winde an den Pflanzen zerren, wo die Winter bitterkalt und die Schneedecken schwer sind, da sind die Alpengeschichten voller Wunder. Eines davon ist ein Laubstrauch. In beeindruckendem Tempo, doch ohne sich groß aufzuspielen, prescht die Grünerle mit vor und bildet noch über der Waldgrenze ausgedehnte und beinahe undurchdringliche Wälder. Wie die Föhre besteht sie aus elastischem Holz. Auch sie kann Schneemassen tragen. Doch irgendwann geben auch Föhren und Grünerlen auf. Der Berg setzt sich durch. Er gesteht jetzt nur noch wenigen Pflanzen einen Standort zu. Schließlich übergibt er Felsen, Eis und Schnee die Alleinherrschaft.
Alpenpflanzen haben es schwer, doch lassen sie sich das nicht anmerken. Vielleicht bewundert der Mensch sie deshalb so sehr: Wie sich das zarte Alpenglöckchen, an dessen dünnem Stil helllila Blüten baumeln, vor eisigem Wind schützt, indem es sich am Gletscherrand in den Schnee stellt! Wie es der Gletscherhahnenfuß auf bis über viertausend Meter schafft, wo er weiße Blüten aus der Schneedecke schiebt, die sich dann rosa färben und schließlich tiefrot leuchten! Mit welch purpurner Blütenpracht die Alpenrose ganze Hänge ausstattet und daher nicht nur wegen ihres Rausch, Krämpfe und Herzlähmung verursachenden Pflanzensaftes den Rufnamen Almrausch verdient! Am meisten bewundert der Mensch das Edelweiß. Diese schlichte Pflanze, die sich mit ihrer starken Behaarung gegen Wasserverlust und ultraviolette Strahlung schützt, hält er für die Königin der Alpenblumen. Zahllose Männer haben sie in den vergangenen Jahrhunderten in waghalsigen Höhen vom Felsen gepflückt, um sie ihren Liebsten als Verheißung, als Symbol der heilen Welt mit nach Hause zu bringen. Dabei wächst die Blume nicht wie in Heimatfilmen auf luftigen Felsvorsprüngen, sondern auf Matten und steinigem Rasen. Der Mensch hinter dieser Brille der Bewunderung kennt seine Alpenkönigin gar nicht. Die weißen, filzigen Blätter am Ende des Stängels sind nämlich nicht die Blüten. In Wahrheit ist das Edelweiß gelb. Und es ist auch keine Alpenpflanze, sondern stammt aus Trockentälern im nördlichen Himalaja.
Auch Steinböcke und Gämsen, diese kletterfreudigen, scharfäugigen und sprungbegabten Hochalpinisten, die am unteren Ende der Schneegrenze leben, werden vom Menschen bewundert. Und da er, was er bewundert, auch besitzen will, jagt er diese Tiere. Das Gehörn, das bei Steinböcken bis zu fünfzehn Kilogramm wiegt, ist seine Trophäe. Das Gamsrückenhaar steckt er sich an seinen Hut. In den Alpen ist es wie anderswo auch: Gegen alles weiß sich die Natur zu wehren, außer gegen den Menschen.





























