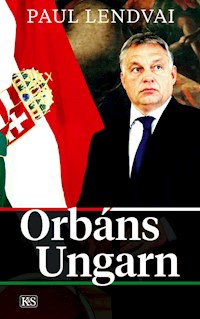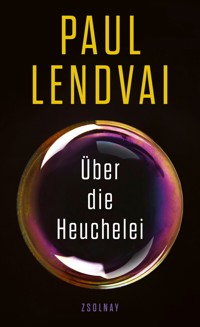
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Journalist Paul Lendvai beobachtet seit Jahrzehnten das politische Weltgeschehen und sieht darin eine Konstante: Die Heuchelei. Russlands Krieg, Migration, Klimawandel, Inflation, Trump zum Zweiten? Es herrscht Endzeitstimmung, wieder einmal. Weltweit aktive Geheimdienste und hoch alimentierte Forschungseinrichtungen schaffen es nicht, Antworten auf dramatische Umbrüche des globalen Kräftespiels zu finden. Ja, die sie lenkenden Politikerinnen und Politiker liegen häufig vollkommen falsch. Man denke nur an die Einschätzungen der Entwicklung in Russland und China und innerhalb der EU in Ungarn und Polen. Seit Jahrzehnten beobachtet Paul Lendvai das Geschehen aus unmittelbarer Nähe. Er sieht sowohl die nachlassende Kraft liberaler Ideen als auch die verführerischen Angebote populistischer Autokraten. Konstant bleibt dabei nur eines: die Heuchelei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Russlands Krieg, Migration, Klimawandel, Inflation, Trump zum Zweiten? Es herrscht Endzeitstimmung, wieder einmal.Weltweit aktive Geheimdienste und hoch alimentierte Forschungseinrichtungen schaffen es nicht, Antworten auf dramatische Umbrüche des globalen Kräftespiels zu finden. Ja, die sie lenkenden Politikerinnen und Politiker liegen häufig vollkommen falsch. Man denke nur an die Einschätzungen der Entwicklung in Russland und China und innerhalb der EU in Ungarn und Polen.Seit Jahrzehnten beobachtet Paul Lendvai das Geschehen aus unmittelbarer Nähe. Er sieht sowohl die nachlassende Kraft liberaler Ideen als auch die verführerischen Angebote populistischer Autokraten. Konstant bleibt dabei nur eines: die Heuchelei.
Paul Lendvai
Über die Heuchelei
Täuschungen und Selbsttäuschungen in der Politik
Paul Zsolnay Verlag
Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
(Die Welt will betrogen sein, also werde sie betrogen.)
Vorwort
»Er hat offensichtlich alle getäuscht«, sagte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, als Erklärung dafür, dass die von ihr geführte Landesregierung bis zum russischen Überfall auf die Ukraine mit Putins Russland aufs Engste verbunden war und die umstrittene Nord-Stream-2-Pipeline mithilfe einer dubiosen Stiftung fertiggebaut hat.1 Warum lag nicht nur sie, sondern lagen auch zahlreiche deutsche und österreichische, französische und US-amerikanische Politiker und Meinungsmacher so oft und so lange so falsch bei der Einschätzung der russischen Politik? Warum hat es so lange gedauert, bis die Institutionen der Europäischen Union die richtigen Antworten auf die aggressiven Handlungen serbischer Machthaber oder auf die autoritären Entwicklungen in Ungarn und Polen fanden? Warum hat man die von nationalistischen Autokraten ausgehende Gefahr für die liberalen Werte des Westens so spät erkannt?
Wie der Titel dieses Buches andeutet, möchte ich insbesondere die Rolle der Heuchelei, der Doppelmoral, der menschlichen und politischen Doppelzüngigkeit und Scheinheiligkeit bei den im Rückblick unverständlichen Handlungen und Erklärungen von Spitzenpolitikern behandeln. Die Politik der vergangenen Jahrzehnte hielt die Illusion aufrecht, die Anziehungskraft der Demokratie sei unwiderstehlich, und hinterließ damit von Moskau bis Budapest triumphierende Betrüger und von Berlin bis Wien zufriedene Geprellte.
Der Philosoph des Skeptizismus, Michel de Montaigne, schrieb 1580: »Verstellungskunst wird unter die vorzüglichsten Eigenschaften des Jahrhunderts gezählt«, und er fügte hinzu: »Was wir heute Wahrheit nennen, ist nicht, was wahr ist, sondern was man anderen einreden kann.«2
In diesem Buch möchte ich auch meine persönlichen Erfahrungen als Kommentator und Berichterstatter in weltpolitischen Krisensituationen mit der Flut von neuen Informationen über Fehlgriffe und Fehldeutungen der westlichen Politik verbinden, um die Vernebelung und den Schwindel zu enttarnen. Deshalb fange ich mit meinen persönlichen, zufälligen und doch symbolträchtigen Begegnungen mit »Opfern« und mit »Tätern« an, mit Persönlichkeiten der russischen Gesellschaft, die hinter einer Maske agieren, und für die die Worte Nietzsches gelten: »Die scheinbare Welt ist die einzige, die ›wahre Welt‹ ist nur hinzugelogen …«3 [kursiv im Original, Anm.].
Es folgt ein Blick auf die Vorläufer der heutigen Putin- und Orbán-»Versteher« und damit auf die Wurzeln der verhängnisvollen Gewöhnung an deren politische Heuchelei, auf jene berühmten Intellektuellen, Autoren und Reporter, die aus Naivität oder aus finanziellen Interessen als »politische Pilger« die Diktatoren von Stalin bis Castro gelobt und ihre Tyrannei verharmlost haben. In zwei Kapiteln beschreibe ich die Mitverantwortung jener deutschen Politiker, vor allem des Altkanzlers Gerhard Schröder, die das Putin-Regime verharmlost, legitimiert und indirekt mitfinanziert haben.
Einen wichtigen Teil des Buches bildet die mit Heuchelei gekoppelte Beschwichtigungspolitik gegenüber den früheren und gegenwärtigen Brandstiftern auf dem Balkan, wo nach wie vor, von Serbien bis zum Kosovo, von Bosnien bis Mazedonien, Zeitbomben ticken. Was die EU-Erweiterung durch die Balkanstaaten betrifft, prägt unverändert Heuchelei die Haltung beider Seiten: »Die einen tun so, als wollten sie sich erweitern, die anderen tun so, als wollten sie beitreten.«4
Den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der Ungarn seit 2010 ungefährdet regiert, kann man nur als Weltmeister der politischen Heuchelei, als Herrscher eines als »illiberale Demokratie« verkleideten Mafia-Staates darstellen, mit betrüblichen Folgen für die europäische Politik. Für ihn vor allem gilt die von Jean Starobinski, dem Montaigne-Biographen, zusammengefasste Erkenntnis des großen Autors des sechzehnten Jahrhunderts: »Die Heuchler verstehen sich bewundernswert darauf, das Wort gegen die Heuchelei zu erheben. Wer immer sich dabei einen Vorteil ausrechnet, betreibt, wenn auch unter großem Zeitaufwand, nur weiter die Sache der Masken: Er selbst bleibt eine maskierte Persönlichkeit.«5
Seinen faszinierenden ungarisch-amerikanischen Gegenspieler George Soros, der ursprünglich als Philanthrop bewundert wurde, heute aber von den bedrohten Autokraten zum verhassten Dämon stilisiert wird, beschreibe ich als Beispiel für die globale Bedeutung von Verschwörungstheorien.
Das Schlusskapitel bildet Österreich, wo, so Thomas Bernhard, »die Verlogenheit zuhause ist«6, wo glänzende Blender, von Jörg Haider bis Sebastian Kurz, die Maskerade und die Doppelzüngigkeit in der Politik zur allgemeinen Regel erhoben und damit »Wunder an blinder und grenzenloser Willfährigkeit des Volkes« vollbracht haben.7
Gewalt und Widerstand: Begegnungen mit Akteuren der russischen Politik
Die Akteure treten von der Bühne ab, nachdem sie ihre Rolle gespielt haben. Im Theater.
Stanisław Jerzy Lec
Meine erste und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit letzte persönliche Begegnung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fand anlässlich seines ersten offiziellen Staatsbesuches in Österreich am 9. Februar 2001 statt. Bundespräsident Thomas Klestil gab ein glanzvolles Staatsbankett in der Hofburg zu Ehren des russischen Gastes. Vorher wurden ihm die österreichischen Gäste formell vorgestellt. Auch unsere Begegnung — Putin quittierte mit freundlichem Lächeln meine auf Russisch formulierten Gemeinplätze — hat ein Fotograf festgehalten, und ich konnte meine journalistische Eitelkeit durch den Abdruck dieses Fotos in meiner Autobiographie befriedigen.
Von dem Abendessen blieb mir aber nur meine rechte Tischnachbarin lebhaft in Erinnerung. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, bedauere ich die verpasste Chance eines längeren Gesprächs mit der freundlichen, attraktiven Frau. Ihr Name war Ljudmila Narussowa Sobtschak. Ich wusste, dass sie die Witwe Anatoli Sobtschaks war, des ersten frei gewählten früheren Bürgermeisters von Sankt Petersburg (1991 bis 1996). Unsere Unterhaltung in einer Mischung aus gebrochenem Englisch und Russisch dauerte nur einige Minuten. Ich war bald in ein Gespräch mit meinen österreichischen Tischnachbarn gegenüber und links von mir über die damals herrschenden Spannungen zwischen Thomas Klestil und Bundeskanzler Wolfgang Schüssel verstrickt und habe sie sträflich vernachlässigt.
Damals hatte ich allerdings noch keine Ahnung von den verdächtigen Umständen im Zusammenhang mit dem Tod Sobtschaks und den Korruptionsvorwürfen gegen ihn und seinen damaligen Stellvertreter Wladimir Putin.8 Er starb ein Jahr vor dem Bankett in der Hofburg, und die Anwesenheit seiner Witwe in der russischen Delegation war ein Beweis für ihre enge Beziehung zu Präsident Putin. Narussowa war Parlamentsabgeordnete, später wurde sie zum langjährigen Mitglied des russischen Föderationsrates. Die freundschaftlichen Kontakte mit Putin stammten noch aus der Sowjetzeit, als Anatoli Sobtschak Professor für Rechtswissenschaft an der Universität Leningrad war. Putin, und auch dessen Nachfolger als Übergangspräsident, Dmitri Medwedew, gehörten zu seinen Studenten. Eine Beschreibung des politischen Aufstiegs und Sturzes Sobtschaks würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Fest steht jedenfalls, dass Narussowa in einem BBC-Interview fast zwanzig Jahre später die Gerüchte um den Tod ihres Mannes öffentlich bestätigte. Auf die Frage des Reporters, ob ihr Mann ermordet worden sei, sagte sie nach einigem Zögern: »Ich weiß es nicht.«9
Sie hat nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit ihren kritischen Stellungnahmen mehrmals international Aufsehen erregt. Zuletzt war sie die Einzige unter den 170 Mitgliedern des Föderationsrates (des eigentlichen Oberhauses des Parlaments), die sich bei der Abstimmung Mitte April 2023 über die Digitalisierung der Einberufung zur Armee der Stimme enthalten hat. Ohne Putin namentlich zu kritisieren, rechtfertigte sie in einem ungewöhnlichen Interview mit der in Lettland auf Russisch und Englisch erscheinenden Zeitung Nowaya Gazeta Europe ihre kritische Haltung mit dem Vermächtnis ihres Mannes.10
Erschütternde Morde
Durch eine Verkettung von Zufällen habe ich auch mehrere andere russische Persönlichkeiten vor ihrem Aufstieg oder nach ihrem Sturz getroffen, die in Sankt Petersburg oder in Moskau als Gegner oder Helfer Putins auf seinem Weg zur absoluten Macht auftraten. Selbst kurze Bekanntschaften bieten dem Chronisten einen besonderen Zugang zum Schicksal dieser Menschen. Die folgende Geschichte spielte sich zwei Jahre vor dem Tod Sobtschaks ebenfalls in Sankt Petersburg ab. Russische Zeitungen nannten Sankt Petersburg, einst von Zar Peter dem Großen als »Fenster zum Westen« erbaut, in den späten 1990er Jahren die »Hauptstadt des Verbrechens«. Im Zuge der Revierkämpfe zwischen politischen Gruppen, manche mit Querverbindungen zu Mafia-Banden, gehörten Überfälle auf Politiker, Geschäftsleute und kritische Journalisten zum Alltag. Das größte Aufsehen und die stärkste Anteilnahme löste die Ermordung der Abgeordneten und Anführerin der Bewegung »Demokratisches Russland«, Galina Starowoitowa, am 20. November 1998 aus. Im Treppenhaus zu ihrer Wohnung in Sankt Petersburg lauerten ihr zwei Killer auf und schossen ihr gegen 23 Uhr mit einem Maschinengewehr dreimal in den Kopf. Sie starb an Ort und Stelle.
In ihrer bahnbrechenden Analyse des Putin-Regimes, »Putins Netz«, betont Catherine Belton, dass Starowoitowa nur vier Monate nach der Ernennung Putins zum Chef des Inlandsgeheimdienstes wegen ihrer Korruptionsermittlungen ermordet worden sei: »Sie war die führende Demokratin in Sankt Petersburg und die lauteste Stimme gegen die Korruption. Nach ihrem Tod verfiel die Stadt in tiefe Trauer, und das ganze Land stand unter Schock.«11 Ehemalige Mitarbeiter und eine ihrer besten Freundinnen waren laut Belton überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Korruptionsermittlungen auf Anordnung der Sankt Petersburger Sicherheitsbehörden ermordet worden sei.
Ich war erschüttert, als die Nachricht im ORF-Morgenjournal gemeldet wurde, weil ich Galina gut gekannt hatte. Beide hatten wir an der vierzigsten Generalversammlung des Internationalen Presse-Instituts in Kyoto (21. bis 24. April 1991) teilgenommen. Mit ihren offenen Wortmeldungen erregte sie von Anfang an Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu dem ebenfalls anwesenden, eher zurückhaltenden Alexander Jakowlew, dem engsten Berater des sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, übte sie scharfe Kritik an den Reformgegnern in Moskau.
Die politische Karriere der Ethnologin Galina Starowoitowa begann mit ihrer Wahl zur Vertreterin der Armenischen Republik im sowjetischen Volksdeputiertenkongress, sie war auch Mitglied der ersten oppositionellen parlamentarischen Fraktion, der auch der Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow angehörte. Sie bezeichnete sich als Tochter »einer stolzen Kosakin« und eines »russifizierten Weißrussen«. Durch ihre Familiengeschichte sensibilisiert, widmete sie mehr als siebzig Veröffentlichungen den Völkern des Kaukasus. Auf der Konferenz in Kyoto verurteilte sie leidenschaftlich die Unterdrückung der Minderheiten und die antisemitischen Tendenzen im sowjetischen System und sprach aus persönlicher Erfahrung über die Problematik der ethnischen Minderheiten im Kaukasus und die Gefahr des russischen Nationalismus. Bei unseren Vieraugengesprächen war sie noch offenherziger und machte kein Hehl aus ihren Sorgen über die Offensive der Reformgegner.
Im Jänner 1991 hatte sie trotz Warnungen des Militärs eine gewaltige Demonstration mit hunderttausend Teilnehmern unter dem Motto »Freiheit für Litauen!« in Moskau angeführt. Das erste Staatsoberhaupt des freien Litauens, Vytautas Landsbergis, hob Galinas Mut hervor, indem er sie zitierte: »Wenn die Männer feige sind, dann muss eine Frau vorangehen.«12
Vier Monate nach unserer Begegnung in Kyoto erlebte die Welt den gescheiterten Putsch gegen Gorbatschow und den Aufstieg Boris Jelzins zum Präsidenten der Russischen Föderation. Starowoitowa wurde Jelzins Beraterin für nationale Minderheiten. Bereits Ende 1992 stellte man sie wegen ihrer Kritik an der Regierungspolitik im Konflikt mit den Osseten und Inguschen frei. Sie trat offen gegen Jelzins Tschetschenienpolitik auf und forderte die Bestrafung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Bergkarabach und Tschetschenien.
Während dieser turbulenten Zeit kam sie zu einem Vortrag nach Wien und kontaktierte mich. Wir trafen uns im Café Griensteidl zum Gespräch, und sie berichtete von der Verschärfung der politischen Spannungen und von Morddrohungen nach ihren Auftritten im Fernsehen. Es sei ihr immerhin gelungen, ihrem Sohn ein Stipendium für eine Hochschule in London zu verschaffen. Sie klang entschlossen und erzählte mir auch, dass sie bald an der Brown University von Providence, Rhode Island, Vorlesungen über die Politik der Selbstbestimmung für ethnische Minderheiten halten werde. Da ich einige Monate zuvor an derselben Universität über die politische Lage auf dem Balkan vorgetragen hatte, konnte sie mich als Referenz nennen. Sie war dann mehrere Jahre Gastprofessorin in Providence.
Weiterhin blieb sie in der russischen Politik aktiv und wurde 1998 zur Vorsitzenden der Bewegung »Demokratisches Russland« gewählt. Sie sollte das Bündnis bei den Parlamentswahlen im Dezember 1998 vorbereiten und führen. In der Kampagne kritisierte sie die Erweiterung der Machtbefugnisse des FSB, des Inlandsgeheimdienstes, und stimmte gegen die Nominierung von Jewgeni Primakow als Ministerpräsident. Galina Starowoitowa war eine chancenreiche Kandidatin für den Posten der Gouverneurin des Petrograder Gebietes und wurde in den Medien sogar als potenzielle Präsidentschaftskandidatin gehandelt. Sie musste sterben, weil sie zu viel über die korrupte Szene in Sankt Petersburg und die politischen Querverbindungen zu den dortigen Silowiki (den Vertretern der Geheimdienste und des Militärs in bedeutenden politischen und wirtschaftlichen Positionen) wusste.13
Fünf Jahre nach meiner Begegnung mit Galina Starowoitowa, 1996, wurde ich gebeten, bei einem Arbeitsessen für den Gouverneur der russischen Provinz Nischni Nowgorod anlässlich eines vom Davoser Weltwirtschaftsforum organisierten Mittel- und Osteuropäischen Wirtschaftsgipfels in Salzburg als Gastgeber und Moderator aufzutreten. Das Treffen mit dem jungen Gouverneur löste bei den ausländischen Journalisten und Unternehmern besonderes Interesse aus. Sie wollten wissen, warum die Region — etwa so groß wie Österreich, dreieinhalb Millionen Einwohner — zu einem Vorbild für ganz Russland geworden war. Der Gast, damals Mitte dreißig, erklärte in fließendem Englisch, manchmal mit einem Lächeln, wie er seit 1991 gegen die alte, korrupte Nomenklatura vorgegangen sei, wie er ausländische Konsulenten geholt und durch die Förderung von Privatinitiativen versucht habe, die Macht der Monopole zu brechen. Der international kaum bekannte Gouverneur, blendend aussehend, hieß Boris Nemzow.
Obwohl an der dreitägigen Veranstaltung dutzende Präsidenten, Regierungschefs und Minister teilnahmen, galt Nemzow als einer der aufsehenerregenden Stars. Klaus Schwab, der Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums in Davos, hatte ihn bereits 1993 als ersten Russen in die Gruppe der »künftigen Führungskräfte der Welt« aufgenommen. Sowohl die Zuhörer, die sich bei unserem Essen um die Stühle drängten oder stehend zuhörten, als auch das Publikum bei einer Diskussionsrunde mit Nemzow tags darauf waren von seiner Offenheit und dem direkten Stil gefesselt. Er betonte immer wieder, dass bei der Verwirklichung weitreichender wirtschaftsliberaler Reformen, bei der Privatisierung der Staatsbetriebe, der Landwirtschaft und des Handels in Russland das Schwierigste die Änderung der Mentalität der Menschen und das Finden von Verantwortungsträgern gewesen sei.
Nemzow war eine außerordentliche Persönlichkeit, begabt und bescheiden zugleich und sympathisch. In den folgenden Jahren wurde er überregional höchst populär, als Gouverneur wiederbestätigt und 1997 von Präsident Boris Jelzin zu einem von zwei Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt. »Ich werde nicht lügen, nicht stehlen und mich nicht bestechen lassen«, sagte er bei seinem Amtsantritt. Mit fünfzig Prozent der Stimmen in Meinungsumfragen schien er nach seinem Ausscheiden aus der Regierung ein aussichtsreicher Kandidat für die Wahl zum russischen Präsidenten zu sein. »Die Familie«, also der engste Kreis um den schwerkranken und diskreditierten Boris Jelzin, entschied sich aber für Wladimir Putin. Die Folgen seiner Wahl zum Präsidenten im März 2000 sind bekannt.
Boris Nemzow warnte bereits im Jänner 2004 in einem mit seinem Berater und Freund Wladimir Kara-Mursa unter dem Titel »Über die Gefahr des Putinismus« verfassten Artikel in der Zeitung Nesawissimaja Gaseta vor den drohenden Gefahren einer Diktatur.14 Mit dem gleichen Mut und derselben Leidenschaft, wie er als Gouverneur und Minister die Reformmaßnahmen vorangetrieben hatte, trat Nemzow gegen das Putin-Regime auf. Am 10. Dezember 2014 gab Boris Nemzow der ARD ein fulminantes Interview15: »Russland ist ein klassischer Mafia-Staat mit dem ›Mafioso‹ Putin an der Spitze. Es gibt einen engen Kreis von Personen, die von diesem Mafioso gefüttert werden und vollkommen von ihm abhängig sind. Für sie gelten keine Gesetze. Sie kontrollieren alle Massenmedien. Putin sieht überall Feinde. Das ist auf dem Niveau einer Paranoia […] Sanktionen [wegen der Krim-Annexion, Anm.] gegen die russische Bevölkerung sind schlecht. Gut sind Sanktionen gegen die Dreckskerle, Halunken und Banditen aus dem Umfeld Putins, die zu Milliardären geworden sind. Man darf mit Putin keine Kompromisse machen. Er hat sich die Krim genommen. Als Nächstes wird er sich Kiew nehmen, danach ist die Republik Moldau dran, dann Polen und die baltischen Staaten. Das ist ein Räuber. Er versteht nur die Sprache der Stärke, keine andere Sprache.«
Zehn Wochen später war Boris Nemzow, 55, tot. Er wurde am Abend des 27. Februar 2015 in Begleitung seiner unverletzt gebliebenen Freundin auf der Moskwa-Brücke in Sichtweite des Kremls durch vier Schüsse in Rücken und Hinterkopf getötet.
Wie auch in anderen politischen Mordfällen wurden zwar angebliche Täter zu Haftstrafen verurteilt, aber die Motive und die Auftraggeber bleiben bis heute unbekannt. Nemzows älteste, im Ausland lebende Tochter, das Europaparlament und der Europarat haben bisher vergeblich eine internationale Untersuchung gefordert.16
Galina Starowoitowa und Boris Nemzow sind mir unvergesslich. Sie bestätigen für mich, was Arthur Koestler Anfang 1944 über den Massenmord an den Juden schrieb und was auch für das Verständnis von Zahlen über die Opfer etwa von Stalins Säuberungen oder von Putins Verhaftungswellen bei den Protesten gegen den Ukrainekrieg gilt: »Statistiken bluten nicht, es ist das Detail, was zählt.«17 Deshalb wirken selbst die zeitlich kurzen, aber intensiven persönlichen Bekanntschaften mit Menschen, die tragische Einzelschicksale erleiden, unvergleichlich stärker als lange Abhandlungen mit genauen Opferzahlen über das gleiche Thema.
Schreibtischtäter
In einem langen Leben kommt man sowohl in Kontakt mit künftigen Opfern von Diktaturen als auch mit »Tätern«, also mit den Verantwortlichen und Repräsentanten eines autoritären Systems oder gar einer Diktatur. So geschah es, dass ich — der nie mit Geheimdiensten zu tun hatte — zwei Chefs des russischen Geheimdienstes kennenlernte. Im Herbst 1986 erschien in der von mir herausgegebenen Europäischen Rundschau ein Artikel von Jewgeni Primakow über die sowjetische Außenpolitik unter dem Titel »Philosophie der Sicherheit«. Primakow war damals Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen in Moskau. Sein von der Presseagentur Nowosti vermittelter Aufsatz enthielt keine neuen Gedanken und wiederholte bloß die anfänglich noch konventionellen Schwerpunkte der von Generalsekretär Michail Gorbatschow am 27. Parteitag verkündeten Außenpolitik.
Nie hätte ich gedacht, dass der Autor, ein langjähriger Journalist und Nahostexperte, in den folgenden Jahren ins Politbüro der KPdSU und zum Chef des Auslandsnachrichtendienstes aufrücken würde. Offensichtlich war er schon als Nahostkorrespondent der Prawda ein hochrangiger Aufklärer. Ich habe ihn in der turbulenten Zeit vor dem Zerfall der Sowjetunion, bereits als Kandidat des Politbüros, am Rande einer Konferenz des Internationalen Presse-Instituts persönlich getroffen. Ich erinnere mich, dass er bei einem Hintergrundgespräch noch eine harte Linie gegenüber den Unabhängigkeitsbestrebungen der baltischen Sowjetrepubliken vertrat.
Nichts könnte die spätere Auflockerung in der Gorbatschow-Ära besser illustrieren als folgende Begebenheit: Ich nahm mir 1995 die Freiheit, Primakow — damals Chef des Auslandsgeheimdienstes — durch den österreichischen Botschafter in Moskau einen persönlichen Brief überreichen zu lassen. In diesem erinnerte ich ihn an seinen Artikel und an unsere Begegnung, um dann, mit dem Hinweis auf die Politik der Glasnost (Offenheit), frech um mich betreffende Informationen aus dem KGB-Archiv zu ersuchen. Der Grund sei die Vorbereitung meiner Autobiographie. In einem höflichen Brief teilte mir der Pressechef des Auslandsgeheimdienstes mit, nur im gemeinsamen Archiv der Staatssicherheitsdienste der ehemaligen sozialistischen Länder sei ich als eine »Person erwähnt, die im Verdacht steht, mit dem westdeutschen Geheimdienst Kontakte zu pflegen«.18
Das war natürlich ebenso Unsinn wie die bunten Lügen in den ungarischen und tschechoslowakischen Akten, aber es war bemerkenswert, dass Moskau überhaupt reagierte. Primakow wurde 1996 Außenminister und war 1998/99 sogar Ministerpräsident, bevor Jelzin und die »Familie« Putin zu dessen Nachfolger ernannten.
2007 erhielt Primakow, ein lebenslanger Hardliner und Weggefährte Putins, das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich, Verdienste, die mir völlig unbekannt sind.
Aufregender und kostspieliger war mein Weg zu Wladimir Krjutschkow, der in der ungarischen und sowjetischen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt hat. Zur Vorbereitung meines Buches über den Ungarn-Aufstand 195619 gelang es mithilfe des österreichischen Botschafters in Moskau, Kontakt zu einem ehemaligen Mitarbeiter des Geheimdienstes herzustellen, der bereit war, für ein stattliches Honorar ein Interview mit dem ehemaligen KGB-Chef General Wladimir Krjutschkow in dessen Wohnung zu arrangieren. Es fand am 26. September 2005 statt. Krjutschkow diente ab 1954 in der sowjetischen Botschaft in Budapest als Dritter Sekretär, wurde der engste Mitarbeiter des ebenfalls 1954 zum sowjetischen Botschafter ernannten Juri Andropow und später langjähriger Ungarn-Referent des Zentralkomitees der KPdSU. An der Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956 war er aktiv beteiligt. Bei unserem Gespräch behandelten wir in erster Linie die Rolle des KP-Chefs János Kádár (1956 bis 1988) und jene des 1958 nach einem Geheimprozess hingerichteten Ministerpräsidenten während des Aufstandes, Imre Nagy.
Krjutschkow wurde Andropows Büroleiter, als dieser 1967 die Führung des KGB übernahm, und stieg 1988 sogar zum Vorsitzenden des Geheimdienstes im Rang eines Armeegenerals auf. Er war eine Schlüsselfigur bei der missglückten Verschwörung im August 1991 gegen Präsident Gorbatschow. Unter der Präsidentschaft Boris Jelzins saß er wegen seiner Beteiligung am Putsch siebzehn Monate im Gefängnis, bis er 1994 vom Parlament begnadigt wurde. Seine volle Rehabilitation verdankte er seinem einstigen KGB-Untergebenen, Oberstleutnant Wladimir Putin, als dieser Staatspräsident wurde. Seine Anwesenheit unter den 1500 Gästen bei der Amtseinführung Putins spiegelte in den Augen der amerikanisch-russischen Moskau-Korrespondentin Masha Gessen einen Regimewechsel, den Krjutschkow offenbar aus ganzem Herzen begrüßte.
Unser Treffen im Jahr 2005 fand in Anwesenheit seiner Tochter in einer geräumigen, geschmackvoll eingerichteten Vierzimmerwohnung statt, die er nach seiner Rehabilitation durch Putin bezogen hatte. Er sei öfter Gast beim Präsidenten gewesen, dessen Politik er voll unterstütze, erzählte er. Nach unserem Gespräch schenkte er mir zwei Bücher mit seinen Erinnerungen, die er nach dem Amtsantritt Putins herausgegeben hatte. Ich dachte an die schrecklichen Tage im Luftschutzkeller unseres Hauses in Budapest nach dem massiven Angriff der russischen Panzer am 4. November 1956 und an das erschütternde Bild unserer zerstörten Wohnung. Und jetzt, fast ein halbes Jahrhundert später, dieses freundliche Gespräch mit dem Zeitzeugen des Bösen über die Kulissengeheimnisse der verhassten Sieger — welch ein Gegensatz. Zu stehen fiel dem damals 81-jährigen Mann schwer, zwei Jahre nach unserem Interview starb er.
Michail Gorbatschow — eine Ausnahmeerscheinung
Der Zufall spielte bei meinen Begegnungen mit zwei Opfern und zwei »Schreibtischtätern« in der Zeit des Überganges vom sowjetischen System über das kurze, misslungene demokratische Experiment unter Boris Jelzin zur Diktatur Wladimir Putins eine große Rolle.
Und ich hatte das Glück, die einzigartige und historisch wichtigste Persönlichkeit seit Josef Stalin, Michail Gorbatschow, zweimal zu treffen. Wir im Westen bewunderten ihn als den eigentlichen Zerstörer des Sowjetsystems und des Ostblocks, obwohl es bis zuletzt sein Ziel gewesen war, beides zusammenzuhalten. Für die meisten Russen war er aber jener Politiker, der nach sechs Jahren an der Macht (1985 bis 1991) das Erbe Stalins