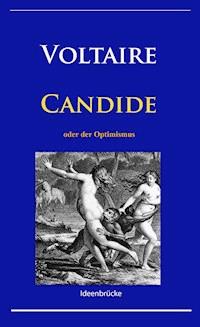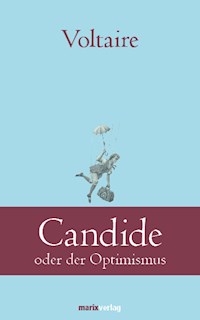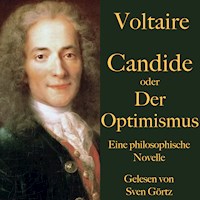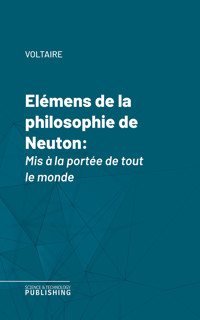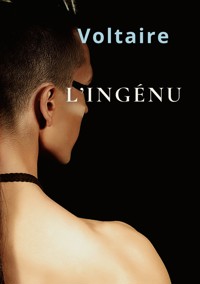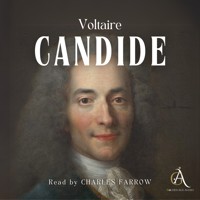5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
1762 wird in Toulouse der Kaufmann Jean Calas auf grausame Weise hingerichtet. Man beschuldigte ihn, seinen Sohn ermordet zu haben, weil der zum Katholizismus habe übertreten wollen. Ein klarer Justizmord. Voltaire nimmt den Fall auf und verfasst eine flammende Abhandlung gegen religiösen Fanatismus, ein Plädoyer für Toleranz. Diese hier neu übersetzte Abhandlung mit sämtlichen Anmerkungen Voltaires im Anhang ist einer der wichtigsten Texte der europäischen Aufklärung. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Toleranz
Aus Anlass des Todes von Jean Calas
Aus dem Französischen übersetzt von Ulrich Bossier
Reclam
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961813-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014018-5
www.reclam.de
Inhalt
Über Toleranz
Der Tod des Jean Calas. Kurze Darstellung des Falles
Folgerungen aus der Hinrichtung des Jean Calas
Der Reformgedanke im 16. Jahrhundert
Ist Toleranz gefährlich?Und bei welchen Völkern besteht sie?
Wie und warum Toleranz gewährt werden sollte
Verträgt sich Intoleranz mit Natur- und Menschenrecht?
Gab es bei den Griechen Intoleranz?
Waren die Römer tolerant?
Über die Märtyrer
Über zwei Gefahren: falsche Legenden und Verfolgung durch Christen
Der Frevel der Intoleranz
War die Intoleranz dem göttlichen Recht des Judentums gemäß, und wurde sie stets zur Anwendung gebracht?
Extreme Toleranz der Juden
Hat Christus Intoleranz gelehrt?
Stimmen gegen die Intoleranz
Gespräch zwischen einem Sterbenden und einem Menschen, der sich wohl befindet
Brief eines Benefiziaten an den Jesuiten Le Tellier vom 6. Mai 1714
Die wenigen Fälle, in denen Intoleranz den menschlichen Rechten doch gemäß ist
Von einem Religionsstreit in China
Soll man das Volk im Aberglauben halten?
Tugend ist mehr wert als Wissenschaft
Von der universellen Toleranz
Gebet an Gott
Postskriptum
Fortsetzung und Schluss
Zu dieser Ausgabe
Nachwort
Der Beginn des Textes in der Erstausgabe von 1763
[7]Kapitel I
Der Tod des Jean Calas. Kurze Darstellung des Falles
Der Mord an Calas, begangen zu Toulouse mit dem Schwerte der Justiz am 9. März 1762, ist eines der eigentümlichsten Ereignisse, welche die Aufmerksamkeit unseres Zeitalters und auch die der Nachwelt verdienen. Die Scharen von Menschen, die auf den Schlachtfeldern fallen, vergisst man rasch – erstens, weil dies zum Schicksal im Kriege unvermeidlich dazugehört; zweitens, weil jene, die durch die Fügung der Waffen umkamen, ja auch ihren Feinden den Tod hätten bringen können, und sie sind nicht gefallen, ohne sich zu verteidigen. Wo Gefahr und Vorteil sich die Waage halten, endet die Erstauntheit, und sogar das Mitleid schwächt sich ab. Aber wenn ein unschuldiger Familienvater in die Hände des Irrtums, der Leidenschaft oder des Fanatismus gerät, wenn der Angeklagte keinen anderen Verteidiger hat als seine Tugend; wenn die Schiedsrichter über sein Leben, sollten sie ihn niedermachen, nicht mehr riskieren, als dass sie sich eben geirrt haben; wenn sie ungestraft töten dürfen durch ein Urteil, dann erhebt sich der öffentliche Schrei, jeder bangt um sich selbst; man sieht, dass vor einem Tribunal, das errichtet wurde, um über das Leben der Bürger zu wachen, niemand seines Lebens sicher ist, und alle Stimmen vereinen sich zu einem Ruf nach Vergeltung.
Es ging in dieser seltsamen Affäre um Religion, um Freitod, um Verwandtenmord; es ging um die Frage: haben hier ein Vater und eine Mutter ihren Sohn erwürgt, weil sie [8]Gott gefallen wollten? Hat ein Bruder seinen Bruder erwürgt? Hat ein Freund seinen Freund erwürgt? Müssen sich die Richter etwa vorwerfen, dass sie einen unschuldigen Vater aufs Rad schickten, dafür aber eine schuldige Mutter, einen schuldigen Bruder und einen schuldigen Freund ungestraft davonkommen ließen?
Jean Calas, damals achtundsechzig, lebte seit über vierzig Jahren als Händler in Toulouse und galt bei allen, die ihn näher kannten, als ein guter Vater. Er war Protestant, auch seine Frau und all seine Kinder hingen dieser Konfession an, außer einem Sohn; dieser hatte der Häresie abgeschworen, der Vater zahlte ihm dennoch eine kleine Unterhaltsrente. Es gab Zeichen genug, wie weit entfernt er war von jenem absurden Fanatismus, der alle gesellschaftlichen Bande zerreißt: so wandte er gegen die Konversion seines Sohnes Louis Calas nichts ein und beschäftigte seit dreißig Jahren eine überzeugte und aktive Katholikin als Dienstmagd, die auch seine Kinder erzog.
Einer der Söhne des Jean Calas, Marc-Antoine, war ein Mensch, der viel las; er galt allgemein als ein unruhiger, melancholischer und heißsporniger Geist. Der junge Mann konnte im Handel nicht reüssieren, ja er scheiterte gleich zu Beginn, weil er für dieses Gewerbe nicht taugte. Advokat wiederum durfte er nicht werden; dazu hätte es eines Katholizitätszertifikats bedurft, und an das kam er nicht heran. So entschied er sich, seinem Leben ein Ende zu setzen, und ließ diese Absicht gegenüber einem seiner Freunde auch durchblicken. Er bestärkte sich selbst in seinem Entschluss, indem er alles studierte, was je über Selbstmord geschrieben worden war.
Eines Tages dann, nachdem er sein Geld im Spiel [9]verloren hatte; wählte er diesen Tag für die Ausführung seines Vorhabens. Ein Freund der Familie und auch der seinige mit Namen Lavaisse, ein junger Mann von neunzehn Jahren, bekanntermaßen von aufrichtiger und sanfter Art, Sohn eines berühmten Toulouser Advokaten, war tags zuvor aus Bordeaux gekommen1 und aß an diesem Abend zufällig bei den Calas. Der Vater, die Mutter, Marc-Antoine, ihr ältester, und Pierre, ihr zweiter Sohn, speisten zusammen. Nach Tisch zog man sich in einen kleinen Salon zurück. Marc-Antoine verließ die Runde; schließlich wollte der junge Lavaisse gehen, und nachdem er und Pierre Calas die Treppe hinabgestiegen waren, fanden sie unten neben dem Laden Marc-Antoine im Hemd an einer Tür erhängt; sein Anzug lag gefaltet auf der Theke. Das Hemd war in keiner Weise derangiert, die Haare waren ordentlich gekämmt; an seinem Körper hatte er keine Wunde, keine blauen Flecken.2
Wir übergehen hier all die Details, welche die Anwälte schon genügend wiedergegeben haben; wir schildern nicht den Schmerz und die Verzweiflung des Vaters und der Mutter; die Nachbarn haben ihre Schreie gehört. Lavaisse und Pierre Calas, ganz außer sich, rannten los, um Ärzte und die Polizei zu holen.
Während sie so ihre Pflicht erfüllten, während Vater und Mutter aus dem Weinen und Schluchzen nicht herauskamen, versammelte sich das Volk von Toulouse um das Haus. Dieses Volk ist ungezügelt abergläubisch und gereizt; ihre Brüder, die nicht derselben Religion angehören wie sie, sind für jene Leute Ungeheuer. In Toulouse dankte man Gott feierlich für den Tod Heinrichs III.; in Toulouse schwor man, dass der Erste, der vorschlage, den großen, [10]guten König Heinrich IV. anzuerkennen, mit seinem Leben bezahlen werde. Diese Stadt feiert immer noch jedes Jahr mit einer Prozession und Freudenfeuern den Tag, an dem sie vor zweihundert Jahren viertausend häretische Bürger massakrierte. Sechs Verfügungen hat die Stadt gegen dieses abscheuliche Fest erlassen, doch vergeblich: die Toulouser feierten sie einfach weiter wie Blumenspiele.
Irgendein Fanatiker aus dem Pöbel schrie, Jean Calas selbst habe seinen Sohn Marc-Antoine erhängt. Andere schrien es ihm nach, und binnen eines Augenblicks wurde es einhellige Meinung. Weitere Vorwürfe traten hinzu: morgen habe der Getötete seiner Konfession abschwören wollen; seine Familie und der junge Lavaisse hätten ihn aus Hass gegen die katholische Religion erwürgt; ein Augenblick – und niemand zweifelte mehr; die ganze Stadt war überzeugt, es sei ein Glaubensprinzip bei den Protestanten, dass Eltern einen Sohn umbringen müssten, sobald dieser die Absicht äußere zu konvertieren.
Sind die Gemüter erst einmal in Wallung, gibt es für sie kein Halten. Man phantasierte sich zurecht: Am Vortag hätten sich die Protestanten des Languedoc versammelt und mehrheitlich einen Henker ihrer Sekte bestimmt; die Wahl sei auf Lavaisse gefallen; der junge Mann habe binnen vierundzwanzig Stunden von seiner Wahl erfahren und sei aus Bordeaux nach Toulouse gekommen, und dort sollte er nun Jean Calas, seiner Frau und beider Sohn Pierre helfen, einen Freund, einen Sohn und einen Bruder zu erwürgen.
Einen Herrn David, Ratsherr von Toulouse, erregten diese Gerüchte; er wollte sich durch promptes Handeln profilieren, agierte dabei aber gegen Regel und Recht. Die [11]Familie Calas, die katholische Dienerin und Lavaisse wurden in Ketten gelegt.
Man veröffentlichte ein Monitorium, das ebenso unkorrekt war wie Davids Verfahren. Man ging noch weiter. Marc-Antoine Calas war als Calvinist gestorben, und wäre man davon ausgegangen, dass er wirklich Hand an sich gelegt hatte, so hätte er über den Erdboden aus der Stadt hinausgeschleift und draußen verscharrt werden müssen. Stattdessen setzte man ihn mit dem größten Pomp in der Kirche Saint-Etienne bei; vergebens protestierte der Pfarrer gegen diese Profanierung.
Es gibt im Languedoc vier Kongregationen religiöser Bußbrüder, auch Pönitenten genannt: die weiße, die blaue, die graue und die schwarze. Die Konfratres tragen eine lange Kapuzenkutte, dazu eine Stoffmaske mit zwei Löchern für die Augen darin. Sie haben einmal den Herzog Fitz-James, den Truppenkommandeur des Languedoc, ersucht, ihnen beizutreten, was dieser jedoch ablehnte. Die weißen Pönitenten veranstalteten für Marc-Antoine Calas eine weihevolle Messe wie für einen Märtyrer. Nie hat je eine Kirche einen wirklichen Märtyrer mit mehr Pomp gefeiert, aber dieser Pomp war grässlich. Auf einen prächtigen Katafalk hatte man ein Skelett postiert, das man Bewegungen machen ließ und das Marc-Antoine Calas darstellte. In der einen Hand hielt das Gerippe einen Palmzweig und in der anderen die Feder, mit der er seine Abkehr von der Häresie unterzeichnet hätte. Tatsächlich aber schrieb diese Feder das Todesurteil für seinen Vater.
Nun fehlte dem Unglücklichen, der Hand an sich gelegt hatte, nur noch die Kanonisation. Das ganze Volk betrachtete ihn als einen Heiligen; einige riefen ihn an; andere [12]beteten an seinem Grab; andere baten ihn um Wunder; andere erzählten jene, die er schon vollbracht hatte. Ein Mönch zog ihm ein paar Zähne, um dauerhafte Reliquien zu besitzen. Eine fromme Frau, die an leichter Taubheit litt, sagte, sie habe wieder klar und deutlich die Glocken läuten gehört. Ein apoplektischer Priester fand sich geheilt, nachdem er ein Brechmittel eingenommen hatte. Man begann, die Wunder zu protokollieren. Der Schreiber dieser Zeilen besitzt eine schriftliche Aussage über folgenden Vorgang: Ein junger Toulouser betete mehrere Nächte hindurch am Grab des neuen Heiligen und bat um ein Wunder, das aber ausblieb; daraufhin wurde der Mann verrückt.
Einige Mitglieder des Magistrats gehörten der weißen Bußbrüderschaft an. Damit stand der Tod des Jean Calas so gut wie fest.
Was sein gewaltsames Ende besonders beförderte, war die zeitliche Nähe jenes seltsamen Festes, das die Toulouser jedes Jahr begehen und mit dem sie feiern, dass in ihrer Stadt einmal viertausend Hugenotten massakriert wurden. Im Jahre 1762 zelebrierte man nun das zweihundertste Jubiläum dieses Ereignisses. Die Vorbereitungen dieser Feierlichkeit liefen bereits; sie fachten die schon erhitzte Phantasie des Volkes noch mehr an. Man sagte öffentlich, das Schafott, auf dem die Calas’ gerädert werden sollten, sei die größte Zierde des Festes; man sagte, die Vorsehung selbst habe diese Delinquenten beschert, damit sie unserer heiligen Religion geopfert werden könnten. Zwanzig Personen haben diese Reden gehört, und noch ärgere. Und das in unseren Tagen! Und das zu einer Zeit, da die Philosophie solche Fortschritte gemacht hat! Und das, wo doch hundert Akademien schreiben, um für sanftere [13]Sitten zu werben! Es scheint, als würde der Fanatismus, außer sich über die Erfolge der Vernunft in letzter Zeit, nun mit noch mehr Wut gegen sie anrennen.
Dreizehn Richter versammelten sich täglich, um den Prozess zu einem Ende zu bringen. Man hatte keinen Beweis gegen die Familie; man konnte keinen haben; aber die untreulich gebrauchte Religion ersetzte den Beweis. Sechs Richter beharrten lange Zeit darauf, man solle Jean Calas, seinen Sohn und Lavaisse zum Rädern verurteilen und Jean Calas’ Frau zum Scheiterhaufen. Die sieben anderen waren moderater und verlangten wenigstens, dass man eine Untersuchung führe. Die Debatten wiederholten ständig dieselben Argumente und dauerten. Einer der Richter, überzeugt von der Unschuld der Angeklagten und von der Unmöglichkeit des Verbrechens, sprach energisch zu ihren Gunsten; er stellte dem Eifer der Härte den Eifer der Menschlichkeit entgegen. Er wurde der öffentliche Anwalt der Calas’ in allen Häusern von Toulouse, wo das unaufhörliche Geschrei der missbrauchten Religion das Blut dieser Unglücklichen forderte. Ein anderer Richter, dessen Heftigkeit notorisch war, redete in der Stadt mit genauso viel Zorn gegen die Calas’, wie der Ebengenannte Beflissenheit zeigte, sie zu verteidigen. Die Erregung wurde so groß, dass beiden nichts blieb, als sich gegenseitig als Rechtsprecher abzulehnen und aus der Runde auszuscheiden; sie zogen sich aufs Land zurück.
Aber durch ein seltsames Unglück war der den Calas’ wohlgesonnene Richter so anständig, sich an seinen Stimmverzicht zu halten; der andere jedoch kam zurück und gab sein Votum ab gegen jene, über die er eigentlich gar nicht richten durfte. Genau dieses gab den Ausschlag zur [14]Verurteilung zum Rad, denn das Stimmenverhältnis betrug jetzt acht zu fünf – einer der sechs Richter der Gegenseite war nach vielen Streitereien zur entschiedenen Härtepartei übergegangen.
Man möchte meinen, dass, wenn es um Verwandtenmord geht und darum, ob man einen Familienvater der abscheulichsten Exekutionsart ausliefern will, das Urteil einstimmig zu sein habe, weil die Beweise für solch ein unerhörtes Verbrechen3 eine jedermann einsichtige Evidenz besitzen sollten. Der geringste Zweifel muss in einem solchen Fall genügen, um einem Richter, der ein Todesurteil zu unterzeichnen sich anschickt, die Hand zittern zu lassen. Die Schwäche unserer Vernunft und die Unzulänglichkeit unserer Gesetze zeigen sich täglich, aber wann offenbart sich einem dieses Elend deutlicher als dann, wenn der Vorsprung von einer Stimme einen Menschen zum Schafott verdammt? In Athen brauchte es fünfzig Stimmen über die Hälfte, ehe man ein Todesurteil zu fällen wagte. Was lehrt uns dies? Etwas, das wir wissen, ohne daraus zu lernen: dass die Griechen weiser und menschlicher waren als wir.
Jean Calas, ein alter Mann von achtundsechzig Jahren, der seit Langem unter geschwollenen und schwachen Beinen litt, konnte eindeutig keinesfalls einen außergewöhnlich kräftigen Sohn von achtundzwanzig Jahren erwürgt und aufgehängt haben, jedenfalls nicht allein; bei dieser Hinrichtung hätten ihm unbedingt seine Frau, sein Sohn Pierre Calas, Lavaisse und die Dienerin helfen müssen. Die Genannten hatten einander an dem Abend, da der fatale Vorfall passierte, nicht einen Augenblick verlassen. Aber die zweite Vermutung war ebenso absurd wie die erste: [15]Wie hätte eine leidenschaftlich katholische Dienerin hinnehmen können, dass Hugenotten einen jungen Mann, den sie erzogen hatte, ermordeten, um ihn dafür zu bestrafen, dass er die Religion ebenjener Dienerin liebte? Wie lässt sich denken, Lavaisse sei eigens aus Bordeaux gekommen, um seinen Freund zu erwürgen, von dessen behaupteter Konversionsabsicht er gar nichts wusste? Wie hätte eine zärtliche Mutter Hand an ihren Sohn legen können? Wie wären sie alle gemeinsam imstande gewesen, einen jungen Mann zu erdrosseln, der so stark war wie sie alle zusammen, ohne einen langen und heftigen Kampf, ohne furchtbares Geschrei, das die ganze Nachbarschaft alarmiert hätte, ohne wiederholte Schläge, ohne Blessuren, ohne Risse in der Kleidung?
Es war evident, dass, wenn man davon ausging, der Mord sei möglich gewesen, alle Angeklagten gleichermaßen schuldig gesprochen werden mussten, denn sie waren die ganze Zeit zusammen. Es war evident, dass sie die Tat nicht begangen haben konnten. Es war evident, dass der Vater allein sie auch nicht hätte vollbringen können. Und doch verurteilte man allein diesen Vater aufs Rad.
Der Hintergrund dieses Urteils ließ einen ebenso fassungslos zurück wie alles Übrige. Die Richter, die unbedingt die Hinrichtung des Jean Calas wollten, überredeten die anderen mit dem Argument, der schwache Greis werde den Martern während der Exekution nicht standhalten und bestimmt unter den Schlägen der Henker sein und seiner Komplizen Verbrechen gestehen. Sie waren bestürzt, als ebenjener Greis, während er auf dem Rad starb, Gott als Zeugen seiner Unschuld anrief und ihn beschwor, seinen Richtern zu vergeben.
[16]Sie sahen sich gezwungen, ein zweites Urteil zu fällen, das dem ersten widersprach: Die Mutter, der Sohn Pierre, der junge Lavaisse und die Dienerin seien freizulassen. Aber einer der Räte machte ihnen klar, dass dieses Urteil das erste negierte und sie so über sich selbst den Stab brächen: Da alle Angeklagten zur vermuteten Tatzeit ununterbrochen beisammen gewesen seien, bewiese die Freilassung aller Überlebenden zwingend die Unschuld des hingerichteten Familienvaters. Also entschied man, den Sohn Pierre Calas des Landes zu verweisen. Diese Verbannung musste jedoch ebenso inkonsequent, ebenso absurd wirken wie alles Bisherige: Entweder war Pierre Calas an dem Verwandtenmord beteiligt oder nicht. War er es, verdiente er den Tod auf dem Rad wie sein Vater; war er es nicht, verdiente er keine Verbannung. Aber die Richter, betroffen vom leidensvollen Ende des Vaters und von der rührenden Frömmigkeit, mit der er gestorben war, vermeinten, sie retteten ihre Ehre, indem sie glauben machten, dass sie dem Sohn Gnade erwiesen. Als ob dieser Gnadenerweis nicht eine neuerliche Amtsverletzung gewesen wäre. Und sie glaubten, die Verbannung dieses jungen Mannes, der arm und hilflos dastand, habe keine schlimmen Folgen und sei keine große Ungerechtigkeit nach der, die sie leider begangen hatten.
Man begann, Pierre Calas in seinem Kerker zu drohen, man werde ihn wie seinen Vater behandeln, wenn er nicht seiner Religion abschwöre. Dies hat der junge Mann schriftlich und mit Eid bezeugt.4
Als Pierre Calas die Stadt verlassen wollte, begegnete er einem Abbé, der auf Bekehrungen spezialisiert war und ihn zurück nach Toulouse führte. Dort sperrte man ihn in ein [17]Dominikanerkloster, wo man ihn zwang, alle Regeln der Katholizität zu erfüllen. Auf diese Wendung hatte man teilweise bewusst hingearbeitet. Es war der Preis für das Blut seines Vaters, und die Religion, die man geglaubt hatte, rächen zu müssen, schien befriedigt.
Der Mutter nahm man ihre Töchter fort; sie wurden in ein Kloster gesteckt. Diese Frau, fast bespritzt vom Blut ihres Gatten, die ihren toten Ältesten in den Armen gehalten hatte, den anderen verbannt wusste, ihrer Töchter beraubt und ihres gesamten Besitzes enteignet, stand nun allein da auf der Welt, ohne Brot, ohne Hoffnung, und starb dahin in ihrem maßlosen Elend. Mehrere Personen, die alle näheren Umstände dieses schrecklichen Ereignisses reiflich geprüft hatten, waren darüber so bestürzt, dass sie Madame Calas, die sich an einen einsamen Ort zurückgezogen hatte, drängten, sich an den Thron zu wenden und dort um Gerechtigkeit zu bitten. Sie konnte sich kaum aufrecht halten und wirkte hinfällig. Zudem jagte der geborenen Engländerin, die es frühzeitig in eine französische Provinz verschlagen hatte, der bloße Name der Stadt Paris Schauder ein. Die Hauptstadt des Königreichs, so vermeinte sie, müsse noch barbarischer sein als die des Languedoc. Schließlich aber siegte die Pflicht, das Andenken ihres Mannes geradezurücken, über ihre Schwäche. Sie war kaum noch recht lebendig, als sie in Paris ankam. Dort fand sie, zu ihrem Erstaunen, freundliche Aufnahme, Hilfe und Tränen.
In Paris hat die Vernunft die Oberhand über den Fanatismus, so stark er auch sein mag, während in der Provinz der Fanatismus fast immer die Oberhand über die Vernunft besitzt.
[18]Herr de Beaumont, berühmter Advokat des Pariser Parlaments, übernahm als Erster ihre Verteidigung und erstellte ein Gutachten, das von fünfzehn anderen Advokaten mitunterzeichnet wurde. Herr Loiseau verfasste mit nicht geringerer Eloquenz eine Denkschrift zugunsten der Familie. Herr Mariette, Advokat am Stadtrat, setzte ein juristisches Gesuch auf, das allgemein überzeugte.
Die drei hochherzigen Verteidiger der Gesetze und der Unschuld überließen der Witwe die Erträge der Buchausgaben ihrer Plädoyers.5 Paris und ganz Europa zeigten sich vor Mitleid erschüttert und forderten Gerechtigkeit gegenüber der unglücklichen Frau. Das Urteil war von der gesamten Öffentlichkeit längst gesprochen, bevor der Pariser Stadtrat es unterzeichnen konnte.
Trotz des ständigen Sturzbachs von Angelegenheiten, der ein solches Gefühl meist gar nicht zulässt, drang dieses Mitleid bis zu ihm durch. Auch führt das ständige Wahrnehmen von Unglücklichen zur Gewöhnung und kann das Herz zusätzlich verhärten. Hier aber ließ man sich rühren. Die Mutter bekam ihre Kinder zurück. Man sah sie alle drei mit Trauerflor bedeckt und tränenüberströmt, und nach einer Weile weinten auch ihre Richter.
Und doch hatte diese Familie immer noch einige Feinde; schließlich ging es um Religion. Mehrere Personen – Angehörige einer Gruppe, die man in Frankreich les dévots nennt, die Devoten6 – sagten laut, es sei besser, einen alten Calvinisten zu rädern, als acht Räte des Languedoc bloßzustellen, indem man sie zu dem Eingeständnis trieb, dass sie sich geirrt hatten. Man bediente sich sogar der Formulierung: »Es gibt mehr Magistrate als Calasse«; und dies sollte heißen, man müsse die Familie Calas der Ehre der [19]Magistratur opfern. Die das äußerten, kamen gar nicht auf die Idee, dass die Ehre der Richter – wie die der anderen Menschen auch – darin besteht, ihre Fehler wiedergutzumachen. Man glaubt in Frankreich nicht, dass der Papst, der sich mit seinen Kardinälen berät, unfehlbar sei; dann möchte man doch meinen, dass acht Richter in Toulouse es ebenso wenig sind. Die übrigen Leute, soweit verständig und objektiv, sagten, dass das Urteil in ganz Europa für null und nichtig erklärt würde, selbst wenn die Obrigkeit sich zu besonderen Rücksichtnahmen verpflichtet sehe wie jene, die den Rat von Paris hinderten, das Verdikt zu kassieren.
So war der Stand der Dinge in dieser seltsamen Affäre, als ebendiese ein paar unparteiischen, aber empfindsamen Leuten die Absicht eingab, der Öffentlichkeit ein paar Reflexionen über Toleranz, Milde und Erbarmen zu präsentieren. Da konnte Abbé Houtteville in seiner schwülstigen und tatsachenwidrigen Deklamation noch so dagegen wettern und das Mitleid ein »monströses Dogma« nennen – die Vernunft nennt es doch Erbgabe der Natur.
Entweder haben die Richter von Toulouse, mitgerissen vom Fanatismus des Pöbels, einen unschuldigen Familienvater rädern lassen – ein Vorgang ohne Beispiel; oder jener Familienvater und seine Frau haben, unter Mitwirkung eines zweiten Sohnes und eines Freundes, diesen Verwandtenmord begangen, ihren ältesten Sohn erwürgt – ein Vorgang wider die Natur. In beiden Fällen hätte der Missbrauch der allerheiligsten Religion zu einem gewaltigen Verbrechen geführt. Es liegt also im Interesse der Menschheit zu prüfen, was die Religion praktizieren sollte: Milde oder Barbarei.
[20]Kapitel II
Folgerungen aus der Hinrichtung des Jean Calas
Wenn die weißen Bußbrüder die Ursache zur Exekution eines Unschuldigen, zum totalen Ruin und zum Auseinanderreißen waren, wenn hier nicht allein die Ungerechtigkeit, sondern eine Hinrichtung Anlass zu Schmach und Schande gibt; wenn die Eilfertigkeit, mit der jene weißen Bußbrüder jemanden, der laut unseren barbarischen Gebräuchen durch den Dreck hätte geschleift werden müssen, wie einen Heiligen feierten, einen ehrsamen Familienvater aufs Rad brachten – dann sollten jene Bußbrüder tatsächlich Buße tun, und zwar für den Rest ihres Lebens; sie und die Richter sollten weinen, aber nicht in langen weißen Kutten und mit einer Maske vorm Gesicht, die ihre Tränen verbirgt.
Den Bruderschaften tritt man allgemein mit Achtung entgegen; sie sorgen für Erbauung; aber welchen großen Nutzen sie dem Staat auch bereiten können – wiegt dieser das abscheuliche Übel auf, das sie verursacht haben? Sie scheinen durch den Glaubenseifer begründet worden zu sein, der im Languedoc die Katholiken gegen jene beseelt, die wir Hugenotten nennen. Offenbar haben da welche geschworen, ihre Brüder zu hassen; wir haben genug Religion, um zu hassen und zu verfolgen, aber nicht genug, um zu lieben und zu helfen. Was, wenn an der Spitze dieser Kongregationen Schwärmer stünden, wie früher bei bestimmten Vereinigungen von Handwerkern oder auch Herrschaften, welche die Gewohnheit, Visionen zu erleben, zu einer Kunst gemacht und in ein System gebracht [21]haben, wie einer unsere beredsamsten und kenntnisreichsten Magistrate sagt? Was, wenn man in den Bruderschaften gewisse dunkle Räume anlegt, genannt Meditationskammern, auf deren Wände Teufel mit Hörnern und Krallen gemalt sind, dazu flammende Schlünde, Kreuze und Dolche, und über das Bild der heilige Name Jesu? Welch ein Schauspiel für ohnehin schon betörte Augen und für die Phantasien jener, die ebenso entflammt wie ihren Führern gefügig sind!
Es gab Zeiten – dies ist uns nur zu bekannt –, da die Bruderschaften gefährlich waren. Fratrizellen und Flagellanten etwa haben für gehörige Unruhe gesorgt. Die Heilige Liga ging aus solchen Vereinigungen hervor. Warum wollte man sich dergestalt von den anderen Bürgern unterscheiden? Wähnte man sich vollkommener? Das allein schon wäre eine Beleidung dem Rest der Nation gegenüber. Wollte man etwa, dass alle Christen in die Bruderschaft eintraten? Das ergäbe ein tolles Schauspiel: das gesamte Europa im Kapuzenmantel und hinter Masken mit zwei kleinen runden Löchern vor den Augen! Meint man ernsthaft, Gott sei ein solcher Aufzug lieber als normaler Justaucorps? Und damit längst kein Ende der Bedenklichkeiten: dieser Habit ist die Uniform der Kontroversisten, die ihre Gegner auffordert, sich zu bewaffnen; sie kann eine Art Bürgerkrieg in den Köpfen entfachen, und der mündete vielleicht in schlimme Ausschreitungen – wenn der König und seine Minister nicht so weise wären, wie die Fanatiker verrückt sind.
Wir wissen zur Genüge, welchen Preis sie gefordert haben, die Streitigkeiten zwischen Christen über Dogmen: Blut ist geflossen, auf den Schafotten wie auf den [22]Schlachtfeldern, vom vierten Jahrhundert an bis in unsere Zeit. Beschränken wir uns hier auf die Kriege und die sonstigen Schrecken, welche die Zwistigkeiten um die Reformation auslösten und was deren Quelle in Frankreich war. Vielleicht kann eine kurze und getreue Schilderung dieses ganzen Unheils einigen Menschen, die nicht genau Bescheid wissen, die Augen öffnen und gutgesinnte Herzen rühren.
[23]Kapitel III
Der Reformgedanke im 16. Jahrhundert
Als mit der Wiedergeburt der Wissenschaften die Geister sich zu erhellen begannen, beschwerte man sich allgemein über Missbräuche; jeder muss zugeben, dass diese Klage berechtigt war.
Papst Alexander VI. hatte die Tiara öffentlich gekauft, und seine fünf Bastarde teilten sich, was sie einbrachte. Sein Sohn, der Kardinalherzog von Borgia, ließ mit dem Einverständnis des päpstlichen Vaters eine Reihe hochgestellter Persönlichkeiten eines gewaltsamen Todes sterben, um ihre Herrschaftsbereiche an sich zu reißen, darunter Vitelli, Urbino, Gravina, Oliverotto und noch hundert andere mehr. Julius II., vom gleichen Geist beseelt, exkommunizierte Ludwig XII. und überließ dessen Gebiete dem nächstbesten Okkupanten. Und er selber, Helm auf dem Kopf und Panzer vor der Brust, verwüstete mit Flamme und Schwert einen Teil Italiens. Leo X. verschacherte Ablassbriefe, wie andere Leute Lebensmittel auf einem öffentlichen Markt verkaufen; damit finanzierte er seine Vergnügungen. Jene, die gegen so viel Räuberei aufbegehrten, hatten zumindest hinsichtlich der Moral nicht unrecht. Sehen wir nun, ob sie hinsichtlich der Politik gegen uns recht hatten.
Sie machten geltend, dass Jesus Christus nie Annaten oder Reservation verlangt und weder Dispensationen für diese noch Ablässe für die andere Welt verkauft habe; also bestehe keine Notwendigkeit, einem ausländischen Fürsten all diese Dinge zu bezahlen. Nehmen wir an, die [24]Annaten, die Prozesse am römischen Gerichtshof sowie die Dispensationen – was es ja alles bis zum heutigen Tage gibt – kosteten uns jährlich nur 500 000 Francs, so haben wir seit den Zeiten Franz’ I. innerhalb von 250 Jahren 125 Millionen bezahlt; berücksichtigt man den geänderten Preis der Silbermark, beträgt diese Summe nach jetzigem Geld etwa 250 Millionen. Man kann also ohne Blasphemie einräumen, dass die Häretiker, als sie die Streichung dieser merkwürdigen Abgaben, über welche die Nachwelt sich wundern wird, vorschlugen, dadurch dem Reich keinen Schaden zuzufügen gedachten, und dass sie eher gute Rechner denn schlechte Untertanen waren. Hinzu kommt noch, dass allein sie Griechisch konnten und sich in der Antike auskannten. Bestreiten wir nicht, dass wir, trotz ihrer Irrtümer, ihnen die Entwicklung des menschlichen Geistes verdanken, der lange Zeit unter einer sehr dicken Schicht Barbarei gelegen hatte.
Aber sie leugneten das Fegefeuer, an dem man nicht zweifeln darf und das obendrein den Mönchen eine Menge einbrachte. Ebenso wenig verehrten sie die Reliquien, die man jedoch verehren muss und die den Mönchen noch mehr einbrachten. Weil sie also höchst respektierte Dogmen attackierten,7 antwortete man ihnen gleich zu Beginn bloß dadurch, dass man sie verbrennen ließ. In Deutschland beschützte der König sie und nahm sie in Lohn und Brot. Anders in Frankreich: Da ging der König an der Spitze einer Prozession, nach der man mehrere dieser Unglücklichen hinrichtete. Und diese Exekution ging so: Man steckte einen langen Balken horizontal durch einen Baum, so dass eine Art große Wippe entstand, und an einem Ende der Bohle befestigte man die Delinquenten; unter ihnen [25]entzündete man ein Feuer, tauchte sie hinein und zog sie wieder hoch, eins ums andere Mal. Sie verspürten die Qualen des Sterbens stufenweise, bis sie endlich ihr Leben aushauchten, gepeinigt durch die längste und scheußlichste Marter, welche die Barbarei jemals erfunden hat.
Kurz vor dem Tode Franz’ I.