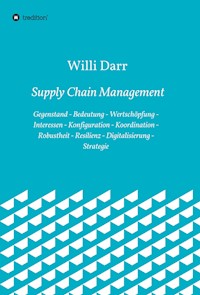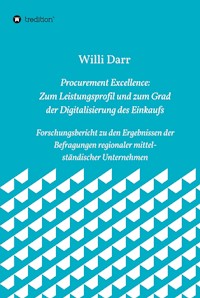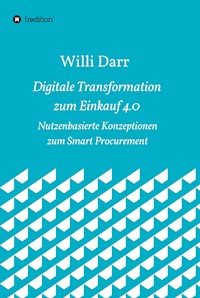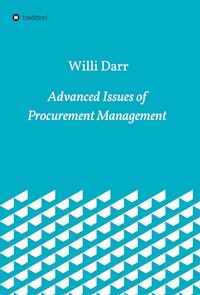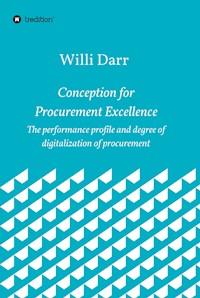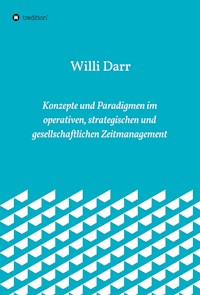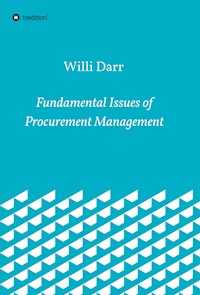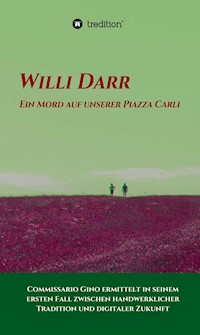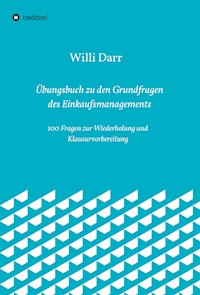
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dieses Übungsbuch leistet einen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung im Einkaufsmanagement, indem es die zentralen Elemente und Zusammenhänge aus meinem Lehrbuch "Grundfragen des Einkaufsmanagements" wiederholt und anhand von detaillierten Fragen die Aufmerksamkeit auf die facettenreiche Welt des Einkaufs lenkt. Es ist für den Einstieg in das Einkaufsmanagement geeignet und damit eine hilfreiche Lektüre für alle Studenten und Praktiker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Willi Darr
Übungsbuch zu den Grundfragen des Einkaufsmanagements
100 Fragen zur Wiederholung und Klausurvorbereitung
Willi Darr
Übungsbuch zu den Grundfragen des Einkaufsmanagements
100 Fragen zur Wiederholung und Klausurvorbereitung
tredition VerlagHamburg
Hardcover
ISBN 978-3-7469-7893-2
Paperback
ISBN 978-3-7469-7892-5
e-Book
ISBN 978-3-7469-7894-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2018 Willi Darr
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung. Dies gilt insbesondere für den Nachdruck, für Vervielfältigung, Bearbeitungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Herstellung und Verlag
tredition GmbH, Hamburg
Vorwort
Der Einkauf bzw. das Einkaufsmanagement in Unternehmen hat in den letzten Jahren einen deutlichen Bedeutungsschub erhalten. Die zunehmende Fremdvergabe von Leistungen an Lieferanten und die gleichzeitige Beauftragung internationaler Lieferanten haben die Aufgaben und das Berufsbild der Einkäufer hinsichtlich ihres Beitrages zur unternehmerischen Wertschöpfung verändert. Dabei finden zunehmend Produktentwicklungen in der Lieferkette statt. Ohne Einkaufsmanagement sind unternehmerische Strategien und die Erreichung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile nicht mehr zu erzielen. Der Einkauf ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Unternehmen geworden. Eine profunde Ausbildung der Einkäufer ist heute selbstverständlicher Teil jeder Aus- und Weiterbildung.
Dieses Übungsbuch leistet einen grundlegenden Beitrag, indem es die zentralen Elemente und Zusammenhänge aus meinem Lehrbuch „Grundfragen des Einkaufsmanagements“ wiederholt und anhand von detaillierten Fragen die Aufmerksamkeit auf die facettenreiche Welt des Einkaufs lenkt. Es ist für den Einstieg in das Einkaufsmanagement geeignet und damit eine hilfreiche Lektüre für alle Studenten und Praktiker.
Um die Lesbarkeit zu wahren, wird auf die Verwendung von Doppelformen oder andere Kennzeichnungen für weibliche und männliche Personen verzichtet.
Jedem Leser wünsche ich hilfreiche Einblicke und erlebte Lerneffekte bei seinem Weg in den bzw. im Einkauf.
Willi Darr
Inhaltsverzeichnis
1. Übungsfragen zu den Grundlagen des Einkaufsmanagements
a. Zum Begriff des Einkaufs
b. Zu den Einkaufsobjekten
c. Zum Einkaufsprozess
d. Zum Einkaufsmanagement
e. Zu den Zielen des Einkaufs
f. Mögliche Klausurfragen
2. Übungsfragen zur Bedeutung des Einkaufsmanagements
a. Zum Outsourcing
b. Zur Hebelwirkung des Einkaufs
c. Zu den sinkenden Transferkosten
d. Zu den schwankenden Wechselkursen und Rohstoffpreisen
e. Mögliche Klausurfragen
3. Übungsfragen zum Management der Einkaufsorganisation
a. Zum Aufbau der Primärorganisation
b. Zur hierarchischen Bedeutung des Einkaufsmanagements
c. Zu den Gliederungsprinzipien der Organisation
d. Zur Sekundärorganisation
e. Zur Qualifikation der Einkäufer
f. Mögliche Klausurfragen
4. Übungsfragen zum Materialmanagement
a. Zur Übersicht der Aufgaben
b. Zum Outsourcing als Entscheidungsproblem
c. Zu den Beständen als Entscheidungsproblem
i. Zu den Beständen als Wert
ii. Zur Mengenplanung
iii. Zu den strategischen Aspekten der Materialwirtschaft
d. Mögliche Klausurfragen
5. Übungsfragen zum Lieferantenmanagement
a. Zu den Aufgaben des Lieferantenmanagements
b. Zur Bildung der Lieferantenstruktur
c. Zu den Merkmalen der Lieferantenbeziehung
d. Zur Lieferantenbewertung
e. Mögliche Klausurfragen
6. Übungsfragen zum Risikomanagement und Compliance
a. Zum Risiko und zur Krise
b. Zu den gesetzlichen Grundlagen des Risikomanagements
c. Zu den Phasen des Risikomanagements
d. Zu den Grundlagen des Compliance
e. Mögliche Klausurfragen
7. Literaturhinweise
1. Übungsfragen zu den Grundlagen des Einkaufsmanagements
a. Zum Begriff des Einkaufs
Frage 1-1: Wie wird „Einkauf“ definiert?
Antwort 1-1: Der Einkauf ist definiert als die Gesamtheit der Tätigkeiten, um dem Unternehmen die benötigten, aber nicht selbst erstellten Güter zur Verfügung zu stellen. Dabei liefert der Einkauf einen sog. Transaktionsnutzen, d.h. einen Nutzen hinsichtlich der beschaffungsseitigen Geschäftsvorbereitung, -anbahnung und -abwicklung.
Frage 1-2: Wie wird der Einkauf (bzw. Beschaffung) im Unternehmen eingeordnet?
Antwort 1-2: In einer funktionalen Gliederung des Unternehmens ist der Einkauf neben der Produktion/ Produktentwicklung und dem Marketing/ Vertrieb die dritte produktbezogene Wertschöpfungsfunktion eines Unternehmens.
Frage 1-3: Welches sind die Unterschiede von Einkauf und Logistik im Wertschöpfungsprozess des Unternehmens?
Antwort 1-3: Diese Antwort wird auf der Grundlage eines Auftragszyklus vorgenommen. Zu den Kernaufgaben des Einkaufs zählen die Prozesse von der Bedarfsermittlung bis zur Auslösung der physischen Warenströme beim Lieferanten. Die Logistik ist verantwortlich von der Auslösung der physischen Warenströme vom Lieferanten bis zum einkaufenden Unternehmen. Diese beiden Bereiche eines Unternehmens sind nicht unabhängig voneinander und sind aufeinander abzustimmen. Grob lassen sich die beiden Bereiche durch die Flussrichtung (Einkauf: zum Lieferanten; Logistik: vom Lieferanten) und den Gegenstand (Einkauf: Informationsfluss zu Aufträgen; Logistik: physischer Warenfluss) voneinander abgrenzen.
Frage 1-4: In welchem Verhältnis stehen die Tätigkeiten des Einkaufs und die Lieferkette eines Unternehmens?
Antwort 1-4: Die Lieferkette eines Produktes ist durch eine Vielzahl an aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten und in der Regel eine Vielzahl an tätigen Unternehmen gekennzeichnet, um ein definiertes Endprodukt zu erstellen. Aus der Sicht eines Unternehmens werden spezifischen Fertigungsschritte selbst vorgenommen (make) und die vorgelagerten Fertigungsschritte der Vorprodukte von Lieferanten (buy) bezogen. Die komplette Lieferkette eines Unternehmens setzt sich somit zusammen aus einer Vielzahl von Einkaufs- und Fertigungsprozessen. Der Produktionsanteil eines Unternehmens an der Lieferkette wird als Fertigungstiefe (make-Anteil) bezeichnet. Diese wird durch den prozentualen Anteil der Fertigungskosten an den Gesamtkosten des Produktes gemessen. Der Anteil, den ein Unternehmen einkauft, wird demzufolge als Einkaufstiefe (buy-Anteil) bezeichnet. Diese wird durch den prozentualen Anteil der Einkaufskosten an den Gesamtkosten des Produktes gemessen. Bezogen auf ein Unternehmen ist die Summe aus Fertigungstiefe und Einkaufstiefe definitorisch immer 100 %.
Frage 1-5: Wie setzt sich die Einkaufstiefe in der Lieferkette zusammen?
Antwort 1-5: In einer kompletten Lieferkette eines Produktes von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Endprodukt ist die Summe aller Einkaufstiefen (bzw. die Summe aller Fertigungstiefen) aller beteiligten Unternehmen eines Produktes definitorisch immer 100 Prozent.
Frage 1-6: In welchem Verhältnis steht die Produktion des einkaufenden Unternehmens bzw. die Leistungen der Lieferanten zum Einkauf?
Antwort 1-6: Der Einkauf hat immer zwei natürliche „Nachbarn“: den Vertrieb des Lieferanten und die Produktion des eigenen Unternehmens. Den Bedarf an zu beschaffenden Gütern erhält der Einkauf von der Produktion bzw. der Produktionsplanung (Nettobedarfe). Der Produktionsplan bildet damit i.d.R. eine wesentliche Grundlage für den qualitativen und quantitativen Beschaffungsbedarf des Einkaufs. Dieser basiert auf dem Primärbedarf des Unternehmens und wird über die Stückliste in den Sekundärbedarf heruntergebrochen. Im Abgleich mit den Lagerbeständen werden aus den Brutto-Sekundärbedarfen die Netto-Werte der Produktion und der Beschaffung bestimmt.
Die Lieferanten werden im Abgleich mit den Zielen des einkaufenden Unternehmens und deren Leistungsfähigkeit beauftragt. Der Einkauf ist das Bindeglied zwischen dem Beschaffungsmarkt und der eigenen Produktion und koordiniert in Summe die Aktivitäten der beiden „Nachbarn“, indem er die Netto-Bedarfe sicherstellt und die Chancen des Beschaffungsmarktes nutzt.
Frage 1-7: Welche Spannungsfelder bestehen grundsätzlich zwischen dem Einkauf und den Lieferanten?
Antwort 1-7: Zwischen dem einkaufenden Unternehmen und dem verkaufenden Unternehmen (Lieferant) bestehen immer Spannungsfelder: In materieller Hinsicht fertigt der Lieferant die benötigten Teile; in finanzieller Hinsicht definiert der Einkaufspreis (Verkaufspreis des Lieferanten) die konkurrierende finanzielle Situation beider Unternehmen; in räumlicher Sicht sind Distanzen zu überwinden; in zeitlicher Hinsicht konkurrieren die Vorbereitungszeiten des Lieferanten mit den kurzen Lieferzeitzielen des Einkaufs; in informatorischer Sicht weiß der Einkauf mehr von den bedarfsmengenbestimmenden Sachverhalten des Absatzmarktes; in rechtlicher Sicht ist der Gefahrenübergang vom Lieferanten auf das einkaufende Unternehmen festzulegen.
b. Zu den Einkaufsobjekten
Frage 1-8: Wie können Einkaufsobjekte kategorisiert werden?
Antwort 1-8: Es sind mehrere Unterteilungen möglich. Eine erste Einteilung erfolgt in die Kategorien „Produktionsmaterial, Nicht-Produktionsmaterial, Investitionsgüter, Dienstleistungen, Handelswaren“. Eine zweite Einteilung unterscheidet hinsichtlich der alternativen Lieferkettenstrukturen „Make to Stock (MTS), Assemble to Order (MTO)“. bzw. Make to Order (MTO)“ Eine dritte Einteilung unterscheidet hinsichtlich der Fertigungsorganisation/ der Stückzahl in einer Fertigung die Kategorien „Einzelprodukt, Serienprodukt bzw. Massenprodukt“.
c. Zum Einkaufsprozess
Frage 1-9: Welche Vorgänge lösen die interne Anforderung der Produktionsabteilung (z.B. nach Bauteilen oder Rohstoffen) im Unternehmen und beim Lieferanten aus?
Antwort 1-9: Auf der Grundlage einer Absatzplanung oder fester Kundenaufträge (Primär-Bedarf eines Unternehmens) wird eine Produktionsplanung erstellt. Damit ist der mengenmäßige Bedarf an Bauteilen über die Stückliste festzustellen (Brutto-Sekundärbedarf). Im Abgleich mit den internen Lagerbeständen an Bauteilen ergibt sich der Netto-Sekundärbedarf, der als Beschaffungsmenge notwendig ist, um die Produktion durchführen zu können. Hierdurch kommt die Rolle eines Unternehmens bzw. des Einkaufs als Teil einer Lieferkette zum Ausdruck.
Frage 1-10: Aus welchen Elementen besteht der Auftragszyklus?
Antwort 1-10: Der Auftragszyklus (Einkaufsprozess) ist Teil des Wertschöpfungsprozesses des Unternehmens und beschreibt die einzelnen Schritte von der Willensbildung der Einkaufsaufträge bis zur Übergabe der beschafften Güter an die Fertigung, d. h. den internen Nachbarn. Die Gesamtheit aller Prozessschritte von der Willensbildung des Einkäufers bis zum Erhalt der Beschaffungsgüter wird als Auftragszyklus