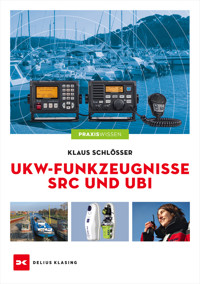
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Praxiswissen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Sofern eine entsprechende Funkanlage an Bord ist, müssen Wassersportler – je nach Fahrgebiet – ein Beschränkt Gültiges Funkbetriebszeugnis (SRC) oder ein UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) erwerben, um am Funkverkehr teilzunehmen. Dieses Lehrbuch bereitet praxisnah auf die See- (SRC) und Binnenfunkprüfung (UBI) vor, dient aber auch als Nachschlagewerk im Alltag an Bord. Die klare Struktur des Buches (Theorie- und Praxiswissen getrennt) und die anschaulichen Beispiele – im Seefunk zusätzlich in englischer Sprache – bereiten effizient und optimal auf die Prüfung vor. Das Lehrbuch wird ergänzt mit den amtlichen Seefunktexten und den offiziellen Fragenkatalog für SRC und UBI und ist daher auch zum Selbststudium hervorragend geeignet. Das Lehrbuch beschreibt ausführlich das Weltweite Seenot- und Sicherheitssystem (GMDSS), in dem die digitale Kommunikation via UKW-DSC, AIS oder EPIRB eine Rolle spielt. Wichtig für Sportbootfahrer ist aber auch das Verhalten im Seenotfall, die Teilnahme am Revierfunk und Schleusenfunk, der Kontakt zur Radarberatung oder die alltägliche Kommunikation zwischen Schiffen untereinander. Dieses Buch soll Spaß machen auf Seefunk und Kommunikation auf dem Wasser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRAXISWISSEN
KLAUS SCHLÖSSER
UKW-FUNKZEUGNISSE SRC UND UBI
DELIUS KLASING VERLAG
Inhalt
Einleitung
Legende
Hinweise im Internet
Theorie
GMDSS
Was ist GMDSS?
Einteilung in Seegebiete
Zusammenfassung
Rechtliches
Zuteilungsurkunde
Identifikationsmerkmale
Funkzeugnis
Fernmeldegeheimnis
Ausrüstungspflicht
Zusammenfassung
Küstenfunkstellen
Öffentlicher Verkehr
Nichtöffentlicher Verkehr
Zusammenfassung
SAR
Bremen Rescue Radio
Seenotleitung (MRCC)
Funkärztlicher Beratungsdienst
Zusammenfassung
Dienstbehelfe
Funkdienst für die Klein- und Sportschifffahrt
VTS Guide
Handbuch Suche und Rettung
Öffentliche Küstenfunkstellen in Deutschland
Funktagebuch
Weitere Funkliteratur
Zusammenfassung
Funksignal
Funkwellen
Reichweite
Antenne
Sendeleistungen
Zusammenfassung
Funkanlage
Funkgeräte
DSC-Controller
Handsprechfunkgerät
Auswahl der Funkanlage
Zusammenfassung
EPIRB
Die Satelliten
Funktionsweise und Handhabung von EPIRBs
Zusammenfassung
SART
AIS-SART
Zusammenfassung
NAVTEX
Einstellung des Empfängers
Meldungsarten
Stationen und Navareas
Zusammenfassung
AIS
Zusammenfassung
UKW-Kanäle
Bedeutung der UKW-Kanäle
Simplex, Duplex, Semi-Duplex
Zusammenfassung
Batterien
Zusammenfassung
Praxis
Sprache
Buchstabieralphabet
Formulierungen
Verfahrenswörter
Funkdisziplin
Wahl des Schiffsnamens
Anrufverfahren
Anrufkanäle
Anrufverfahren per Sprechfunk
Anrufverfahren per DSC
Laufendes Gespräch
Hörbereitschaft
Unverständlicher Anruf
Wiederholung des Anrufes
Testaussendungen
Schiff–Schiff
Anruf per Sprechfunk
Anruf per DSC
Funkverkehr an Bord
Unbekanntes Schiff
Schiff–Land
Anruf per Sprechfunk
Anruf per DSC
Häfen, Brücken und Schleusen
Revierfunk
Not / Dringlichkeit / Sicherheit
Notverkehr
Fehlalarm
Dringlichkeitsverkehr
Sicherheitsverkehr
Binnenfunk
Rechtliches
Handbuch Binnenschifffahrtsfunk
Voraussetzungen und Geltungsbereich
ATIS-Nummer
Verkehrskreise
Ausrüstungspflicht
Revierzentralen, Verkehrsposten und Blockkanäle
Verkehrsabwicklung
Anhang
Anrufverfahren SRC
Anrufverfahren UBI
Seefunktexte SRC
Fragenkatalog SRC
Fragenkatalog UBI
Prüfung
Voraussetzungen
Beschränkt Gültiges Funkbetriebszeugnis (SRC)
Ergänzungsprüfung SRC
UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI)
Ergänzungsprüfung UBI
Anpassungsprüfung SRC
Prüfungsausschüsse
Register
Einleitung
Am Ende eines jeden Kapitels gibt es eine Zusammenfassung mit dem notwendigen theoretischen Prüfungswissen. Die Zahlen in blauer Schrift (SRC) beziehen sich auf die Fragennummer im Fragenkatalog für das »Beschränkt Gültige Funkbetriebszeugnis« (ab Seite 118), während sich die Zahlen in roter Schrift (UBI) auf den Fragenkatalog für das »UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk« (ab Seite 141) beziehen.
Legende
Wichtige Hinweise sind in einem blauen Kasten aufgeführt.
Wichtiger Hinweis
Wertvolles Praxiswissen ist fett dargestellt.
Praxistipp
Weiterführende Informationen im Internet finden Sie hier.
www: schlagwort
Hinweise im Internet
Weiterführende Informationen im Internet sind zur Einfachheit und Linkpflege nicht mit der vollständigen Internetadresse aufgeführt. Die einheitliche Internetadresse für dieses Buch lautet:
www.delius-klasing.de/funkinfo
Über die entsprechenden im Buch angegebenen Schlagworte (Tags) kann dann die korrespondierende Website aufgerufen werden.
Theorie
GMDSS
Im Jahre 1896 begann das Zeitalter der kabellosen Kommunikation. Pioniere wie Guglielmo Marconi und Alexander Stepanowitsch Popow experimentierten erfolgreich mit der Übertragung von Morsesignalen. Aufgrund der schnell fortschreitenden Entwicklung konnten schon bald Schiffe mit Funkanlagen ausgestattet werden. Dadurch ergab sich zum Beispiel der Vorteil, die Schiffsankunft vorab telegrafisch zu melden.
Bereits zehn Jahre später, auf der ersten internationalen Funkkonferenz in Berlin, wurden rechtliche Absprachen für Funkanlagen und Funkzeugnisse getroffen. Das Notzeichen SOS (save our ships, später: save our souls) wurde beschlossen. Von neu entstandenen Küstenfunkstellen wurden Mitteilungen über den Atlantik gemorst und unter anderem Linienschiffe mit Nachrichten für die Bordzeitung versorgt. Bis 1912 – Untergang der Titanic – gab es weder eine Funkausrüstungspflicht noch eine Hörbereitschaft. Als Folge der Katastrophe wurde das Netz der Küstenfunkstellen ausgebaut, deren Aufgabe unter anderem das Abhören der Notfrequenzen war und bis heute ist.
Den Anstoß für das Weltweite Seenot- und Sicherheitssystem (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS) gab unter anderem der Untergang der München im Jahre 1978. Obwohl die Funkausrüstung der münchen über dem üblichen Standard lag, versagte sie teilweise. Die Empfehlung des Seeamtes lautete nach der Katastrophe, das bestehende Seenotalarmsystem dem neuesten Stand der Technik anzupassen und dabei ein automatisches, satellitengestütztes Seenotsystem in Betracht zu ziehen.
Was ist GMDSS?
Das Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) besteht aus technischen Einrichtungen, Dienststellen und Regeln für Notfälle und für die Sicherheit auf See. Es wurden das Sprechfunk- und das Kurzwelle-Fernschreibverfahren aus der bisherigen Praxis übernommen und durch ein digitales Alarmierungs- und Anrufverfahren ergänzt. Zudem wurden das bereits vorhandene NAVTEX-Funkfernschreibverfahren und der Inmarsat-Satellitenseefunk sowie das COSPAS-SARSAT-System in das neue Funksystem integriert.
Zwei wichtige Grundsätze des GMDSS sind eine Alarmierung durch mindestens zwei voneinander unabhängige Systeme im Seenotfall sowie die automatisierte, digitale Alarmierung und Hörbereitschaft.
Ein ausrüstungspflichtiges Schiff muss mindestens ausgestattet sein mit:
►
einer Seenotfunkbake (EPIRB), die von jedem Ort der Welt im Notfall ein Notsignal an ein Satellitensystem übermittelt;
►
einem UKW-Sprechfunkgerät mit DSC-Controller (Digitalem Selektivruf) mit automatischer Hörbereitschaft.
Distresstaste am DSC-Controller
Auch bei nicht ausrüstungspflichtigen Sportbooten wird das Prinzip der redundanten Alarmierung empfohlen.
Alle wichtigen Informationen, die Funker früher zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Frequenzen abhören und aufschreiben mussten, werden heute im Fall der digitalen schriftlichen Kommunikation automatisch an Bord gespeichert und stehen bei Bedarf zur Verfügung.
Einteilung in Seegebiete
Im GMDSS wird die vorgeschriebene Funkausrüstung durch das Einsatzgebiet des Fahrzeuges bestimmt. Die Seegebiete werden nach der an den jeweiligen Küsten vorhandenen Funkversorgung eingeteilt. Es sind vier Seegebiete festgelegt:
Seegebiet A1
Ein Gebiet innerhalb der Sprechfunkreichweite mindestens einer UKW-Küstenfunkstelle, die ununterbrochen für DSC-Alarmierungen zur Verfügung steht.
Seegebiet A2
Ein Gebiet (ausgenommen Seegebiet A1) innerhalb der Sprechfunkreichweite mindestens einer Grenzwelle-Küstenfunkstelle, die ununterbrochen für DSC-Alarmierungen zur Verfügung steht.
Seegebiet A3
Ein Gebiet (ausgenommen Seegebiete A1 und A2) innerhalb der Überdeckung geostationärer Inmarsat-Satelliten (70° N bis 70° S), die ununterbrochen für Alarmierungen zur Verfügung stehen.
Seegebiet A4
Das Gebiet außerhalb der Seegebiete A1, A2 und A3 (die Polkappen).
Zusammenfassung
SRC: 2, 3, 12, 13–15
Das Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) besteht aus technischen Einrichtungen, Dienststellen und Regeln zur weltweiten Hilfe bei Seenotfällen und zur Sicherung der Schifffahrt. Eine Besonderheit ist die schnelle, automatisierte Alarmierung im Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsfall.
Darstellung der Seegebiete A1 bis A3 (mit UKW-Relaisstationen auf Bohrinseln)
Der Umfang der technischen Einrichtung (auf einem ausrüstungspflichtigen Schiff) wird unter anderem durch die GMDSS-Seegebiete (engl. sea areas) geregelt. Das Seegebiet A1 liegt innerhalb der Sprechfunkreichweite einer UKW-Küstenfunkstelle, die ununterbrochen für DSC-Alarmierungen zur Verfügung steht.
Die satellitengestützten Alarmierungssysteme im GMDSS sind das COSPAS-SARSAT- und das Inmarsat-System.
Rechtliches
Damit die Funkkommunikation auf der ganzen Welt möglichst reibungslos und störungsfrei abgewickelt werden kann, bedarf es internationaler Übereinkommen und Regelungen. Da sich Funkwellen grenzenlos ausbreiten, muss dafür gesorgt werden, dass Telefongespräche mit dem Handy keinen Flugverkehr lahmlegen oder das Garagentor des Nachbarn nicht durch ein Babyfon geöffnet wird.
Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Maritime Manual) 2016, herausgegeben durch die ITU
Für die technischen Aspekte der Telekommunikation und Verfahrensvorschriften ist die International Telecommunication Union (ITU) zuständig. Alle drei bis vier Jahre wird eine Weltfunkkonferenz (WRC) abgehalten. Das Ergebnis dieser Konferenz ist in der jeweils aktuellen Ausgabe der Radio Regulations (RR) nachzulesen. Alle Vertragsstaaten sind verpflichtet, diese Änderungen in nationales Recht fortzuschreiben. In Deutschland erfolgt dies auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Die Radio Regulations heißen in Deutschland »Vollzugsordnung für den Funkdienst« oder kurz VO Funk.
Ausrüstungsvorschriften werden auf internationaler Ebene von der International Maritime Organization (IMO) beschlossen. Die IMO ist unter anderem zuständig für die Ausweichregeln auf See, die Umweltschutzbedingungen (MARPOL) oder das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See – SOLAS (Safety of Life at Sea), das unter anderem die (Funk-)Ausrüstungspflicht regelt.
In Deutschland sind zwei Behörden für die Belange des UKW-Seefunks zuständig.
►
Die
Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, kurz
BNetzA
, ist für die Genehmigung zum Betreiben einer Seefunkanlage zuständig. Auf Antrag wird eine Nummernzuteilung ausgestellt. Die rechtlichen Voraussetzungen leiten sich aus den Radio Regulations ab.
►
Das
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
ist für die Abnahme von Seefunkanlagen auf ausrüstungspflichtigen Schiffen und die Abnahme von Funkprüfungen für Seeleute zuständig. Die Grundlage für diese Tätigkeit leitet sich aus SOLAS ab. Das BSH hat die Abnahme von Prüfungen für Funkzeugnisse der Sportschifffahrt den Wassersportverbänden übertragen.
Neben dem BSH gibt es eine Reihe anderer Prüfstellen für die erforderliche technische Zulassung von Seefunkanlagen. In der Sportschifffahrt sind üblicherweise Funkanlagen mit CE-Kennzeichen im Einsatz. Ausrüstungspflichtige Schiffe benötigen für elektronische Anlagen das Zulassungszeichen mit dem Steuerradsymbol (Wheelmark).
Beim Erwerb von Funkanlagen im Ausland oder über Internetauktionsseiten ist auf eine korrekte Kennzeichnung zu achten. Neben der fehlenden Zulassung kann es auch eine Abweichung der Kanalbelegung geben, was den nationalen Funkverkehr stören könnte.
Zuteilungsurkunde
Eine Seefunk- beziehungsweise Schiffsfunkanlage darf nicht ohne Zuteilungsurkunde (Ship Station Licence) betrieben werden. Die Urkunde wird von der Bundesnetzagentur, Außenstelle Hamburg ausgestellt. Für den Antrag ist es nicht erforderlich, ein Funkzeugnis zu haben. Die Urkunde muss auf dem Schiff im Original mitgeführt werden.
Der Wechsel des Eigentümers sowie Namens- oder Gerätewechsel müssen schriftlich angezeigt werden. Dies gilt auch, wenn man die alte Anlage in ein anderes Schiff einbaut (und das Rufzeichen behalten möchte).
Die Bundesnetzagentur ist zur Sicherstellung der Frequenznutzung befugt, die Funkanlage an Bord zu überprüfen und bei Verstößen gegen das TKG den Betrieb einzuschränken oder die Außerbetriebnahme anzuordnen.
Beim Ausfüllen des Antrags auf Nummernzuteilung ist besonders das sorgfältige Ausfüllen der »Angaben zur Kontaktperson für Rückfragen des MRCC oder der ITU in Notfällen« wichtig. In den Antrag gehört die eigene Handynummer. Es empfiehlt sich aber vor allem, Angaben zu Personen zu machen, die normalerweise über den eigenen Törnverlauf informiert sind (Stegnachbarn, Familienangehörige etc.). Die Angaben können formlos erweitert werden und auch nachträglich noch eingereicht und regelmäßig aktualisiert werden.
Der Antrag auf Nummernzuteilung ist im Internet verfügbar.
www: Zuteilungsurkunde
Nummernzuteilungsurkunde der Bundesnetzagentur
Identifikationsmerkmale
Die Bundesnetzagentur, Außenstelle Hamburg vergibt an die Antragsteller der Nummernzuteilungsurkunde ein Rufzeichen und die MMSI. Zusätzlich wird eine ATIS-Nummer an Fahrzeuge vergeben, die am Binnenschifffahrtsfunk teilnehmen. In der sogenannten »List of Ship Stations« der ITU sind alle Seefunkstellen verzeichnet und nach Name, Rufzeichen oder MMSI sortiert. Diese Daten sind auch im Internet verfügbar.
www: mars
Rufzeichen
Ein Rufzeichen (englisch: call sign) besteht aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen. Die ersten beiden Zeichen weisen auf die Nationalität der Funkstelle hin. DA bis DR kennzeichnet ein Fahrzeug unter deutscher Flagge. Rufzeichen werden grundsätzlich unter Zuhilfenahme des internationalen Buchstabieralphabets (s. Seite 59) gesprochen.
Fahrzeuge, die ins Schiffsregister eingetragen sind, erhalten als Identifikationsmerkmal ein Unterscheidungssignal. Es dient gleichzeitig als Rufzeichen im Seefunkdienst. Für Fahrzeuge unter deutscher Flagge baut sich das Unterscheidungssignal aus vier Buchstaben oder vier Buchstaben und einer Ziffer (von DAA… bis DRZ…) auf. Für Fahrzeuge bis 15 Meter ist der Eintrag ins Schiffsregister freiwillig. Fahrzeuge, die nicht im Schiffsregister eingetragen sind, oder Binnenschiffe erhalten ein Rufzeichen bestehend aus zwei Buchstaben und vier Zahlen (von DA2001 bis (zurzeit) DK9999).
Seeschiffe1
Binnenschiffe oder Sportboote bis 15 m2
Rufzeichen
DACQ1(vier Buchstaben oder vier Buchstaben und eine Ziffer)
DA1234(zwei Buchstaben, vier Ziffern)
Aussteller
Schiffsregister des Heimatortes
Bundesnetzagentur, Außenstelle Hamburg
Zuteilung
bei Kiellegung
auf Antrag
1 Fahrzeug mit Eintrag im Schiffsregister
2 Fahrzeug ohne Eintrag im Schiffsregister
MMSI – Rufnummer im Seefunkdienst
Schiffe mit DSC-Controller, einer Seenotfunkbake oder AIS-Transponder erhalten zusätzlich eine 9-stellige Rufnummer. Die MMSI (Maritime Mobile Service Identity) wird in die Funkanlage, die EPIRB oder das AIS fest einprogrammiert. Die ersten drei Stellen der MMSI – vergleichbar mit der Landesvorwahl einer Telefonnummer – stellen die Seefunkkennzahl (MID – Maritime Identification Digit) dar. Diese ist für Fahrzeuge unter deutscher Flagge die 211 oder die 218.
Fahrzeuge können zusätzlich eine Gruppennummer führen. Dies kommt beispielsweise für Fahrzeuge einer Reederei oder Behördenfahrzeuge in Betracht. Mit dieser Gruppennummer können alle zugehörigen Fahrzeuge gleichzeitig gerufen werden. Der Seefunkkennzahl wird eine Null vorangestellt, zum Beispiel 021145670.
Küstenfunkstellen haben ebenfalls eine MMSI. Hier werden der Seefunkkennzahl zwei Nullen vorangestellt. Beispielsweise hat die Küstenfunkstelle Bremen Rescue Radio die MMSI 002111240.
Muster
Beispiel
Schiff
211XXXXX0
211456780
Gruppe
0211XXXX0
021145670
KüFuSt
00211XXX0
002111240
ATIS-NUMMER
Fahrzeuge, die am Binnenschifffahrtsfunk teilnehmen, müssen eine sogenannte Kombianlage (oder eine zusätzliche Anlage) haben, die mit einer ATIS-Nummer programmiert ist (s. Seite 101).
Der Betreiber einer Kombianlage, in die eine ATIS-Nummer einprogrammiert ist, muss sowohl ein See- als auch ein Binnenfunkzeugnis haben, auch wenn er sich nur im Seebereich aufhält.
Funkzeugnis
Ein Schiffsführer eines Sportfahrzeugs oder Traditionsschiffs, der eine Seefunkanlage betreiben möchte, benötigt ein entsprechendes Seefunkzeugnis. Das Beschränkt Gültige Funkbetriebszeugnis (SRC – Short Range Certificate) ist auf den Frequenzbereich UKW und auf entsprechende Anlagen an Bord beschränkt. Zur Teilnahme am Funkverkehr via Grenz- und Kurzwelle oder Satellitenfunk (Inmarsat) wird das Allgemeine Funkbetriebszeugnis (LRC – Long Range Certificate) verlangt. Für die Berufsschifffahrt gibt es andere Funkzeugnisse.
Alle vor 2003 ausgestellten Funkzeugnisse sind weiterhin gültig. Das UKW-Betriebszeugnis I oder II (mit Zusatzprüfung) oder das Allgemeine Betriebszeugnis sind gleichzusetzen mit dem SRC bzw. LRC. Inhaber dieser Zeugnisse dürfen auch am Binnenfunk teilnehmen. Alle älteren Funkzeugnisse beinhalten nicht die Bestandteile des GMDSS. Die Bedienung einer UKW-Funkanlage ist mit diesen Zeugnissen nur zulässig, wenn kein DSC-Controller eingebaut ist.
Für reine Empfänger (NAVTEX) oder geschlossene Systeme im GMDSS (EPIRB, SART, AIS) wird kein Funkzeugnis benötigt.
Schiffsführer müssen ein der Anlage an Bord entsprechendes Funkzeugnis haben, auch wenn sie diese nicht benutzen. Bedienen darf die Anlage allerdings jedes Crewmitglied mit Einwilligung und unter der Anleitung des Schiffsführers.
Fernmeldegeheimnis
Der Funkverkehr unterliegt dem Telekommunikationsgeheimnis. Neben dem Betreiber der Funkstelle sind alle an Bord befindlichen Personen verpflichtet, das Fernmeldegeheimnis zu wahren.
Nachrichten, die nicht an die eigene Funkstelle gerichtet sind, dürfen weder abgehört noch an Dritte weitergegeben werden. Sind Nachrichten allerdings »an alle Funkstellen« gerichtet, dürfen diese auch empfangen werden.
Ausrüstungspflicht
Privat genutzte Sportboote unterliegen keiner Ausrüstungspflicht. Anders sieht es bei Charterschiffen, Traditionsschiffen oder Fahrzeugen für Ausbildungszwecke aus. Charterschiffe mit einer Länge von mehr als zwölf Meter benötigen für ihre Funkausrüstung ein Funksicherheitszeugnis der BG Verkehr, Dienststelle Schiffssicherheit. Das Gleiche gilt für gewerbsmäßig genutzte Sportboote ab einer Schiffslänge von acht Meter (z. B. Ausbildungsschiffe einer Segelschule). Details zur Ausrüstungspflicht für gewerbsmäßig genutzte Sportboote finden sich auch in der See-Sportbootverordnung.
www: sportbootverordnung, gshw (Traditionsschifffahrt)
Zusammenfassung
SRC: 1, 25–36, 38–45, 59–67, 70
UBI: 13, 18–21, 28, 31–35, 37
Mobiler Seefunkdienst (kurz: Seefunk) bezeichnet den Funkdienst zwischen Seefunkstellen untereinander bzw. zwischen Seefunkstellen und Küstenfunkstellen. Schiffsführer eines Sportbootes mit einer Funkanlage müssen eine Zuteilungsurkunde (ausgestellt durch die BNetzA, Außenstelle Hamburg) mit den Identifikationsmerkmalen (z. B. Schiffsname, Rufzeichen, MMSI) und das Funkzeugnis (z. B. SRC oder LRC) im Original an Bord mitführen.
Die Anlage muss zugelassen oder ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht sein (CE-Zeichen). Bei gewerbsmäßig genutzten Sportbooten besteht eine Ausrüstungspflicht. Es wird ein Funksicherheitszeugnis (ausgestellt durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr) benötigt. Neben der BNetzA ist auch das BSH berechtigt, die Funktionsfähigkeit von Funkstellen zu überprüfen. Bei Austausch der Funkanlage oder Schiffsnamensänderung muss dies der BNetzA schriftlich mitgeteilt werden.
Im TKG ist das Abhören von Nachrichten, die für die eigene Funkstelle nicht bestimmt sind (Abhörverbot), geregelt. Alle Personen, die Kenntnis über öffentlichen Nachrichtenaustausch erlangt haben, sind zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet. Nachrichten »an alle Funkstellen« dürfen abgehört und weiterverbreitet werden.
Rufzeichen von Schiffen unter deutscher Flagge beginnen mit DA bis DR und bestehen aus vier Buchstaben (= Unterscheidungssignal von Fahrzeugen im Schiffsregister) oder zwei Buchstaben und vier Ziffern. Die Rufzeichen werden von der BNetzA in Hamburg vergeben. Die MMSI ist die Rufnummer im Seefunkdienst und besteht aus neun Ziffern. Die Seefunkkennzahl (MID) kennzeichnet die Nationalität (211 oder 218 für Deutschland) der Seefunkstelle. Bei der MMSI von Küstenfunkstellen werden der Seefunkkennzahl zwei Nullen vorangestellt (Beispiel: 00 211 1240).
Küstenfunkstellen
Küstenfunkstellen (KüFuSt) werden danach unterschieden, ob sie für den öffentlichen oder den nichtöffentlichen Funkverkehr tätig sind.
Öffentlicher Verkehr
Küstenfunkstellen des öffentlichen Verkehrs vermitteln für die Öffentlichkeit zugänglich Telefongespräche oder Telegramme zwischen Schiff und Land. Die Kennzeichnung der KüFuSt erfolgt durch den geografischen Ort gefolgt von dem Wort »Radio«. Beispiele: »Bremen Radio« oder »Kiel Radio«. Bei »Radio Bremen« handelt es sich daher nicht um eine Küstenfunkstelle, sondern um einen Hörfunksender im Norden Deutschlands.
Um am öffentlichen Funkverkehr teilnehmen zu können, benötigen Betreiber einer Seefunkstelle einen Vertrag mit einer Abrechnungsgesellschaft (Accounting Authority Identification Code – AAIC). Darüber können Nachrichten, die von See nach Land vermittelt wurden, abgerechnet werden. Vergleichbar mit der Handy-Nutzung im Ausland werden die anfallenden Kosten an die Gesellschaft übermittelt, mit der man den Vertrag geschlossen hat. Eine in Deutschland weit verbreitete Abrechnungsgesellschaft ist DP07 (gesprochen Delta Papa Null Sieben) (s. Seite 29).
Nichtöffentlicher Verkehr
Der nichtöffentliche Funkverkehr umfasst sowohl den Revierfunk-, den Hafenfunk- und Schiffslenkungsdienst als auch den Funkverkehr der Schiffe untereinander zum Zwecke der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Die Kennzeichnung der Küstenfunkstellen erfolgt durch den geografischen Ort gefolgt von dem Dienst, den sie verrichten, sowie dem Wort »Radio« (das im Alltag weggelassen wird).
… Traffic Radio
Verkehrszentrale (Bsp. Jade Traffic)
… Port Radio
Hafen (Bsp. Bremerhaven Port)
… Radar Radio
Radarberatung (Bsp. Neuwerk Radar)
… Lock Radio
Schleuse (Bsp. Papenburg Lock)
… Bridge Radio
Brücke (Bsp. Hunte Bridge)
… Kanal Radio
Verkehrsabwicklung NOK (Bsp. Kiel Kanal 2)
… Pilot Radio
Lotse (Bsp. Elbe Pilot)
Bremen Rescue Radio
Seenotleitstelle (mit Sitz in Bremen)
Im Ausland können auch andere Dienstbezeichnungen wie »Control« oder »Marina« (für Häfen) oder »VTS« (für Verkehrssicherungssysteme) verwendet werden.
Verkehrszentralen
Viele Länder haben in stark befahreneren Gebieten Verkehrssicherungssysteme (Vessel Traffic Services – VTS) eingerichtet, die von Seehäfen oder Verkehrsbehörden betrieben und mit der Flugsicherung in der Luftfahrt vergleichbar sind. Sie bestehen technisch im Wesentlichen aus Radar- und Videoüberwachungsanlagen, UKW-Funk und dem Automatischen Schiffsidentifizierungssystem (AIS). Sie dienen sowohl der Navigation als auch dem reibungslosen Ablauf der Schifffahrt.
Die Aufgaben der Verkehrssicherungssysteme sind:
Registrierung der Schiffs-, Personenzahl- und Ladungsdaten
Versorgung der Schifffahrt mit nautischen Informationen wie Wetterwarnungen, Tidenverhältnissen, Bauarbeiten oder Veränderungen des Fahrwassers sowie Schiffsbewegungen (Lagemeldungen)
der Schiffslenkungsdienst – die Verkehrsreglung in besonderen Situationen.
Schiffe einer bestimmten Größe, Tonnage oder Gefahrgutschiffe haben eine Meldepflicht.
Sportboote haben keine Meldepflicht, sind aber zur Hörbereitschaft auf den Arbeitskanälen der Verkehrszentralen verpflichtet, sofern sie mit einem Funkgerät ausgerüstet sind. Dieses ist ausdrücklich in der Seeschifffahrtsstraßenordung für Fahrzeuge aller Art geregelt. Im Bereich des Großen Belts (Dänemark) sind auch Segelfahrzeuge (mit einer Masthöhe von mehr als 15 Meter) meldepflichtig.
Radarberatung
Auf stark befahrenen Küstengewässern erfolgt bei verminderter Sicht eine Radarberatung durch die Verkehrszentralen. Dieser Service kann auch von Sportbooten (ohne Radar) in Anspruch genommen werden und ist kostenlos.
Zusammenfassung
SRC: 7–11, 87–92
Küstenfunkstellen sind Funkstellen des mobilen Seefunkdienstes. Über KüFuSt wird nichtöffentlicher Verkehr (Revierfunk-, Hafenfunk- und Schiffslenkungsdienst) und öffentlicher Verkehr (zum Austausch von Nachrichten) betrieben. Der Revier- und Hafenfunkdienst dient der Übermittlung von Nachrichten, die das Führen, die Fahrt und die Sicherheit von Schiffen betreffen. Für die Teilnahme am öffentlichen Funkverkehr benötigt man einen Vertrag mit einer Abrechnungsgesellschaft. Liegen Nachrichten für einen vor, dann erfährt man das über eine individuelle Benachrichtigung oder Sammelanrufe.
Die Kennzeichnung der Küstenfunkstellen des nichtöffentlichen Revier- und Hafenfunkdienstes erfolgt durch den geografischen Ort gefolgt von dem Dienst, den sie verrichten, sowie dem nicht gesprochenen Wort »Radio«. Beispiel: Warnemünde Traffic Radio (KüFuSt des Revierfunkdienstes).
Arbeitsplatz von Bremen Rescue Radio: Hörbereitschaft auf UKW-Kanal 16 und 70
SAR
Die SOLAS-Vertragsstaaten sind verpflichtet, in ihren Küstengewässern einen Such- und Rettungsdienst (Search and Rescue – SAR) zu unterhalten. In Deutschland wird diese Aufgabe von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Sitz in Bremen übernommen.
Die DGzRS betreibt zum einen die Küstenfunkstelle Bremen Rescue Radio und zum anderen das MRCC (Maritime Rescue Coordination Center), die Seenotleitung.
Bremen Rescue Radio
Die Hauptaufgaben von Bremen Rescue Radio sind die kontinuierliche Überwachung der UKW-Kanäle 16 und 70 über die abgesetzten Stationen an der gesamten deutschen Nord- und Ostseeküste, die Durchführung des Notverkehrs im Seenotfall und die Aussendung vitaler Sicherheitsmeldungen.
Seenotleitung (MRCC)
Das MRCC koordiniert im Seenotfall die Such- und Rettungsmaßnahmen. Das MRCC Bremen arbeitet dabei eng mit der SAR-Leitstelle Glücksburg (aeronautischer SAR-Dienst) zusammen.
Im Notfall wird neben der Seenotleitung eine Funkstelle vor Ort benötigt, die die Maßnahmen und die Kommunikation koordiniert. Die »On-Scene Communication« übernimmt in der Regel die Funkstelle, die technisch und personell am besten dafür geeignet ist. Der On-Scene Coordinator (OSC) dient der Seenotleitung als Auge und Ohr vor Ort. Die Kommunikation zwischen den Havaristen, dem OSC und anderen Funkstellen, die Hilfe leisten (können), wird als Funkverkehr vor Ort bezeichnet.
Nationale Datenbank
Die Seenotleitung hat Zugriff auf die Datenbank mit den Nummernzuteilungen der Bundesnetzagentur und kann im Notfall die dort bei der Antragstellung angegebenen Kontaktdaten einsehen. Hierbei sind sowohl die Mobilfunknummer des Schiffsführers als auch die Kontaktdaten von Menschen, die über den geplanten Reiseverlauf informiert sind, wichtig.
Entsprechende Daten können formlos bei der Bundesnetzagentur aktualisiert, geändert oder hinzugefügt werden. Im eigenen Interesse sollte die dort hinterlegte Information immer aktuell sein.
Angaben zur Seefunkstelle aus dem Einsatzleitsystem »Viadux«, mit dem das MRCC Bremen arbeitet
Alarmierung per Mobilfunktelefon
Auch wenn die Seenotleitung telefonisch 24 Stunden am Tag erreichbar ist, so ist die Kontaktaufnahme per Seefunk der telefonischen vorzuziehen. Die Vorteile sind:
►
schnelle und sichere Alarmierungsmöglichkeit (über DSC)
►
bessere Netzabdeckung (gegenüber Mobilfunktelefonen) und Erreichbarkeit auf See
►
Ortungsmöglichkeiten durch Anpeilen des UKW-Funksignals
►
Erreichbarkeit aller in Funkreichweite befindlichen Seefunkstellen
►
üblicherweise längere und sicherere Stromversorgung
Notfall-Kontaktdaten der DGzRS
UKW:
Kanal 16 (Ruf: Bremen Rescue), Kanal 70 (DSC)
MMSI:
00 211 1240
Telefon:
+49 (0) 421 53 68 7-0
Telefax:
+49 (0) 421 53 68 7-14
Inmarsat-C:
492 521 021
Mobilfunk:
124 124 (Alarmierung ausschließlich über Mobiltelefon innerhalb des Abdeckungsbereichs des deutschen Mobilfunknetzes ausschließlich an der deutschen Nord- und Ostseeküste)
Diese Kontaktinformationen dürfen nur im Ernstfall und auf keinen Fall zu Testzwecken verwendet werden.
Für andere Angelegenheiten erreichen Sie die DGzRS telefonisch unter 0421 / 53 70 70 oder im Internet unter www.dgzrs.de.
Ein Mobiltelefon ist im Notfall als zusätzliches Alarmierungsmittel sinnvoll. Dabei sollte die Festnetznummer (statt der Mobilnummer) der Seenotleitung eingespeichert werden, damit eine Erreichbarkeit auch aus dem benachbarten Ausland gewährleistet ist. Auch die Crew sollte mit dem Bordhandy vertraut sein, um dieses im Notfall schnell benutzen zu können.
Mobiltelefone sind bei der Netzabdeckung auf See vermehrt auf der Suche nach geeigneten Funkmasten, was zum schnelleren Entladen führt. Es ist daher ratsam, das Telefon nur gezielt zum Gebrauch einzuschalten, um den Ladezustand zu erhalten.
Funkärztlicher Beratungsdienst
In einigen Ländern wird funkärztliche Beratung über Sprechfunk angeboten. Der Medico-Dienst in Deutschland wird durch das Krankenhaus in Cuxhaven abgedeckt. Es kann durch die Vermittlung einer Küstenfunkstelle auch aus dem Ausland erreicht werden. In Deutschland ist die Vermittlung kostenlos.
Um dem Funkarzt die Diagnose zu erleichtern (und um Rückfragen und Zeit zu sparen), ist es zweckmäßig, vor Gesprächsbeginn einen standardisierten Meldebogen für Notfallbehandlungen auszufüllen.
Medico-Dienst in Cuxhaven
Telefon:
+49 (0) 4721 78-0 (Zentrale)
+49 (0) 4721 78-5 (Notfall)
Fax:
+49 (0) 4721 78-1520
E-Mail:
www: medico
Zusammenfassung
SRC: 23, 125–130, 147, 175–177
Im SAR-Fall (Suche und Rettung) koordiniert das RCC / MRCC ([Maritime] Rescue Coordination Center) die zur Verfügung stehenden Kräfte, wickelt den Notverkehr ab und informiert über SAR-Maßnahmen. Der On-Scene Coordinator (OSC) übernimmt den Funkverkehr vor Ort (On-Scene Communication).
Die Vorteile einer UKW-Seefunkanlage gegenüber einem Mobiltelefon sind die sichere Alarmierung, die Erreichbarkeit aller in Funkreichweite befindlichen Fahrzeuge und die Verfügbarkeit der Informationen für alle Beteiligten.
Ein funkärztliches Beratungsgespräch wird als Medico-Gespräch bezeichnet.
Dienstbehelfe
Dienstbehelfe sind Unterlagen für die Abwicklung des Funkverkehrs an Bord. Dort findet man Angaben über die entsprechenden Funkkanäle sowie Prozeduren und Anrufverfahren. Für nicht ausrüstungspflichtige Seefunkstellen wie Sportboote sind nautische Veröffentlichungen nicht vorgeschrieben. Empfehlenswert ist allerdings, mindestens den Funkdienst für die Klein- und Sportschifffahrt bzw. für andere Fahrgebiete ein vergleichbares Werk an Bord mitzuführen.





























