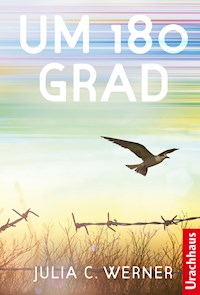
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Zum Davonlaufen findet Lennard die Besuche bei der schrulligen Frau Silberstein. Wenn die hübsche Lea nicht wäre, die er im Heim ab und zu trifft, wäre es dort ganz schön grau. Doch dann erfährt er vom Schicksal der alten Dame, die die Hölle von Auschwitz und das tiefste Schwarz überlebt hat, als sie in Lennards Alter war. Zwischen dem Jugendlichen und Frau Silberstein entwickelt sich eine leise Verbundenheit. Mit der Zeit erzählt sie Lennard immer mehr von ihrem eigenen Leben und den schrecklichen Erfahrungen im KZ und ihm wird klar: Wenn er ihr nicht zuhört, tut es niemand mehr. Außer vielleicht Lea, die sich, statt für ihn, immer mehr für Frau Silbersteins Geschichte interessiert ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia C. Werner
UM 180 GRAD
INHALT
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
QUELLEN UND BEZÜGE
DER HOLOCAUST ODER DIE SHOA
NACHWORT UND DANK
DIE AUTORIN
PROLOG
Das Klackern der Dosen wird immer lauter und mir ist langsam schlecht vom Farbgestank. Mein T-Shirt klebt nassgeschwitzt auf der Haut. Wir haben die Wand vorm U-Bahnhof und das Abbruchhaus klargemacht, sind die Gleise entlanggelaufen, das war lebensgefährlich. Irgendwann hörten wir »Stopp!« und rannten wie die Weltmeister, eine Dose kullerte davon, das Grün, damit hatte Samuel ein riesiges Cannabisblatt auf eine Scheibe gesprüht. Auftauchen wollte keiner von uns aus dem Farbrausch, bis jetzt zumindest. Jetzt kriege ich ein immer mieseres Gefühl in unserer Nacht voller Adrenalin.
Bei der letzten Station bin ich der Schmieresteher, der Checker, laufe von der Mauer bis zur Straße und wieder zurück, hin und her durch den Eingangstunnel, durch den die Leute aus dem Heim tagsüber auf die Straße gespuckt werden. Dann stehen sie da mit ihren Krücken und Rollstühlen und bleichen Gesichtern und starren ins Licht wie erschrockene Gespenster. Tagesgespenster, die nachts alle in ihren Betten begraben sind.
Unser Atem verdampft im schwachen Licht, das Klackern macht Angst und das Sprühen macht Lust, Lust auf Abenteuer, auf alles, auf die ganze bunte Welt. Es ist schon lange dunkel, kalt und feucht, kaum jemand ist draußen. Klackern, Sprühen, Kick! Jetzt sind die Umrisse aller Buchstaben zu sehen, das ›S‹ ist schon fett und gelb, es leuchtet und schimmert auf der Wand in dem spärlichen Licht. Samuel ist für die Buchstaben zuständig, Pascal sprüht die Sterne. »Wow!«
»Seid leise.« Ich renne vor und zurück. »Macht schneller. Mann, hier wohnen Leute!« Der zweite und dritte Buchstabe sind fertig, vor und zurück. Vierter, fünfter, hin und her. Die Farbe riecht jetzt meilenweit gegen den Wind, dabei ist hier im Tunnel gar kein Wind – irgendetwas stimmt nicht. Dieses Etwas liegt in der Luft, und es stinkt noch viel mehr als die Farbe. Wir müssen weg, denke ich, das dauert viel zu lange!
»Botten!«, schreit Samuel, er hat uns vorher gewarnt, was das im Sprayer-Slang heißt: Abhauen, ja klar! Das zu wissen nützt uns gar nichts. Der Tunnel hat nur einen Ausgang. Schatten kommen auf uns zu, ich rüttle panisch an der Tür, auf Sichthöhe ist ein Stück Glas und dahinter ein großer, leerer Raum mit irgendwelchen Möbeln in der Ecke. Eine Gestalt löst sich da drin aus dem Halbdunkel und schwebt auf mich zu. Weiß gekleidet, weiße Haare, ein fast wirkliches Gespenst. Ich weiche zurück.
»Botten!« Mit dem Rücken an der Wand. Keiner rennt. Ich halte den Atem an, das Nachtgespenst ist auf der einen und die Schatten sind auf der anderen Seite. Dann doch lieber durch den Tunnel und raus an die Luft, ins Freie, wo die Lebendigen und normale Menschen sind. Selbst wenn die Tür jetzt vor mir aufginge, hier will ich mich sogar im Notfall nicht verstecken, und freiwillig gehe ich da schon gar nicht rein. Niemals!
1
Kein Wort habe ich beim Mittagessen gesprochen, zu niemandem, und anschließend auch nicht. Klar haben wir Mist gebaut, das weiß ich, und ich hab’s oft genug zugegeben. Aber heute ist der Tag, an dem ich mal wieder was lernen soll über die Welt, der ich ja so respektlos begegnet bin. Respekt ist ein Lieblingswort bei uns zu Hause.
»Trotzig wie ein kleiner Junge«, sagt meine Mutter, schleudert mir diesen Satz vor die Füße und bringt mich damit fast zum Stolpern. Sie wirft ihre langen Haare zurück und sieht nach vorne – wir haben es eilig.
Wir haben es eilig, weil ich dachte, ich könnte mich in letzter Sekunde drücken. Rein ins Zimmer, drinbleiben, fertig. Doch definitiv sind wir auf dem Weg zu einem Ort, den ich nie von innen sehen wollte. »Mann, ich bring das nicht!« Meine Stimme klingt erst seltsam dunkel, dann haut sie nach oben ab. Was ich sage, bricht nun öfter entzwei in Hoch und Tief, es klingt doppelt doof, und ich wollte doch gar nichts sagen, von mir aus den ganzen Tag nicht. Ich werde langsamer, meine Mutter auch, wir bleiben stehen und sie legt eine Hand auf meine Schulter. Wäre ich wirklich noch ein kleiner Junge, wie sie behauptet, würde sie sich zu mir herunterbeugen, um mir prüfend in die Augen zu sehen. Bald aber bin ich größer als sie. Nur noch ein paar Zentimeter. Ich mache mich los und gehe weiter.
»Hast du etwa Schiss?«, fragt sie hinter mir und holt mich ein. Ich stapfe durch einen Haufen verfärbter Blätter am Wegrand.
»Pfff«, mache ich und kann unser Ziel schon sehen.
Am frühen Nachmittag liegt der ›Bunker‹ im Schatten. Die Mauern haben so eine Tarnfarbe, irgendwas zwischen Grau und Braun, und das Heim hat auch keinen Vorgarten und keinen einzigen Balkon, wie es bei fast allen Häusern hier normal ist. An einer Stelle weiter oben in der Wand sind ein paar Löcher zu sehen, vielleicht sind es Einschusslöcher. Bunker. Für mich passte der Name immer. Fast überall die Gardinen zugezogen, Gardinenbunker, so sagen auch manche zu dem Heim, das nicht nur nachts düster wirkt. In einem der Fenster steht schon seit Ewigkeiten ein Strauß vertrockneter Blumen. Den hat einfach jemand vergessen.
Noch ein paar Meter, fast sind wir da. Ein Typ pilgert auf dem Gehweg auf und ab, er trägt einen weißen Kittel und auf dem Kinn einen schmalen Bart, starrt auf sein Handy. Wahrscheinlich gehört er zum Heim dazu. Wir gehen an ihm vorbei und durch den Eingangstunnel bis zu der Tür, an der ich vor einem Monat panisch gerüttelt habe. Meine Mutter klingelt und lächelt mich an. Es sieht nett aus, ihr Lächeln, ich mag es fast immer. Jetzt nicht. Sie hat sich zu meinem Begleitschutz ernannt, damit ich nicht abhauen kann. »Komm schon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen.«
»Oder ich kaufe mich noch frei. Der Schaden geteilt durch drei ergibt 500 für jeden.«
»Ja, rechnen kannst du, das weiß ich. Aber erstens hast du nicht so viel Geld, weil du dir gerade unbedingt ein teures Handy kaufen musstest, und zweitens: Schau es dir doch erst einmal an.« Der Türöffner summt. »Es braucht hier niemand zu erfahren, dass du das da draußen mit deinen tollen Freunden warst. Samuels Eltern haben bei der Heimleitung offiziell die Verantwortung übernommen, von mir aus kann das so bleiben.«
»Erpressung!«
»Erziehung.«
Am liebsten würde ich gegen die dämliche Wand hauen. So was nennen meine Eltern »wie besprochen«, auch so ein Lieblingsausdruck in ihrer viel gepriesenen ›Diskussionskultur‹. Als ich rief: »Zu den Halbtoten und Irren gehe ich nicht!«, da gab es kein Diskutieren mehr, da war ich schon wieder respektlos.
Unser Werk auf der Wand ist weg. Samuel wollte riesengroß das Wort ›Sunshine‹ sprühen und hat schon vorher damit angegeben, dass er in seinem Graffiti-Workshop seinen Style, seinen ›Tag‹, seine besondere Schrift gelernt hat. Ein fettes, leuchtendes Sunshine vor einem blauen Himmel mit ein paar bunten Sternen drum rum. Jetzt ist nur noch ein verschwommener dunkelgrauer Umriss zu sehen, der wie eine schwere, große Wolke auf dem Gemäuer liegt. Nun haben die Leute hier Gewitter statt Sonnenschein. Mein Herz klopft. Meine Mutter hält immer noch die Tür auf.
Ich hole Luft und gehe an ihr vorbei. Ich habe ein komisches Gefühl im Bauch, eine Mischung aus schlechtem Gewissen, Schiss und Wut, vielleicht ist auch ein bisschen was von dem Adrenalin dabei, als alles passierte. Nur leider ist das, was jetzt kommt, kein Abenteuer. Bunker klingt ja noch spannend. Aber es ist nur ein langweiliges Alters- und Pflegeheim, jetzt überall wieder graubraun wie immer.
»Du bist also Lennard, der gerne einmal die Woche vorlesen mag!«, ruft Frau Kraftschick – so oder so ähnlich klingt ihr seltsamer Name, die Buchstaben auf dem Schildchen am weißen Blusenkragen kann ich auf den ersten Blick nicht richtig entziffern.
Gerne! Einmal die Woche! Mag! Sehr witzig.
Frau Kraftschick ist immer dienstags hier, in diesem Zimmer im ersten Stock. Dann kümmert sie sich um jene Bewohner, die keine Angehörigen oder kaum Besuch haben. Aha. Und wenn jemand kommt wie ich, der anscheinend nichts Besseres mit seiner Zeit anfangen kann, überschlägt sie sich vor Begeisterung. »Ist nicht so oft, dass ein Junge bei sooo eine tolle Aktion! Mitmachen! Will!«, ruft sie mit Pausen zwischen den Wörtern, Frau Kraftschick kommt wohl woanders her, so wie sie spricht, und sie streckt ihre Handflächen nach oben, als danke sie Gott im Himmel persönlich dafür. »Du bist in ein Alter von 14, ja?«
Ich nicke nur. Ihr Deutsch klingt lustig, aber ich werde aus Prinzip nicht lachen, nicht mal lächeln. Dummerweise hatte ich zu Hause von der Lesepatenschaft erzählt. ›Lesepaten von jung bis alt für jung bis alt‹ – über die Kampagne haben wir in der Schule gesprochen. Wir sollen wissen, wie wichtig ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft ist, und ein paar haben sich gemeldet. Für mindestens ein Jahr. Das war echt das Letzte, was ich tun wollte. Doch jetzt bin ich hier, und meine Mutter hält es für ideal, dass für mich gleich drei Dinge auf einmal dabei sind, wie beim Überraschungsei: Ich kann Respekt lernen, Engagement zeigen und Schulden abarbeiten.
Frau Kraftschick nickt zurück. Ihre blauen Augen, die von mir zu meiner Mutter und zurück huschen, sehen wässrig aus, als würde sie gleich weinen, dabei kleben ihre Mundwinkel immer noch oben. Ich schaue weg, auf die kahle Wand, an der ein einsamer Kalender hängt. Auf dem Schreibtisch liegt ein Bleistift mit abgebrochener Mine, daneben ein Blatt weißes Papier, auf dem eine Telefonnummer ganz verloren steht. Und einen Computer gibt es natürlich, der ziemlich laut ist – nicht gerade das neueste Modell. Die Luft ist stickig und warm. Ich habe auf einmal Durst.
»Ich will …« Schon sehe ich aus den Augenwinkeln, wie meine Mutter den Kopf zu mir dreht.
Ich will das gar nicht machen! Ich werde von meinen furchtbaren Eltern dazu gezwungen, würde ich am liebsten sagen. Oder es schreien. Wobei die Idee, dass es gerade der Bunker hier sein sollte, natürlich von meiner Mutter kam. Sie würde also seelenruhig ein Bein über das andere schlagen und zu Frau Kraftschick sagen: »Nun ja. Nicht ohne Grund. Lennard möchte etwas gutmachen. Wir sollten das einfach probieren.«
Und dann? Wahrscheinlich wären sich beide schnell einig, dass das Abarbeiten der Schulden doch eine prima Sache ist …
Frau Kraftschicks Lächeln geht in ein Seufzen über. »Wenn ich denke an meine Söhne, die würden nie freiwillig lesen, niemals nicht. Die schauen Fernsehen und nur Handy, Handy, Handy …« Ein lautes Rauschen ist zu hören, wahrscheinlich kommt es aus dem großen Rohr, das an der Wand entlangläuft, und das Rauschen liefert sich mit dem Computer ein Geräusche-Wettrennen, etwas scheppert vor der Tür. Frau Kraftschick richtet sich auf und lässt sich gleich wieder in ihren Stuhl sinken. Nimmt mich in ihr wasserblaues Blickfeld, sieht dann meine Mutter an.
»Ja, wie denken Sie? Haben Sie Wünsche?«
Meine Mutter deutet auf mich. »Das entscheidet mein Sohn natürlich selbst.«
Ich studiere das Schildchen an Frau Kraftschicks weißem Blusenkragen: also K-r-a-w-c-z-y-k. Um Gottes willen, c-z-y-k, diese Sprache, wo die Frau herkommt, will ich nie lernen, und der Name wird also doch nicht wie Tschick geschrieben, wie ich im ersten Moment dachte. Tschick ist der Held aus meinem Lieblingsbuch, das ich zweimal gelesen habe. Die Geschichte ist einfach cool.
»Möchtest du zu einem Herrn oder einer Dame?«, fragt der Mund über dem Blusenkragen. »Ich habe hier eine Kartei mit Bewohnern, die sich freuen über Lesepaten.«
Ich zucke mit den Schultern, in der Hoffnung, dass diese Frau mit dem seltsamen Namen endlich das Wichtigste überhaupt begreift: Ich bin nicht der tolle Junge mit dem super Engagement! Frau Kraftschick fängt wieder an zu strahlen. »Es gibt nicht so viele Jungen wie du«, wiederholt sie und wendet sich ihrem Steinzeit-Computer zu. »Wir wollen sehen und gemeinsam finden.«
Wir gehen den Flur entlang. Der Boden quietscht unter unseren Füßen, und wir steigen über einen Scherbenhaufen hinweg, ein zerbrochener Teller, dessen Teile sich über auf dem Boden klebendem gelbem Kartoffelbrei verbreitet haben. Kartoffelbrei mit Scherben gibt es hier also, wie lecker.
»Hat wieder jemand fallen gelassen, obwohl mit Tellern herumlaufen doch ist verboten«, sagt Frau Kraftschick kopfschüttelnd und blickt sich um. Niemand ist zu sehen, die Gänge sind wie ausgestorben. Es riecht frisch geputzt. »Die Zeit zwischen Mittag und Kaffee viele schlafen«, sagt Frau Kraftschick und zeichnet dabei mit dem Arm einen Riesenbogen für all die unsichtbaren Bewohner in die Luft. Da streckt sich am Ende des Gangs ein Kopf mit nach allen Richtungen abstehenden Haaren aus einem Zimmer – ein Punk mit grauen Haaren – und verschwindet gleich wieder. Eine Tür schlägt zu.
War das einer von den verrückten Alten, den Irren? Wenn ich die so nenne, ist das ja nicht erfunden. Manche von denen starren nur vor sich hin oder führen Selbstgespräche, wenn sie im Rollstuhl herumgeschoben werden oder im Park allein auf der Bank sitzen. Einem wuchs nur noch eine einzige weiße Haarsträhne aus der Glatze, die wehte hin und her, und er schüttelte immer den Kopf und rief dazu: »Ja, ja! Ja, ja!« Ein Verrückter eben.
Dabei tun mir Rollstuhlfahrer oder alte Leute, die zittrig, gebeugt oder gelähmt sind, leid, auch Omi, die neuerdings öfter mal auf den Boden knallt. Aber manchmal finde ich sie auch ein wenig unheimlich und eklig, so ganz Alte und Kranke. Und entspannt sind die meistens auch nicht gerade.
Wieder schlägt eine Tür zu, diesmal kommt es von hinten. Alle paar Meter stehen Pflanzen in Kübeln, und als ich mit der Hand über eine kleine grüne Palme streiche, spüre ich Plastik. An den Wänden hängen Fotos, große Aufnahmen von Blumen, menschenleeren Stränden und hohen Bergen, die ihre Spitzen in die Wolken bohren, und ein paar bunte Kinderzeichnungen.
Wir bleiben vor einer Tür mit der Nummer 36 stehen. »Ich zuerst«, sagt Frau Kraftschick, »hier wohnt ein Herr, der hat nie Besuch, niemals nicht, aber er ist sehr freundlich.«
Sie klopft, öffnet die Tür. Frau Kraftschick verschwindet in dem dunklen Spalt, und ich soll jetzt so tun, als machte ich das gern und freiwillig, zu einem Fremden gehen, der vielleicht auch verrückt ist? Ich drehe mich zu meiner Mutter um, und sie hebt sofort eine Hand: »Lenny, natürlich ist es hier nicht besonders toll. Aber genau deswegen sind wir ja hier. Uns geht es so gut …«
Ich drehe mich wieder weg, kann es nicht hören, wenn meine Mutter mit mir redet, als wäre ich zehn oder elf und sie die Retterin der Welt. Hab schließlich selbst Augen im Kopf, sehe die Penner und Bettler und Betrunkenen in der Stadt, und auf der Welt gibt es Kriege, Terror, Flüchtlingswellen, Bootstragödien, Hungersnöte, Atomwaffen, Klimakatastrophen und Selbstmordanschläge. Aber bloß weil es diese vielen schrecklichen Dinge gibt, bin ich jetzt auch nicht glücklicher, wenn ich nur solche Probleme habe wie ein paar Graffiti und die Folgen.
Meine Mutter merkt, dass ich jetzt keinen Vortrag gebrauchen kann. Sie sieht aus dem Fenster in den Hof. Der ist groß, aber nicht gerade einladend. Eine Menge Mülltonnen stehen dort, und es gibt ein paar Büsche und Bänke und ein Stück Wiese. Der Weg endet einfach weiter hinten an einer Ziegelmauer ohne Fenster. Krähen flattern herum.
Die Tür zu Zimmer 36 geht wieder auf. Frau Kraftschick lacht nicht mehr. »Der Herr ist leider krank«, sagt sie. »Nicht so gut für Besuch. Ich wusste nicht.«
Dann ein andermal, möchte ich rufen. Ich will in gar kein Zimmer hineinschauen, das ist nicht meine Welt und meine Schuld ist es schon gar nicht, dass die alle hier sind!
Frau Kraftschick legt einen Finger auf den Mund und denkt ganz stark nach. »Ich weiß jetzt! Frau Silberstein, die hat auch nie Besuch, niemals nicht, und steht auch in die Kartei!« Sie marschiert los, dahinter meine Mutter, dahinter ich, ohne Meinung. Wir betreten ein dämmriges Treppenhaus. »Fahrstuhl heute außer Betrieb«, erfahren wir von Frau Kraftschick, während sie nach oben stapft und leise keucht. »Schlecht für Rollstuhlfahrer.«
Im zweiten Stock quietscht der Boden noch lauter. Eine Schwester kommt uns entgegen … heißen die in einem Heim überhaupt Schwester? Sie sieht so aus wie im Krankenhaus. Weißer Kittel, weiße Schuhe, und sie zieht sich gerade Gummihandschuhe über. Im Vorbeigehen nickt sie uns zu.
Zimmer 72. Frau Kraftschick klopft vorsichtig, leise und lauter, dann geht sie rein und ich höre Stimmen, ein »Doch« und ein »Aber« und ein »Ach«. Die Tür öffnet sich nun weit. An den gegenüberliegenden Wänden steht je ein gleiches Bett mit Tisch daneben, echt wie im Krankenhaus, und zwischen den Betten sind ungefähr drei, vier Schritte Platz – Platz für Platzangst vielleicht.
Frau Kraftschick nickt uns zu. Meine Mutter berührt meine Schulter, dirigiert mich vorwärts. Ich trete in das Zimmer. Meine Schläfen beginnen zu pochen. In den Betten liegen bis zum Hals zugedeckt zwei grauhaarige Frauen. Als wären sie tot. Am Fenster gibt es noch einen kleinen Tisch mit drei Stühlen und einen Sessel, einen dunkelbraunen großen Schrank. Viel mehr passt auch nicht rein. Frau Kraftschick holt einen Stuhl und stellt ihn ans rechte Bett. Sie winkt mich heran. »Frau Silberstein möchte liegen. Ihr könnt euch erst einmal kennenlernen. Wir kommen wieder mit Kaffee. Halbe Stunde?«
Auf einmal ist mir glühend heiß. Was mache ich denn hier jetzt eine halbe Stunde lang – allein? Ich habe ja nicht mal ein Buch dabei. Meine Mutter lehnt am Türrahmen und schaut sehr ernst. »Soll ich warten oder gehen?«, fragt sie.
Ich würde sie am liebsten anflehen, mich mitzunehmen. »Mir egal«, sage ich mit einem fetten Kloß im Hals.
»Na dann, bis nachher. Guten Tag, Frau Silberstein!« Meine Mutter winkt noch mal ins Zimmer hinein, dabei könnte das hier auch ein Mumien-Aufbewahrungsraum sein. Da rührt sich nichts.
Frau Kraftschick hat wieder ihr Lächeln aufs Gesicht geklebt. Beide gehen fort, leise schließt sich die Tür, und ich stehe am Bett von dieser Frau Silberstein, kann mich kaum bewegen. Höre meinen eigenen Atem. Die beiden Frauen sind still, ich hoffe einfach nur, sie schlafen tief und fest, traue mich nicht, richtig hinzuschauen.
Da bewegt sich die Mumie, und ich schaue in ihr Gesicht. Sie macht die Augen auf. Überall sind Falten und Runzeln, sie ist alt, viel älter als Omi, uralt. Ihre Augen sind grau oder blau, und sie schaut weder freundlich noch feindlich, ich weiß nicht, wie. Wir sehen uns an, ich sollte langsam mal was sagen …
»Willst du Wurzeln schlagen?« Die Alte mustert mich mit nun großen Augen, die in einem ganzen Meer aus Falten schwimmen. »Du siehst ja unglücklich aus.« Ihre Stimme ist tief und kratzig, als müsste sie geölt werden oder als hätte sie schon ewig nichts gesprochen und nun geht knarrend der Sargdeckel auf und die Mumie guckt raus. »Willst wohl nicht hier sein? Setz dich doch.«
Alles ist voll peinlich. Sie schiebt sich ein bisschen nach oben, ist in eine dicke Oma-Strickjacke eingepackt, und rückt das Kissen unter ihrem Kopf zurecht, rosa Rosen auf Grün. Sie möchte wohl ein wenig aufrechter sitzen. »Soll ich … irgendwie helfen?«, höre ich mich fragen, wenigstens das macht man doch so, oder?
»Nein, danke.« Mehr sagt sie nicht, ruckelt sich zurecht und liegt wieder still.
So herumzustehen ist allerdings noch peinlicher, und ich setze mich nun doch. »Wie geht es Ihnen?«, frage ich mit trockenem Mund, auch das macht man ja so, und als keine Antwort kommt – vielleicht ist sie ja schwerhörig –, frage ich noch mal ein bisschen lauter: »Wie geht es Ihnen hier denn so?«
»Schwerhörig bin ich nicht«, krächzt Frau Silberstein, und ich will nur noch raus aus diesem überheizten Zimmer, wo das Atmen fast schwerfällt. Ich bin so wütend! Auf alle. Auf meine Mutter und Frau Kraftschick, die beide so tun, als fände ich das toll hier. Auf Samuel und Pascal, weil ich die bescheuertste Strafe von allen bekommen habe, obwohl ich eigentlich viel früher aufhören wollte in dieser Nacht – nicht an Wohnhäuser, habe ich gesagt, und die beiden lachten: Das ist doch nur der Bunker. Aber ich wollte auch nicht plötzlich als Feigling dastehen, schon gar nicht bei meinen besten Freunden – die lasse ich nicht im Stich.
»Kann ich doch nicht wissen!« Habe ich das der Alten gerade geantwortet? Schlechter Start. Das wird nichts mit mir und ihr, niemals nicht, wie Frau Kraftschick sagen würde.
Frau Silberstein hebt den Kopf vom Kissen. »Weißt du, Junge – nein, Lennard ist ja dein Name, und ein Kind bist du auch nicht mehr –, weißt du, was wir beide gemeinsam haben?«, fragt sie und kneift die Augen zusammen, als müsste sie selbst erst mal genauer schauen, was das Gemeinsame sein könnte.
»Nee«, sage ich. Was soll mich mit einer Halbtoten verbinden, die gleich so seltsame Fragen stellt?
Sie lässt den Kopf wieder sinken. »Ich würde auch lieber woanders sein, genau wie du. Das kannst du mir glauben.«
Beim Abendessen erzählt Jana irgendwas von ihren Freundinnen, ich lese unter dem Tisch eine Nachricht von Pascal. Na, überstanden? Er darf seine Schulden in der Werkstatt seines Vaters abarbeiten, was ich hundertmal besser finde als meine Sozialstunden. Allerdings hat er dazu ein paar Ohrfeigen kassiert, und ich bin noch nie, nicht ein einziges Mal geschlagen worden. Am besten hat es mal wieder Samuel. Der konnte seinen Eltern, die sowieso reich sind, alles von seinem Ersparten zurückzahlen, und damit war die Sache erledigt. Ich hingegen arbeite bei jedem Besuch im Heim 10 Euro von den 500 ab, die meine Eltern Samuels Eltern überwiesen haben. Dies sei ein guter Stundenlohn für einen Vierzehnjährigen, meinte auch mein Vater. Fünfzigmal soll ich also zu Frau Silberstein gehen! Da drehe ich ja irgendwann durch – und niemand interessiert’s.
Wir kauen.
Und es ist Jana, der es einfällt: »Du warst doch heute im Bunker. Wie war’s?«, fragt sie, als hätte ich einen Klassenausflug nach Disneyland gemacht.
Meine Mutter guckt neugierig, mein Vater legt die Zeitung weg. Meistens liest er die abends, wenn er nicht zu fertig ist, er arbeitet ziemlich viel. Aber dafür, sagt er stolz, ist er jetzt als Architekt sein eigener Chef, und in ferner Zukunft, so meint er, werden wir auch mal viel Geld haben. Alle schauen jetzt zu mir, und ich betrachte das Brot in meiner Hand. Frau Silberstein hatte zum Glück eine Weile die Augen zugemacht und irgendwann wieder so heiser gesagt: »Gleich ist die halbe Stunde um, und wenn es Kaffee gibt, kannst du ja gehen.« Da dachte ich noch, sie meint für immer. Wegen dem schlechten Start.
Ich trinke einen Schluck Saft und weiß plötzlich eines: Ich werde hier gar nichts erzählen, das ist meine kleine Rache, Berichte können sich meine Eltern abschminken, und meine Schwester sowieso. Sie kann überhaupt nichts für sich behalten, und jede ihrer Freundinnen weiß von dem großen Bruder, den die Polizei kürzlich nachts nach Hause gebracht hat. Aber vielleicht könnte ich mir wenigstens einen Spaß aus der Sache machen. »Es war super dort. Der spannendste Nachmittag seit Langem. Dass ein Junge bei sooo eine tolle Aktion! Mitmachen! Will!«, äffe ich Frau Kraftschicks komisches Deutsch und ihre Begeisterung nach und studiere weiterhin das Verhalten von Eiersalat auf Brot. Mayonnaise tropft herunter.
»Len-ny«, sagt meine Mutter im leicht vorwurfsvollen Singsang-Ton.
Als Frau Kraftschick endlich wiederkam und fragte, wie wir uns verstanden haben, meinte Frau Silberstein: »Ich denke, wir verstehen uns wohl gut.«
Frau Kraftschick verkündete daraufhin glücklich: »Dann, Lennard, kommst du nächste Woche wieder, ja?« Ich konnte nur baff nicken.
»Echt, so toll?«, fragt Jana, und meine Mutter seufzt: »So ein Unsinn. Dein Bruder nimmt dich auf den Arm. Es ist kein tolles Heim. Und da wären wir schon bei Omi.«
Mein Vater seufzt gleich mit. »Heute mal ein anderes Thema?« Er schaut uns alle über den Brillenrand hinweg an, und meine Mutter beginnt mit dem Salatbesteck in der Glasschüssel herumzurühren. »Von wegen, das Thema ist aktueller denn je. Wir sollten sie vielleicht doch erst einmal zu uns nach Hause holen.«
Das Brot in meinem Hals wird zu einem dicken Klumpen. Mit Omi hier in der Wohnung, die ganze Zeit? Darüber hatten wir tausend Diskussionen. Es wäre für sie nur der Rumpelraum übrig, wie wir zu dem kleinen Zimmer immer sagen. Jeder stellt dort rein, was er will, und manchmal trocknet da ewig lang die Wäsche. Außerdem verzieht Omi das Gesicht, wenn es zu laut ist, als müsste sie gleich sterben. Wir machen aber alle Krach. Jana schreit öfter hysterisch herum, Filme muss ich laut sehen, und mein Vater ist irre stolz auf seinen Uralt-Plattenspieler. Hier sind wir schon immer, und etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.
»Bis ich einen schönen Platz für sie gefunden habe«, sagt meine Mutter und rührt nun immer wilder in der Schüssel. Der arme Salat. »Vorübergehend.« Sie lässt das Besteck plötzlich los, laut klirrt es gegen das Glas. Für einen Moment ist es ganz still. Dann nicken alle nachdenklich, außer mir, ich würge an einem Brotklumpen und denke an Frau Silberstein. Wir könnten Omi, würde sie so leben müssen, nicht mal alle gemeinsam besuchen, weil es viel zu eng im Zimmer wäre. Als ich aus dem Heim raus war, musste ich erst mal tief Luft holen.
»Lennard?«, fragt mein Vater. In unserer Familie hat jeder ein Mitspracherecht, selbst wenn man Mist gebaut hat.
Der Klumpen rutscht endlich runter. »Klar«, röchele ich. Dann für Omi lieber erst mal der Rumpelraum.
2
Ohne Plan stehe ich vor unserem riesigen Bücherregal herum. Seit meinem Antrittsbesuch im Bunker vor einer Woche habe ich null darüber nachgedacht, was ich Frau Silberstein vorlesen soll. Doch jetzt schlägt Stunde zwei, meine Mutter kommt rein und kapiert natürlich sofort, was los ist.
»Also, was nimmst du mit zu deinem ersten richtigen Lesebesuch?«, fragt sie fröhlich, und meine Laune sinkt noch tiefer. Erst diese tolle Sozialstunde, und später den ganzen Abend lernen.
»Keine Ahnung.«
»Keine Ahnung? Aber darüber habt ihr doch vielleicht gesprochen?«
Netter Versuch, mich wieder auszufragen. Ich antworte nicht.
»Na gut. Ich möchte nicht weiter stören beim Suchen und Finden«, sagt sie, da halte ich sie am Arm fest. »Du hast mir das eingebrockt, jetzt hilf mir auch.«
»Eingebrockt hast du es dir selbst.«
Klar. Meine Mutter lässt nie etwas stehen, wenn sie etwas anders sieht als andere, nicht eine Silbe. Und mich jetzt hoffentlich auch nicht. Sie nimmt ein Buch aus dem Regal und drückt es mir in die Hand. »Vielleicht mag sie Heinrich Heine.«
Das Gedicht vom Fräulein an dem Meere kenne ich fast auswendig, weil mein Vater es am Strand oft aufgesagt hat, wenn die Sonne unterging und meine Mutter seufzte und wir alle darüber lachten, weil er dabei seine Stimme verstellte und sie extra tief für uns seufzte. Heine auf dem Buchdeckel schaut mich kritisch an.
»Jetzt schlag du was vor«, sagt meine Mutter.
Ich greife nach einem grellroten Buchrücken, eben weil er so rot ist. Darauf steht irgendwas mit ›sexueller Revolution‹.
»Das finde ich nicht komisch. Mach dir zu deiner Lesepatenschaft bitte ein paar intelligente Gedanken.«
Intelligente Gedanken? Ich mache jetzt meine eigene Revolution! »Vielleicht lese ich Tschick«, sage ich.
»Eure Schullektüre? Ein Jugendbuch?«
»Ein Buch, das auch Erwachsene sehr gut lesen können«, antworte ich schlau, denn den Satz habe ich von unserer Deutschlehrerin. Ob die Geschichte auch Mumien gefällt, davon hat sie allerdings nichts gesagt.
»Aha. Und worum geht’s da noch mal?«
»Um zwei Jungs, die auf der Fahrt in die Walachei mit einem geklauten Wagen ein paar Abenteuer erleben und schräge Menschen treffen. Wenn ich schon vorlesen muss, dann was Cooles.« Jetzt lacht meine Mutter. »Probier’s aus. Nimm sicherheitshalber auch die Gedichte mit.«
Ich packe die beiden Bücher ein, verweigere aber den Regenschirm. Dann laufe ich mit Heine und Tschick zu Frau Silberstein los und würde wie beim letzten Mal am liebsten umdrehen. Der Nieselregen wird immer mehr. Ich will, dass die Stunde einfach schon vorbei ist und das ganze Jahr dazu.
Beim Bunker angekommen stehe ich erst mal wie ein begossener Pudel da und schaue auf die fleckige Wand. An jenem Abend gab es hier im Eingangstunnel nur wenig Licht, eine der Lampen funktionierte nicht, und vorbeilaufende Fußgänger hätten nicht gleich erkannt, was wir da machten. Meine Eltern waren irgendwo, und ich wusste, wenn ich vor eins nach Hause komme, merken die nichts von meinem etwas längeren Ausflug. Eigentlich war alles klar. Mit Jana war abgemacht, dass sie die Klappe hielt. Ihre Strafe dafür waren zwei Wochen Küchendienst, und mein Vater sagte in der Nacht noch zu mir: »Du bist ja ein Held.«
Ich klingele und werde hineingelassen. Grauer Boden, graues Licht, in einer Ecke stehen ein paar Stühle und ein niedriger Tisch, daneben ein braunes Sofa und ein Sessel, in dem eine alte Frau vor sich hinschnarcht. Zwei grauhaarige Opas sitzen nebeneinander auf den Stühlen, stützen sich dabei auf ihre Stöcke und beobachten mich. Weiter hinten gibt es so etwas wie einen Empfang, und dahinter sitzt jemand vor einem großen Monitor. Ich gehe daran vorbei, da taucht ein Kopf hinter dem Bildschirm auf. Es ist der Typ mit dem schmalen Kinnbart, den ich draußen schon mal gesehen habe, und er ruft mir zu: »Hallo, wo willst du denn hin?«
Ich bleibe stehen. »Zu Frau Silberstein? Zimmer 72?«
Er hackt etwas in die Tastatur und mustert mich wie einen Schwerverbrecher: »Du bist ein Lesepate? Für Frau Silberstein?« »Na ja …«, antworte ich, da redet er schon weiter: »Ich wäre vor ein paar Jahren nie auf die Idee gekommen, so etwas zu machen, echt nicht. Wahnsinn!« Er lacht, es klingt wie das Meckern von einer Ziege, und so sieht er mit dem bescheuerten Kinnbart auch aus. Aber wenigstens hat er einen. Ich schaue jeden Morgen umsonst in den Spiegel, ob sich da was tut. Sein Lachen frustriert mich irgendwie. Schnell weg.
Der Aufzug scheint wieder zu funktionieren, schön für alle Rollstuhlfahrer, aber ich nehme die Treppe, so kann ich noch eine weitere Minute vertrödeln. Oben schaue ich aufs Handy. Es ist drei Minuten nach drei, und um Punkt vier gehe ich wieder. Am Ende des Gangs schiebt eine Pflegerin einen Servierwagen über den Flur. Pfleger nämlich heißen die in einem Heim, aber Schwester klingt wesentlich cooler. Da ist das Zimmer. Ich stehe noch ein paar Sekunden vor der Tür herum, klopfe leise und öffne sie langsam.
Zuerst sehe ich eine andere Frau, wahrscheinlich die aus dem zweiten Bett, in dem großen Sessel sitzen, über ihren Knien liegt eine karierte Decke. »Hallo«, sage ich laut und trete ein. Die Frau schaut mich mit seltsamem Blick an, als ob sie durch mich hindurchsieht. Einen Moment ist alles ruhig, dann bewegt sich etwas im Bett von Frau Silberstein, ihr Kopf hebt sich, sie streicht sich über die Haare und sagt: »Hallo. Du bist also wieder da.«
»Muss ich ja …«, sage ich leise, als ich mich zur Tür umdrehe, um sie zu schließen.
»Ach ja? Komm rein. Es zieht.«
Mein Gesicht kann sie in diesem Moment nicht sehen und ich beschließe, dass sie nicht gehört haben kann, was ich eben gemurmelt habe. Ich stelle einen Stuhl ans Bett, etwas weiter weg als beim letzten Mal, und setze mich. Frau Silberstein richtet sich auf, wieder hat sie diese dicke Strickjacke an und rückt das Kissen mit dem Blumenmuster zurecht, und die andere Frau im Sessel schaut die ganze Zeit zu uns herüber.
»Das ist Gerda«, sagt Frau Silberstein und faltet die Hände auf der Bettdecke wie zum Gebet. Die Heizung rauscht, ein bisschen Regen klopft an die Fensterscheibe. In Gedanken beginne ich zu zählen, eins, zwei, drei – bis mir einfällt, was ich sagen soll. Nur dazusitzen macht mich kribbelig, und an Zahlen zu denken hilft mir manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich sonst machen soll.
Zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig …
Da sagt Frau Silberstein endlich was: »Du redest auch nicht gerade viel. Außerdem hast du vom Regen feuchte Haare. Dort im Schrank findest du ein Handtuch.«
»Nein, brauche ich nicht.«
»Na, wie du meinst.«
Diese andere Frau hat ein Stofftier auf dem Schoß, sie hält es in die Höhe und ruft laut: »Das ist Paula!«
In der Luft schwebt eine kleine gefleckte Kuh. Ich hole schnell die Bücher aus der Tasche und lege sie auf meine Knie. »Also, äh, ich bin ja zum Lesen da, und ich weiß nicht, was Ihnen so gefällt.« Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Kuh Paula wieder in Gerdas Schoß sinkt. »Mögen Sie Gedichte?«, frage ich, und wie bescheuert ist das denn, die wollte ich doch gar nicht lesen. Frau Silberstein greift nach dem Wasserglas, das neben einem Wecker und anderem Zeug auf ihrem Tisch steht. »Gedichte …«, sagt sie mit dieser tiefen, heiseren Stimme. Dunkel, fällt mir ein. Ihre Stimme ist so dunkel.
»… Gedichte können Leben retten. Welche Gedichte?« Sie trinkt einen Minischluck und stellt das Glas zurück.
Wieder steigt der Frust in mir auf, den ich in mir habe, seit ich zu diesem Job hier verdonnert bin. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, bin ich auch auf Frau Silberstein sauer. Sie könnte sich ruhig ein bisschen mehr darüber freuen, dass ich hier bin. Als ob ich nichts Besseres mit meiner Zeit anfangen könnte, als mit zwei Omas rumzuhängen, eine seltsamer als die andere.
»Heine«, sage ich nur.
Frau Silberstein sieht mich seltsam an, zieht ihre dunklen Augenbrauen weit nach oben, die fast wie zwei umgekippte Fragezeichen aussehen, weil sie so ähnlich geschwungen sind.
»Mögen Sie Heine? Oder lieber etwas, äh, Jugendliches?«, frage ich.
»Hast du Heine für mich ausgesucht?«, fragt Frau Silberstein.
Gerda ruft: »Das ist Paula!«
Mir ist das jetzt zu viel. »Ich habe hier gar nichts ausgesucht!«
Der Satz hallt im Raum, hallt in meinem Kopf. Ich starre auf die Bücher auf meinem Schoß, Heine schaut noch kritischer als vorhin zurück, als wollte er sagen: So redet man aber wirklich nicht mit einer alten Dame! Nimm dich zusammen, Junge!
Ich stehe auf, es passiert ohne meinen Willen, die Bücher klatschen auf den Boden.
»Gerda ist lieb. Sie tut nichts. Sie ist nur ein bisschen verwirrt. Setz dich wieder«, sagt die dunkle Stimme, und das erste Mal klingt es nett und freundlich.
Ich höre auf sie.
»Erzähl mal.«
»Was erzählen? Bin zum Lesen hier«, sage ich, und die Fragezeichen über Frau Silbersteins Augen ziehen sich zusammen.
»Weißt du was? Ist mir wurscht«, antwortet sie.
Ich muss schlucken, habe auf einmal schrecklichen Durst. »Wieso wurscht?«, krächze ich. Frau Silbersteins Heiserkeit ist ansteckend.
Sie streicht sich mit den Fingern über ihren runzeligen, mit dicken blauen Adern durchzogenen Handrücken. »Habe ich dir doch schon beim letzten Mal gesagt. Mir geht’s wie dir, ich möchte auch nicht unbedingt hier sein. Aber du, du kannst doch einfach wieder gehen. Das macht mir nichts. Du bist doch frei.« Ich kapiere gar nichts. »Woher wissen Sie denn so genau, dass ich nicht hier sein will?«
»Ich habe eben gute Ohren.«
»Aber Sie suchen doch einen Lesepaten?«
»Unsinn. Ich suche gar nichts mehr.«
»Aber Frau Kraftschick …«
»Ach, Frau Krawczyk, die liebe Frau. Ja, stimmt, sie hat mal meinen Namen in eine Kartei aufgenommen, weil mich niemand mehr besuchen kommt, und gesagt, vielleicht käme irgendwann jemand zum Vorlesen oder zur sonstigen Unterhaltung vorbei.«
»Also suchen Sie doch jemand?«
»Nein. Ich suche nicht. Ich stehe in einer Kartei, weil ich hier niemanden mehr habe, und Frau Krawczyk sucht. Mir ist das egal.«
»Niemanden?« Ich spiele oft Echo, wenn ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Ist ja schlimm: Immer hier sein und niemand kommt vorbei, nur ich jetzt, und das nicht mal freiwillig.
»Ein Besuch, der gar nicht gern da ist, macht noch einsamer«, sagt Frau Silberstein. Sie hört nicht nur gut, sie liest auch noch Gedanken! »Geh nur.«
Geh nur – das sagt Omi auch oft, und das habe ich dann manchmal auch gemacht. Aber hier geht das nicht so einfach. »Ich muss ein Jahr hierherkommen.« Jetzt ist auch das raus, und gleich schickt Frau Silberstein mich weg. Ist sowieso besser. Ich will sie ja nicht noch einsamer machen, wie sie eben so schön meinte. »Es ist die Idee meiner Eltern, oder besser gesagt: eine sogenannte Erziehungsmaßnahme«, sage ich.
»Aha.« Frau Silberstein macht die Augen zu und rührt sich nicht. Nun erst recht. »Weil ich mit Freunden Graffiti gesprüht habe, unten auf die Wand am Eingang. So, jetzt können Sie es allen verraten, die glauben, ich mache das hier freiwillig. Stimmt gar nicht!«
Ein Auge von Frau Silberstein öffnet sich. »Ich fand das da draußen hübsch. Schade, dass es nicht fertig geworden ist.«
»Was?«
»Graue Mauern sind hässlich, sind traurig, sind schaurig.«
»Sie finden so was hübsch?«
»Spreche ich so undeutlich?«
»Nein, ich meine, es ist viel zu grau hier. Ich habe unten aufgepasst, dass niemand kommt, und es war auch niemand zu sehen, und trotzdem sind auf einmal Zivilbullen aufgetaucht, und wir waren dran.« Die Worte sprudeln aus mir raus, und nach dieser Beichte brauche ich hier bestimmt nicht mehr aufzutauchen.
Frau Silberstein schaut auf ihren Wecker. »Hilfst du mir mal? Unten am Bett ist so ein Hebel, damit kannst du die Lehne hochstellen.«
Mein Gesicht fühlt sich rot an. Als Frau Silberstein aufrecht sitzt, holt sie eine Bürste und einen Spiegel aus ihrer Tischschublade und beginnt in aller Ruhe, sich ihre silbrigen Haare zu frisieren. Als gäbe es um sie herum keine andere Welt mehr. Gerdas Kopf ist auf die Schulter gesunken, Kuh Paula auf den Boden gefallen. Jetzt bin ich mir ganz sicher: Beide sind verrückt …
»Ich sage nur nichts, weil ich glaube, du willst nicht wissen, was ich denke.« Was Frau Silberstein von sich gibt, klingt allerdings kein bisschen verrückt.
»Wieso denn?« Ich spüre Rotz aus der Nase laufen, ziehe ihn wieder hoch.
Frau Silberstein deutet auf die Taschentücher, die auf dem Tisch liegen. »Also ich denke, ihr Kerle wart schön dumm. Ist euch nicht klar gewesen, dass es hier Kameras gibt?«
Ich rotze in ein Taschentuch. Jetzt wäre es mir lieber, sie wäre doch nicht so klar im Kopf. Die Kameras haben uns verraten, klar, das weiß ich auch schon, nur haben wir damals nicht daran gedacht. Null. Wir haben ja auch gar keine gesehen. Klackern, Zischen, Sprühen, Kick! Wenigstens kamen wir wegen der anderen Graffiti in der Stadt nicht dran.
»Ihr lest doch bestimmt Krimis und schaut viele Filme, überall gibt es doch Kameras, oder nicht?«
»Ja, aber warum denn hier?« Ich bin wieder wütend. »Hier ist doch niemand gefährlich, und es bricht doch keiner in ein Altersheim ein, oder?«
Sie lässt Spiegel und Bürste sinken. »Hier gibt es viele kranke Menschen. Jemand fällt hin, braucht Hilfe, manche laufen weg. So können die Leute, die gerade Dienst haben, das immer beobachten. Ich fand es schade, dass das Bild nicht fertig wurde. Es war auch kein Grün dabei. Grün ist meine Lieblingsfarbe, es fehlte noch Grün.«
»Sie haben es gesehen?«
»Ja, morgens komme ich manchmal an die frische Luft.« Sie deutet auf das komische Ding, ein Rollstuhl, der zusammengeklappt neben dem Schrank steht. »Wenn jemand Zeit für mich hat.«
Da geht die Tür auf. Eine Frau mit kurzen blonden Haaren kommt mit einem Tablett herein. Sie hat überall Sommersprossen und sie lacht fröhlich.
»Schwester Susanne!« Frau Silbersteins Gesicht leuchtet auf, als die blonde Frau ans Bett tritt und eine Tasse Kaffee auf dem Tisch abstellt, dazu einen kleinen Teller mit drei Butterkeksen. Sie streichelt über Frau Silbersteins Wange und holt ein kleines Handtuch aus der Schublade, das sich Frau Silberstein gerade und ordentlich auf die Brust legt.
»Wie geht es Ihnen?«, fragt die Schwester.
Frau Silberstein lächelt. »Wenn Sie da sind, geht es mir gut.«
Jetzt lacht die Schwester auch mich an: »Du bist der Lesepate? Frau Silberstein ist eine ausgesprochen nette und feine Dame, weißt du das schon?«
Frau Silberstein könnte jetzt antworten: Aber leider will Lennard nicht hier sein, sondern lieber Farbe an Wände sprühen. Doch sie sagt keinen Ton, beachtet nur noch ihren Kaffee, mich sieht sie gar nicht mehr an. Die Schwester geht zu dem Häuflein Mensch in dem Sessel und streichelt Gerdas Kopf. »Wenn du durstig bist, draußen auf dem Wagen stehen auch Saft und Tee«, sagt sie zu mir.
»Und das Klo?«, frage ich. Ich muss zwar nicht dringend, aber es ist mir gerade zu eng hier im Zimmer.
»Gegenüber vom Schwesternzimmer, und eine der Kabinen ist für Besucher, das siehst du dann schon.«
Ich gehe sofort raus, auf dem Gang sind ein paar Türen geöffnet, irgendwo läuft ein Fernseher oder ein Radio, ich höre Stimmen, und weiter weg rumst etwas laut. Ich stürze ein Glas Saft herunter, tippe ein bisschen auf dem Handy herum. Leider keine Nachricht, die mir irgendwie hilft …
Also aufs Klo, wo auf einer der Kabinentüren in großen Buchstaben steht: Besucher. Das siehst du dann schon. Ja, das kann ich lesen, liebe Schwester, und jetzt bin ich auch noch auf die Pflegerin sauer, die doch eigentlich ganz nett ist. Ich schließe mich ein und glotze auf die knallorangefarbene Ablage. Neben den aufeinandergetürmten Klopapierrollen liegt ein Handy. Sieht aus wie neu. Ich nehme es in die Hand, mein Magen zieht sich zusammen. Tue ich es, tue ich es nicht? Ich tue es. Habe so was noch nie getan. Stecke das Handy vorne in den Bund der Jeans und ziehe meinen Pulli drüber. Auf einmal ist jedes Geräusch tierisch laut. Ich schaue mich um. Gibt es hier auch Kameras? Sehe keine. Das Handy jedenfalls hat jemand dort vergessen, und wenn ich es nicht finde, findet es logischerweise jemand anders. Oder soll ich es brav bei der Schwester oder diesem Ziegenbart unten abgeben? Ich drücke die Klospülung. Mann, ich habe ein Handy gefunden! Vielleicht kann ich es irgendwie verkaufen, schließlich brauche ich schnell Geld, und es kann nur ein Wink des Schicksals sein, dass ich es gerade jetzt finde. Noch nie habe ich was Wertvolles gefunden, schon gar nicht geklaut, wobei etwas Gefundenes mitnehmen auch nicht Klauen ist, oder?
Auf dem Gang scanne ich die Wände und alle Ecken. Immer noch keine Kameras. Eine Tür geht hinter mir auf, mein Herz zerspringt für einen Moment, aber ich drehe mich nicht um. War schließlich offiziell nur auf dem Klo. Und wenn ich gleich hier raus bin, komme ich nie wieder hierher …
Es ist schon nach halb vier, als ich wieder am Bett sitze und die Schwester rausgegangen ist. »Haben Sie es ihr erzählt?«, frage ich.
Frau Silberstein stellt ihre Tasse zurück. »Was?«
»Na, dass ich gar nicht der tolle Lesepate bin.«
Sie sieht mich an. »Ach, deine Geschichte. Weißt du was? Dann musst du dein Jahr eben absitzen. Du kannst hier machen, was du willst, vielleicht Schularbeiten? So bekommst du die Zeit sicher rum.«
»Äh … ich weiß nicht …« Vorne am Bauch vibriert das gefundene Handy, zum Glück nur kurz. Aber es fühlt sich an wie ein kleiner Stromschlag.
Frau Silberstein hat schon wieder die Augen zu. »Kannst auch wieder früher gehen. Ich bin nach dem Kaffee meistens sowieso sehr müde und mache meinen zweiten Mittagsschlaf.«
Ich bücke mich nach meiner Tasche, die unter das Bett gerutscht ist. Ein, zwei, drei Sekunden bleibe ich da unten, Frau Silberstein bewegt sich, das Bett quietscht leise, das Handy drückt an den Bauch, ich komme wieder hoch. Ihr Angebot klingt entspannt, und zu Hause muss ich davon ja nichts erzählen. »Wirklich?«
Sie brummt: »Ja. Tschüss.«
Ich murmle: »Okay, tschüss.«
Ich schleiche raus, und an meinem Bauch fühlt es sich seltsam warm an. Vielleicht sollte ich das Handy lieber wieder zurücklegen, Stromschläge sind nicht so mein Ding. Doch am Ende des Gangs steht die blonde Schwester vor einer offenen Zimmertür und redet mit irgendjemand. Ich müsste an ihr vorbei, und zweimal in einer halben Stunde aufs Klo, das ist ziemlich verdächtig, vor allem, falls schon jemand das Telefon vermisst, falls schon danach gesucht wird. Also verschwinde ich lieber Richtung Treppenhaus, und um Besuch Nummer drei komme ich wohl nicht herum. Allerdings könnte sich Frau Silberstein ruhig ein bisschen mehr freuen, wenn ich schon da bin. Die blonde Schwester hat sie schließlich angestrahlt wie eine aufgehende Sonne. Ein paar Strahlen auch für mich, und ich käme mir nicht so überflüssig vor.
Zu Hause sitzt Omi zwischen den vielen Kissen auf unserem Sofa, die Hände im Schoß. Ich drücke sie kurz. Der Fernseher läuft leise, sie sieht sich mal wieder eine Kochsendung an. Beim total spannenden Schnippeln von Gemüse – gerade wird eine Möhre zerlegt – muss ich an Samuel denken, den ich eben lieber mal vergessen würde. Er isst oft eine Mohrrübe, lässt sie dabei extra laut knacken. Ob er nun vielleicht alles schlimmer oder besser macht – ich habe echt keine Ahnung.
Als das Heim mich aus dem Tunnel auf die Straße gespuckt hatte, wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte. Also habe ich bei meinem besten Freund noch einen Stopp gemacht, habe ihm erzählt, wie lässig Frau Silberstein auf unsere Graffiti-Aktion reagiert hat.
»Cool, Len, da hast du echt Glück gehabt«, war sein Kommentar dazu.
Ja, Len klingt vielleicht cool, aber was Len tun muss, ist das Gegenteil davon. Da wurde meine Laune ganz schlecht. »Idiot! Ich muss da jetzt ein Jahr hin!«, habe ich ihn angemacht.
Voller Unschuld hat er die Hände gehoben. »Soll ich deswegen auch zum Lesepaten werden? Jetzt chill doch mal. Du schaffst das schon. Stell dir vor, die Alte wollte wirklich die ganze Zeit nur Gedichte vorgelesen bekommen, das wäre hart.«
Erst in seinem Zimmer habe ich das Handy rausgeholt. Bis dahin hatte ich die ganze Zeit und überall das Gefühl, ich würde beobachtet oder so. »Das lag da rum«, erzählte ich.
Samuel nahm es mir aus der Hand, als wäre es ein rohes Ei. Er machte es an, das Display leuchtete auf. »Keine Face-ID, nur Zahlencode«, sagte er, runzelte die Stirn und sah mich an, als sähe er mich plötzlich zum ersten Mal. »Du hast es einfach eingesteckt?«
»Einfach eingesteckt.«
»Und jetzt?«
»Mann, denkst du echt, ich gehe da ein Jahr lang hin? Vielleicht kann ich dafür Geld bekommen, mich freikaufen!« Ich nahm ihm das Handy wieder weg. »Zahlencode, klar. Was jetzt?«
»Ts, Ts«, machte er. »Meinst du, deswegen gibt es keine geklauten Handys zu kaufen? Ganz zufällig … also das ist nun echt ein Zufall.« Er grinste breit. »Vertrau mir. Ich kenne da jemand.«
»Du? Woher denn?«
»Sag ich doch: Zufall. Ein neuer Bekannter. Ich hole für dich raus, was ich kann. Ich helfe dir da gern.«
Wir saßen noch da und haben Freunden und Pascal geschrieben, doch als Samuel mich mit ›Sozialarbeiter des Jahres‹ betiteln wollte, war Schluss, und mitlachen konnte ich auch nicht. »Das ist kein Thema, klar?« Ich bin auch bald gegangen und habe es irgendwie bereut, ihm das Handy dagelassen und von Frau Silberstein erzählt zu haben. Die Stimmung zwischen Samuel und mir war nicht die beste. Aber er wird das alles ja wohl für sich behalten können …













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















