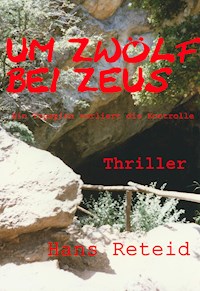
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1. März 1996. In der Fachhochschule Osnabrück explodiert während des Festaktes zur 25-Jahr-Feier ein Sprengkörper. Zahlreiche Ehrengäste aus Wissenschaft, Forschung und Politik werden verletzt. Ein britischer Professor ist sofort tot. Durch dieses Ereignis kreuzen sich erneut die Wege zweier Rivalen: Marco Brandes, ein früherer Topspion der DDR, und Berthold Ackermann, Vizepräsident der Fachhochschule. Für Brandes endlich der passende Anlass, sich an Ackermann zu rächen. Dabei zieht er alle Register seiner Stasi- und KGB-Ausbildung. Knapp vier Monate später endet der Kampf auf der griechischen Insel Kreta in einer Katastrophe. Zwei Frauen geraten mit in diesen erbarmungslosen Strudel: Ackermanns Tochter Ellen und die niederländische Journalistin Samantha Smits. Das Geheimnis um den Tod von Ackermanns Frau Gisela überschattet alles. Ein spannungsgeladener Spionagethriller, besonders interessant für Norderney- und Kretaurlauber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Reteid
UM ZWÖLF BEI ZEUS
Ein Topspion verliert die Kontrolle
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Story:
Die Hauptpersonen:
Lied der Tschekisten
Wachsam sein, immerzu ...
Teil 1 - Der Anschlag
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil 2 – Die Erpressung
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil 3 - Kreta
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Epilog
Impressum neobooks
Die Story:
Hans Reteid
UM ZWÖLF BEI ZEUS
Ein Topspion verliert die Kontrolle
Thriller
(Überarbeitete Auflage Februar 2018)
1. März 1996. Friedensstadt Osnabrück. In der Fachhochschule explodiert während des Festaktes zur 25-Jahr-Feier ein Sprengkörper. Zahlreiche Ehrengäste aus Wissenschaft, Forschung und Politik werden verletzt. Ein britischer Professor ist sofort tot. Durch dieses Ereignis kreuzen sich erneut die Wege zweier alter Rivalen: Marco Brandes und Berthold Ackermann. Für Brandes genau der passende Anlass, sich endlich an Ackermann zu rächen. Dabei zieht er alle Register seiner Stasi- und KGB-Ausbildung. Knapp vier Monate später endet der Kampf auf der griechischen Insel Kreta in einer Katastrophe. Zwei Frauen geraten mit in diesen erbarmungslosen Strudel: Ackermanns Tochter Ellen und die niederländische Journalistin Samantha Smits. Das Geheimnis um den Tod von Ackermanns Frau Gisela überschattet alles.
Die Hauptpersonen:
Marco Brandes (56), ehemaliger Topspion der DDR und immer noch überzeugter Tschekist; nach der Wende verraten, verhaftet und durch Gefängnis, Alkohol, Arbeitslosigkeit abgerutscht zum obskuren Privatdetektiv im Berliner Rotlichtmilieu. Das will er jetzt ändern. Die Pläne dazu sind alt, denn es gibt für ihn nur einen, der an allem die Schuld trägt:
Berthold Ackermann (54), Vollblutwissenschaftler mit engen Verbindungen zur internationalen Luft- und Raumfahrtindustrie, Vizepräsident der Fachhochschule Osnabrück, zugleich Dekan des Fachbereichs Werkstofftechnik und in den siebziger Jahren von der CIA in Spionageabwehr ausgebildet. Er entwickelt mit seinem Team eine neue Keramikbeschichtung, die in Flugzeugtriebwerken effektivere Verbrennungstemperaturen bei geringerem Schadstoffausstoß ermöglicht - ein hochsensibles Projekt, besonders bedeutsam für den Großraum-Airbus und den Eurofighter.
Ellen Ackermann (26), Bertholds Tochter, eine lebenslustige Archäologie-Studentin, die sich auf ihre Promotion an der Universität Rethymnon (Kreta) vorbereitet. Sie sieht ihrer 1973 tödlich verunglückten Mutter Gisela täuschend ähnlich, hat auch deren erotische Ausstrahlung.
Samantha Smits (43), niederländische Journalistin. Sie erlebt den Anschlag in Osnabrück und stößt bei ihren Recherchen schon sehr früh auf Spuren im Geheimdienstmilieu, während Polizei und BKA die Täter noch im Umfeld der IRA vermuten. Aus anfangs rein journalistischem Interesse entwickelt sich langsam Liebe zu Ackermann. Das widerstrebt Ellen, zumal aus der Beziehung neue Probleme entstehen: Samantha arbeitet mit belgischen und französischen Kollegen an einem Buch über Verbindungen früherer Stasi- und KGB-Agenten mit kolumbianischen Drogenkartellen. Sie entdeckt dabei ein Beziehungsgeflecht, das bis in höchste Regierungskreise der Bundesrepublik Deutschland führt.
Lied der Tschekisten
Wachsam sein, immerzu,
Und das Herz ohne Ruh´,
Auch in friedlicher Zeit nie geschont.
Tschekisten, Beschützer des Friedens der Menschen,
Soldaten der unsichtbaren Front.
Dies ist der Refrain eines Kampfliedes sowjetischer Tschekisten. Die 1917 im Auftrag Lenins von Feliks Edmundowitsch Dserschinskij gegründete Geheimpolizei „Tscheka“ war wegen ihrer grausamen Exzesse gefürchtet. Aus ihr wurde nach mehrfachen Umbenennungen 1954 der Geheimdienst KGB.
Markus Wolf, der legendäre Leiter der DDR-Auslandsaufklärung, hat dieses Kampflied für seine „Kundschafter an der unsichtbaren Front“ - die Agenten der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) - ins Deutsche übersetzt.
Das Lied hat mehrere Strophen und wurde bei geselligen Anlässen gesungen.
Wachsam sein, immerzu ...
In diesem Thriller werden Sie, liebe Leserin und lieber Leser, auf ein Phänomen stoßen, mit dem viele Agenten schon gerungen haben. Klaus Fuchs, der so genannte „Atomspion“, umschrieb es einmal mit dem Begriff „kontrollierte Schizophrenie“. Er verband damit die Frage: Wie lange und unter welchen Bedingungen gelingt es, die Kontrolle über das gleichzeitige Denken, Fühlen und Handeln in mehreren unterschiedlichen Lebenswelten zu behalten?
Aber gelingt das auch, wenn der Auftraggeber, das Land, die geistige Heimat des Spions plötzlich nicht mehr existiert?
Genau damit ringt der Protagonist dieses Thrillers; und weil dies an realen Schauplätzen geschieht und eingebettet ist in Ereignisse mit bekannten Persönlichkeiten und Organisationen der jüngeren Zeitgeschichte, entsteht der Eindruck, als hätte sich dies alles genau so zugetragen. Dennoch: Die Handlung und seine Figuren sind frei erfunden. Lassen Sie sich durch die Vermischung von Fiktion und Fakten nicht Ihre Kontrolle über Phantasie und Wirklichkeit entreißen.
Und bleiben Sie wachsam. Denn es gibt sie immer noch: Diese mehr oder weniger versteckt arbeitenden und unverbesserlichen Tschekisten mit ihrem antrainierten Zerstörungspotenzial aus der Zeit des Kalten Krieges; sie feiern möglicherweise gerade das 100-jährige Bestehen der Tscheka.
Teil 1 - Der Anschlag
Kapitel 1
Beim Öffnen des Briefkastens spürte er sie wieder: diese innere Unruhe von heute Morgen. Schweißgebadet war er aufgewacht, und das Herz hatte sein Blut durch die Adern gejagt, als wäre er in größter Gefahr.
Dabei klemmte die Briefkastentür nur ganz leicht. Sonst war da nichts. Kein Kratzer am Schloss. Keine Fingerabdrücke. Nur das Messingschild mit den eingravierten Buchstaben „Detektei M. Brandes“ blitzte so, als hätte es eben jemand blank gerieben.
Oder war es der Brief im Kasten? - Nicht zugeklebt. Keine Anschrift. Kein Absender. Misstrauisch beäugte er ihn, nahm ihn behutsam heraus, betrachtete ihn von allen Seiten. Seine Hand zitterte. Er schob den Zeigefinger zwischen die Blätter, bis er genau das Wort lesen konnte, das ihn seit der Entlassung aus dem Gefängnis verfolgte: Rechnung!
Schritte hallten durch das gekachelte Treppenhaus, kamen näher, ließen den sonst üblichen Fluch zwischen seinen Lippen gefrieren. Blitzschnell drehte er sich um. Er sah in zwei große Augen, deren Pupillen sich so bewegten, als würden sie ihn von oben bis unten einschätzen. Das faltige Gesicht des Mannes hinter den dicken Brillengläsern sah harmlos aus. Aber in der linken Hand sah Brandes eine große Rohrzange pendeln.
„Na?“, fragte der Alte. „Fangense immer erst kurz vor zwölfe an?“ Und weil er keine Antwort bekam, setzte er gleich nach: „Schön, det ick Sie ooch mal zu Jesicht krieje. Motzke. Bin der Hausmeister hier. Det mit die fällige Kaution, den Umschlag da, den hab ick innen Briefkasten jelegt.“ Dabei streckte er die rechte Hand zum Gruß vor und redete wie ein Wasserfall weiter: Über die miese Zahlungsmoral heutzutage, über tropfende Heizungsrohre, die Witwe Hollewitz im zweiten Stock, die türkische Familie Özdemir unterm Dach und wie friedlich es in der Oranienburger Straße doch war, als Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl das Sagen hatten. „Damals. Als det hier noch die Hauptstadt der DDR war.“
„Ja, ja“, stoppte Brandes den Redefluss, ließ die Hand des Mannes los und entspannte sich langsam wieder, verfolgte aber aufmerksam jede Bewegung der Rohrzange. Als Motzke fragte, welche Art Aufträge er denn als Detektiv so bearbeiten würde, schloss er den Briefkasten zu und stapfte, ohne darauf zu antworten, an dem Alten vorbei die Treppe hinauf.
„Sindse bloß vorsichtig“, hörte er ihn rufen. „Nicht datse am Ende Ärjer kriejen, mit die Russenmafia - oder so.“
*
In der ersten Etage hatte Marco Brandes vor wenigen Tagen eine Zweieinhalbzimmerwohnung gemietet, mit einem Erker. Von dort ließ sich die Oranienburger Straße nach beiden Seiten einsehen, ohne die Fenster zu öffnen. Das größere Zimmer diente als Büro, das kleinere war eine Mischung aus Wohn- und Schlafzimmer. Er nannte es Kombizimmer.
Als er den Schlüssel der Korridortür herumdrehte, spürte er wieder dieses Gefühl im Bauch und in der Brust. Warum hatte der alte Motzke vorhin die Russenmafia erwähnt?
Nachdenklich betrat er die Wohnung, schaute ins Kombizimmer, in die kleine Küche, ins Büro. Nichts Auffälliges. Auf dem Schreibtisch wie immer: Computerbildschirm, Tastatur, die Fotos von Mutter und Tante Gertrud, die Dose mit den Büroklammern und die Schale mit den Farbstiften und Kugelschreibern. Alles geordnet wie die Utensilien eines Buchhalters - bis auf die offene Rechnung, die er auf die Tischplatte geworfen hatte.
Er schlurfte zur Schrankwand und verglich den Inhalt der Regale mit den gespeicherten Bildern in seiner Erinnerung, fand auch hier keine Abweichungen. Wegen seines fotografischen Gedächtnisses hatte man ihn in der „Firma“ oft beneidet. Bis jetzt hatte es immer zuverlässig funktioniert. Bis jetzt.
Unschlüssig blieb er vor der Schrankwand stehen, kratzte sich am Hinterkopf, schielte zum Schreibtisch herüber. Irgendetwas war anders. Aber was?
Die Signallampe des Anrufbeantworters blinkte. „Verdammt! Warum hab´ ich die übersehen?“ Hastig drückte er auf die Wiedergabetaste und wartete angespannt. Die Geräusche klangen wie aus einer Telefonzelle an einer belebten Straßenkreuzung. Knacken in der Leitung. Aufgelegt. Kein Wort. Keine versteckte Botschaft. Auf dem Display stand: „1. März 1996, 10:50 Uhr.“
Er schaute auf die Armbanduhr. Acht Minuten vor zwölf. Nervös trommelte er mit den Fingern auf der Tischplatte.
„Stachynskij! Idiot! Warum meldeste dich nicht noch mal?“
*
Ellen Ackermann saß gern an dem runden Tisch im Esszimmer. Kindheitserinnerungen waren damit verbunden, früher hatte er bei den Großeltern in Freiburg gestanden. Wenn sie nach einem erfolgreichen Studienabschnitt wieder für einige Zeit in Osnabrück wohnte, deckte sie ihn meist liebevoll; auch dann, wenn sie allein frühstückte.
Die letzten Monate hatte sie an der Sorbonne in Paris verbracht. Sie erinnerte sich an das quirlige Leben im Quartier Latin, an die Ruhepausen im Jardin du Luxembourg und an die Cafés und Bistros rund um den Boulevard St. Michel. Doch ein Frühstück an dem runden Tisch war mit all dem nicht zu vergleichen.
Ellen hatte sich nach dem Duschen nur einen Morgenmantel übergestreift. Gut, dass er mich so nicht sieht, dachte sie. Er würde sicher wieder mit seinen Ansichten über meinen Lebenswandel nerven. Frühstück kurz vor zwölf? Nackt unterm Bademantel? Und überhaupt: als Professorentochter erst morgens um zehn nach Hause kommen? - Zum Glück wird er im Augenblick andere Dinge im Kopf haben. Die große akademische Feier zum Beispiel, die müsste jetzt ihren Höhepunkt erreichen.
Erinnerungen an Sven drängten sich dazwischen. Sie hatte sich in dem thailändischen Restaurant lächelnd an seinen Tisch gesetzt. Gestern Abend. Sven war groß, sportlich, ein charmanter Plauderer, sah sexy aus. Und er tanzte auffallend gut. Das hatte sich anschließend in der Disco herausgestellt. Nur in der Liebe war er nicht besonders fantasievoll. Da fehlte das französische Element. Das war deutsche Hausmannskost mit spürbarem Drang zum Leistungssport. Sie lächelte. Wie hieß Sven eigentlich mit Nachnamen?
Ellen belegte die letzte Brötchenhälfte mit einer großen Scheibe Zungenwurst. Im Radio begannen die Mittagsnachrichten. Hauptthema: die Bonner Querelen über die ausufernden Umzugskosten in die neue Hauptstadt Berlin. Dann hörte sie plötzlich:
„Osnabrück. In der Aula der Fachhochschule Osnabrück ist während des Festaktes zur Fünfundzwanzig-Jahr-Feier ein Sprengkörper explodiert. Nach unbestätigten Meldungen hat es Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Über die genaue Ursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.“
Sie sprang auf. Kaffee schwappte aus der Tasse.
„Oh Gott! Hoffentlich ist ihm nichts passiert!“
Sie rannte zum Telefon, wählte die Nummer der Hochschule, verwählte sich, versuchte es noch einmal.
Besetzt!
Unschlüssig lief sie in dem Esszimmer hin und her, dann zum Tisch, wischte mit einem Handtuch die Kaffeepfützen weg, blieb ratlos stehen.
Das Auto! Damit könnte ich hinfahren. Sie kämpfte mit tiefen Atemzügen gegen die aufkeimende Panik. - Geht nicht. Das Auto hat er mitgenommen.
Sie lief ins Gästezimmer, kleidete sich an, blieb vor dem Garderobenspiegel stehen, schob mit den Händen die hellblonden Haare halbwegs in Form, schlüpfte in den Mantel und verließ eilig die Wohnung. Den Schlüssel hatte sie rechtzeitig vor dem Zuschnappen der Tür zu fassen bekommen.
„Lieber Gott“, flehte sie, während sie die geschwungene Treppe hinunter stürmte. „Lass mir wenigstens meinen Vater!“
*
Brandes trommelte immer noch nervös auf der Tischplatte. Der Rhythmus änderte sich, geriet ins Stocken, wurde wieder heftiger, dann stoppte er abrupt. Er öffnete die Schreibtischschublade, rechts unten, zog eine angebrochene Weinbrandflasche heraus und trank einen kräftigen Schluck. Mit der Hand wischte er über den Mund, schraubte die Flasche zu und ließ sie in die Schublade zurückrollen.
„Stachynskij! Melde dich! Verdammt!“ Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Nach kurzem Zögern stand er auf, lief im Zimmer nervös umher, blieb stehen, starrte auf den Schreibtisch unten rechts. „Kein Schnaps mehr!“
Er schlurfte in die Küche, drehte den Wasserhahn auf und ließ den kalten Strahl abwechselnd über den Puls beider Arme laufen. Danach formte er die Hände zu einer Mulde, trank daraus und verteilte das restliche Wasser prustend über Gesicht und Haare. Als er mit dem Kopf wieder hochkam, sah er sich im Spiegel. Eine unausgeschlafene Fratze starrte ihn an, mit dicken Falten auf der Stirn und Säuferaugen. Und dann dieser nasse, fettige Lockenwust und dieser hässlicheGrauschimmer über den Schläfen. „Wie ein Schimmelpilz breitet der sich aus!“
Brandes sah an seinem schmuddeligen Hemd herab und auf die ausgebeulten Hosenbeine. Was hatte Oberst Warnke immer gesagt, wenn sie sich in der „Firma“ auf dem Flur begegnet waren? „Wie Sie mal wieder rumloofen, Jenosse Brandes.“
Der alte Warnke. Was der wohl jetzt macht? Nach der Wende war er spurlos verschwunden, wie die meisten aus dem Gebäudekomplex in der Normannenstraße. Bis auf die paar, die im Knast plötzlich wieder aufgetaucht waren. Denunziert und verraten - von den eigenen Leuten!
Stachynskij, dieser Filou! Ja, auf den war wenigstens Verlass. Meistens jedenfalls. Wenn der nicht gewesen wäre mit seinen obskuren Aufträgen. Und Bärbel, dieses unersättliche Weib. Die ganze Nacht hat sie mich wieder ...
Das Telefon riss ihn aus seinen Gedanken. Er rannte zum Schreibtisch, griff mit nassen Händen zum Hörer: „Ja?“
Er wusste sofort, wer am anderen Ende der Leitung war. Das Rauschen im Hintergrund und die näselnde Stimme. Sie klang nervöser als sonst: „Besuch ausgefallen. R16. Beeil dich!“ Aufgelegt. Keine drei Sekunden hatte es gedauert. Es war etwas schief gegangen. Jetzt musste gehandelt werden.
Er zog den vorbereiteten Brief aus der Schreibtischschublade, trank vor dem Zukleben hastig einen Schluck aus der Flasche. Dann griff er Diktiergerät, Fotoapparat, Teleobjektiv und schob nach kurzem Zögern noch die Pistole in den Gürtel. Sorgfältig schloss er die Wohnungstür hinter sich ab.
*
Mit wehendem Mantel rannte Ellen von der Katharinenstraße zum Heger-Tor-Wall. Dort war ein Taxistand und schräg gegenüber eine Haltestelle für Busse in Richtung Westerberg. Daran erinnerte sie sich.
Auf der anderen Straßenseite des Walls staute sich der Verkehr vor einer Ampel. Mitten in der Schlange entdeckte sie ein Taxi. Sie streckte beide Arme hoch, lief über die Fahrbahn, über den breiten Mittelstreifen und erreichte das Taxi, bevor die Ampel auf Grün wechselte. Hastig öffnete sie die Beifahrertür und sprang ins Auto.
„Fachhochschule, Westerberg!“, sagte sie und zog die Tür zu.
„Langsam, langsam.“ Der alte Taxifahrer musterte sie über den Rand seiner Brille.
„Fahren Sie doch los, bitte!“
„Fachhochschule? Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Die IRA soll mal wieder ´ne Bombe ..., habe ich über Funk ...“
„Bitte!“ Ellen hatte Tränen in den Augen.
Der Mann schüttelte den Kopf, fädelte sich aber doch mit seinem Diesel in den Verkehr Richtung Lotter Straße ein.
Je näher sie dem Westerberg kamen, umso öfter sahen sie Krankenwagen mit Blaulicht. Ellen hörte am Funkgerät sogar mit, wie die Taxifahrer im Stadtgebiet aufgefordert wurden, sich für den Transport von Leichtverletzten bereitzuhalten.
„Ja? Zentrale? Hier ist Manne“, sagte der Alte in sein Handmikrofon. „Bin schon auf dem Weg.“
Hinter der nächsten Kreuzung begann ein Stau. Die Polizei hatte eine Straßensperre errichtet. Das Taxi scherte nach links aus und fuhr an den stehenden Autos vorbei, bis es von einem Polizeibeamten angehalten wurde. Der Fahrer kurbelte das Seitenfenster herunter.
„He, Meister. Lass uns mal da durch. Ich wurde über Funk angefordert. Soll Verletzte an der FH abholen.“
Der Polizist schob wortlos die Sperre zur Seite und winkte das Taxi durch. Der Fahrer grüßte militärisch und kurbelte das Fenster wieder zu.
„Na, geht doch“, brummte er zufrieden und jagte seinen Diesel auf dem freien Straßenstück den Berg hinauf.
Als sie sich der Bergkuppe näherten, fragte Ellen: „Wie haben sie das vorhin gemeint mit der IRA?“
Er schaute sie irritiert an. „Sind nicht von hier, wie? Osnabrück ist einer der größten britischen Militärstandorte im Norden. Es hat in den letzten Jahren schon mehrfach Anschläge auf die Kasernen gegeben.“
„Und was hat das mit der Fachhochschule zu tun?“
„Die Fachhochschule ist doch in die frei gewordenen Teile der britischen Kasernen eingezogen, als die Tommies ab sind nach Jugoslawien. Frischer Inschenörnachwuchs wird da jetzt gemacht, wissen Sie? Ist ja eigentlich besser so. - Aber wer weiß? Vielleicht war das auch gar nicht die IRA. Laufen doch genug Verrückte rum in Osnabrück.“
Sie hatten die Einfahrt zum Hauptgebäude erreicht und wurden von einem Feuerwehrmann gestoppt. Ellen sah die Rauchsäule, die aus dem mittleren Block des Gebäudekomplexes aufstieg. Wasserfontänen spritzten von drei Seiten her auf den Brandherd. Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn kamen immer wieder aus der Einfahrt. Sie gab dem Fahrer einen Zehnmarkschein. „Danke. Stimmt so“, sagte sie, stieg aus und lief an dem Feuerwehrmann vorbei auf das Hauptgebäude zu.
*
„Hier können Sie nicht durch.“ Der junge Polizeibeamte sagte es höflich, stellte sich aber so in den Weg, dass Ellen nicht an ihm vorbei kam.
„Ich muss meinem Vater helfen“, entgegnete sie selbstbewusst. „Er ist Vizepräsident der Fachhochschule.“
Der Polizist überlegte kurz und trat einen Schritt zur Seite.
„Dort in dem Wagen“, sagte er, „da ist die Einsatzleitung. Vielleicht hält sich Ihr Vater da auf.“
Ellen lächelte gequält und schob sich an ihm vorbei. Sie musste aufpassen, dass sie nicht über das Gewirr von Schläuchen und Elektrokabeln stolperte. Der Wind drückte Rauchschwaden nach unten. Sie rieb sich die Tränen aus den Augen und steuerte unbeirrt ihr Ziel an: den Lastwagen mit dem großen Kofferaufbau und den Antennen auf dem Dach. Unmittelbar daneben sah sie ein Kamerateam. Scheinwerfer waren auf einen Reporter gerichtet und einen Polizeibeamten mit goldenen Sternen auf den Schulterklappen. Sie näherte sich der Absperrung. Jetzt verstand sie die Stimmen besser, die zuvor im Lärm der Löschfahrzeuge und der Notstromaggregate untergegangen waren. Trotzdem hörte sie nur unvollständige Sätze und Wortfetzen:
„... ein Todesopfer ... britischen Profess ...“
Sie atmete auf. Vater lebt! Vielleicht hat er nur ein paar Schrammen abbekommen.
Dann hörte sie: „... zahlreiche schwer verletzte ... fliegende Trümmerteile ... Brandwunden ... Rauchvergift ...“
„Gibt es schon Namenslisten? Für die Angehörigen?“, fragte der Reporter.
„... keine vollständigen“, antwortete der Polizeisprecher. „Die ersten Verletzten sind ... da ging´s um Schnelligkeit ... müssen wir noch ermitteln.“
Ellen versuchte, von der anderen Seite näher an den Einsatzwagen heranzukommen. Sie hob das rotweiße Absperrband an.
„Halt!“ Die Stimme klang gereizt. Ein älterer Polizist packte sie unsanft am Arm. „Gaffer können wir hier nicht gebrauchen!“ Er zeigte unmissverständlich in Richtung Straße.
„Nicht so brutal!“, fauchte Ellen zurück. „Ich suche meinen Vater. Ich will wissen, ob ihm etwas zugestoßen ist“.
„Hier bei der Einsatzleitung haben Unbefugte nichts verloren. Gehen Sie! Sonst gibt´s ´ne Anzeige.“ Weil sie seiner Anweisung nicht nachkam, packte er sie erneut am Arm und zog sie in Richtung Straße. Ellen wehrte sich. Der Polizist zog unbeeindruckt weiter.
„Lassen Sie die Frau los! Bitte!“ Ellen hörte eine kräftige Männerstimme hinter sich. Der Polizist stutzte, drehte sich um, blieb stehen, lockerte den Armgriff.
„Trotta?“ Ellen erkannte ihn sofort, trotz seines rußbeschmierten Gesichts und der angesengten Kleidung. Er stand auf der Eisentreppe des Einsatzwagens, neben ihm ein britischer Militärpolizist.
Arnulf Trotta war wie Ellens Vater Professor im Fachbereich Werkstofftechnik. Sie mochte ihn wegen seines hintergründigen Humors, aber auch, weil er nochziemlich jung war und perfekt tanzen konnte. Der Flirt mit ihm auf Vaters Geburtstagsparty vor zwei Jahren kam ihr wieder in den Sinn. Oder war es schon drei Jahre her? Jedenfalls hatte damals nicht mehr viel gefehlt und es wäre mehr daraus geworden.
„Ellen Ackermann? - Ich denke, du bist in Paris“, sagte Trotta überrascht, als er neben ihr angekommen war. Ohne ihre Antwort abzuwarten, wandte er sich an den Polizisten: „War das denn nötig? Die junge Dame derart ...?“
„Ich mache hier meine Arbeit“, unterbrach der ärgerlich. „Gaffer haben hier nun mal nichts verloren.“
Arnulf Trotta legte seinen Arm über Ellens Schulter und drehte sie von dem Polizisten weg.
„Ich kenne die Dame“, sagte er. „Ich kümmere mich um sie.“
Sie ließen den Polizisten stehen. Ellen wischte sich mit dem Ärmel die restlichen Tränen aus dem Gesicht. „Danke“, sagte sie nach einigen Schritten. „Du weißt das vielleicht noch nicht. In Paris habe ich abgeschlossen. Aber, was wichtiger ist: Wo ist Vater? Ist er verletzt?“
Trotta hüstelte verlegen, während sie weitergingen.
„Berthold lebt, aber ich glaube, es hat ihn ziemlich ...“ Trotta machte eine Pause, blieb stehen. „Er war gerade auf der Bühne angekommen, als der Sprengstoff detonierte. Das Rednerpult, du kennst ja dieses riesige Holzding, das hat ihn vor dem Schlimmsten bewahrt, obwohl er am Ende darunter lag und fast verbrannt wäre.“
„Hatte er Schmerzen? Hat er was gesagt? Hat er ...“
„Kollege Derscheid und ich fanden ihn zum Glück früh genug.“ Trotta schluckte. „Er war bewusstlos. Der Notarzt und die Sanitäter haben ihn als einen der Ersten versorgt und abtransportiert.“
„Wohin?“
„Deshalb war ich bei der Einsatzleitung. Auf den Listen dort finden sie seinen Namen nicht.“
„Irgendwo müssen die ihn aber doch hingebracht haben.“
Er versuchte sie zu beruhigen: „Es könnte sein, dass er wegen seiner Brandwunden mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Ins Ruhrgebiet.“
„Brandwunden? - Sag die Wahrheit!“
„Dein Vater ist ein zäher Bursche.“
*
Die Cafeteria lag im hinteren Gebäudekomplex der Hochschule, weit genug außerhalb der Gefahrenzone. Deshalb war hier eine Sammelstelle für die Mitarbeiter und Angehörigen eingerichtet worden. In dem Seminarraum gleich nebenan war das notdürftig ausgestattete Pressezentrum. Hier herrschte Hektik, hier wurde geraucht, gerufen, gefrotzelt, in Diktiergeräte gesprochen; hier wurden mit flinken Fingern die neuesten Erkenntnisse in Laptops gehackt. Einige Reporter hatten sogar die kleinen Schüsseln ihrer Satellitentelefone in die geöffneten Fenster gehängt. Sie mussten sie abnehmen und die Fenster schließen, denn der Wind schlug um und wehte Rauchschwaden herein.
Als Ellen und Trotta den Raum betraten, wurde sie von einer gestressten Frau mit Pflasterstreifen im Gesicht und verrußten Haaren begrüßt. Ihr langer schwarzer Rock war am Saum voller Brandflecken und die Bluse übersät mit winzigen Löchern. Ellen schätzte die Frau auf Mitte dreißig.
„Kennen Sie sich?“, fragte Trotta und zeigte auf seine Begleiterin.
„Sie könnten Ellen Ackermann sein“, sagte die Frau. „Ihr Vater hat mir kürzlich voller Stolz ein Foto gezeigt.“
„Dann sind Sie Frau Gödeler, die Pressesprecherin der Hochschule“, erwiderte Ellen und reichte ihr die Hand. „Vater hat einige Male erzählt, wie professionell Sie seine internationalen Kongresse organisiert haben.“
„Nennen sie mich Anke“, sagte sie und lächelte zum ersten Mal. „Sie suchen Ihren Vater, nicht?“
„Haben Sie eine Ahnung, in welche Klinik man ihn transportiert hat?“, hakte Trotta nach. „Auf den Listen der Einsatzleitung steht er nämlich nicht.“
„In die Städtische nehme ich an. Da sind fast alle ersten Fahrten hingegangen. Ich frage mal nach.“
Anke Gödeler nahm ihr Handy. Die Nummer der Klinik hatte sie inzwischen gespeichert. „Die Notaufnahme bitte“, sagte sie und fügte an die beiden gerichtet hinzu: „Das werden wir gleich wissen.“ Und nach einer kleinen Pause: „Ja, Anke Gödeler noch mal. Sagen Sie bitte, ist bei Ihnen auch unser Vizepräsident, Professor Ackermann, eingetroffen? - Ja? - Berthold Ackermann.“ Kurze Pause. „Oh, prima. Welche Zimmernummer? - Danke.“ Sie beendete das Gespräch und sagte stolz: „Volltreffer! Er liegt im Aufwachraum. Wird voraussichtlich gegen fünfzehn Uhr ins Zimmer A-137 verlegt.“
„Gott sei Dank!“, entfuhr es Ellen. „Wir haben ihn!“
„Der Präsident liegt übrigens gleich nebenan“, sagte Frau Gödeler zu Trotta. „Mit einem Sicherheitsbeamten vor der Tür. Anordnung der Polizei, solange die Hintergründe des Anschlags nicht klar sind.“
„Weiß man denn schon was?“, fragte Trotta. „Gibt´s Hinweise, Anhaltspunkte?“
„Nichts Genaues. Wegen Professor Scantleburys Tod ist die IRA im Verdacht. Der soll in London kürzlich eine heftige Presseattacke gegen die losgetreten haben. Logistisches Aushungern muss er gefordert haben, oder so ähnlich. Mehrere Morddrohungen sollen die Folge gewesen sein. Aber das macht alles keinen Sinn. Warum ausgerechnet hier?“
„Und Mühlenhofen? Weiß man schon, warum der Präsident kurz vor Beginn des Festaktes genau vor seiner Haustür verunglückte? Da ist doch etwas faul.“
Ellen bemerkte, dass sie die ganze Zeit schon von einer Frau in hautenger Jeans und einem dunkelblauen Rollkragenpullover beobachtet wurde. Die stand jetzt auf und kam auf sie zu.
„Verzeihung, Samantha Smits vom BRANDPUNT“, sagte sie mit niederländischem Akzent. „Respektive der deutschen Ausgabe, dem BRENNPUNKT. Sie wissen? Die neue europäische Konkurrenz von SPIEGEL und FOCUS. Ich unterbreche Sie nur ungern. Aber zufällig habe ich mitbekommen, dass Ihr Vater und Herr Mühlenhofen im selben Krankenhaus liegen?“ Und zu Ellen gewandt ergänzte sie: „Ich will da jetzt hinfahren. Wenn Sie möchten, nehme ich Sie mit.“
Anke Gödeler reagierte mürrisch. Ellen sah nur die Chance, möglichst schnell zu ihrem Vater zu kommen. „Danke“, sagte sie. „Das Angebot nehme ich gern an“.
Während die Journalistin zu ihrem Tisch zurücklief, eilig den Laptop und die übrigen Unterlagen zusammenpackte, bedankte sich Ellen bei Arnulf Trotta und Anke Gödeler. Sie hatte jetzt nur eines im Sinn: die Klinik und ihren Vater!
„Sensationspresse!“, entfuhr es Anke Gödeler.
Trotta grinste.
„Lachen Sie ruhig.“ Sie griff zum Handy. „Ich werde Mühlenhofen warnen vor dieser Frau.“
*
Berthold Ackermann lag auf dem Rücken. Er atmete unregelmäßig. Links neben ihm hing ein Glasbehälter an einer Stange. Daraus tropfte Nährlösung in einen durchsichtigen Plastikschlauch und lief von dort weiter bis zu einer Kanüle, die an seinem Handrücken mit Heftpflaster festgeklebt war. Von seiner Brust führte ein Bündel farbiger Drähte in mehrere Geräte am Kopfende des Bettes. Aus winzigen Lautsprechern ertönte rhythmisches Piepen, und in kleinen Monitoren bewegten sich im gleichen Takt Zacken und Kurven auf und ab. Bertholds rechter Arm ruhte angewinkelt in einem Schienenverband auf dem Bauch, er hob und senkte sich im Rhythmus der Atemzüge. Am Fußende hatten die Pfleger aus rundgebogenen Stäben und Verbandmaterial eine Art Tunnel gebaut, zum Schutz des rechten Fußes vor dem Druck der Bettdecke.
Ellen hatte sich einen Stuhl neben das Krankenbett gezogen. Sie saß darauf schon eine ganze Weile, streichelte nachdenklich die linke Hand ihres Vaters.
„Die Brandwunden bereiten uns die größten Sorgen“, hatte der Chefarzt bei seinem letzten Kontrollgang gesagt, vor einer viertel Stunde etwa. „Um den Knöchel herum, wo die Strümpfe saßen, da sind stellenweise Verbrennungen zweiten Grades, und die Ferse und die Fußunterseite sehen auch nicht gut aus. Kann sein, dass da eine Hauttransplantation erforderlich wird. Langwierige Geschichte, erfahrungsgemäß.“
„Und der rechte Arm?“, hatte Ellen gefragt.
„Gebrochen, am Oberarmknochen. Aber den konnten wir leicht richten.“
„Und wie schlimm sind die übrigen Verletzungen?“
„Abgesehen von den Prellungen und Schürfwunden an Kopf, Hüfte und am Oberschenkel sind noch zwei Rippen angebrochen, auf der rechten Seite. Ziemlich schmerzhaft und kann dauern.“
„Ist das nicht gefährlich?“
„Nein. Da können sie beruhigt sein, Frau Ackermann. Problematisch sind, wie schon gesagt, die Verbrennungen. Damit ist nicht zu spaßen. Wegen der Belastung des Kreislaufs, besonders aber wegen der Infektionsgefahr. Die kann man selbst bei größter Sorgfalt niemals völlig auschließen.“
Ellen streichelte noch einmal über die Hand. Dann stand sie auf, ging ein paar Schritte und blieb am Fenster stehen. Sie stützte sich mit den Händen auf die Fensterbank. Ihr Blick streifte über die bräunlichen Weideflächen, die sanft ins Tal abfielen und am Horizont wieder aufwärts in niedrige Hecken, Buschgruppen und bewaldete Hügel übergingen. Rechts erkannte sie die flachen Gebäude des Flugplatzes Atterheide. Über allem schwebten dichte graue Wolken. Es regnete leicht.
Sie setzte sich auf die Fensterbank und betrachtete ihren Vater. Schade, dachte sie. Auf den Hochschulball heute Abend hatte ich mich so gefreut. Einmal wieder mit ihm tanzen, so richtig ausgiebig wie damals, vor sechs Jahren. Ob er das mit seinem Fuß jemals wieder kann?
Erinnerungen an den Abiturball 1989 stiegen in ihr hoch: Übermütig und ausdauernd hatten wir getanzt. Tango, Quick-Stepp, Jive, Wiener Walzer. Er beherrschte das meisterhaft. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl: Jetzt hat er akzeptiert, dass seine Tochter erwachsen ist. Endlich! Bis in die Nacht hinein haben wir einen Schlussstrich unter die Kindheit getanzt. Eine katastrophale Kindheit. Ja, so habe ich die letzten Jahre empfunden. Eine Kette endloser Kleinkriege. Und alles nur, weil ihn immer diese gottverdammte Angst übermannte, seine Tochter könnte wegen ihrer „Jungensgeschichten“ oder „Affären“ durchs Abitur fallen – und vielleicht so werden wie die Mutter.
Erst das Archäologiestudium in Freiburg und später die Zeit in Saarbrücken, der räumliche Abstand, das Sich-nicht-ständig-beobachtet-Fühlen: Das hat unser Verhältnis nach und nach entkrampft.
Ellen horchte auf. Vor der Tür des Krankenzimmers hörte sie Schritte. Ein Mann und eine Frau schienen sich zu streiten. Dann öffnete sich die Tür und Samantha Smits kam mit hochrotem Kopf herein, zischte dem Sicherheitsbeamten eine unverständliche Bemerkung zu und versuchte, die Tür wieder zu schließen. Gegen ihn hatte sie aber keine Chance. Ein Ruck, die Tür flog auf und schon hatte er Samantha im Polizeigriff. Sie schrie vor Schmerz kurz auf.
Ellen sprang von der Fensterbank. „Sind denn heute alle übergeschnappt? Wollen Sie, dass mein Vater durch dieses Getue aufgeweckt wird?“
„Tschuldigung“, sagte der Beamte. „Aber ich habe strengste Anwei ...“
„Schon gut“, unterbrach Ellen. „Sie können loslassen. Ich kenne diese Journalistin.“
Der Mann zuckte mit den Schultern, ließ Samantha los und schlurfte betont langsam aus dem Zimmer. Die Tür ließ er einen Spalt offen.
„Danke, Ellen“, sagte Samantha Smits. „Ich darf doch Ellen zu Ihnen sagen. Oder?“
„War das denn nötig? Sie sehen doch, dass mein Vater Ruhe braucht.“
Samantha kramte in ihrer Umhängetasche. Dann hatte sie plötzlich eine Kamera in der Hand und schritt auf das Bett zu.
„Die stecken Sie mal schnell wieder weg!“ Ellens Stimme klang verärgert. „Keine Fotos!“
„Aber ich brauche ein Bild. Text und Bild zusammen vermitteln dem Leser erst einen anschaulichen Gesamteindruck.“
„Glauben Sie im Ernst, bei dem Kopfverband erkennt irgendeiner Ihrer Leser meinen Vater wieder? Ich bitte Sie.“
„Ich brauche aber ein Bild. Möglichst authentisch.“
Ellen sah, wie die graugrünen Augen in dem winterurlaubsgebräunten Gesicht listig leuchteten. Die wird garantiert nicht locker lassen.
„Unsere Leser haben ein Recht auf anschauliche Darstellung“, setzte Samantha nach. „Das erwarten die. Das ist unser Markenzeichen. Und ein bisschen Entgegenkommen ihrerseits ....- schließlich habe ich Sie hier hergefahren.“
„Wissen Sie was, Frau Smits? Mein Vater hat auch ein Recht auf Ruhe und Genesung!“ Sie drehte sich um, ging zum Garderobenhaken, suchte nach etwas in ihrer Handtasche, zog ein Passbild heraus und hielt es Samantha hin. „Das ist wenigstens ein Bild mit Wiedererkennungswert“, fügte sie hinzu. „Nehmen Sie es. Und dann gehen Sie. Bitte!“
Ellens Handbewegung war eindeutig. Sie zog die Tür so weit auf, dass der Sicherheitsbeamte die Situation unmissverständlich erkennen konnte.
„Schade“, sagte Samantha, „aber wenn Ihr Vater selbst wieder Entscheidungen treffen kann, komme ich zurück. Verlassen Sie sich drauf. Immerhin hat er mir vor dem Festakt ein ausführliches Interview versprochen.“ Mit blitzenden Augen rauschte sie an Ellen vorbei auf den Flur.
Dort wurde es erneut laut. Ellen sah, wie vom hinteren Ende des Ganges eine ganze Gruppe Journalisten heranstürmte. Sie umschwärmten mit ihren Kameras und Mikrofonen einen breitschultrigen, hochgewachsenen Mann. Samantha zögerte nur kurz, dann schloss sie sich dieser Gruppe an und kam zurück. Der Sicherheitsbeamte erhob sich von seinem Stuhl und stellte sich breitbeinig in den Weg.
„Hauptkommissar Brockschmidt vom BKA“, sagte der Mann und streckte ihm einen Dienstausweis entgegen.
Auch das noch! Ellen schob die Tür zu und lehnte sich für einen Augenblick von innen dagegen. Sie atmete erst erleichtert auf, als sie hörte, dass der Hauptkommissar nach Professor Mühlenhofen fragte und sich dessen Zimmer zeigen ließ. Der Lärm auf dem Flur ebbte ab.
Langsam ging sie zu dem Stuhl neben dem Krankenbett, setzte sich und nahm vorsichtig die Hand ihres Vaters. Dabei fiel ihr auf, dass er unruhiger atmete. Auch das Piepen aus den Lautsprechern klang nicht mehr so gleichmäßig. Die Kurven auf den Monitoren verschoben sich, wurden flacher, dann wieder steiler. Berthold öffnete die Augen, schaute verstört hin und her, versuchte sich aufzurichten, sank aber unter lautem Stöhnen sofort zurück aufs Kissen.
„Bleib ruhig liegen“, sagte Ellen und streichelte über sein Gesicht.
„Wo bin ich?“ Berthold starrte seine Tochter mit weit geöffneten Augen an. „Wo ist mein Spickzettel für die Rede?“
Ellen versuchte ihn zu beruhigen, zog den Stuhl näher ans Bett und erzählte ihm, was sie von Trotta, Anke Gödeler und den Ärzten erfahren hatte. Nur, dass Professor Scantlebury tot war, behielt sie für sich. Die beiden kannten sich gut. Das wusste sie, und möglicherweise würde ihn diese Nachricht im Augenblick zu sehr belasten. Als sie ansetzte, ihm von dieser aufdringlichen Journalistin Samantha Smits zu erzählen, klopfte es. Hauptkommissar Brockschmidt stand im Türrahmen.
„Darf ich?“, fragte er leise. „Ich hab ein paar Fragen. Aber nur, wenn´s wirklich schon geht.“
Er kam näher an das Bett. „Guten Tag, Herr Professor. Ich bin Hauptkommissar Brockschmidt vom Bundeskriminalamt.“
„BKA?“, fragte Berthold. „Was wollen Sie denn von mir?“
„Wissen Sie, Herr Professor, bei Anschlägen mit terroristischem Hintergrund, bei Industriespionage, Wirtschaftskriminalität größeren Ausmaßes, werden wir automatisch ...“
„Terroristischer Hintergrund?“, unterbrach Berthold. Das Sprechen fiel ihm schwer. Ellen beobachtete mit wachsender Sorge, wie sich die Kurven auf den Monitoren veränderten.
„Alles noch Vermutungen, Herr Professor“, antwortete Brockschmidt. „Im Augenblick jedenfalls. Kann auch ein durchgeknallter Einzeltäter gewesen sein. Vielleicht ein Anschlag auf den Bischof von Osnabrück, auf Konsul Leberecht, die anwesende Politprominenz. Die ganze erste Reihe in der Aula hat was abgekriegt.“
„Und Mühlenhofen?“, fragte Berthold. „Eigentlich hätte der Präsident auf der Bühne gestanden. Ich musste doch nur als Vize für ihn einspringen. Völlig überraschend.“
„Das haben wir uns auch schon gefragt.“ Brockschmidt nickte mit dem Kopf. „Denn genau neben dem Rednerpult, da hat er gestanden, dieser verflixte Overhead-Projektor. Da war der Sprengstoff drin. So viel ist sicher.“
„Der Overhead ...!“ Es klang wie der Schrei eines Menschen, dem die Kehle zugedrückt wird. Ellen erschrak.
„Und genau die Stange von diesem Dingsda“, hört sie Brockschmidt weitersprechen, „die Stange, wo der Spiegel und die Linse oben dran befestigt sind. Die hat sich mit voller Wucht in den Kopf dieses britischen Professors gebohrt, der auch in der ersten Reihe saß. Zum Glück war der Herr Scantlebury, oder so ähnlich, sofort tot. Er hat nicht viel davon gemerkt.“
„Waas?“ Berthold bäumte sich auf. „Bryan ist tooot?“ Dann sackte er mit weit aufgerissenen Augen zurück in die Kissen.
Das Piepen der Lautsprecher wurde schneller, immer schneller, dann plötzlich langsam. Die gezackten Kurven auf den Monitoren wurden runder, hügeliger, flacher und ähnelten schon fast einem waagerechten Strich. Aus dem Lautsprecher kam ein lang gezogener, schriller Ton.
Ellen sprang auf.
„Das hätten Sie jetzt nicht sagen dürfen!“, raunzte sie den Hauptkommissar an. Sie riss die Tür auf und schrie verzweifelt in den Flur: „Hilfe! Mein Vater stirbt!“
Kapitel 2
Er schwankte, hielt sich am Treppengeländer fest, blieb stehen, verschnaufte einen Augenblick.
„Keine Müdigkeit, Jenosse Brandes“, trieb er sich wieder an und nahm die letzten Stufen. Als er das Schlüsselloch der Korridortür auf Anhieb traf, schwärmte er: „Siehste, jeht doch. Det Bier im Tacheles is nun mal det beste Sszielwasser.“
Beim Öffnen der Tür entglitt ihm die Tüte, die er die ganze Zeit wie ein Kellner auf der linken Hand balanciert hatte. Erst kurz über dem Boden fing er sie wieder auf. „Det ma bloß nix an die Currywurst kommt.“ Er lachte dabei übertrieben.
Mit zu viel Schwung erreichte er das Arbeitszimmer und stieß dort gegen den Schreibtisch. Die Tüte fiel auf die Platte, riss an der Seite auf. Eine Wurstscheibe rollte heraus, zog in Schlangenlinien eine rote Spur. Brandes kicherte, ging weiter, knipste den Fernsehapparat an, zog sich im Zurückgehen umständlich den Mantel aus, wankte zur Korridortür, stieß sie mit dem Fuß zu und warf den Mantel über den Garderobenständer. Der schwankte ihm entgegen. Er fing ihn auf und drohte mit erhobenem Zeigefinger: „Wer hat hier zu viel jesoffen? Du oder icke?“ Er stellte ihn gerade und schlich an der Wand entlang in die Küche. „Muss noch ´n Bier, damit die Pommes besser flutschen.“ Ein kräftiger Rülpser beendete den Satz.
Es dauerte eine Weile, bis er mit Besteck und geöffneter Bierflasche an seinen Schreibtisch zurückkehrte und das verspätete Abendessen anfangen konnte. Inzwischen hatte im Fernsehen das Nachtmagazin angefangen. Ein Filmbericht aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok flimmerte über den Bildschirm. Im Vorfeld des Europa-Asien-Gipfels seien Bundeskanzler Helmut Kohl und Chinas Premierminister Li Peng zusammengetroffen, um über den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zu beraten, erläuterte der Nachrichtensprecher.
„Kiek mal, der Helmut“, lachte er und zeigte mit einigen aufgespießten Pommes frites in Richtung Fernseher, „da strahlt er und schüttelt dem alten Peng die Hand. Und hier bei uns, da kiekt er immer muffig und meckert über die roten Socken.“ Ein Rülpser setzte erneut den Schlussakkord.
Das Thema wechselte. Ein Bild von Konrad Porzner wurde eingeblendet. Wegen Unstimmigkeiten mit dem Kanzleramt habe der Chef des Bundesnachrichtendienstes die Versetzung in den Ruhestand beantragt, und Bundespräsident Roman Herzog habe auf Anraten des Kanzleramtsministers Bohl bereits dem Wunsche Porzners entsprochen.
„Schade“, kommentierte Brandes und spülte sich mit einem kräftigen Schluck aus der Bierflasche den Mund leer. „Die nennen den alle den Glülücklosen von Pullach. Dabei war det echt ´n Glücksfall - für uns, zssumindest. Prost Konni!“
Die nächste Meldung ließ ihn aufhorchen:
„Osnabrück. Heute Vormittag ist es während einer akademischen Feierstunde in der Fachhochschule Osnabrück zu einem Sprengstoffanschlag gekommen. Es gab einen Toten und zahlreiche Verletzte. Sehen sie hierzu einen Bericht unseres Reporters Gerhard Wunse.“
Die Kamera schwenkte über die Dächer Osnabrücks mit der Katharinenkirche, dem Dom, der Marienkirche, den Windrädern auf dem Piesberg und blieb einen Augenblick auf die Rauchsäule gerichtet, die über den Hochschulgebäuden am Westerberg schwebte. Schnitt.
Es folgte ein Interview mit einem Polizeisprecher. Im Hintergrund hektisches Treiben und laute Geräusche von Löschfahrzeugen und Notstromaggregaten.
Der Sprecher erläuterte, dass es sich bei dem Toten um den britischen Professor Bryan Scantlebury handeln würde, einen international renommierten Wirtschaftswissenschaftler, der während des heutigen Festaktes wegen seiner Verdienste für die Entwicklung deutsch-britischer Studienangebote zum Ehrensenator ernannt werden sollte. „Da er kürzlich wegen eines Zeitungsartikels gegen den Terror in Nordirland in die Schusslinie der Irisch-Republikanischen-Armee geraten war, ist nicht auszuschließen, dass die Bombe auf das Konto dieser Terrororganisation geht.“
Nun wurden kurze Ausschnitte aus einem Amateurvideo eingeblendet: die Reihe der Ehrengäste in der Aula, die festlich geschmückte Bühne, Professor Scantlebury im Gespräch mit Berthold Ackermann. Dazu der Kommentator:
„Professor Ackermann, der Vizepräsident der Hochschule, wurde bei diesem Anschlag schwer verletzt. Die Bombe explodierte in dem Augenblick, als er die Bühne betrat, um die Festveranstaltung offiziell zu eröffnen. Seit den Abendstunden wird vermutet, dass der Anschlag eventuellauch im Zusammenhang mit Ackermanns Forschungsarbeiten stehen könnte. Die von ihm neu entwickelte Keramikbeschichtung in Flugzeugturbinen ist nämlich für den britischen Triebwerkhersteller Rolls-Royce ...“
Brandes sprang auf. „Welcher verdammte Idiot war das?“
Er trat gegen den Schreibtischsessel, stolperte fluchend in die Küche, riss die Kühlschranktür auf und fing an, zwischen Käsetüten, Aufschnittpäckchen und Jogurtbechern aufgeregt nach etwas zu suchen: eine Flasche Wodka! Er hatte sie selbst versteckt. Im Eisfach, ganz hinten.
Hastig schraubte er den Verschluss ab und goss den kalten Schnaps in sich hinein, als könnte er nur so das krampfartige Reißen in seiner Brust betäuben. Im Hintergrund war noch die Stimme des Reporters zu hören. Er berichtete von zahlreichen Prominenten mit erheblichen Verletzungen; darunter der Bischof von Osnabrück, der Oppositionsführer des niedersächsischen Landtages und der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung.
Brandes schluckte weiter. Seine Finger schmerzten von der Eiskruste an der Flasche. Er schluckte, schluckte - und setzte die Flasche erst ab, als die Kälte ihm die Kehle zuschnürte. Hustend hielt er sich am Kühlschrank fest, knallte die Flasche auf die Ablage. In seinem Magen rumorte es. Er musste würgen, rannte los in Richtung Toilette, blieb mit der Schulter am Türrahmen hängen, fluchte, löste sich wieder, stolperte weiter. Sein Gesicht: eine Grimasse.
*
Brandes saß aufrecht im Bett, rieb sich die Augen, wischte mit dem Hemdsärmel über die Stirn. Sein Herz jagte. Ein Schrei hallte in seinen Ohren, verzerrt, wie aus einem vorbei rasenden Zug. Er hatte sich angehört wie „Rache!“
Die blassrosa Leuchtreklame von der anderen Straßenseite warf flackrige Schatten an die Wand. Dazwischen entdeckte er, wenn auch nur verschwommen, die kleine minoische Doppelaxt, den vertrauten Kalender mit den farbigen Steckwürfeln und daneben das silberfarbige Holzbrett mit der Collage aus aufgeklebten Dioden, Transistoren, Widerständen und bizarr verwinkelten Drähten: Erinnerungsstücke aus vergangenen Zeiten, wie sie nur in seinem Zimmer, dem Kombizimmer, hängen konnten. Das beruhigte ihn.
Er rutschte auf die Bettkante, stemmte sich hoch und schlurfte zur Toilette. „Wieso muss ich nachts eigentlich mehr unten rauspissen, als ich tagsüber oben reinschütte?“, schimpfte er. „Fehlkonstruktion - verdammte!“
Erst als er wieder den Weg zurück auf den Rand seines Bettes gefunden hatte und diese stechenden Schmerzen im Nacken und am Hinterkopf spürte, ahnte er, dass er nach dem Zusammentreffen mit Stachynskij noch in mehreren Kneipen heftig zugelangt haben musste. Der faulige Geschmack im Mund und der Geruch, der nach jedem Aufstoßen in die Nase strömte, waren weitere Indizien.
„Und wie bin ich nach Hause gekommen? Weshalb hab ich noch Schuhe an? Und det Hemd? Und die Hose?“
Er versuchte sich zu erinnern, krampfhaft. Aber da war nichts! Kein noch so kleiner Gedankenzipfel. Nur dumpfe Leere im Kopf und diese entsetzlichen Schmerzen; sie kamen und vergingen im Rhythmus des Pulsschlages.
Drei Uhr sieben zeigte der Radiowecker mit roten Leuchtziffern. Zu früh, um aufzustehen.
Brandes zog sich im Sitzen aus, schob die Beine unter die Bettdecke. Mit den Händen massierte er Hals und Schultern. Dadurch wurden die Schmerzen erträglicher. Sein Blick streifte über die Wand und blieb auf dem Kalender mit den Steckwürfeln hängen.
Stiepnaya! Wie ein Geschoss bohrte sich dieses Wort durch sein Gehirn. Selbst in der kasachischen Steppe ist er mir in die Quere gekommen: dieser gottverdammte Ackermann!
Stiepnaya! Die große Hoffnung nach der Flucht aus Bad Ems 1973 und dem Scheitern im amerikanischen Hartford einige Jahre später.
„Für die BRD und die USA bist du verbrannt“, hatte Oberst Warnke im Ministerium für Staatssicherheit gesagt, damals, so im Frühjahr 79 muss das gewesen sein. „Aber die Jenossen vom KGB schätzen deine besonderen Fähigkeiten. Immer noch. Sie wollen dich in der Stiepnaya für Italien präparieren. Siehst ja schließlich aus wie ein Italiener. Oder?“
Brandes legte sich auf den Rücken, zog die Decke langsam bis unters Kinn und starrte auf die Wand.
Stiepnaya! Wo war die eigentlich? Wo genau?
Er erinnerte sich dunkel an eine Akte. Während seiner Zeit bei der Schule für Nachrichtenwesen in Bad Ems hatte er sie wegen einer kleinen Unachtsamkeit des Verschlusssachenverwalters kurz durchblättern können. Als Fabrik für russische Spione in den romanisch sprechenden Ländern wurde sie darin beschrieben und an der nördlichen Grenze Kasachstans vermutet, in der Nähe von Schkalow. Er erinnerte sich auch an Zeichnungen mit den verschiedenen hermetisch abgeschirmten Sektionen innerhalb des riesigen Areals: für Frankreich im nordwestlichen Teil, Spanien im Norden, Italien im Nordosten und für Portugal, Brasilien, Argentinien, Mexiko im Süden.
Ähnliche Einrichtungen gab es, so hatte er gelesen, auch für andere Sprachregionen. Die Prakowka, zum Beispiel, für Deutschland und für die nordeuropäischen Länder. Sie lag bei Minsk.
Alle waren sie nach dem Vorbild der Gatschina aufgebaut. Über die Gatschina bei Kuibyschew gab es reichlich Material. Sie war die berühmteste dieser Art, speziell für die Agenten in den englischsprachigen Ländern: eine fast naturgetreue Nachbildung städtischen und dörflichen Lebens mit Kneipen, Friseur und allem, was dazugehört. Zehn Jahre dauerte das Training in der Gatschina. Zehn Jahre Leben mit englischem Namen unter englischen Verhältnissen, oder amerikanischen. Meisterspione wie Gordon Lonsdale, Reginald Kenneth Osborne oder Geoffrey Nobel hatten dort ihre Ausbildung erhalten. Niemand wollte nach ihrer Enttarnung glauben, dass sie in Wahrheit Russen waren.
Stiepnaya! Eine Ausnahme für jemanden, der kein Bürger der Sowjetunion war. Eine seltene Ausnahme. Zumal die jungen russischen Agenten, selbst nachdem sie die Marx-Engels-Schule in Gorkij und anschließend die weiteren Etappen in Moskau und Werchownoje absolviert hatten, nicht im Geringsten etwas von der Existenz der Gatschina, Stiepnaya oder Prakowka ahnten. Ein Schauer kroch über seinen Rücken.
*
„Ich hoffe, du bist dir der jroßen Ehre bewusst, Jenosse Brandes“, hatte mich Oberst Warnke damals verabschiedet und mir noch den Satz nachgerufen: „Wolf und Mielke erwarten von dir, dass du unsere Sache würdig vertrittst. Also, keine Weibergeschichten diesmal! Hörst du?“ Und noch etwas vom „Sieg des Sozialismus“ flatterte hinterher. Aber das war irgendwie untergegangen, im Echo des langen Flurs.
Dann dieser Schock, unterwegs, im Bahnhof von Kuibyschew. Ich sehe es wieder deutlich, spüre es in den Muskeln, den Knochen, wie sie mich einem Schwerverbrecher gleich aus dem Zug gerissen, in einem abgedunkelten Wagen auf holprigen Wegen stundenlang umhergefahren und anschließend in eine feuchte, stinkende Zelle geschubst haben. Ohne irgendein Wort.
Ich weiß nicht mehr so genau, wie lange ich darin gestanden oder gelegen habe. Aber dieser Gestank von Urin und Angstschweiß, der steigt wieder in die Nase. Und dieser Ekel, der immer aufkam, wenn ich mich vor lauter Erschöpfung nicht mehr auf den Beinen halten konnte und im Halbschlaf auf diese widerliche Matratze plumpste. Oder wie ich in dem Verhörraum stehen musste, bewegungslos, mit dem Gesicht zur Wand ...
*
„Hände in den Nacken!“, höre ich eine Stimme im Hintergrund, in beinahe akzentfreiem Deutsch, unüberhörbar roh und mit sadistischem Unterton. Immer wieder peitscht dieser Satz durch die Stille, bei jeder kleinen Regung. Der Schmerz in der Schulter nimmt zu. Arme, Beine, Füße werden von Minute zu Minute schwerer. Jeder Teil des Körpers, jedes noch so kleine Fingerglied fühlt sich an, als würden Tonnen voller Müdigkeit daran hängen.
Eine Verwechslung? Ich hab Angst um mein Leben. Alle guten Worte sind bisher abgeprallt. Die russischen Wachposten wechseln ständig.
Kalter Schweiß bricht aus den Poren, lässt die Haut immer unerträglicher jucken. Als ich mich kratze, nur ein bisschen, obwohl mir danach ist, als müsste ich den ganzen Leib mit einer Drahtbürste abschrubben, schreit die Stimme wieder: „Hände in den Nacken!“
Es fällt zunehmend schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Ich schwanke.
„Bleib stehen! Gerade!“ Und nach einiger Zeit wieder: „Hände in den Nacken!“
Stundenlang zieht sich dieses Ritual hin. Ich wundere mich, wie lange man so etwas aushält. Obwohl ich vergleichbare Methoden von der Stasi-Ausbildung kenne. Mit Händen im Nacken bewegungslos stehen, das weicht unwillkürlich die Widerstandskraft auf. Bei dem einen früher, bei dem anderen etwas später. Aber sie weicht auf.
Ist diese Tortur etwa nur eine dieser gar nicht so seltenen Scheinverhaftungen? Ich habe zumindest davon gelesen. Will der KGB sich, wie bei anderen erstaunten Geheimdienstanwärtern, nur von meiner Standfestigkeit überzeugen?
„Halt durch, Junge!“, befehl ich mir. „Lass dir nichts anmerken!“
Und wieder bewegt sich der Zeiger der inneren Uhr ein bisschen weiter.
Dann höre ich plötzlich ein sattes Klicken, wie bei einem Revolverhahn, der nach hinten gezogen wird und einrastet. Schweiß bricht aus. Ich zucke zusammen, als ein kaltes Metallstück meinen Hinterkopf berührt. Ich bin nicht mehr in der Lage mich zu wehren. Dabei hätte ich doch nur mit den Händen ...
*
Jetzt sitze ich einer jungen Frau gegenüber, einer Frau in der Uniform eines russischen Oberleutnants. Sie lächelt.
„Du weißt, warum wir dich verhaften mussten?“ Ihre Stimme klingt einschmeichelnd. Wo habe ich diese weiche Aussprache, dieses sanft rollende russische „R“, schon einmal gehört?
„Nein“, antworte ich. Die Grundregeln über das Verhalten im Verhör! Und überhaupt: Wachsam sein - immerzu!
„Soll ich dir ein Stichwort geben?“
Ich schweige. Nur mit Mühe kann ich mich auf dem Stuhl gerade halten.
„Nun gut, Genosse.“ Die Stimme wird eine Kleinigkeit härter. „Denk mal an die Zeit in Bad Ems. Gute Berichte hast du damals aus der Schule für Nachrichtenwesen der Bundeswehr geliefert. Sehr gute, und viele Mosaiksteinchen, die uns vorher fehlten, um Struktur und Ausbildung beim Militärischen Abschirmdienst, dem Frontnachrichtendienst und den anderen Abwehreinrichtungen der westdeutschen Klassenfeinde und der NATO präziser einschätzen zu können. Wirklich, Towarischtsch, beeindruckende Arbeit aus der Höhle des Löwen.“
Sie schaut mich mit listigem Augenaufschlag an und beugt sich vor. „Aber was mich im Augenblick noch mehr beschäftigt, ist all das, was du uns nicht berichtet, - was du uns sozusagen verheimlicht hast.“
Ich starre mit unbewegter Mine auf die Akte auf ihrem Schreibtisch, bin hellwach.
„Du antwortest nicht?“ Ihre Stimme nimmt an Härte weiter zu. „Nun gut. Gisela Ackermann, geborene von Kanitz. Sagt dir der Name etwas?“
„Ja.“
„Hattest du mit ihr eine - wie sagt man doch? - Beziehung?“
„Ja.“
„Von wann bis wann?“
„Ist schon so lange her.“
„Erinnere dich!“
„Weiß nicht so genau.“
„Von 1967 bis zu ihrem Tod 1973!“, schreit sie mir ins Gesicht, wird dann aber wieder leiser. „Sechs Jahre waren das. Habt ihr miteinander geschlafen?“
„Gehört dazu, als Romeo.“
„Du wusstest, dass sie für die CIA arbeitet?“
Ich stutze einen Moment, dann frage ich zurück: „CIA?“
„Marco Brandes, der Meisterspion der DDR, bumst sechs Jahre lang eine CIA-Agentin und merkt das nicht?“ Ihre Stimme wird lauter. „Für wie dumm hältst du mich?“
„Militärischer Abschirmdienst“, sage ich knapp, „dafür hat sie vielleicht gearbeitet. Ihr Vater war Kommandeur der MAD-Lehrgruppe in Bad Ems.“
„Sie hat dich um den Finger gewickelt.“ Ihre Stimme schwillt wieder an. „Sie hat dich umgedreht, langsam aber sicher!“
Was wird hier gespielt? Ohne zu antworten, beobachte ich, wie sie aufsteht, meinen Stuhl mehrere Male schweigend umkreist und sich wieder hinsetzt.
„Gisela Ackermann“, fährt sie fort, „war verheiratet mit Dr. Berthold Ackermann. Und der war ihr Führungsoffizier, getarnt als Mitarbeiter des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz. Du hast das wirklich nicht gewusst?“
Ich bleibe stumm. Mein Gehirn arbeitet fieberhaft.
„Ihr habt beide mit ihr geschlafen? Abwechselnd? Oder sogar zusammen? Der flotte Dreier von der CIA?“
Perverse Sau!, denke ich. Wenn du wüsstest, wie sehr ich Gisela geliebt habe.
„Ihr habt sie zu Tode gefickt!“, schreit sie provozierend auf Russisch.
Ich springe hoch, klammere mich an der Stuhllehne fest und schreie erregt zurück: „Du hast kein Recht, sie in den Dreck zu ziehen! Du weißt überhaupt nicht, wovon du redest.“
“Und ob ich das weiß. Ich habe ihren Abschiedsbrief gelesen. Sie wusste nicht mehr ein noch aus, wusste nicht, wo sie eigentlich hingehört: zu dir, zu Ackermann, zu ihrem Vater, zur STASI, zur CIA, zum MAD. Und außerdem: Sie war schwanger!“
Ich falle auf den Stuhl zurück. Mein Atem wird flach, nervös.
„Ich lass dich jetzt allein“, sagt sie wieder in ruhigem Ton. „Auf dem Schreibtisch liegt ein Geständnis. Unterschreibe es. Lass dir Zeit, aber unterschreibe es.“
„Geständnis? Für was?“ Ich will aufspringen, sacke wieder zusammen. Kraftlos.
„Dass du die Stiepnaya ausspionieren sollst, für die CIA!“
„Ich?“
„Wer sechs Jahre so exzellent aus Bad Ems berichten kann, ist der ideale Kandidat für zehn Jahre exzellente Berichte aus der Stiepnaya. Oder?“
„Schwachsinn.“ Ich sage es leise, schüttele meinen Kopf.
„Unterschreibe, und ich lasse dich zurückreisen in die DDR. So als wäre überhaupt nichts weiter geschehen. - Andernfalls“, sie macht eine Pause. „Ach was! Du bist intelligent. Du wirst unterschreiben“.
Sie streichelt dabei über meine klebrigen Haare, merkwürdig liebevoll, und verlässt dann das Zimmer.
In meinem Kopf dreht sich alles. Gisela und Berthold? Beide Agenten der CIA? Unmöglich. Oder doch? Und Gisela. Schwanger. Von mir? Von Berthold? Bin ich am Ende wirklich schuld an ihrem Tod? Oder mitschuldig? Und Berthold, hat der mich damals vielleicht doch ans Messer geliefert? Nur um sich selbst und die CIA aus der Schusslinie zu bringen? Wieso konnte der so kurz nach Giselas Tod die Leitung dieser Forschungsgruppe bei Pratt & Whithney in den Staaten übernehmen?
Mir ist plötzlich, als würde ich vornüberstürzen, in einen Strudel, tiefer, immer tiefer.
*
„Hände in den Nacken!“
Ich zucke zusammen, stehe mit dem Gesicht zur Wand. Die Glieder sind schwer wie Blei. Sind das überhaupt meine Glieder, die ich da fühle? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nur, dass ich den Wisch nicht unterschrieben habe, das haftet noch in meinem Gedächtnis, verschwommen. Und dieser Rest an Erinnerung, der lässt mich hoffen.
Ich denke, also bin ich! So hatte es der berühmte Descartes gesagt, damals, im 17. Jahrhundert, auch wenn er dabei nicht mit dem Gesicht zur Wand stehen musste.
Ich lebe! Also bin ich. Aber wie lange noch?
Ich höre, wie sich eine Tür öffnet, jemand den Raum betritt, einige unverständliche Worte gewechselt werden, jemand den Raum verlässt. Dann ist es wieder still. Ich spüre aber, wie sich langsam und mit leisen Schritten jemand von hinten nähert. Eine Frau? Dieser Geruch?
Ich fühle eine warme Hand in meinem Nacken. Vorsichtig berührt sie mich, fast zärtlich. Eine zweite Hand legt sich auf meine Schulter. Ich werde herumgedreht und zu dem Stuhl vor dem Schreibtisch geführt. Mein Herz klopft und stolpert. So habe ich die Angst im Nacken noch nie erlebt. Ein Würgegriff, und ich hätte gewusst, woran ich bin. Aber so?
Gerade, als ich die verklebten Augen langsam öffnen will, um mich zu vergewissern, wer mir jetzt gegenübersitzt, blitzt eine Lampe auf und verdeckt alle Konturen. Von einer grellen Lichtwand werde ich geblendet.
„Los! Unterschreib endlich!“, schreit eine Frauenstimme, sie überschlägt sich fast dabei, aber das rollende „R“ verrät mir, dass ich richtig vermutet habe.
Ich gebe mir einen Ruck, atme tief ein, straffe den Oberkörper und die Bauchmuskulatur und sage kraftvoll und entschlossen: „Nein!“
„Unterschreibe!“
„Nein!.“
„Verdammt! Du sollst unterschreiben!“
„Ich denke nicht dran.“
„Du willst also nicht?“
„Nein!“
„Wirklich nicht?“
„Und wenn ihr mich unter Drogen setzt, oder was weiß ich noch für Schweinereien mit mir anstellt! - Nein!!“
Es ist einen Augenblick still in dem Raum, beängstigend still. Dann höre ich ein leises „Danke, das genügt.“
Was hat sie gesagt? Habe ich mich verhört? Ein neuer Trick? Eine neue Variante des Psychoterrors, dem ich schon seit etlichen Stunden - oder sind es schon Tage? - zu widersetzen versuche. Hat sie wirklich „Danke, das genügt.“ gesagt?
Ich horche in die Stille, höre nur das nervöse Klopfen in meinen Adern und wie meine Atemluft in unregelmäßigen Stößen durch die Nase strömt. Die Zeit dehnt sich wie ein Gummi.
Ich vernehme Schritte. Sie kommen von außerhalb. Die Geräusche werden lauter. Stimmen mischen sich darunter. Der grelle Scheinwerfer erlischt und die Deckenleuchte wird eingeschaltet. Eine Seitentür öffnet sich, mehrere Soldaten treten ein. Voran ein russischer General. Mit strahlendem Lachen, die Hände weit zur Begrüßung ausgestreckt, stürmt er auf mich zu, reißt mich vom Stuhl hoch und umarmt mich.
„Bravo!“, sagt er mit seiner sonoren Stimme. „Endlich kann ich unseren Ostberliner Meisterspion einmal persönlich in die Arme schließen.“
Der General trommelt dabei übermütig auf meinen Schultern herum. Als ich wieder frei atmen kann und auf dem Stuhl sitze, höre ich ihn sagen:
„Verzeih, lieber Freund, was wir dir so alles zugemutet haben. Das war gewiss nicht angenehm. Es hat auch mir in der Seele wehgetan. Und ganz besonders der Genossin Olga Werenskaja, die das Verhör leiten musste, obwohl - oder sagen wir: Gerade, weil sie dich wegen deiner grandiosen Arbeit in Bad Ems so verehrt. Es war notwendig, lieber Freund.“
Ich sehe die Augen der Frau, die jetzt neben dem Schreibtisch steht, ihre straffe, durchtrainierte Figur, die Offiziersuniform und den Stolz in ihrer aufrechten Haltung. Das passt überhaupt nicht zu ihrem weichen Blick. Die Worte „Danke, das genügt“ sind darin noch immer zu lesen.
„Ich bin Pjiotr Wassiljenko“, fährt der General fort und erklärt langatmig und umständlich, weshalb es notwendig war, mich vor der Weiterfahrt in die Stiepnaya dieser letzten Überprüfung zu unterziehen.
„Es gab Widerstand gegen deine Aufnahme in die Stiepnaya. Den konnten wir nur auf diesem Weg brechen, und es gab Leute, die der oft gerühmten Wunderwaffe aus der HVA misstrauten und deine Fehler in den Vordergrund spielten. Außerdem gibt es ein altes Sprichwort im KGB: Ein Agent lebt rund zehn Jahre. Du bist da schon weit drüber.“
Als müsse er sich für all das entschuldigen, drückt er dann mit blumigen Worten und weit ausholenden Gesten seine „große Freude über die beeindruckende Standfestigkeit in den Verhören“ aus. „Man kann nicht vorsichtig genug sein, mein Freund“, fügt er hinzu, „das verstehst du. Bist ja selbst Geheimdienstexperte. Und gerade, weil du so ein Experte bist und weil ich überzeugt bin, dass auch wir von deiner Erfahrung profitieren können, will ich dich unbedingt in der Stiepnaya haben.“
Danach erläutert er, dass die Leiche - „nicht deine richtige natürlich!“ - schon auf dem Wege nach Ostberlin sei. Eine „stattliche Anzahl russischer Offiziere und Diplomaten“ werde sich an den „außerordentlich gefährlichen Einsatz“ erinnern, bei dem es „zu dem tragischen Tod des Meisterspions Marco Brandes“ in der Gegend um Nowosibirsk gekommen sei. Dabei lacht er so heftig, dass der unterste Knopf seiner Uniformjacke abspringt und über den Fußboden rollt.
„Und was wichtiger ist, mein Freund: Die westichen Geheimdienste werden diese Nachricht gern hören, nein: Aufsaugen wie Nektar werden sie alles.“
Er hält mir ein riesiges Glas Wodka hin.
„Nas da rowje, Towarischtsch! Trink es aus, und dann wird dich Olga in eine behagliche warme Badewanne stecken und dann ins Bett. Und wenn du wieder wach wirst, bist du wie neugeboren. Du heißt dann Salvatore Cesare.“
Nachdem ich unter dem Beifall des Generals und seiner Soldaten das Glas geleert habe, falle ich um.
*
Die Sonne scheint hell und warm auf mein Gesicht. Es duftet nach Tee und frischgebackenem Brot. Eine Hand berührt vorsichtig meine Nasenspitze. Ich höre eine weiche Stimme und das sanft rollende „R“.
„He, Salvatore. Du hast schon zwei Tage geschlafen. Jetzt wird´s langsam Zeit.“
Olga Werenskaja sitzt auf der Bettkante neben mir und lächelt. Ihre dunkelbraunen Augen, die geschwungenen dichten Brauen darüber, die leichte Stupsnase, die fülligen feuchten Lippen, die beiden Grübchen links und rechts davon: Nichts erinnert mehr an Uniform, soldatische Selbstbeherrschung, raffinierte Verhörtechnik. Nur, dass sie die schwarzen glänzenden Haare nach hinten zu einem Knoten zusammengebunden hat, gibt ihr einen Rest von Strenge.
Meine Arme bewegen sich auf den Knoten zu. Die Finger ziehen vorsichtig an den Nadeln. Olga wehrt sich nicht, scheint die Berührung meiner Hände zu genießen, neigt mir ihren Kopf zu. Ich halte einen Augenblick inne, streichele über ihre Wangen, über den Hals, ziehe weiter an den Nadeln, bis die Haare dicht über meinem Gesicht hängen. Sie wiegt ihren Kopf hin und her, kommt näher und näher, streicht mit den Haarspitzen über meine Stirn, die Nase, meine Lippen.
Bereits bei dem Verhör, gestern, vorgestern, oder wann das war, als sie hinter mir stand und meinen Nacken und die Schultern berührte, da hatte mich das erregt, obwohl ich mit meinen Kräften am Ende war.
Als sich unsere Lippen berühren, erst vorsichtig tastend, dann immer leidenschaftlicher, gibt es kein Zurück mehr.
*
Erschöpft liegen wir nebeneinander. Der Atem wird gleichmäßiger. Mit den Fingerkuppen streichelt Olga über meine Haut; das Vibrieren darunter lässt nur langsam nach. Ihre warmen Finger ziehen kleine Kreise um den Bauchnabel, wandern weiter nach unten. So hatte es Gisela auch oft gemacht.
Ich drehe mich zur Seite, nähere mich ihrem Arm, berühre ihn mit der Zunge, gleite weiter über die Armbeuge zu den Brustspitzen. Die Haut schmeckt salzig. Der Duft bringt mich zur Raserei. Sie riecht wie Gisela! Ich wandere mit meinem Mund weiter nach unten. Olga dreht und wendet sich lustvoll, zieht meinen Kopf nach oben, drückt ihren Körper eng an mich und öffnet die Schenkel. Langsam, zärtlich, sanft kreisend, dann wilder und immer leidenschaftlicher heben wir ab zu einem neuen Höhenflug. Genau wie bei Gisela!
Plötzlich sind da Olgas Worte aus dem Verhör: „Ihr habt sie beide zu Tode gefickt!“ Und ich liege nackt genau neben dieser Frau? Irgendwo bei Kuibyschew?
*
Brandes sprang in die Höhe, stand plötzlich neben dem Bett, rieb sich die Augen und sah seine vertraute Wand: blassrosa, Kalender mit Steckwürfeln, minoische Doppelaxt und ein silberfarbenes Brettchen.
„Scheiß Träume! Ich muss wieder pinkeln!“
Auf dem Rückweg von der Toilette hatte er schon die Flurgarderobe und alle Schränke im Kombizimmer durchgewühlt. Jetzt versuchte er sein Glück in den Schubladen seines Schreibtisches. „Wo ist nur dieses verdammte Foto?“
Während der Fernsehbilder über den Anschlag in der Hochschule war es ihm in den Sinn gekommen: das Foto von der Karnevalsfeier, damals in Bad Ems.
Er erinnerte sich. Sie waren in bester Laune gewesen: Gisela, Berthold, er und die ganze ausgelassene Gesellschaft, die sich oft zu kleinen oder größeren Festen traf, mal im Offizierskasino der Bundeswehrschule, mal in der Kantine oder in diversen privaten Kellerbars.
Dieses Karnevalsfest hatte bei „Clarence“ geendet. Jeder Lehrgangsteilnehmer von Bad Ems kannte die Kneipe. Sie lag genau an der Ecke der AltenKemmenauer Straße, die zur Nachrichtenschule hinauf führte. Bei „Clarence“ wurde der obligatorische „Schlürschluck“ genommen. „Clarence“ war die letzte Tankstelle vor dem Bett. Den richtigen Namen wusste er nicht mehr. Aber, dass die Wirtin „Clarence“ genannt wurde, weil sie so fürchterlich schielte, genau wie der gleichnamige Löwe in der Fernsehserie „Daktari“, die in den Sechzigerjahren über die Bildschirme flimmerte. Und, dass man bei „Clarence“ so richtig die „Sau rauslasse“ konnte, wie die Emser das nannten. Das müsste auch auf dem Foto zu sehen sein.
Brandes kramte nervös in der Schublade unten rechts: Videobänder, verschiedenfarbigen Kassetten des Diktiergerätes, Disketten, eine angebrochene Knäckebrotpackung. Und die halbleere Weinbrandflasche rollte ihm entgegen.
„Scheiß Fusel! Das Zeug muss weg. Ab in den Ausguss.“





























