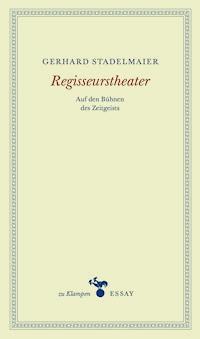Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Bub, geh bloß nie zur Zeitung!“, beschwört ihn die Großmutter, denn Zeitungen sind für sie des Teufels. Doch das Kind, das der Erzähler einmal war, verfällt dem Zaubermedium. In allen Umbrüchen der Zeiten und der Zeilen: von der kleinen "Stadtpost" über die "Landeszeitung", wo die Rezension als Hochamt gegen alle Anfechtungen des Zeitgeists zelebriert wird, bis hin zur "Staatszeitung", wo die Mauern fallen, die Dämme brechen. Gerhard Stadelmaier, der legendäre Theaterkritiker der F.A.Z., weiß Bescheid, was im Inneren von Redaktionen passiert. Sein erster Roman, eine Art literarische Autobiographie, ist eine so wortgewaltige wie tragikomische Liebeserklärung an das, was Zeitung war und sein sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
»Bub, geh bloß nie zur Zeitung!«, beschwört ihn die Großmutter, greift ins Weihwasser und zeichnet ihm das Kreuzeszeichen auf die Stirn. Denn Zeitungen sind für sie des Teufels. Doch um das Kind, das der Erzähler, »der junge Mann«, einmal war, ist es bereits geschehen. Er verfällt dem Zaubermedium Zeitung. In allen Umbrüchen der Zeiten und der Zeilen. Obwohl ein paar Leichen von Chefredakteuren seinen Weg säumen. Ihm aber hat es immer Spaß gemacht: von der Stadtpost, deren Chef von den Lesern noch als kleiner Herrgott angebetet wird, über die Landeszeitung, wo der Umbruch als Bastion, die Rezension als Hochamt gegen alle Anfechtungen des Zeitgeists zelebriert werden, bis hin zur Staatszeitung, wo die Mauern fallen, die Dämme brechen.
Gerhard Stadelmaier, der legendäre Theaterkritiker der F.A.Z., weiß wie wenige Bescheid, was im Inneren von Redaktionen passiert. Sein erster Roman ist eine so wortgewaltige wie tragikomische Liebeserklärung an das, was Zeitung war und sein sollte.
Zsolnay E-Book
GERHARD
STADELMAIER
UMBRUCH
Roman
Paul Zsolnay Verlag
ISBN978-3-552-05812-5
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2016
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Motiv: © plainpicture/Bildhuset/Torbjörn Boström
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Meinen Lieben gewidmet
Primum scribere,
deinde vivere
Heimito von Doderer,
»Die Dämonen«
Erstes Kapitel
HANDGRIFFE INS WEIHWASSER oder ALS DAS LESEN NOCH GEHOLFEN HAT
Der Tag, an dem der Chefredakteur sich selbstmorden ging, war ein heiterer. Linde Winde strichen durch die Stadt und übers Land. Es waren Habichte und Bussarde in der Luft. Und auch Segelflugzeuge, die von einer mittelgebirgigen Hochfläche aus, weiter draußen überm Land vor der Stadt gelegen, sich in den Himmel hinauf hatten ziehen lassen und nun die von den städtischen Dächern in der frühen Junihitze abstrahlende Thermik für ihr Kreisen, ihr Kurven und Gleiten nutzten. An jeder Ecke war also ein hohes, von Tragflächen wegsirrendes Pfeifen und ein über Vogelschnäbel kollernd gestoßenes Girren zu hören.
Und aus der Aktenablage des örtlichen Amtsgerichts drangen Liebeslaute, im Basso profundo ausgekeucht vom Amtsgerichtsdirektor, verziert mit den Koloraturen, ausgejuchzt von einer amts- und stadtbekannten Lady, Gattin eines nichts sehenden, nichts hörenden, nichts sagenden brav-äffischen Biedermanns, die es außerehelich gerne mit höher gestellten Persönlichkeiten trieb, erst dem Amtsgerichtsdirektor, später einem Chefarzt, dem sie anlässlich eines Spitalaufenthalts so lange ihre, wie sie es zu nennen pflegte, »wunde Stelle« zeigte, bis dieser gar nicht mehr anders konnte, als seinen Balsam dranzugeben. Jetzt aber, in der Aktenablage des Amtsgerichts, jubelte sie derart duettmäßig, dass die schräg gegenüber im Untersuchungsgefängnis einsitzenden Delinquenten es hören konnten – und die Nachricht davon trotz der Knastmauern in die Stadt hinausdrang. Wo sie auf höchst interessierte Ohren traf, denn derartige Affären wurden in unserer kleinen Stadt gerne und ausführlich bewispert.
Alles zusammen ergab die wohl fröhlichste, freilich auch unpassendste Trauermusik. Abgesehen davon, dass noch keine Hintergrundmusik aus den paar Kaufhäusern, Aufzügen und Restaurants unserer kleinen Stadt zu hören war, und die akustischen Horizonte des Daseins vom Pfiff der Dampflokomotiven im engen Tal gezogen wurde, höchstens hie und da überwölbt vom seltenen Brummen eines Flugzeugmotors. Es war eine stillere Zeit. Man musste sich seinen Lärm damals selber machen.
Es sollte sich später herausstellen, dass der Tag, als der Chefredakteur sich selbstmorden ging, ein heiterer und an sich harmloser Tag, wie ein Fädchen war. Wenn man an ihm zog, aber darauf kam man erst später, lag ein durchwirktes Gewebe an Tagen und Jahren vor einem. Ein Stoff, in den sich viel, wenn nicht alles wickeln ließ. Dennoch löste der Tod des gar noch nicht Alten ein gewaltiges »Psssst!« in den Hirnen und Herzen der Leser aus, und das waren ausnahmslos alle Bürger unserer kleinen Stadt. Eine Art Bewegung, die einem Kehren glich: unters Gewebe des Stoffs. Man bekam es mit einer Art seltsamer Angst zu tun.
Der junge Mann spürte diese Angst auf seiner Stirn. Dorthin hatte die Tante, als er morgens aus dem Haus ging, mit dem Zeige- und Mittelfinger ihrer rheumaverkrüppelten Hand rührend mühevoll ein Kreuzeszeichen gemacht, nachdem sie ihre Finger in ein kleines Weihwasserbecken aus getriebenem Silber getunkt hatte, das neben ihrer Wohnzimmertür an der Wand hing, überwölbt von einer Gottesmutter samt Jesusknaben auf dem Arm, die, aus einem einzigen großen Silberblech kunstvoll gehämmert, als mild übers Familienleben wachende Schutzfigur alle Ein- und Ausgänge zu segnen hatte. Schon die erst vor gar nicht langer Zeit verstorbene Großmutter hatte dem jungen Mann, als er noch ein Kind war, aber von allen immer nur »Junger Mann!« gerufen wurde, als wolle man ihn vor allem Kindischen warnen oder ihn auf ein Leben mahnend einstimmen, das »kein Schleckhafen« (was meinen sollte: kein Zuckerschlecken) sein werde – schon die Großmutter also, die ganz besonders vor allem Zuckerschleckerischen zu warnen stets aufgelegt war, hatte dem jungen Mann allmorgendlich das weihwasserbenetzte Kreuzeszeichen auf die Stirn gefingert, auf die ein paar widerspenstige haarwirbelige Locken herunterfielen.
Das Kreuzeszeichen war sozusagen als Segens- und Warnprophylaxe für den ganzen kommenden Tag gedacht. Auf dass der Herr den jungen Mann besprenge und ihn reinwasche, damit er »weißer als Schnee« werde. Worauf der junge Mann allerdings keinerlei Lust verspürte. Zumal der Schnee damals, sofern er als städtischer Schnee in Betracht kam, eher eine graue Färbung annahm und »weißer als Schnee« keine sonderliche Verlockung darstellte. Und als die Tante »Geschieht ihm recht!« und »Wer geht auch schon zur Zeitung!« murmelte und jede weitere Nachfrage nach dem Warum und Woher des Todes des Chefredakteurs in einer kurzen, herzlichen, wiewohl nervösen Abschiedsumarmung erstickte, da war es, als vollziehe sie nur, was ihr wiederum ihre Mutter über den Tod hinaus aufgetragen habe: den jungen Mann vor der Zeitung zu bewahren. Notfalls mit Weihwasser.
Schon das Kind, das der junge Mann einmal war, spürte das Entsetzen, die geradezu panische Angst der Großmutter vor allem, was die Leute draußen, das hieß außerhalb der von der Gottesmutter überm Weihwasserkesselchen bewachten Wohnstube, über das denken und reden könnten, was nur sie und ihre Familie etwas anging. Und das war etliches. Zum Beispiel wenn ihr Mann nächtens lauthals in den Straßen seine schöne Tenorstimme erhebend von einem Wirtshausbesuch heimkehrte. Oder wenn er seine dürftige Rente mit dem Schreiben kleiner Artikel in der örtlichen Zeitung aufbesserte oder alljährlich berüchtigte Glossen, ebenfalls in der Lokalzeitung, zum Jahresschluss verfasste, in denen er die Silvesterknallerei geißelte und stereotyp vorschlug, das verpulverte Geld »lieber den Armen zu geben«. Nicht nur bei solchen Anlässen drohte das von einer gewaltigen melierten Haarfülle überwölbte stark ovale Gesicht der Großmutter mit der hohen Stirn, den klaren, leicht wässrigen, aber immer wie in einen Güte-Abgrund hineinleuchtenden Augen, dem schmalen Mund und dem spitzen Kinn schier in Scham und Schande zu zerfließen. Oft kamen ihr dabei auch die Tränen. Sie las die Zeitung. Aber eigentlich nur, um sich zu vergewissern, dass diese sie nichts anging.
Ihre Erregungen wie ihre Informationen entnahm sie dem Radio, dem Medium, das unendlich weit weg und zugleich so nahe und greifbar war, dass man es ausschalten konnte. Als in Ostberlin ein Arbeiteraufstand von russischen Panzern zusammengeschossen wurde, als die gleichen Panzer wenige Jahre später in Prag, Warschau und vor allem Budapest Rebellionen, die nach Freiheit und Gerechtigkeit verlangten, niederwalzten, hörte das Kind, das der junge Mann einmal war, in jenen ganz aufregenden und aufwühlenden fünfziger Jahren die Großmutter am Radio laut schreien vor Pein und Entsetzen. Und als sie dann, zwar unter großen Erstickungsschmerzen, starb, aber völlig mit sich, ihrem Glauben, ihrem Gott im Reinen und naturgemäß versehen mit den dazu notwendigen Sakramenten der heiligen katholischen Kirche, war ihr einziger großer Kummer, dass sie die Stationen ihres ganzen Lebens wie in einer Prozession draußen auf der Straße an sich vorüberziehen sah. Und nicht im Wohnzimmer. Wie ihr überhaupt die Straße, »die Gass’«, wie sie immer sagte, das Peinigendste, das Fremdeste war. Sie blieb, wie ihre gleichaltrigen Nachbarinnen, am liebsten und besten in ihren vier, von der Mutter Gottes beschützten Wänden.
Dort war Sicherheit. Hier waren die Ordnungsmächte am Werk, auf die Verlass war. Und die größte unter ihnen hieß: Unverrückbarkeit. Jede noch so kleine Verrückung wurde zum Unglücks- und Ernstfall. Wenn irgendetwas nicht an seinem Platz war oder blieb, schien der ganze Kosmos gefährdet, der auf einem Gefühl gründete, für die Ewigkeit geschaffen zu sein. Jedes Haus schien da auf seinem Posten gegenüber den anderen Häusern eine Ewigkeitsgarantie zu sein, einsam in den Himmel ragend, auch wenn sie eng beieinanderstanden, wobei die jeweiligen Bewohner nur sich selbst im Baublick hatten. So wurde eigentlich jede Nachbarschaft zu einem feindlichen Gebiet auswärtiger Rücksichtnahmen oder Rücksichtslosigkeiten, je nachdem. Der diesbezügliche Schlachtruf lautete denn auch: »Was sollen bloß die Leute denken!«, was zu einer unaufhörlichen Selbstbekämpfung in Form einer Selbstbeschränkung führte, einer gewollten Einschränkung der freien Entfaltung, durchaus auch unter Zähneknirschen, wenn der Nachbar »Mein ist der Zaun!« behauptete und man »um des lieben Friedens willen« keinen Krach »da draußen« wollte, solange man drinnen unbeschadet davonkam. Was nicht hinderte, dass das jeweilige nachbarliche Drinnenbleiben unter ständiger Beobachtung und Bewisperung stand.
So wurde konstatiert, dass sich die eine Nachbarin den einzigen Luxus eines Heraustretens dadurch leistete, dass sie in ihrem Gartenhaus Hühner hielt, die sie zweimal am Tag, morgens, wenn sie die Gefiederten aus dem Häuschen, und abends, wenn sie das Geflügel wieder hineintrieb, mit einem »Allez, allez, vous, vous!« in hoher Stimmlage vor sich her scheuchte. Nicht, dass sie dabei Französisch hätte sprechen wollen. Sie passte sich einfach dem Sprachgebrauch unserer kleinen Stadt an, die noch in Zeiten des sogenannten Siebzigerkrieges (1870/71) viele Gefangene aus der Armee Kaiser Napoleons III. beherbergt hatte, die hier lebten, litten und starben und ihre Sprache im täglichen Umgang mit der Bevölkerung, der sie zu Diensten zu sein hatten, dem örtlichen Dialekt gleichsam injizierten. So setzten sie aber nur die Tradition unfreiwillig einwandernder und sich mit der heimischen Sprache vermischender Wörter fort, die noch aus vergangenen Franzosenkriegen herrührte – über die napoleonischen Feldzüge bis hinunter ins späte siebzehnte Jahrhundert, als die Truppen des vierzehnten Ludwig das südliche Deutschland verwüsteten und verheerten und der Name von Ludwigs Marschall Mélac zum Beispiel sich mühelos in den »Lackl« verwandeln ließ, seit dieser Zeit das Schimpfwort für einen unmöglichen Kerl. So gab es in unserer kleinen Stadt auch nie einen Bürgersteig, immer aber ein Trottoir, keine Umstände, sondern Fisimatenten, kein Face à nez (Einstecktuch), sondern ein Fazanettle, und eben das Hühnerscheuchkommando »Allez, allez, vous, vous!«.
Und da die Großmutter zudem als junges Mädchen als Herrschaftsköchin in den Häusern des gehobenen jüdischen Bürgertums unserer kleinen Stadt gearbeitet hatte (was sie gegen jedwede Form des Antisemitismus imprägnierte, weil sie früh kapierte, dass es auch bei den Juden »solche und solche« gibt), waren in ihren vier Wänden auch sprachliche Alltagsrosinen wie »meschugge« oder »nebbich« oder »Kokolores« oder »Mischpoche« gang und gäbe. Sie und ihre Nachbarinnen, von denen sie wahrscheinlich nie auch nur eine als eine Freundin betrachtet hätte, lebten drinnen in einer mit kargem Zierrat versehenen, aber durchaus gemütlichen, vor Fremd-Elementen geschützten Welt. Und wenn sie hie und da einen reisenden Herrn, einen Handelsvertreter etwa, für ein paar Tage in Kost und Logis nahm, um ihre Witwenrente aufzubessern, dann hatte sich der Fremde dem Hausbrauch anzupassen, angefangen beim Nachttopf bis hin zum Verbot jeglichen Fluchens und jeder Unanständigkeit. Fand sie des Morgens Flecken auf seinem Laken, flog er raus.
Die auf Französisch ihre Hühner antreibende Nachbarin hatte auch eine Marotte, was ihre Beherbergungsgunst anging: Sie vermietete die Dachgeschosszimmer ihres Hauses vornehmlich an lesbische Kathechetinnen, die paarweise dort logieren durften und als katholische Religionslehrerinnen in den örtlichen Grundschulen, die sich damals noch Volksschulen nannten, mit der allgemeinen biblischen Unterweisung und den besonderen Vorbereitungsexerzitien zur heiligen Erstkommunion der lieben frommen Kleinen aushalfen. Und ihre Schüler jeden Freitag, wenn das Elf-Uhr-Leuten von den Glockentürmen der Stadt her einsetzte, dazu zwangen, aus den Bänken zu treten, im Gang zwischen den Bankreihen niederzuknien und den »Engel des Herrn« zu beten. Der Engel des Herrn wurde von den lehrenden Damen den Kindern in der anschließenden Kathechese dergestalt nahegebracht, dass er mit ausschließlich weiblichen Attributen und Eigenschaften versehen schien. Sodass der junge Mann sich noch Jahre danach Engel nie anders denn als Frauen vorstellen mochte. Und auch den Heiligen Geist hatte er lange Zeit in femininem Verdacht.
Das eheähnliche Zusammenleben der Religionslehrerinnen wurde gesellschaftlich nicht nur geduldet, es fiel auch niemandem groß auf, weil in jenem Viertel unserer kleinen Stadt, in dem die Großmutter wohnte, etliche Frauenpaare ihrer Liebe, von der die Umwelt nichts wusste oder nichts wissen wollte oder sie schlicht verdrängte, einen mietvertragsgezimmerten Rahmen schufen. Sie waren allesamt Mitglieder im Verband weiblicher Angestellter (VWA), eines sehr katholischen Vereins, der im sogenannten Dritten Reich schikaniert wurde und sich einen leicht widerständigen Nimbus in die Nachkriegszeit hinübergerettet hatte. Es waren herbere und vor allem schon ältere Exemplare dessen, was man auch hier ein »Fräuleinwunder« hätte nennen können – wenn dieses Wort nicht den flotteren, jüngeren, pettycoatumrauschten Mädels jener Jahre vorbehalten gewesen wäre. Und da auch die älteste Tante des jungen Mannes mit ihrer Lebensfreundin seit Jahrzehnten intimst zusammenlebte, beide in unverbrüchlicher Treue einander und natürlich auch dem »Weiberverband« verbunden, wie ihn die Großmutter verächtlich nannte, und der junge Mann zu beiden ganz selbstverständlich »Tante« sagte, gehörte diese Form des Zusammenlebens zu seiner Normalitätserfahrung.
Die Großmutter freilich sah sie nicht gern. Sie sah vieles nicht gern. Draußen, auf der Straße, sah sie zum Beispiel Männer mit Krücken, denen ein Bein fehlte, oder die ihren ganz beinlosen Rumpf auf einer Art Karre fortbewegten, die sie mit den kräftigen Händen vorantrieben. Männer, die man zu der Zeit noch häufig sah, die der Krieg versehrt hatte. Die Großmutter sah vor allem sie nicht gern. Es waren für sie Bilder, die ihr Gewissen seltsam belasteten. Denn sie war während des Krieges fast alle Tage in die große gotische Stadtkirche gegangen und hatte dort den Rosenkranz rauf und runter gebetet und ihre drei Söhne, die alle im Feld standen, dem Schutz der Muttergottes anvertraut. Da aber ihre drei Jungen den Krieg – körperlich – unbeschadet überstanden, andere Frauen jedoch, die auch jeden Tag den Rosenkranz gebetet hatten, neben den Söhnen auch noch den Mann im Krieg verloren, schien ihr jeder versehrte und verstümmelte Überlebende eine Anklage gegen das perfekte, unverstümmelte Davongekommensein in ihrer Familie, das ihr immer die nagende Frage auf die Seele band: Womit habe ich das, haben wir das verdient? Wieso die? Und wieso wir nicht? Es spendete ihr in dieser seltsamen Gewissenszwangslage ein wenig Trost, wenn es auch ein fast perverser, grausamer und unanständiger Trost war, dass ihre jüngste Tochter beinahe die ganzen Kriegsjahre über mit einem hochentzündlichen, sie unaufhaltsam verkrüppelnden Gelenkrheuma ans Bett gefesselt war. Was die Großmutter als »mein Kriegsopfer« bezeichnete.
So ängstigte sie sich vor allem, was draußen war. Es stärkte das, was sie »sich der Sünden fürchten« nannte. Und wenn einer der Verkrüppelten, in eine Wachstuchpelerine gekleidet, ein gummiartiges Barett keck auf dem Kopf, sich in den Hausgang geschlichen, dort eine Mandoline hervorgezogen und das ganze Haus mit zittrigen Klängen zigeunerhafter Provenienz zu schauerlichem Gesang durchdrungen hatte, sprang sie aus der Wohnungstür, warf ihm sofort einen gar nicht unbeträchtlichen Münzgeldbetrag hin, auf den er, der auf schäbige Pfennige hoffte, gar nicht gefasst war. Was ihn immer voller Überraschung die Mütze ziehen und sofort verschwinden ließ. So wehrte sie alles ab, was von draußen kam. Es roch ihr zu stark nach Zeitung. Gleichwohl sah sie auf ihrem Totenbett aus wie eine milde Heilige, aller Seligkeiten teilhaftig, die sie sich erträumt haben mochte.
Später hat der junge Mann solche Schreie, wie sie die Großmutter am Radio bei den großen politischen Katastrophen seines Kinderjahrzehnts ausstieß, ja förmlich aussang, nur noch im Theater erlebt. Allerdings ohne die Kreuzeszeichen, die seine Großmutter damals schlug, und ohne die Gesetze des Schmerzhaften Rosenkranzes, den sie danach gegen alle Schlechtigkeiten und Panzerketten der Welt zu beten pflegte. Aber auch die Katastrophen draußen schienen ihr etwas nur und allein sie Angehendes, nur ihr im Moment Gehörendes zu sein. Sie wollte darüber genauso wenig reden wie über den dicken Bauch, den ein kaum sechzehnjähriges Nachbarmädchen seit ein paar Monaten mit sich herumtrug, wobei dem Kind, das der junge Mann einmal war, der Begriff »uneheliches Kind« als der Verbrechen ärgstes und sündhaftestes vor Augen gehalten wurde, die dann aber gleich wieder davor zu schließen waren.
Dass sich ein anderes Nachbarkind, Sohn eines Fahrlehrers, mit der Pistole seines Vaters, der sie aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hatte, erschoss, fiel ebenso unters große »Psssst!«-Gebot wie die Geschichte des Sohnes einer im Haus der Großmutter logierenden Witwe, von dem die Sage ging, er sei in der Nazizeit, wenn er mehr als zwei Viertel Wein getrunken hatte, auf den Marktplatz unserer kleinen Stadt getreten und habe dort »Heil Moskau! Heil Stalin!« so lange laut geschrien, bis sie ihn verhafteten und in ein KZ brachten. Das taten sie insgesamt drei Mal. Nach dem zweiten Mal tauchte Otto, den alle nur »Ottel« riefen, weil er als sogenannter Geistesdackel von aller Welt für einen verrückt spinösen Trottel gehalten wurde, mit zerschlagenem Gesicht und nur noch einem Auge in Großmutters Haus wieder auf und erzählte, wie es zuging im Konzentrationslager, und erzählte auch, dass er das nicht erzählen dürfte. Ein drittes Mal hat er nicht überlebt. Seine Mutter erhielt eine Rechnung, seine Beerdigung beziehungsweise Beiseiteschaffung betreffend. Als Todesursache wurde amtlicherseits »Lungenentzündung« angegeben.
Diese Geschichten, einmal nur gehört und dann im Kopf weitergedichtet und weitergegruselt und mit dem heimlichen Wunsch geschmückt, sie in einer unheimlichen Zeitung unter Schlagzeilen lesen zu können, ersetzten dem Kind, das der junge Mann einmal war, zunächst die Geschichtsbücher, nach denen er später griff, und auch die Dramen, die er Jahre danach erst als Schreckensabgrundschätze entdeckte. In seiner Lieblingsgeschichte wurde die Großmutter sogar zur Heldin. Er stellte sie sich vor, allein in einem Abteil der Eisenbahn, die vom großen See an der Grenze zur Schweiz und Österreich zuerst in eine kleine, schmutzige Industriestadt im benachbarten Flusstal und von dort dann mit einem Bummel- und Bimmelzug in unsere kleine Stadt führte. Die Großmutter hatte sechs Wochen lang mitten im Krieg in der Bäckerei und in dem kleinen Hotel, das ihr Bruder am großen See betrieb, gearbeitet, geputzt, geschuftet, Kinder gehütet, wurde dabei schamlos ausgenutzt, um jetzt, im vierten Kriegs- und Hungerjahr, als Lohn einen Sack voll Mehl nach Hause zu bringen. Vielleicht hielt der Zug auf offener Strecke. Der junge Mann phantasierte an dieser Stelle immer einen Fliegeralarm herbei. Der Großmutter gegenüber im Abteil ein blutjunger Soldat in Uniform mit dem Gepäck des Fronturlaubers, dessen Haare wie in einer weißen Lohe erstarrt schienen, als habe ein Riesenschreckensschauder, der seinen Kopf samt Haut in unsagbarem Horror durchrüttelt haben musste, sie entfärbt.
Plötzlich brach er in Tränen aus, legte der Großmutter den Kopf auf die Schulter und drückte ihr den von Krämpfen geschüttelten Körper schutzsuchend gegen die Seite. Auf ihre Frage »Büble, was hast du denn?« erzählte er, dass er in der Ukraine an Judenerschießungen habe teilnehmen und zuschauen müssen, wie auf die Toten und auch die nur Halbtoten Erde geschüttet wurde, und: »Die Erde hat noch gebebt!« Und dieses Bild einer von Toten bebenden Erde kriegte er nicht mehr aus dem Kopf. Ob und wie der Zug weiterfuhr, was die Großmutter mit dem jungen Soldaten machte, ob und wie sie ihn zu trösten und zu beruhigen versuchte, ob sie mit ihm einen Rosenkranz betete oder ihn mit einem Kreuzeszeichen bedachte, gehörte nicht mehr zur Geschichte. Sie erzählte sie nur einmal dem jungen Mann, der danach kein Kind mehr war, leise, in einem Entsetzensmurmeltron. Dass der junge Mann das Ganze gleich darauf am liebsten auf der Straße ausgeschrien und erzählt und brühwarm in die Öffentlichkeit (womöglich in die Zeitung) gebracht hätte, wie er am liebsten alles, was er erfuhr und las und erlebte, auf den Markt getragen haben würde, führte zu ein paar Ohrfeigen – und zu einer Verbotsverkündigung: »Geh bloß nie zur Zeitung!«
Und da die Tante mit ihrem krankheitsbedingt unbeholfenen Handgriff ins Weihwasser das Verbot der Großmutter, nur mit anderen Worten, sozusagen auffrischte am Tag, als der Chefredakteur sich selbstmorden ging, kam es dem jungen Mann zwar schon wie ein Verhängnis vor, aber doch auch wie ein Verhängnis, das selbst wieder zu einer Geschichte zu werden versprach.
Der Chefredakteur war eigentlich gar kein Chefredakteur. Und er ging sich auch eigentlich nicht selbstmorden. Er fuhr vielmehr. In seinem noch nicht ganz abbezahlten Mercedes. Welch Letzteres in unserer kleinen Stadt naturgemäß den absoluten Gipfel des Skandals abgab. Und womöglich war es auch gar kein Selbstmord. Sieht man davon ab, dass bei hellem Sonnenlicht ohne Gegenverkehr ein Mercedes (ob nun abbezahlt oder nicht) von schnurgerader Straße abkam und mit Vollgas direkt auf einen Chausseebaum zuhielt. Der Lenker jedenfalls stand zu seinen Lebzeiten der Lokalredaktion der örtlichen Stadtpost vor, deren Zentralredaktion weiter weg, in der Kreisstadt, ihren Sitz hatte. Aber der Herrscher übers Lokale galt am Ort mehr als ein Chefredakteur.
Der rotgesichtige, feist-gedrungene Mann mit seinem schlohweißen, in etwas wirr gefiederten Büscheln den gewaltigen Schädel samt Halbglatze umwehenden Haarkranz wurde in unserer kleinen Stadt als eine Art Gott wahrgenommen, ja, im lokal üblichen Idiom, das durch Anhängung einer sprachlichen Verkleinerungsformel an den Gott sogar noch eine Erhöhung desselben zustande brachte, dementsprechend als »Herrgöttle« apostrophiert, dessen Sprüche und Weissagungen weithin treffenden Charakter hatten und gleich nach den Hochamt-Predigten des Münsterpfarrers als Offenbarungen gehandelt wurden. Insofern auch, als Offenbarungen seit jeher ja immer auch gedeutet werden müssen und nie nur für sich, sondern für ein dahinter Liegendes, im schlimmsten Falle zu Fürchtendes, im besten Falle zu Erregendes stehen, und die sogenannten Lokalspitzen des Chefs in Form von kursiv gesetzten Glossen und kleinen Leitartikeln, links oben, gleich in der ersten Spalte des Lokalteils, nie mit den Zeilen, immer zwischen den Zeilen zu lesen waren.
Sodass sich die durchaus nicht gewaltige Menge der gedruckten Zeilen (mindestens fünfzig, höchstens siebzig) beim Lesen gut und gerne ins Doppelte, Dreifache, X-Fache vermehren konnte – je nachdem, wie viel der Leser zwischen den Zeilen an Deutbarem, zu Vermutendem, zu Fürchtendem, zu Empörung oder Erregung Anlass Gebendem unterzubringen geneigt war. Wozu ihn die Zeilen des Chefs allemal verführten, der nie mit vollem Namen, immer mit seinem markanten Kürzel zeichnete, das aus dem Anfangsbuchstaben seines Vornamens und den beiden ersten Buchstaben seines Nachnamens bestand, wobei der erste für die entsprechende Markanz sorgte, da er als ursprüngliches »V« in ein lautschreiberisch kokett kleingeschriebenes »vau« aufgelöst ward.
Es war eine gewaltige Lese-Zeit. Sie roch nach Druckerschwärze, ölig erregend die Nerven kitzelnd. Und irgendwie schrieb der »vau«-Mann ja auch immer wie im Rausch. Wer ihn las, schlürfte eine Art von starkem Getränk. Und wer das Gebäude betrat, in dem die Lokalredaktion residierte, der stieg auf den uralten, ausgetretenen Holztreppen einer ehemaligen, klinkerrot ummauerten Metallwarenfabrik, in der keine Gold- und Silberwaren mehr, sondern Druckwaren hergestellt wurden, und die sich als eine Industriekathedrale ausnahm, in eine Art Olymp hinauf, in dem es nach heiligem Papier roch, das die Segnungen des Unausdeutbaren versprach, in das sich jeder Zeitungsleser (und das war damals jeder Bürger) hineinträumen, hineinverlieren, hineinsteigern konnte wie in einen gigantischen Rätselspielplatz. Und nur wem der Zauberspruch »Wie hat er das jetzt wieder gemeint?« von den murmelnden Lippen kam, öffnete sich unter Umständen die Pforte. Dort oben, wo Gott-»vau«-ter thronte. Um ihn herum seine Ganymeds, olympische Mundschenke in Gestalt von Lokalredakteuren, die den Zwetschgenschnaps den lieben langen Schreib- und Blattmachtag aus großen Wassergläsern tranken. Im Gegensatz zu ihrem Chef schrieben sie nicht wie im Rausch, sondern direkt im Rausch, hochroten Kopfes, aber blassen Stils, in einer Sprache, die himmelweit von der Wucht der Chef-Worte entfernt war, immer am Rande aller möglichen Schlagflüsse sich an Schreibtischkanten festhaltend und auf altertümlichen Schreibmaschinen herumhackend.
Es waren an jenem heiteren Tag, als der Chefredakteur sich nun doch, trotz oder wegen aller Herrgöttlesgleichheit, selbstmorden ging, eben erst zwei Jahre vergangen, seit dem jungen amerikanischen Präsidenten das sympathieheischende Lächelgesicht unter der füllig frischen Scheitelfrisur weggeschossen worden war. Obwohl dieses Gesicht auch finstere Gedanken, viel Lug und Trug und, wie sich später herausstellen sollte, einen langen, unglückseligen, brutalen und schmutzigen Krieg barg, galt es kraft seiner unabweisbaren Sympathie-Erheischung als Inbegriff des Modernen, Jungen, Frischen, die Welt Verändernden. Dass sein Antlitz, in dem so viele so viel Hoffnungsvolles leuchten sahen, nun brutal aus der Welt und ihrer möglichen Veränderung gerissen wurde, schuf auch in unserer kleinen Stadt das Gefühl des Unruhigen, Umbrechenden. Dies aber mit einer gewissen Verzögerung. Schon deshalb, weil unsere kleine Stadt mit ihrem mittelalterlichen bis barocken Häuserbestand ausdehnungsunlustig zwischen zwei enge Täler sich duckte und um ein großes, spitzgiebliges gotisches Gotteshaus Schutz suchend herumzudrängen schien als um eine architektonische Sakralglucke aus alten, haltbar beruhigenden Steinen. Und nun: schon auch ein Temperatursturz, eine Unhaltbarkeit. Eine Tatsachenlawine. Die aber erst viel später niedergegangen zu sein schien.
Denn da das Film- und Fotomaterial, auf dem der Mord am Präsidenten zu sehen war, erst per Flugzeug übern Atlantik gebracht werden musste, hatten schon die Bilder eine Verspätung. Sie flogen den Zeitungen hinterher. Und wurden auch in unserer kleinen Stadt erst viel später im Kino als aktualcineastischer Vorweghappen zum Hauptfilm vom Publikum goutiert, das den Schrecken und den Bibber von vorgestern in Form einer »Wochenschau« (die auch schon wieder Wochen her sein mochte) noch lange als Dessert zum längst in der Zeitung Gelesenen oder im Radio Gehörten genoss. Die erregten, gerne ins Hysterische, Pathosmäßige kippenden Stimmen der »Wochenschau«-Reporter taten ein Übriges, um das Dessert warm zu halten. Zumal eine »Tagesschau«, die übern häuslichen Fernsehschirm flimmerte, den wenigsten beschieden war.
Meistens kamen ein, höchstens zwei Fernsehgeräte auf einen Häuserblock beziehungsweise auf eine Anliegerstraße. Man betrachtete diese Apparate als stolzen Luxus. Man zog den guten Anzug, das hübsche Kleid und die sauberen Sonntagsschuhe an, wenn man zu den Nachbarn zum Fernsehen gehen durfte; man brachte Blumen oder Pralinen mit und wurde mit Knabberzeug und süßem Alkoholischem, vorzugsweise Eckes Edelkirsch oder Bols Cacao oder Verpoorten Eierlikör, bewirtet. Dann ging wie bei einem Theater- oder Opernbesuch der Vorhang, will sagen: der Bildschirm auf, und man sah Quizsendungen oder Kleine Fernsehspiele oder sogenannte Straßenfeger, das waren Übertragungen wichtiger Fußballmatches oder mehrteilige Kriminalfilme. Man musste solche Besuche lange vorher absprechen, denn die jeweilige Haushaltsherrin wollte den Fußboden, auf den die Fernsehgucker ihre Füße stellten, sauber gewischt, die Wohnstube aufgeräumt, überhaupt einen guten Eindruck gemacht haben.
Es war ein genauso unalltägliches Ereignis wie im umgekehrten Fall, wenn die Fernsehbesitzer, die kein Telefon besaßen (es kam allerhöchstens ein Telefonapparat auf eine Wohnstraße), die Telefonbesitzer, die keinen Fernseher ihr Eigen nennen konnten, um den Revanchegefallen und also Telefonbenutzung baten. Öffentliche Telefonzellen, die eine Geruchsmischung aus kaltem Zigarettenrauch, verschimmeltem Pfefferminz und gut abgehangenem Urin verströmten, im Übrigen aber oft das Münzgeld verschluckten, ohne dafür ein Freizeichen zu offerieren und also viel Nerven kosteten, gab es sowieso nur alle paar Kilometer in Großstädten, in unserer kleinen Stadt aber nur in Postamtsnähe. Man musste weit hin zu ihnen laufen. Also erlebte man lieber ins Haus fallende Nachbarn mit rotem Gesicht und neugierig durchs Wohnzimmer streifenden Augen, wie sie den Zeigefinger der linken Hand ins linke Ohr steckten, mit der rechten krampfhaft den Telefonhörer ans rechte Ohr hielten, nachdem sie nervös die schnarrende Wählscheibe betätigt und den einen oder anderen Finger im einen oder anderen Wählscheibenloch falsch untergebracht hatten und gezwungen waren, den gewaltig ausladenden Hörer aus schwerem Bakelit wieder auf die noch ausladendere Gabel zu legen und von neuem stochernd und fingernd ihr Wählglück zu versuchen. Wonach sie ihr Anliegen in die Sprechmuschel schrien, sodass auch fremdnachbarlichen Lauschern nichts verlorenging.
Es gab freilich auch nicht viel zu quatschen. Nur das Nötigste. Das zudem Geld kostete, das die wenigsten in solchen Mengen hatten, die ihnen nahegelegt hätten, es in überflüssige Gesprächseinheiten zu investieren. Man war, wenn man sprechen wollte, auf ein direktes Gegenüber angewiesen. Und mit derartigen Anstrengungen hielt man wohlweislich Haus. Oder gab ihnen das korsettierende Relief des gemeinnützig Organisierten: Man war Vereinsmitglied. Am besten mehrfach. Und im Verein der Segelflieger, der Kleintierzüchter, der Degenfechter, der Stenographen oder der Briefmarkensammler sprach man sich gegenseitig aus, sozusagen in satzungsgemäßem Gerede. Dieses erfolgte nach den Regeln einer gewissen Handgriffartigkeit: Jeder wusste vom anderen, wo dessen Handgriffe an Wesen und Charakter angebracht waren, und wie er zugreifen musste oder durfte, um sein Gegenüber mit Hilfe jener Hand- und Haltegriffe zu bewegen. Wobei die Bewegungen festgelegt waren, damit niemand an den Griffen abrutschte, die zum Teil auch glatt und glitschig sein konnten.
Dass zum Beispiel ein Vereinsmitglied, das nie in die Kirche ging, von einem anderen Vereinsmitglied, das fast täglich die Kirche aufsuchte, wusste, weil er es damals hatte mit ansehen müssen, dass der heute fanatische Kirchgänger einst in Sowjetrussland Juden, Frauen und Kinder und Greise erschossen hatte, bildete einen absolut glitschigen Handgriff, von dem man tunlichst die Finger ließ. Ähnliche Glätte- und Rutschgefahr eignete sonst nur noch Ehebruchs- und Seitensprung-Handgriffen. Während Steuerhinterziehungs- oder andere Bescheißerei-Handgriffe sogar als Stolz- und Ehrenzeichen begriffen wurden. So aber sorgten diese Griffe dafür, dass sich jeder ein zugreifend geordnetes, solides Bewegungsbild vom anderen machen konnte.
Und da es sonst wenig an Bildern zu sehen oder zu glotzen gab, war es eine gewaltige Zeit fürs Lesen. Lesen verschaffte denen Luft, die hie und da zu ersticken drohten. Denn es hing ja jahraus, jahrein eine von unzähligen Kohleöfen gespeiste Glocke brenzlig riechenden Dunstes über der Stadt, was allerdings einem heiteren Tag keinen Abbruch zu tun brauchte. Und es war, als breche die Kohlenglocke, die sowohl buchstäblich wie bildlich über allem lag und natur- und jahreszeitengemäß im Winter dicker und schwefeliger sich ausnahm, nur auf, wenn Myriaden von Lettern, Buchstaben, Sätzen, die wie gigantische Mückenschwärme von den Zeitungsseiten herstürmten, den Dunst durcheinanderwehten und dergestalt Frischluftwirbellöcher in ihn rissen. Zwischen den Zeilen. Der Umbruch der Zeitung umbrach die Stadt.
Und jeder wurde da zum Dechiffreur: dass der katholische, in seinen Predigten den schönsten pseudoliberalen Klerikalkitsch (»Eine Umarmung ist auch ein Gebet«) produzierende Pfarrer einer Stadtteilgemeinde die Ehe eines Paares seines Sprengels dadurch vor aller Augen zerstörte, dass er über lange Vögel-Jahre mit der Frau deren Ehe brach; dass eine weithin geachtete Fabrikantenfamilie Dessous-Partys veranstaltete (»Schlüpferles-Paraden«), die im Swimmingpool der Fabrikantenvilla nur vorläufig endeten; dass der oder jener »Dreck am Stecken« hatte; dass im Stadtrat, dem Gemeindeparlament, Aufträge und Posten verschoben wurden in nachbarschaftlichen und parteilichen Verstrickungen; dass einer der Stadträte, einst persönlicher Adjutant eines Generalfeldmarschalls der Wehrmacht, auch seinen Ehekrieg nicht gewinnen konnte; dass von windigen, aber wohlangesehenen alten Gaunern geführte Firmen und Läden von einer Insolvenz zur nächsten taumelten; dass der Organist des großen gotischen Stadtmünsters während der Choralvorspiele in der Nase bohrte und die Nasenpopel untern Spieltisch schmierte, wenn gerade eine nur die Beine in Schwung haltende Pedalstelle dran war; dass am örtlichen Gymnasium die alten Nazi-Lehrer immer noch auf Pauker-Posten ihre Schüler mit Rohrstock und Faust prügelnd traktierten; dass auf einer Straße, die seit jeher nur »die Judengasse« genannt wurde, obwohl dort gar keine Juden wohnten, die Schmerzensschreie von weinenden Leuten zu hören waren, die ihre blutjunge Tochter durch den Krebs verloren, der in ihrem schmalen, sowieso schon dürren Körper gewütet hatte, und vor deren Sterbezimmer sie das Fenster für alle Welt sichtbar schwarz verhängten und aus dieser Schwärze nie mehr herausfanden; kurz: dass alles in bester Unordnung, also insgesamt in der Ordnung war, die man hinzunehmen gelernt hatte – das alles konnte man lesen. Wenn man wollte. Angedeutet. Angespitzt. Versteckt offenbart. Als Gewagtes. Als Frechheit. Zwischen den siebzig Zeilen einer Lokalglosse. In der Zeitung dieser Zeit. Die sich nicht mit einer Suchmaschine finden lässt.
Denn diese ganzen Jahre sind verloren, unaufgehoben. Sie lassen sich nicht einmal aus den Tiefen der Zeitvergegenwärtigungstäuschungsmaschine, die sich Internet nennt, hervorholen. »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« hat ein großer Wort- und Weltaufschreiber, den der junge Mann erst viel später las, das Zeitunglesen seiner sehr viel älteren Zeit so beschrieben, wie es Jahrzehnte danach immer noch gültig war und geradezu mit heiligem Eifer betrieben wurde: »