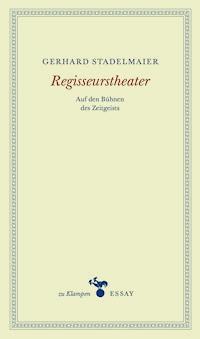
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: zu Klampen Essays
- Sprache: Deutsch
Das Theater arbeitet daran, sich selbst abzuschaffen. Berserkerhaft werden literarische Vorlagen zertrümmert und dem Publikum dann brockenweise hingeworfen. 'Wirklichkeitsnah' will man sein und spricht damit dem Zuschauer jegliches Abstraktionsvermögen ab. 'Regisseurstheater' nennt Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier solche Versuche, das Stück dem kurzlebigen Einfall, dem Zeitgeist zu opfern. Während das Theatralische sich auf der Bühne verflüchtigt, dominiert es zunehmend Politik und Medien, wo Betroffenheit inszeniert und das Denken durch (Mit-)Fühlen ersetzt wird. Seit vier Jahrzehnten begleitet und kommentiert der Autor das Treiben auf deutschsprachigen Bühnen. Wie so viele verzweifelt er regelmäßig daran. Aber wie kaum ein anderer lässt er sich auch vom Zauber, den das Theater zu entfalten vermag, mitreißen und spart in diesem Essay folglich keinesfalls jene Glücksmomente aus, die ihm seine Begeisterungsfähigkeit erhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERHARD STADELMAIER
Regisseurstheater
Auf den Bühnen des Zeitgeists
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Gerhard Stadelmaier, geboren 1950, studierte Germanistik und Geschichte an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Von 1978 bis 1989 war er Redakteur der »Stuttgarter Zeitung«, wechselte dann zur »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, wo er bis 2015 das Ressort Theater und Theaterkritik leitete. Zuletzt sind von ihm erschienen: »Parkett, Reihe 6, Mitte. Meine Theatergeschichte« (2010) und »Liebeserklärungen. Große Schauspieler, große Figuren« (2012).
Inhalt
Cover
Titel
Der Autor
Zitate
Kopf hoch! Aber plötzlich! Das ist ein Überfall!
Und schier in Zähren wir ersaufen
Sentimentales Zwischenspiel mit Aylan, Angela, Nathan, Hamlet und anderen Flüchtlingskindern
Immer mehr Kultur, immer weniger Kritik
Szene mit Chefredakteur
Und was ist mit der Kritik? Was hat sie dabei noch verloren?
Türen und Toren
Der schöne Traum vom autonomen Kopf
Die Bühne als Zeitgeistmaschine
Was ist überhaupt und zu welchem Ende erdulden wir Regietheater?
Unter Pestbeulen
Auf einer Probebühne
Wunder aber gibt es immer wieder
Nennen wir es lieber Regisseurstheater
Nachspiel
Theatralische Zeitgeisterfahrt in einem Zug
Impressum
Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie.
Hugo von Hofmannsthal, »Der Rosenkavalier«, 1. Akt
Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand darnach fragt,
dann weiß ich es; soll ich es aber einem Frager klarmachen,
dann weiß ich es nicht; trotzdem aber behaupte ich voller
Selbstvertrauen, ich wüsste, dass es keine Vergangenheit gäbe,
wenn die Zeit nicht abliefe, und keine Zukunft, wenn nichts herankäme,
und keine Gegenwart, wenn nichts gegenwärtig wäre.
Aurelius Augustinus, »Confessiones«, XI. Buch
Die Zeit geht nicht, sie stehet still,
Wir ziehen durch sie hin;
Sie ist ein Karawanserei,
Wir sind die Pilger drin.
Ein Etwas, form- und farbenlos,
Das nur Gestalt gewinnt,
Wo ihr drin auf und nieder taucht,
Bis wieder ihr zerrinnt.
Gottfried Keller, Sämtl. Werke und Briefe, 3. Band
Theater. Wenn ich bedenke, dass Gott,
der alles sieht, sich das hier auch ansehen muss!
Jules Renard, »Tagebuch«
Kopf hoch! Aber plötzlich! Das ist ein Überfall!
ZEITGEIST. Das sagt oder schreibt sich so leicht hin. Aber was für ein Geist ist er? Wo steckt er? Wie zeigt er sich? Wie hat man ihn sich vorzustellen? Man stelle ihn sich bitte nicht als Dramatiker vor. Denn »die Rechtfertigung des Dichters kann jederzeit angetreten werden; sein Werk bleibt da und kann uns immer wieder vor die Augen gelegt werden«, wie Gotthold Ephraim Lessing in der »Ankündigung« seiner »Hamburgischen Dramaturgie« (1769) schreibt. Der Witz des Zeitgeists besteht aber gerade darin, dass er weder zu rechtfertigen ist noch »immer wieder vor die Augen gelegt« werden kann. Er ist sowohl reine Willkür wie reine Flüchtigkeit. Heute hier, morgen schon wieder fort. Und übermorgen ganz woanders. Also stellen wir uns ihn lieber als Schauspieler vor. Dessen Kunst, so Lessing am selben wunderkritischen polemischen Ort, ist ja »in ihren Werken transitorisch. Sein Gutes und Schlimmes rauschet gleich schnell vorbei; und nicht selten ist die heutige Laune des Zuschauers mehr Ursache, als er selbst, warum das eine oder das andere einen lebhafteren Eindruck auf jenen gemacht hat.« Der Zeitgeist also benötigt, um zu wirken, zu wabern und zu wesen, notwendig die Launen, Modenlüste, Sentiments, Schwindeleien und Wechselwindigkeiten derer, die ihm gestatten, dass er auf sie wirkt. Und vor allem: Er trägt Masken. Sie stellen sein stärkstes Wirkungsmittel dar. Nicht nur indem sie sein Gesicht verbergen, das nicht einmal ein wahres Gesicht sein muss, um sich seines Versteckens sicher sein zu können – sondern indem sie in demjenigen, der auf sie schaut, eine seltsam paradoxe Begierde erzeugen, die sich in einem Glückserfüllungsgefühl staut.
Ob nun ganze Gesellschaften und Völker sich freiweillig zu Sklaven machen und wie gebannt auf die kleinen, glasummantelten, handschweißverschmierten viereckigen Geräte starren, die ihnen stets und ständig Signale übermitteln, denen sie offenbar derart trauen, dass sie sich und ihre Körper fast nur noch als Anhängsel dieser Geräte zu spüren scheinen, wie in Trance fremdgesteuert und seltsam vor sich hin brabbelnd in Bussen und Bahnen sitzend oder durch Straßen und Büros taumelnd, oder ob sich ganze Gesellschaften und Völker wie auf Kommando weltweit, ob in Fabriken, in Wüsten oder Dschungeln oder in Theatern oder einfach im häuslichen Rahmen, in die gleichen grobstoffigen, vernieteten Hosen zwängen – immer liegt dem kollektiven Wahn ein höchst individuelles Versprechen zugrunde: Es ist alles nur für dich – und nur für dich allein! Obwohl es Millionen so empfinden, fühlen und handhaben. Auch hier ist das Vergleichsbild des Schauspielers schlagend: Auch er, der für die große Masse spielt (sonst würde er die Bühne gar nicht erst betreten wollen), suggeriert jedem einzelnen Zuschauer das große, überwältigende Nur-für-dich!-Gefühl. Zugleich mit dem so dringlichen wie naturgemäß vergeblichen, aber ungemein gefühlsfördernden Appell: Halt mich fest! Greif zu! Denn im nächsten Moment bin ich schon wieder weg!
Der tiefste Wirkungsgrund des Zeitgeists aber liegt genau hier: im schlechten Gewissen beziehungsweise in der Angst der gerade Lebenden, von gestern zu sein und das große, bedeutende Jetzt zu verpassen. Die Angst vor der Dauer. Die Sucht nach dem Augenblick. Zeitgeisthändler sind nichts anderes als die Dealer des Augenblicks. Es gibt eine Ur-Szene, ein Ur-Motto dieser Angst vorm Gestern, vorgetragen von einem notorisch Morgigen namens Tancredi Falconeri, dem Neffen des Fürsten von Salina in Tomasi di Lampedusas Roman »Der Leopard«. Tancredis Zeitgeistmotto lautet: »Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich ändert.« Das ist natürlich eine Lüge: Man verändert sich nicht, um sich gleichbleiben zu können. Man wird anders. Und geht – im Falle Tancredis – dafür auch über Leichen. Die Genossen, die er sich zeitgeist- und gegenwartsgemäß erwählt, als er das Motto ausgibt, sind die Kämpfer Garibaldis für ein noch zu einigendes Italien. Wenig später, als diese Kämpfer sich nicht ändern und der neuen bürgerlich oligarchischen Herrschaftsschicht und ihrer zeitgeistgemäßen Machtsicherung parieren wollen, sondern auf ihrem Condottieretum beharren, lässt Tancredi sie kühl liquidieren. Der Ton, den er jetzt anschlägt, gehorcht einer anderen Opportunität als zuvor. So ändern sich die Tancredis. Und gehen dabei gesellschaftlich zugrunde – obwohl sie gerade dieses Zugrundegehen mit ihrer Anpassungslust vermeiden wollten. Denn wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist das eiserne Gesetz, das der Zeitgeist seinen Mitläufern und Gehorsamen gleichsam als vorauseilend institutionalisierten Tritt in den Allerwertesten als gnadenloses Geschenk mitgibt. Denn es spielt im Zeitgeistgewerbe, das im wesentlichen ein Schaugewerbe ist, eine große Rolle, wer gerade Regie führt und den Ton angibt. Der Zeitgeist weht nicht, wie er will. Er wird auch gemacht. Er hat einen Markt, der von ihm profitiert (und umgekehrt). Auf seiner Bühne wechselt das Licht ständig. Und die Auftritte und Abgänge sind absehbar. Der Zeitgeist ist zwar schon Schauspieler, aber ein Schauspieler im Regietheater, das naturgemäß ein Regisseurstheater ist (worauf wir noch zurückkommen).
Ihm gerät immer das, was gerade ist, zum Fetisch. Er befeuert die große Allestilgerin Gegenwart, die das, was noch eben gerade war, ausradiert. Und sie herrscht fast absolut. Und schlägt alles, von dem zu erben wäre, aus. Was war, gilt nicht. Tradition wird gelöscht. Vergangenheit umfasst gerade noch die letzte Woche. Und die Gegenwartsreize werden nach »Gefällt mir«, »Gefällt mir nicht«, Daumen rauf, Daumen runter, gehandelt. Der junge Dramatiker Philipp Weiss, vor ein paar Jahren Hausautor am Wiener Schauspielhaus, einer kleinen Experimentalbühne, die sich kurioserweise exakt der reinen, traditionslosen Gegenwart verschrieben hat, bekennt in einer »Hausautorenkolumne« seine diesbezügliche, geradezu sensationell zu nennende Unzeitgemäßheit: »Ich denke und schreibe in einer Kultur, die nichts mehr zu erben meint. Es ist eine Zeit, die sich der gesellschaftlichen In-vitro-Fertilisation verschrieben hat und mithilfe einer Pränataldiagnostik alle Erbkrankheiten im Labor auszumerzen gedenkt. Alles Vergangene wird so zum Pool, ohne Zusammenhang, ohne Bedeutung und ohne Geschichte. Das Erbe wird zum puren Recht, sich an den Toten frei zu bedienen. Und sich den Nachfolgenden aufzudrängen. Verbindlichkeiten werden ausgeschlagen. Schulden nur gemacht. Ich erbe eine Klon- und Samplingkultur, in der ebenso alles möglich wie nivelliert ist.«
Das Leben in und mit der Kultur erlebt dieser junge Autor, der die Dreißig noch nicht erreicht hat und, wenn er bei seiner Haltung bleibt, es im Theater wohl ziemlich schwer haben dürfte, als Tabula rasa, die jeden Moment zum Nullpunkt macht. Als habe Nietzsche seine Zeitpeitsche aus der »Götzendämmerung« über ihn geschwungen: »Es steht niemandem frei, Krebs zu sein. Es hilft nichts: man muss vorwärts.« Der nächste Auftritt des Schauspielers Zeitgeist in ganz anderem Kostüm und anderer Kulisse wartet bereits: die große Betrügerin Aktualität, die schon morgen sich als solche herausstellen und entlarvt wird, wenn ihre noch unentlarvte Nachfolgerin die Szene betritt. Es herrscht dabei die Panik vor der Zeit, die stillsteht. »Was ihr den Geist der Zeiten heißt,/Das ist im Grund der Herren eigner Geist,/In dem die Zeiten sich bespiegeln«, sagt Faust in Goethes Tragödie erstem Teil gleich am Anfang in der Szene »Nacht« zu seinem Famulus Wagner (dem »trockenen Schleicher«) – und trifft als dann großer Zeitenüberspringer und -durchwanderer den Zeitgeist-Punkt ins Herz: Was man den Geist der Zeiten heißt, wird gemacht. Er ist eine Fabrikation: von vorübergehender Gegenwart. Goethe definiert an anderer Stelle das Wesen der Gegenwartstyrannei: »Wenn eine Seite nun besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt und in dem Grade triumphiert, dass die entgegengesetzte sich in die Enge zurückziehen und für den Augenblick im Stillen verbergen muss, so nennt man jenes Übergewicht den Zeitgeist, der denn auch eine Zeitlang sein Wesen treibt.«
Das Auskotzen der Gegenwart verträgt in seinem Präsentismus keinen Ruhepunkt. Wer sich dabei der Würde des Altmodischen, also leider Vergangenen versicherte und der Frechheit vertraute, die aus den Hinterbeinen kommt, auf die man sich stellt und still stehen bleibt und die Welt weiterrasen lässt – der würde erleben, dass die rasende Welt irgendwann wieder an ihm vorbeikommt. Wobei die Welt den Stehenbleiber eventuell als seltenes Exemplar und kostbare Erscheinung wahrnähme, wenn sie nicht so mit Rasen beschäftigt wäre, also mit dem Auf- und Zuziehen des Vorhangs für den Zeitgeist. Das Kommando aber seines Auftretens kommt vom Inspizientenpult des Zeitgeisttheaters und lautet: »Plötzlichkeit!« Es geschieht im Gestus eines Überfalls, der die Überfallenen die Köpfe aufmerkend hochreißen, sie aber das Nachdenken meistens sofort einstellen lässt. Man ergibt sich drein. Man findet in allen Bereichen dafür die lächerlichsten, beliebigsten, aber wirksamen Beispiele. So klein sie sein mögen, sie verändern die Verhältnisse. Für jeweils unterschiedlich lange Zeitgeistspannen. Plötzlich zum Beispiel tragen alle die Haare lang, die Schläfen-Koteletten bis zum Kinn herabgezogen, den Schnauzer buschig, die Röcke kurz, die Revers der Sakkos und Hemden überdimensional breit, die Schuhsohlen dick, die Hosen mit Schlag, die Farben bunt schreiend (am liebsten orange). Und was noch gestern die psychedelische Ausstattung von aufsässig die Gitarren schlagenden Jugendlichen aus dem wie immer gearteten drogenumnebelten Underground war, wird heute zur bekifften Mode der Bürger. Zum absoluten Muss. Und wer bart- und kotelettenlos im Kleiderladen nach schmalen Hosenbeinen und normalen Hemden verlangt, steht kurz vor der Ausweisung ins Reich des Unmöglichen, ja fast Asozialen. Die Antikonvention von gestern wird zur Konvention von heute. Und verlangt unbedingten Gehorsam, der sich naturgemäß profitabel in Geldeswert umrechnen lässt und ganze Wirtschaftszweige blühen lässt, die im Mitmachen und Mitlaufen, wenn nicht gar im Vorauseilen ihrer Ökonomie erst innewerden: Man muss dem Kunden suggerieren, dass er auf der Höhe der Zeit sein muss, wenn er ein ernstzunehmender und gesellschaftlich anerkannter Mensch bleiben möchte. Das war ums Jahr 1970 herum die gesellschaftliche Zeitgeist-Erfahrung. Gemacht und gesponsort von einer Industrie.
Die Basis für alle diese Erfahrungen durch die Zeiten hindurch aber lautet immer: »Das tut man nicht« oder »Das geht nicht«. Und wer zuvor sich noch, als womöglich ein anderer Zeitgeist im Kurzlebensschwange war, gegen die einschränkende Moral einer »Das tut man nicht«-Floskel zu Recht mit der Gegenfrage »Und wer ist denn: man?« empört und aufgelehnt hätte – der wird jetzt, da sie ihm in den ideologischen Kram passt, zu derem eifrigsten Regieassistenten. Es werden die Listen der Peinlichkeiten und der komplementären Ansprüche erstellt, also dessen, was man zu tun und zu lassen habe. Das entsprechende Wort hierfür ist »angesagt«. Und was angesagt ist, zieht alle mit.
Plötzlich ist Bio angesagt. Und alle machen mit beim Natürlichkeitsschmaus. Als hülfe es der Natur, wenn Unmengen von Getreide weltweit dafür monokulturell angebaut werden, damit sie als Bio-Diesel in umweltfreundlich scheinenden Autos verfahren werden. Plötzlich ist angesagt, bestimmte Wörter nicht mehr zu sagen, weil sie »unkorrekt« sind. Als habe man mit dem Sageverbot den schlechten gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen das jetzt »korrekt« benannte Objekt immer noch lebt, schon das Wasser abgegraben. Als hülfe es den wirtschaftlich ausgegrenzten oder juristisch benachteiligten Schwarzen, wenn man sie nicht mehr »Neger« nennt. Oder plötzlich geht man Fußball auf sogenannten Fanmeilen gucken, im Verein mit Tausenden anderen. Wo man früher ins Stadion ging, um leibhaftig anwesenden Mannschaften beim Kampf um Sieg und Niederlage zuzuschauen, geht man heute (auch) dorthin, um Mannschaften zu erleben, die über eine Leinwand rennen, auf die sie als Fernsehbild projiziert werden. So verwandelt sich das Wohnzimmer zum Marktplatz, das persönliche Erleben zur kameragelenkten und durch endlose Wiederholungen den Idiotien einer TV-Regie unterworfenen Massenhysterie. Man hat da mitzuschreien, mitzujubeln. Es ist eine Erfahrung wohliger, frivol sozialverträglicher passiver Haltlosigkeit, die sich »aufgeschlossen« gibt und als »weltoffen« empfindet. (Dabei mag einem beim Heimfahren, käme man an einem Gotteshaus vorbei, durchaus ketzerisch einfallen, dass zum Beispiel der katholischen Kirche, je mehr sie die Türen zur Welt hin offen und weit gemacht hat, die Leute nicht durch diese Türen hereingeströmt, sondern eher davongelaufen sind. Von der noch leereren, weil noch weltoffeneren evangelischen Kirche ganz zu schweigen.)
Der Plötzlichkeiten aber ist überhaupt kein Ende. Plötzlich spielen zum Beispiel alle ohne Vibrato auf dürren Darmsaiten und klirrenden Hammerklavieren die Musik des Barock und der Klassik. Kein Symphonieorchester traut sich mehr, Bach zu spielen. Die Ensembles, die einen »Originalklang« pflegen und so tun, als könnten sie die alte Musik so spielen, wie sie zu ihrer Zeit erklungen ist, schießen wie Pilze aus dem Konzertboden. Die »historisch informierte Aufführungspraxis« wird zum Muss, die sogenannte Klangrede, das heißt das partout dramatisch-rhetorische Aufladen auch undramatischer Musik, zum Schroffheiten-Credo. Man muss Radio-Moderatoren nur zuhören, wie sie derartige Konzerte mit den immer gleichen Verbalgirlanden ankündigen, die sich vor allem ums Wort »Lebendigkeit« oder »Frische« herumkringeln, um sich über die Leblosigkeit und Stumpfheit der entsprechenden Darbietung nicht mehr zu wundern.
Geht man in einen Schallplatten- beziehungsweise CD-Laden und verlangt nach der Einspielung einer Matthäus-Passion mit großem Chor und großem Orchester – wird man gerne vom Verkäufer im Ton einer Strafpredigt belehrt, dass es sich »herumgesprochen« habe, dass man »das« heute nur noch im Originalklang zu hören habe (fast hätte er noch




























