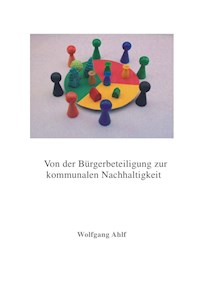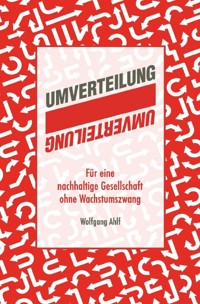
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Das Buch basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass wir unseren Planeten ausbeuten mit den bekannten Folgen: Treibhauseffekt, Artensterben und Ressourcenknappheit. Für die Wege aus diesen Krisen gibt es keine einfachen Lösungen und vielleicht auch deshalb in der Gesellschaft keine einheitliche Initiative. Die Kapitel beleuchten verschiedene Aspekte der aktuellen Situation und zeigen Möglichkeiten auf, wie wir eine bessere Zukunft gestalten können. Es geht darum, sich von der Fixierung auf Wirtschaftswachstum zu lösen und stattdessen für soziale Gerechtigkeit, und ökologische Nachhaltigkeit zu arbeiten. Utopisches Denken ist dabei keine weltfremde Phantasterei, sondern engagierte Gesellschaftskritik. Das kapitalistische System mit seiner Fixierung auf Eigentum und Profitmaximierung ist ein Haupttreiber der Ungleichheit. Die Logik des Kapitalismus führt dazu, dass Renditen auf Kapital schneller wachsen als Einkommen aus Erwerbsarbeit. Das elementare Ziel der Umverteilung ist es, soziale Ungleichheit zu bekämpfen, in Bereiche wie Pflege, Bildung und Klimaschutz zu investieren und Verlustängste im Zusammenhang mit der Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft zu nehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke an Sabine, Hans und Holger
Der Autor
Umverteilung
Für eine nachhaltige Gesellschaft
ohne Wachstumszwang
Wolfgang Ahlf
In dieser Publikation wird keine durchgängig geschlechtergerechte Sprache verwendet. Mit „Bürger“, „Teilnehmer“ usw. sind immer Männer und Frauen gemeint.
Impressum
Texte: © Copyright by Wolfgang AhlfUmschlag: © Copyright by Johann ObermaierVerlag: Wolfgang Ahlf 21075 Hamburg [email protected]
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Druck: epubli, Service der neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
1.1Anspruch des Buches
2Basis einer nachhaltigen Gesellschaft
2.1Das bestehende Wirtschaftssystem
2.2Nachhaltige Gesellschaft
2.3Suffizienz als Leitprinzip
2.4Technologie und Innovation
3Wachstumszwang und Ungleichheit
3.1Verstärker der Ungleichheit
3.2Marktmacht und Konzentration
4Konzept der Umverteilung
4.1Grundlagen und Ziele der Umverteilung
4.2Widerstände
4.2.1Strukturelle und wirtschaftliche Faktoren
4.2.2Psychologische und soziologische Widerstände
4.2.3Politische und ideologische Widerstände
4.3Politische Strategien und konkrete Maßnahmen
4.4Instrumente der Umverteilung
5Nachhaltige Wirtschaft ohne Wachstum
5.1Alternativen zum Wirtschaftswachstum
5.1.1Neudefinition von Wohlstand
5.1.2Nachhaltige Wirtschaftsmodelle
5.1.3Finanzsektor
6Wege in die Transformation
6.1Ungleichheiten
6.2Abbau von Ungleichheiten
6.3Neujustierung
6.4Bausteine
7Vision einer Zukunft des guten Lebens
Literatur
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
Seit etwa einem halben Jahrhundert ist in den Naturwissenschaften beschrieben worden, dass unsere natürlichen Ressourcen nicht unermesslich groß sind. Gleichzeitig mit dieser Erkenntnis bildete sich eine Umweltbewegung mit dem Ziel, belastete Ökosysteme zu schützen. Als zentrale Themen der Forschung wurden Umweltzerstörung und Klimawandel formuliert und nur für Menschen ohne Kenntnisse der Fakten ist strittig, dass wir uns inmitten einer globalen ökologischen Krise befinden. Die Auswirkungen zeigen sich in dem Verlust der Artenvielfalt, der Übernutzung von Ressourcen und in dem beschleunigten Klimawandel. Als Ursache dieser Bedrohung für die Natur wurde die Herstellung von Produkten ohne Berücksichtigung der entstehenden Abfälle erkannt und wird häufig als einfache Gegenüberstellung von Ökonomie und Ökologie typisiert. Während in der Gesellschaft lange als wichtigstes Problem der Klimawandel galt, sind es in der Wahl 2025 zum Bundestag ökonomische Themen, und ein Wachstum von mindestens 2% der Wirtschaft wird gefordert. Wie dieses Wirtschaftswachstum gemessen wird, soll hier kritisch analysiert werden. Nach dieser Forderung ist es folgerichtig, dass mehr Wachstum in der Regel zu mehr Naturverbrauch führt. In den 90iger Jahren wurde das Konzept der Nachhaltigkeit entwickelt, das auf der Idee basiert, dass der Verbrauch von Ressourcen die Erzeugung nicht übersteigen soll.
In der Diskussion über die Auswirkungen des Klimawandels wurde das ökologisches Problem erweitert um die Fragen zur Verteilung von Kosten und Lasten. Das Konzept einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung erhielt einen Aufschwung durch diesen Meinungsaustausch, in dem deutlich wurde, dass globale Probleme nur durch gemeinsame Aktivitäten von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu lösen sind.
Ein zentraler Aspekt ist die Kritik am Wirtschaftswachstum als treibende Kraft hinter vielen Problemen. Es wird zunehmend argumentiert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Hauptindikator lediglich die Summe aller Markttransaktionen misst, ohne Rücksicht auf deren Auswirkungen auf das menschliche Wohlergehen oder die ökologische Stabilität. Die sozialen und ökologischen Kosten werden ignoriert und die Annahme unbegrenzter Bedürfnisse ist hypothetisch. Zudem ist der Mythos vom Wachstum als Allheilmittel trügerisch und konstruiert. Deutschlands Wirtschaft ist die drittstärkste der Welt und ist mit seltenen Ausnahmen jährlich gewachsen. Dennoch ist die Armutsgefährdungsquote, definiert als Anteil der Bevölkerung mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 Prozent des Bundesmedians, relativ konstant geblieben und lag 2023 bei 16,6 Prozent. Wachstum ist also nicht zwingend erfolgreich, um Armut zu bekämpfen, den Sozialstaat zu sichern oder Umweltschutz zu gewährleisten.
Das bestehende Wirtschaftssystem, das auf Wettbewerb und Profitmaximierung ausgerichtet ist, verstärkt eine soziale Vermögensungleichheit. Trotz deutlich gestiegener Vermögen bleibt deren Verteilung weiterhin ungleich. 2021 verfügten die obersten 10 % der Haushalte über 56 % des Gesamtvermögens. Deutschland zählt damit im europäischen Vergleich zu den Spitzenreitern in Sachen Ungleichheit. Dieses deutliche Missverhältnis bedeutet, dass die untere Hälfte der Bevölkerung nur etwa 2,3% des Gesamtvermögens besitzt. Obwohl das Kapital stark konzentriert ist, werden oft private Verluste vergesellschaftet, d.h. auf die Bevölkerung verteilt. Dies geschieht zum Beispiel durch Bankenrettungsprogramme, bei denen die durch Banken verursachten Verluste durch den Staat und somit durch die Steuerzahler übernommen werden. Gleichzeitig werden Gewinne privatisiert und fließen auf Konten von Konzernen und wohlhabenden Einzelpersonen. So haben Sparprogramme, die als Reaktion auf die Bankenrettungen durchgesetzt wurden, viele Menschen in Armut gestürzt. Diese Entwicklung führt zu einer Zunahme sozialer Spannungen, politischer Instabilität und zum Verlust des Vertrauens in demokratische Institutionen und Parteien. Eine demokratische Krise in Europa wird so durch das schwindende Vertrauen in demokratische Institutionen und die Zunahme rechtspopulistischer Bewegungen verursacht.
In einer Welt, die von wachsender Ungleichheit und einer zunehmenden Umweltkrise geprägt ist, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit von Umverteilung der Einkommen und des Gesamtvermögens mit immer größerer Dringlichkeit. Die Erfordernis von Umverteilung ergibt sich nicht nur aus Fragen der Gerechtigkeit, sondern auch aus ökologischer Notwendigkeit. Es werden nicht die Profiteure und größten Klimazerstörer zur Kasse gebeten, sondern die Kosten und Belastungen werden auf die Breite der Bevölkerung abgewälzt. Die Fixierung auf das BIP verschleiert die realen Ursachen von Problemen und lenkt von den Widersprüchen der Gesellschaft ab. Das Erstarken von Rechtsaußen wird beflügelt von Abstiegsängsten und einer sich zuspitzenden Verteilungskrise. Eine Umverteilung von oben nach unten ist notwendig, damit alle Bürger ein gutes Leben in Würde und Sicherheit führen können. Außerdem müssen gerechtere Wirtschaftsmodelle entwickelt werden, da ein "Weiter so" unmöglich ist. Dazu gehören konkrete Maßnahmen, um einen Übergang zu einer Gesellschaft ohne Wachstumszwangt zu gestalten.
Die aktuellen globalen Krisen sind eng mit dem vorherrschenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystem verbunden. Daraus ergibt sich, dass ein tiefgreifender Wandel in verschiedenen Bereichen erforderlich ist, um eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu gestalten. Diese Umgestaltung (Transformation) sollte nicht nur als ein politisches oder wirtschaftliches Projekt betrachtet werden, sondern auch als ein Thema, das Fragen nach unseren Werten, unserer Lebensweise und unserer Rolle in der Welt aufwirft. Es handelt sich um eine notwendige sozial-ökologische Transformation, bei der das Wohlergehen aller im Zentrum steht und die ökologischen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Diese Transformation ist kein einfacher Prozess und erfordert eine Auseinandersetzung mit strukturellen Ursachen von Umweltzerstörung und Ungleichheit.
Alternativen zum Wachstum sollten zeigen, wie ein gutes Leben für alle jenseits des Wachstums aussehen kann. Es geht darum, die Vorstellungskraft zu trainieren und zu zeigen, dass Alternativen möglich und erstrebenswert sind. Das kann einen langen Prozess der Erkenntnis bedeuten, da viele Menschen den Prozess des Shoppens am verkaufsoffenen Sonntag mehr genießen als einen Spaziergang im Wald.
Die Notwendigkeit einer Transformation muss aus der Einsicht in die systemischen Probleme des aktuellen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems resultieren. Es geht um einen tiefgreifenden Wandel in allen Bereichen, der nicht nur technische Lösungen, sondern auch eine Veränderung von Werten und Lebensweisen erfordert.
1.1 Anspruch des Buches
Dieses Buch basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass wir unseren Planeten ausbeuten mit den bekannten Folgen: Treibhauseffekt, Artensterben und Ressourcenknappheit. Für die Wege aus diesen Krisen gibt es keine einfachen Lösungen und vielleicht auch deshalb in der Gesellschaft keine einheitliche Initiative. Die Kapitel beleuchten verschiedene Aspekte der aktuellen Situation und zeigen Möglichkeiten auf, wie wir eine bessere Zukunft gestalten können. Es geht darum, sich von der Fixierung auf Wachstum zu lösen und stattdessen für soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden der Menschen zu arbeiten. Utopisches Denken ist dabei keine weltfremde Phantasterei, sondern engagierte Gesellschaftskritik. Zuversicht lässt sich gewinnen aus dem gesellschaftlichen Wandel, der bereits begonnen hat.
2 Basis einer nachhaltigen Gesellschaft
2.1 Das bestehende Wirtschaftssystem
Das Wirtschaftswachstum ist ein zentrales Ziel der Politik und wird als Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen. Häufig wird das BIP als Wohlstandsindikator gleichgesetzt, obwohl es nicht alle Auffassungen von Lebensstandard und -qualität berücksichtigt.
Das BIP misst die Summe aller Markttransaktionen, beachtet aber nicht deren Auswirkungen auf das menschliche Wohlergehen oder die ökologische Stabilität. Es erfasst nur den in Geld gemessenen Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen, unabhängig davon, ob diese Güter tatsächlich gebraucht werden oder ob sie soziale oder ökologische Schäden verursachen. Beispielsweise werden Bildung, Windkraftanlagen und Fahrräder genauso behandelt wie Werbung und Produktion von Waffen.Auch berücksichtigtdas BIP nicht die sozialen und ökologischen Schäden, die durch die Produktion entstehen. Das BIP bewertet viele schädliche Aktivitäten positiv, was methodisch fehlerhaft ist. Dagegen werden Tätigkeiten wie Hausarbeit, Kinderbetreuung und ehrenamtliche Arbeit nicht einbezogen. Diese Tätigkeiten sind jedoch wesentlich für das Funktionieren der Gesellschaft und tragen zum Erfolg bei.
Das BIP suggeriert, dass Wirtschaftswachstum automatisch zu mehr Wohlstand führt. Einkommensreichtum allein jedoch macht nicht die Lebensqualität aus, die für das Wohlbefinden wichtig ist. Selbst wenn das persönliche Einkommen steigt, ist körperliche und geistige Gesundheit von vielen anderen Dingen abhängig, wie beispielsweise von der sozialen Absicherung. Darüber hinaus kommt eine wachsende Wirtschaft nicht unbedingt allen zugute, sondern kann einer reichen Oberschicht Vorteile bringen, während andere Teile der Bevölkerung benachteiligt bleiben.Das Verhalten von Konzernen verdeutlicht die systemische Problematik des Wirtschaftssystems. Am Beispiel des Autobauers VW wurde die kurzfristige Gewinnorientierung als Fehler des Managements offengelegt. Bei VW führte dies dazu, dass Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wurden, anstatt in Zukunftstechnologien und notwendige Investitionen zu investieren. Allein im Jahr 2023 flossen rund 4,5 Milliarden Euro an die Aktionäre. Das Management hat beispielhaft die Entwicklung von Elektromobilität und autonomem Fahren verschlafen und stattdessen auf hochmotorisierte teure SUVs gesetzt. Eine vorausschauende Unternehmensführung sollte sich nicht nur auf kurzfristige Profite konzentrieren, sondern auch auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Firma.
Ein weiteres systemisches Problem ist die Tendenz, Probleme zu ignorieren, solange die Aktienkurse steigen. Bei VW wurden Schwierigkeiten wie zu teure Produktionsstandorte und verfehlte Investitionen nicht diskutiert, solange die Aktienkurse gut waren. Erst wenn die Kurse fallen, werden die Probleme genannt und die notwendigen Veränderungen kommen dann oft zu spät. Die Maßnahmen zur Bewältigung einer finanziellen Krise wiederholen sich schematisch wie Forderungen nach Lohnverzicht und Werksschließungen, was natürlich zu erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen führt.
Allgemein richtet sich also die Kritik am Wirtschaftssystem und an seinem Indikator darauf, dass es einseitig auf Markttransaktionen fokussiert ist und soziale, ökologische sowie qualitative Aspekte von Wohlstand vernachlässigt.
2.2 Nachhaltige Gesellschaft
Nachhaltigkeit ist ein vielschichtiges Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte umfasst und auf eine zukunftsfähige Entwicklung abzielt. Nachhaltigkeit ist also mehr als nur Umweltschutz, denn es ist ein umfassendes Konzept, das die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigen soll, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit sind eng miteinander verbunden und bedingen einander:
Ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich auf den Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt. Es geht darum, den Verbrauch von Ressourcen zu reduzieren, die Umweltbelastung zu minimieren und die biologische Vielfalt zu erhalten.
Soziale Nachhaltigkeit zielt auf die Gerechtigkeit und das Wohlergehen aller Menschen ab. Dazu gehört die Sicherstellung von Grundbedürfnissen wie Wohnen, Bildung, Gesundheit und soziale Teilhabe.
Ökonomische Nachhaltigkeit steht für die Anforderungen, Rohstoffe, Waren und Kapital auch in Zukunft im gleichen Ausmaß oder besserer Qualität zu erhalten. Gut wirtschaften bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Profite nicht exklusiv im Fokus stehen. Zwar sind sie auch bei zur Kostendeckung notwendig, jedoch sollte in einer nachhaltigen Ökonomie auch die Förderung von fairem Handel, Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit Vorrang haben.
Um die drei Säulen der Nachhaltigkeit in das Gesellschaftssystem einzubinden, werden drei Leitstrategien empfohlen. Sie verbinden die drei Dimensionen und sollen gemeinsam verfolgt werden. Sie werden zunächst kurz skizziert:
Öko-Effizienz: Die Effizienz des Ressourceneinsatzes wird verbessert, um mit weniger Material und Energie mehr zu erreichen.
Suffizienz: Es wird ein Lebensstil mit weniger materiellem Konsum und mehr Lebensqualität angestrebt.
Konsistenz: Die Art der Produktion wird so verändert, dass Wirtschaftsprozesse an ökologische Abläufe angepasst werden. Durch die Imitation natürlicher Kreisläufe sollen Ressourcen dabei möglichst im Produktionszyklus erhalten bleiben und keine Abfälle entstehen.
Eine Kritik am BIP ist keine Ablehnung von Indikatoren im Allgemeinen. Sie sind aussagekräftige Leitgrößen, die dabei helfen, schwer zu charakterisierende Gesamtsysteme zu bewerten, wie zum Beispiel die Luftqualität in Ballungsräumen oder ganze Ökosysteme. Im Kontext von Nachhaltigkeit dienen Indikatoren dazu, die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen zu messen und zu überprüfen. Sie helfen dabei, Stärken und Schwächen zu identifizieren, Konflikte zu benennen und Prioritäten für politische Aktivitäten zu setzen. Es gibt dabei unterschiedliche Arten von Indikatoren, darunter quantitative (z.B. Veränderung des Trinkwasserverbrauchs), qualitative (z.B. Zufriedenheitsmessung) und komparative Indikatoren (gestufte Beurteilung).
Nachhaltigkeitsindikatoren sollten bestimmte Anforderungen erfüllen:
Transparenz: Das Konzept und die methodische Vorgehensweise sollten nachvollziehbar sein.
Zuverlässigkeit: Die Daten sollten verfügbar und glaubwürdig sein.
Entscheidungsbezug: Die Indikatoren sollten sich auf Handlungsbereiche beziehen, die direkt beeinflussbar sind.
Kommunizierbarkeit: Sie sollten für eine breite Öffentlichkeit verständlich sein und in einem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht werden.
Relevanz: Indikatoren müssen für die Überprüfung der Ziele relevant, leicht verständlich und nachvollziehbar sein.
Indikatoren können einzeln betrachtet werden, aber auch in Verbindung zueinander innerhalb eines jeweiligen Handlungsfeldes, um eine umfassende Bewertung der Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Ihre Entwicklung über die Zeit, also die Indikatortrends, sind ebenfalls von Bedeutung. Die Analyse von Zielvorgaben und der Vergleich mit den tatsächlichen Daten ist ein wichtiger Schritt bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts.
Beispiele für Indikatoren sind unter anderem:
Versiegelte Fläche pro Einwohner
Anteil energieeffizienter Gebäude
Durchschnittlicher örtlicher Mietpreis
Anzahl der Tage mit Ozonbelastung
Zahl der Arbeitsplätze pro Hektar Gewerbefläche
Anteil der Frauen in Führungspositionen
Anteil der Bezieher von Sozialleistungen
Menge der Siedlungsabfälle pro Einwohner
Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder in der Kommune
Energie- und Stromverbrauch kommunaler Gebäude
Die Verwendung eines einheitlichen Satzes von Indikatoren hat den Vorteil, dass sich Kommunen vergleichen und Rückschlüsse auf den Stand und den Trend der Nachhaltigkeit ziehen können.