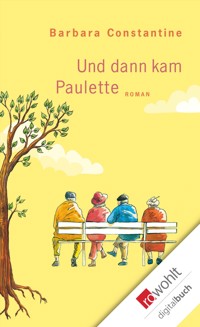
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fast zwei Monate ist es her, dass Ferdinands Sohn mit Frau und Kindern ausgezogen ist. Seitdem lebt Ferdinand mit seinem Kater allein auf dem großen Bauernhof. An manchen Tagen fragt er sich, wie er dieses einschneidende Erlebnis ohne das Tier verkraftet hätte. Marceline lebt seit vielen Jahren in dem Ort, wo Ferdinand seinen Bauernhof hat. Ein tragisches Ereignis hat sie dazu veranlasst, ihren Beruf als Cellistin an den Nagel zu hängen und ihre Heimat Polen zu verlassen. Doch nun droht ihr im wörtlichen Sinne die Decke auf den Kopf zu fallen, und sie muss noch einmal von vorne beginnen. Und wenn Ferdinand und Marceline sich einfach zusammentäten? Eine WG gründeten, um der Einsamkeit zu trotzen? Es ist ein Experiment, und es glückt. Nach und nach kommen immer mehr Bewohner dazu. Alle haben ihr Päckchen zu tragen, aber alle wollen auch die schönen Seiten des Lebens genießen und finden heraus: Zusammen wohnt man besser als allein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Barbara Constantine
Und dann kam Paulette
Roman
Über dieses Buch
Fast zwei Monate ist es her, dass Ferdinands Sohn mit Frau und Kindern ausgezogen ist. Seitdem lebt Ferdinand mit seinem Kater allein auf dem großen Bauernhof. An manchen Tagen fragt er sich, wie er dieses einschneidende Erlebnis ohne das Tier verkraftet hätte. Marceline lebt seit vielen Jahren in dem Ort, wo Ferdinand seinen Bauernhof hat. Ein tragisches Ereignis hat sie dazu veranlasst, ihren Beruf als Cellistin an den Nagel zu hängen und ihre Heimat Polen zu verlassen. Doch nun droht ihr im wörtlichen Sinne die Decke auf den Kopf zu fallen, und sie muss noch einmal von vorne beginnen. Und wenn Ferdinand und Marceline sich einfach zusammentäten? Eine WG gründeten, um der Einsamkeit zu trotzen? Es ist ein Experiment, und es glückt. Nach und nach kommen immer mehr Bewohner dazu. Alle haben ihr Päckchen zu tragen, aber alle wollen auch die schönen Seiten des Lebens genießen und finden heraus: Zusammen wohnt man besser als allein.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel «Et puis, Paulette …» bei Calmann-Lévy, Paris.
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Et puis, Paulette …» Copyright © 2012 by Calmann-Lévy
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt, nach dem Original von Calmann-Lévy
Illustrationen Hélène Crochemore
ISBN Buchausgabe 978-3-463-40641-1 (1. Auflage 2013)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-30901-2
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Mottos
1 Der Vorfall mit dem Gas
2 Fünf Minuten später geht’s ihr schon besser
3 Ein Geschenk am frühen Morgen
4 Ferdinand langweilt sich, aber nicht lange
5 Muriel sucht ein Zimmer und einen Job
6 Die Eltern arbeiten, die Kinder fahren Rad
7 Die Lulus auf dem Hof
8 Die Lulus kichern unter der Bettdecke
9 Isabelle hat die Nase gestrichen voll
10 Ein undichtes Dach
11 Ferdinand bringt die Kinder zurück
12 Ludo ist es lieber, wenn Isabelle mit ihm schimpft
13 Ferdinand kommen Zweifel
14 Ferdinand übt seinen Text
15 Die Einladung
16 Tee zum Frühstück
17 Marceline versteht nicht
18 Auszug, Einzug
19 Guy und Gaby
20 Gaby riecht nach Veilchen
21 Ludos Brief (ohne die Rechtschreibfehler)
22 Simone und Hortense warten
23 Hinterher bei Guy
24 Besuche bei Guy
25 Roland am Telefon
26 Isabelle hat eine Frage
27 Wärmebehandlung
28 Guy, fünfzehn Kilo weniger
29 Zwei + eins
30 Möglicherweise eine Grippe
31 Diagnose
32 Therapeutische Drohung
33 Thymiantee
34 Guys Entscheidung
35 Bonbons, Kaugummi und Kekse
36 Die Schwestern Lumière haben eine Heidenangst
37 Drei + zwei
38 Wassertraum
39 Hortense hat ein müdes Herz
40 Muriel hat einen Schwächeanfall
41 Schulschluss
42 Erste Spritze
43 Katzennamen
44 Die Lulus als Köche
45 Die Zeiger anhalten
46 Drahtesel
47 Erinnerungsbrief
48 Die Trennung
49 Vom Wein traurig
50 Zusammen alt werden
51 Muriels Sicht der Dinge …
52 Nüsse knacken
53 Stock, die Zweite
54 Marceline erzählt
55 Schulschluss
56 Kim, der Wirbelsturm
57 Arbeit, Projekte und Informatik
58 Ein Anflug von Traurigkeit
59 Ferdinand und seine Schilder
60 Die Kraniche
61 Simone kommt mit Geld
62 Zu wenig Salz, von wegen!
63 Eine lange Nacht (Teil 1)
64 Eine lange Nacht (Teil 2)
65 Wie zu erwarten war …
66 Yvons Hof
67 Vollmond am Samstagabend
68 Sonntag
69 Nachtwache
70 Montagmorgen etc.
www.zusammen-alt-werden.de
Übersetzung der Liedtexte
Danksagung
Für Renée und Robert, meine früheren Nachbarn Und für Alain, meinen jetzigen
Mahault, 5¾Jahre, drückt dem Nachbarsjungen einen Blumenstrauß in die Hand, den sie gerade gepflückt hat.
«Hier, pass gut auf ihn auf! Wenn deine Eltern tot sind, kannst du ihn auf ihr Grab stellen.»
(Mahault, meine Enkelin, gibt gern ihr Wissen weiter.)
Ein Haar in der Suppe ist ein Versehen,
zwei Haare sind gewollt.
Franz Bartelt
1Der Vorfall mit dem Gas
Den Bauch hat er ans Lenkrad gepresst, die Nase klebt an der Windschutzscheibe, Ferdinand ist ganz auf die Straße konzentriert. Der Tachozeiger hat sich auf fünfzig eingependelt, das ideale Tempo. So spart er nicht nur Benzin, sondern hat auch genug Zeit, die Landschaft vorbeiziehen zu sehen, das Panorama zu genießen. Und vor allem beim geringsten Anzeichen von Gefahr anzuhalten, ohne einen Unfall zu riskieren.
In dem Moment läuft vor ihm ein Hund auf die Straße. Reflexhaft tritt er auf die Bremse. Reifen quietschen, Splitt fliegt durch die Luft, die Stoßdämpfer knirschen. Der Wagen schlittert, kommt schließlich zum Stehen.
Ferdinand lehnt sich aus der Tür.
«Wo willst du denn hin, mein Guter?»
Der Hund macht einen Satz, spurtet dann am Auto vorbei und legt sich weiter vorn am Straßenrand der Länge nach ins Gras. Ferdinand klettert aus dem Wagen.
«Du gehörst doch meiner Nachbarin. Was treibst du denn hier so ganz allein?»
Er geht auf den Hund zu, streckt vorsichtig die Hand aus, streichelt ihm den Kopf. Der Hund zittert.
Nach einem kurzen Moment wird er so zutraulich, dass er bereit ist mitzukommen.
Ferdinand lässt ihn hinten ins Auto einsteigen und fährt wieder los.
Als er zu einem kleinen Weg kommt, öffnet er die Tür. Der Hund springt heraus, drückt sich jedoch an Ferdinands Beine und wimmert, als hätte er Angst. Ferdinand macht das Holztürchen auf, lockt ihn nach drinnen, doch der Hund weicht ihm nicht von der Seite, hört nicht auf zu winseln. Ferdinand geht zwischen den buschigen Hecken hindurch und gelangt schließlich zu einem kleinen Haus. Die Tür steht einen Spaltbreit offen. Hallo? Jemand da?, ruft er. Keine Antwort. Er sieht sich um, kein Mensch zu sehen. Er stößt die Tür auf. Ganz hinten im Halbdunkel kann er eine Gestalt erkennen, sie liegt auf dem Bett. Er ruft, keine Reaktion. Er schnuppert, Gott, wie es hier stinkt. Er schnuppert noch einmal. Oh, oh, es riecht nach Gas! Er rennt zum Herd, dreht die Gasflasche zu, tritt ans Bett. Madame, Madame! Mit flacher Hand bearbeitet er die Wangen der Frau, zurückhaltend zunächst, doch als sie nicht reagiert, immer heftiger. Der Hund kläfft und springt um das Bett herum. Ferdinand verliert ebenfalls die Fassung, geht zu Ohrfeigen über, schreit sie an, dass sie aufwachen soll. Sein Rufen vermischt sich mit dem Gebell des Hundes. Madame Marceline! Wuff! Wuff! Machen Sie die Augen auf, um Gottes wuff! Wachen Sie auf, ich flehe Sie an, wuff, wuff!
Schließlich gibt sie ein leises Stöhnen von sich.
Ferdinand und der Hund seufzen erleichtert auf.
2Fünf Minuten später geht’s ihr schon besser
Marceline hat wieder Farbe im Gesicht und besteht darauf, ihm etwas anzubieten. Schließlich bekommt sie nicht jeden Tag Besuch. Ferdinand und sie sind zwar Nachbarn, aber er ist zum ersten Mal bei ihr zu Hause. Das muss gefeiert werden. Da mag Ferdinand noch so oft sagen, dass er keinen Durst hat, dass er nur den Hund nach Hause bringen wollte, sie steht trotzdem auf und wankt zum Geschirrschrank, holt eine Flasche Pflaumenwein heraus und möchte seine Meinung dazu hören. Immerhin hat sie den Wein zum ersten Mal selbst gemacht. Sie sagen mir ehrlich, was Sie davon halten? Er nickt. Sie schenkt ihm ein, hält plötzlich inne, fragt besorgt, ob er noch fahren muss. Er sei auf dem Weg nach Hause, antwortet er. Von hier sind es nur fünfhundert Meter, die kann er notfalls zu Fuß zurücklegen. Beruhigt schenkt sie weiter ein. Kaum hat er das Glas mit den Lippen berührt, wird ihr schwindlig. Sie sackt auf einen Stuhl und stützt den Kopf in beide Hände. Ferdinand fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, starrt unentwegt auf die Wachstuchdecke, fährt mit dem Glas die Linien und Quadrate entlang. Er wagt nicht zu trinken und schon gar nicht zu sprechen. Nach einer Weile fragt er fast flüsternd, ob er sie ins Krankenhaus fahren soll.
«Warum?»
«Damit Sie sich untersuchen lassen.»
«Aber ich habe doch nur Kopfschmerzen.»
«Na ja, ich meine nur, wegen dem Gas.»
«Ja …»
«Das ist nicht gut.»
«Nein.»
«Wegen möglicher Begleiterscheinungen.»
«Ja?»
«Es könnte sein, dass Sie sich übergeben müssen.»
«Ach so. Das wusste ich nicht.»
Wieder folgt langes Schweigen. Sie hält die Augen geschlossen. Er nutzt die Situation, um sich ein bisschen umzuschauen. Das Zimmer ist klein, dunkel und unglaublich vollgestellt. Was ihn sogleich daran erinnert, dass bei ihm das Gegenteil der Fall ist. Fast hallt es, so leer ist das Haus. Der Gedanke stimmt ihn traurig, er widmet sich wieder der Wachstuchdecke. Schließlich fragt er sie doch.
«Ich mische mich normalerweise nicht in anderer Leute Angelegenheiten ein, Madame Marceline, das wissen Sie. Aber – könnte es vielleicht sein, dass Sie im Moment so viele Sorgen haben, dass Sie deshalb – dass Sie deshalb …?»
«Dass ich was?»
«Das Gas?»
«Was ist mit dem Gas?»
«Na ja, dass Sie …»
Jetzt wird es kompliziert. Das Thema ist viel zu persönlich, so etwas ist gar nicht sein Ding. Trotzdem spürt er, dass er etwas sagen muss. Er redet um den heißen Brei herum, flüchtet sich in Phrasen, versucht sich mit Andeutungen verständlich zu machen. (Ihm gefällt die Formulierung «zwischen den Zeilen lesen».) Er ist felsenfest davon überzeugt, dass Worte seine Gedanken nur unzulänglich wiedergeben, und würde sich am liebsten von seinem Instinkt leiten lassen. Obwohl er, wenn er ehrlich ist, zugeben muss, dass der ihm schon häufiger übel mitgespielt hat, der Schurke! Da zwangsläufig eins das andere nach sich zieht, fürchtet er, dass Marceline gleich furchtbar emotional reagieren, in Tränen ausbrechen oder gar ein Geheimnis lüften könnte. Der Gedanke gefällt ihm überhaupt nicht. Um wie vieles leichter wäre das Leben, wenn jeder sich einfach nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmern würde! Bei seiner Frau hatte er ein Mittel parat, um allzu intimen Unterhaltungen zu entgehen: Sobald er spürte, dass sie in diese Richtung abzudriften drohte, fing er an, von der Vergangenheit zu reden. Ein dahingesagtes Wort genügte, fortan brauchte er nur noch mit halbem Ohr hinzuhören. Sie hat das Plaudern geliebt, seine arme Frau. Das Plaudern über alles, über nichts, über Banalitäten, ein echtes Waschweib. Was sie am meisten geliebt hat, waren Gespräche über die Vergangenheit, ihre Jugend, darüber, dass früher alles besser war. Um wie viel schöner damals alles war, vor allem, bevor sie sich kennengelernt hatten! Es endete immer damit, dass sie voller Zorn aufzählte, was sie anderswo hätte erleben können, in Amerika, in Australien, vielleicht auch in Kanada. Na klar, warum nicht, möglich wäre es schon gewesen. Wenn er sie nur nicht zum Tanz aufgefordert, ihr zärtliche Worte ins Ohr geflüstert, sie nicht so fest an sich gedrückt hätte, auf diesem verfluchten Ball am 14. Juli. Unendliches Bedauern.
Er nahm es ihr nicht übel. Auch er hatte geträumt, von großartigen Dingen. Doch er hatte rasch begriffen, dass seine Träume und die Liebe nicht miteinander zu vereinbaren waren. Vielleicht war er auch einfach nicht für die Liebe geschaffen. Oder seine Zeit war noch nicht gekommen. Er musste noch warten, auf ein anderes Leben vielleicht, wie die Katzen.
Gut. Zurück zur Gegenwart.
Er ist im Haus seiner Nachbarin. Sie hat ein Problem, scheint aber – trotz seiner vorsichtigen Fragen – nicht darüber reden zu wollen. Er weiß nicht viel über sie, nur, dass sie Marceline heißt. Sie verkauft Honig, Obst und Gemüse auf dem Markt und kommt wahrscheinlich nicht von hier. Sie könnte Russin sein oder Ungarin? Jedenfalls stammt sie aus einem östlichen Land. Und sie ist noch nicht lange hier, ein paar Jahre erst. Sechs oder sieben? Na ja, immerhin …
Er sieht sich weiter um. Diesmal fällt ihm auf, dass über der Spüle kein Warmwasserboiler hängt, auch sind weder Kühlschrank noch Waschmaschine oder Fernseher zu sehen. Keinerlei moderner Komfort. Wie früher, als er ein Kind war. Damals hatten sie nur ein Radio, um sich auf dem Laufenden zu halten, und kaltes Wasser aus dem Hahn. Im Winter, daran erinnert er sich gut, versuchte er stets, sich vor dem Waschen zu drücken. Auch vor der Mühsal des Wäschewaschens, wenn die Sachen steif und eisig aus dem Brunnen kamen und er beim Auswringen helfen musste, mit seinen rissigen Fingerkuppen. Was hat man sich damals abgerackert, meine Güte! Vielleicht, überlegt er, hat die arme Madame Marceline auch genug gehabt von diesem Leben. Von der Härte und all den Widrigkeiten. Womöglich hat sie den Mut verloren. Und außerdem ist sie weit weg von ihrer Heimat, von ihrer Familie. Das könnte sehr wohl der Grund sein …
Er spürt, dass er nicht drum herum kommt. Dass er die Sache in die Hand nehmen, dass er reden muss. Über andere Dinge als Nichtigkeiten, den Regen oder das schöne Wetter. Oder ihren Hund. Ein schlaues Kerlchen, was? Mit dem haben Sie einen Glücksgriff getan. Mein letzter war ziemlich dusselig, aber dafür sehr anhänglich. Der hier … Das ist ein Weibchen? Sind Sie sicher? Ich habe vorhin nicht genau hingeschaut.
Er holt tief Luft und gibt sich einen Ruck. Ohne Umschweife sagt er, dass er versteht. Dass auch er schon ein- oder zweimal so weit war. Dreimal sogar. Na ja, um ganz ehrlich zu sein, viermal. Ja, aber – dann hat er sich Zeit genommen und nachgedacht. Und hat sehr gute Gründe gefunden, die dagegensprachen. Wie zum Beispiel … Auf die Schnelle fällt ihm nichts ein. Na klar, wie konnte er es vergessen: seine Enkel! Enkel sind ein Segen. Sind hinreißend. Und so anders als die eigenen Kinder. Doch, wirklich: goldiger, lebhafter und viel intelligenter. Vielleicht liegt es an der Zeit, in der wir leben. Ja, die Zeiten haben sich wahrhaftig geändert. Oder wir werden im Alter einfach geduldiger. Schon möglich … Sie haben keine? Überhaupt keine Kinder? Mist. Das ist schade. Aber es gibt noch andere Dinge, an die man sein Herz hängen kann. Warten Sie mal, ich denke nach.
Sie hebt den Blick, starrt zur Decke.
Er kratzt sich am Kopf, überlegt krampfhaft, was er sagen könnte.
«Wissen Sie, von Zeit zu Zeit muss man sich in Erinnerung rufen, dass es anderen noch schlimmer geht. Das holt einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, rückt die Dinge ins rechte Licht. Manchmal braucht man das, finden Sie nicht?»
Sie wirkt abwesend. Er sucht nach einem lustigen Spruch.
«Da kein Mensch je zurückgekommen ist, um uns zu sagen, wie es auf der anderen Seite aussieht, muss man sich vielleicht nicht gerade vordrängeln, Madame Marceline? Man muss auch warten können.»
Er kichert. Wartet auf ihre Reaktion.
Nichts.
Jetzt macht er sich ernsthaft Sorgen. Beugt sich zu ihr vor. Verstehen Sie, was ich sage? Vielleicht benutze ich ja Wörter, die Sie nicht …
Sie zeigt auf den Schlauch am Gasherd und sagt mit leicht zittriger Stimme, das Problem befindet sich dort, sie hat die ganze Zeit danach gesucht. Schuld an dem Schlamassel ist Mosche, ihr alter Kater. Er ist vor ein paar Tagen verschwunden. Vielleicht ist er tot? Hoffentlich nicht. Das wäre ein herber Verlust … In der Zwischenzeit ist hier das Chaos ausgebrochen. Sie machen, was sie wollen, die Mäuse. Tanzen die ganze Zeit. Die ganze Nacht, den ganzen Tag. In den Schränken, unter dem Bett, im Fliegenschrank. Sie knabbern alles an, alles. Sie hat das Gefühl, verrückt zu werden! Wenn das so weitergeht, klettern sie noch auf den Tisch und futtern von ihrem Teller, sie sind dermaßen frech, die kleinen Biester!
Ferdinand hat sich ausgeklinkt. Er hört kaum noch zu. Jetzt redet sie nur noch wirres Zeug, die arme Frau. Das Gas ist schuld. Ihre Geschichte von dem toten Kater und den tanzenden Mäusen ist völlig abstrus. Er sieht ihr beim Reden zu, dann senkt er den Blick auf ihre Hände. Sie hat schöne, abgearbeitete Hände. Es muss an der Gartenarbeit liegen, sie müsste sie pflegen, sie eincremen, das würde ihnen guttun. Dabei sieht sie jünger aus, als er sie geschätzt hätte. In den Sechzig…
Plötzlich steht sie auf. Überrascht zuckt er zusammen, erhebt sich ebenfalls. Sie findet es reichlich ärgerlich, sich nur mit Luft zu unterhalten, sagt sie. Es geht ihr auch schon viel besser. Vielen Dank für alles, er kann jetzt gehen, sie wird sich hinlegen und ein wenig ausruhen. Das Gas hat ihr ziemlich zugesetzt. Ferdinand wirft einen Blick auf die Pendeluhr an der Wand: halb fünf, ganz schön früh, um sich schlafen zu legen. Er wundert sich. Sie wird ihn nicht zur Tür begleiten, sagt sie, er findet bestimmt selbst hinaus. Selbstverständlich, sagt er und unterdrückt ein Grinsen. In einem Haus mit nur einem Zimmer kann man sich schwerlich verlaufen! Er streicht der Hündin über den Kopf. Nun gut, auf Wiedersehen, Madame Marceline. Wenn Sie irgendetwas brauchen, rufen Sie mich an. Danke, ja, das mache ich. Sie zuckt mit den Schultern, brummt etwas in sich hinein: Sobald das Telefon angeschlossen ist …
Während Ferdinand zu seinem Wagen zurückkehrt, versucht er zu verstehen, was soeben passiert ist. Diese Frau, die fast an einer Gasvergiftung gestorben wäre, lebt seit Jahren in diesem winzigen Haus, wenige Schritte von ihm entfernt, er ist ihr bestimmt schon hundertmal begegnet, auf der Straße, bei der Post, auf dem Markt, hat kaum je ein Wort mit ihr gewechselt, mal über das Wetter oder die Honigernte … Und jetzt, rums! Läuft ihm ihr Hund – äh, ihre Hündin – über den Weg … Und wenn er vorhin nicht angehalten hätte, um das Tier nach Hause zu bringen, wäre die gute Madame Marceline zur Stunde ganz sicher tot! Und kein Mensch würde sich darum scheren.
Scheiße.
Das ist nicht witzig.
Er steigt ins Auto, fährt los. Bereut, dass er vorhin nicht auf ihre Frage geantwortet hat. Ihr ehrlich gesagt hat, was er von ihrem Pflaumenwein hält. Dass ihr der Wein ausgesprochen gut gelungen ist. Alle Achtung, für eine Premiere, Madame Marceline! Henriette, seine verstorbene Frau, hat früher auch welchen gemacht. Aber der war nie so gut. Doch, doch, wenn ich es Ihnen sage, das meine ich ernst.
In ihrem Häuschen legt Marceline sich aufs Bett.
Ihr Kopf tut nicht mehr so weh. Sie kann wieder denken.
Drolliger Kerl, dieser Ferdinand. Und was für ein Schwätzer! Er hat pausenlos geredet, ganz schön anstrengend. Sie hat nicht alles verstanden. Die Geschichte mit dem Licht, in das die Dinge gerückt werden müssen, zum Beispiel, warum hat er das wohl gesagt, merkwürdig. Er muss eine schwere Depression hinter sich haben und scheint jemandem sein Herz ausschütten zu wollen. Es war etwas ermüdend, aber Zuhören war das mindeste, was sie für ihn tun konnte. Es war jedenfalls sehr nett von ihm gewesen, ihr den Hund zurückzubringen. Sie muss sich das nächste Mal unbedingt bei ihm bedanken. Mit einem Glas Honig vielleicht, wenn er den mag.
Und auf einen Schlag kehren Erinnerungen wieder. An seine Frau. Oje, die war alles andere als sympathisch! Sie war sogar ziemlich unausstehlich gewesen, ganz am Anfang, als Marceline hier noch niemanden kannte. Die Tiere hatten Hunger, sie auch. Sie hatte sich Gemüse aus dem Garten geholt und dann angefangen, diesen zu bestellen. Um genug zu essen zu haben und sich ein paar Groschen dazuzuverdienen, während sie über die Zukunft nachdachte. Doch allen Anstrengungen zum Trotz war das erste Jahr ein Fiasko gewesen. In reifem Zustand waren ihre Karotten groß wie Radieschen gewesen und ihre Zwiebeln so winzig wie kleine Murmeln! Und jede Woche, wenn die gnädige Frau Henriette zum Markt kam, blieb sie vor dem Stand stehen und betrachtete abschätzig ihr Gemüse. Im Jahr darauf hatte sich die Lage gebessert. Die Karotten ähnelten allmählich Karotten, der Lauch war über die Größe eines Füllfederhalters hinausgewachsen. Und die gute Henriette fing an, ihr Kleinigkeiten abzukaufen, mal dies, mal das, wobei sie jedes Mal so tat, als handle es sich um ein Almosen. Am liebsten hätte Marceline sie zum Teufel gejagt. Aber das konnte sie sich nicht leisten. Ja, wirklich, sie hatte die Frau gehasst.
Ehen sind und bleiben ein Rätsel, sagt sie sich. Auch ihre eigene, keine Frage. Sie hat keine große Lust, darüber nachzudenken. Es kommt ihr so weit weg vor, fast wie in einem anderen Leben. Aber diese beiden, unglaublich … Henriette und Ferdinand. Ohne sie wirklich gekannt zu haben, fragt sie sich, wie sie es miteinander ausgehalten haben, wo sie so unterschiedlich waren. Warum hatte keiner von ihnen das Weite gesucht, als das Feuer der Leidenschaft nachließ? Tja, solche Gedanken bringen nichts. Er wirkt auf den ersten Blick jedenfalls ganz anders als sie. Hinter seinem etwas steifen, distanzierten Äußeren scheint sich nichts Bösartiges zu verbergen. Mit seiner großen Wunde, die schwer auf seinem Brustkorb lastet und die er um jeden Preis verstecken will, hat er etwas Rührendes. Wenn er von seinen Enkeln spricht, sieht man genau, dass er sie vermisst, er hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass sie ausgezogen sind. Es muss ein Schock für ihn gewesen sein, plötzlich allein auf diesem großen leeren Bauernhof zu leben.
Der arme Kerl.
Das ist nicht witzig.
Als es dunkel wurde, stand Marceline wieder auf. Ihre Kopfschmerzen waren verschwunden. Sie untersuchte zunächst den Gasschlauch, an dem die Mäuse genagt hatten. Ein langes Stück war noch intakt. Das konnte sie reparieren, danach setzte sie ihre Suppe auf.
3Ein Geschenk am frühen Morgen
Als Ferdinand am nächsten Morgen erwachte, entfuhr ihm ein: «Mist!» Seit geraumer Zeit achtete er sehr auf eine gepflegtere Ausdrucksweise. Damit seine Schwiegertochter Isabelle keine Ausrede mehr hatte, ihm seine Enkel vorzuenthalten. Darum rief er also «Mist!» und nicht «Scheiße», als ihm auffiel, dass das Bettzeug nass war. Ganz offensichtlich hatte er wieder dasselbe geträumt wie in den letzten drei Nächten. In seinem Traum schwamm er wie ein Fisch im warmen, blauen Wasser und wurde von Delphinen begleitet. Er hatte noch nie welche live gesehen, nur im Fernsehen, in Tierfilmen oder in Sendungen über das Meer. Aber als er aufwachte, ging es erst richtig los. Ferdinand war noch ganz benommen und tastete wie jeden Morgen auf der Suche nach seinen Pantoffeln mit dem linken Fuß die Umgebung seines Bettes ab. Als seine Zehen etwas Weiches und Lauwarmes berührten, stand er automatisch auf und wollte hineinschlüpfen. In dem Moment rutschte ihm dann doch ein «Verdammte Scheiße!» heraus. Was in seiner Situation durchaus verständlich war, denn er war auf einen Tierkadaver getreten. Die allmorgendliche Maus, ein Geschenk seines Katers. Um genau zu sein: des Katers seiner heißgeliebten Enkel, den sie gemeinsam Lolli getauft hatten. Da seine Schwiegertochter Isabelle zwei Tage vor ihrem Auszug plötzlich allergisch auf Katzenhaare reagiert hatte, hatte er das Tier wohl oder übel dabehalten müssen. Ja, ja, ist schon in Ordnung, Opa Ferdinand kümmert sich um euern Lolli. Macht euch keine Sorgen. Ich passe gut auf ihn auf. Und ihr könnt ihn jederzeit besuchen kommen, okay? He, ihr Lulus, jetzt ist gut mit Weinen, ja?
Hätte er die Wahl gehabt, wäre ihm ein Hund lieber gewesen, auch wenn er vor sechs Monaten geschworen hatte, sich nach Velcro keinen mehr zuzulegen. Der hatte sich ziemlich dämlich angestellt, ihm nicht gehorcht und war als Wachhund eher mittelmäßig gewesen, dafür aber sehr anhänglich. Und das entschädigte für alles. Ach, wie sehr er ihm fehlte, der Bursche! Mit Katzen war es einfach: Die mochte er nicht. Sie waren durchtrieben, hinterlistig, die reinsten Diebe und so weiter. Sie taugten lediglich für die Jagd auf Mäuse und Ratten. Und das auch nur, wenn man die richtige erwischte. In puncto Gehorsamkeit war von vornherein klar, dass man schlechte Karten hatte. Und auch, was die Anhänglichkeit betraf, musste man sich bescheiden. Es konnte sogar sein, dass man ganz darauf verzichten musste.
Die Folgen: Am Tag des Umzugs hatte sich die kleine Fellkugel abends auf seinem Bett breitgemacht, und er hatte es nicht gewagt, ihn zu vertreiben, er war noch so klein … Am zweiten Tag war er unter die Bettdecke gekrochen, hatte sich an ihn geschmiegt, das Mäulchen in seine Ohrmuschel gesteckt, total süß; am vierten kratzte er an den Füßen des Sessels, ohne dass es ihn im mindesten störte, und am Ende der Woche futterte er auf dem Tisch aus einer Schüssel, die mit seinem Namen beschriftet war. Fehlte nur noch der Serviettenring, dann wäre das Szenario perfekt gewesen.
Fast zwei Monate ist es her, dass sein Sohn Roland, Isabelle und die beiden Kinder ausgezogen sind. Dass sie den Hof verlassen und Ferdinand mit dem Kater allein gelassen haben. An manchen Tagen fragt er sich – leicht erstaunt –, ob er dieses einschneidende Erlebnis und den damit verbundenen Schmerz so gut verkraftet hätte, wenn Lolli nicht an seiner Seite gewesen wäre.
Für weiteres Erstaunen sorgte seine tiefgreifende Wesensänderung. Er, der kühle Ferdinand, der Fels in der Brandung, den nichts aus der Bahn warf. Damit war es vorbei. Von heute auf morgen wurde er empfindsam. Ihm kamen beim geringsten Anlass die Tränen, plötzlich nahm er sich alles zu Herzen. Seine Schutzschicht hatte Risse bekommen. Vielmehr ein großes Loch. Das er mit allen Mitteln zu stopfen versuchte.
Natürlich erzählt er niemandem davon. Er konnte sich noch nie besonders gut ausdrücken, schon gar nicht, wenn es um seine Gefühle ging. Es kam ihm dann immer so vor, als würde er sich an einem Markttag mitten auf dem großen Platz nackt ausziehen. Das ist nichts für ihn. Er behält seine Gedanken lieber für sich, tief vergraben, das ist einfacher.
Daher weiß kein Mensch, dass der Auszug der Kinder und die damit einhergehende Leere ihn tief verletzt haben. Ritsch, ratsch! Eine riesige Schnittwunde quer über der Brust. Es wird dauern, bis diese Wunde verheilt. Monate oder Jahre. Vielleicht auch nie. Gut möglich, dass das so ist.
Nachdem er zunächst auf die tote Maus gestoßen war, hatte er seinen Pantoffel schließlich unter der Kommode gefunden, den Tierkadaver beim Schwanz gepackt und draußen auf den Misthaufen geworfen.
Und in diesem Moment, im Pyjama draußen auf dem Hof, die Hose noch feucht, fragte er sich verzweifelt, wie er dem Kater beibringen könnte, dass es besser wäre, viel besser, wenn es seine Beute fressen würde. Sinnloses Töten war Verschwendung. Das war eine Spezialität der Menschen. Wozu? So etwas sollte man nicht nachahmen, Lolli.
Nur: Wie konnte man das einem Kater erklären? Einem kleinen noch dazu. Kaum vier Monate alt. Was sieben Menschenjahren entspricht. Wie sollte er das verstehen?
Nein, seit einiger Zeit erkannte er sich wahrhaftig nicht wieder, der Ferdinand. Er musste sich unbedingt wieder fangen.
Am späten Vormittag zog der Himmel frei. Ferdinand nutzte das Wetter, um Wäsche zu waschen.
Die Sache war dringend.
Drei Nächte in Folge derselbe Traum, schon hatte er kein sauberes Laken mehr im Schrank. Und auch keine Pyjamahose.
Übrigens: Sollte er eines Tages jemandem erzählen müssen, was er nach dem Auszug der Kinder empfunden hatte, würde er sagen, dass sich, nachdem der letzte Koffer eingeladen war, die letzten Küsse an die Kleinen verteilt waren und sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, unter seinen Füßen ein großes Loch aufgetan hatte, ein schwarzes Loch, tiefer als ein Schacht. Und dass ihn das Schwindelgefühl, das ihn in dem Moment erfasst hatte, seither nicht mehr losgelassen hat. Es würde von nun an zu seinem Leben dazugehören. Das hatte er begriffen.
Aber die Chance ist gering, dass er eines Tages davon erzählen wird.
Es ist nicht sein Ding, sich vor anderen zu entblößen.
4Ferdinand langweilt sich, aber nicht lange
Nach dem Essen hängte er im Freien die Wäsche auf. Dann drückte er sich bei der Scheune herum. Als er an seinem Traktor vorbeikam, konnte er nicht widerstehen. Er kletterte auf den Sitz und ließ den Motor an, um zu sehen, ob er es noch tat. Anschließend ging er in die Werkstatt. Auf der Werkbank lag seit Wochen das Schild für Alfred, erst zur Hälfte graviert. Es war immer noch nicht fertig. Mit schlechtem Gewissen beäugte er das Werkzeug, begann mechanisch, alte Nägel zu sortieren. Er hatte einfach keine Lust zu arbeiten. Was soll’s? Also stieg er ins Auto, und als er an dem kleinen Weg vorbeikam, der zu Marcelines Haus führte, fuhr er langsamer, überlegte kurz, ob er halten und sich nach ihrem Zustand erkundigen sollte, beschloss aber, später am Abend bei ihr vorbeizuschauen. Und fuhr weiter ins Dorf. Nachdem er das Auto weit weg vom Marktplatz abgestellt hatte, nahm er einen Stock aus dem Kofferraum und schleppte sich übertrieben humpelnd die Hauptstraße hinauf. Er begegnete keiner Menschenseele. Was ihn ein wenig enttäuschte. Als er das Café am Platz erreichte, bestellte er sich ein Glas Weißwein und setzte sich draußen an einen der Tische. Das machte er seit zwei Monaten so.
Die Rathausuhr zeigte halb vier.
Er brauchte nur noch eine Stunde auszuharren, dann war die Schule aus und der Moment gekommen, in dem er seine Enkel sehen durfte. Seine Lulus. Ludovic acht Jahre alt, Lucien sechs. Er könnte ihnen einen Kuss auf die Wange drücken, bevor Isabelle herbeieilte und sie ihm entzog, um sie schnell in ihr neues Zuhause zu bringen unter dem Vorwand – den sie in leicht bedauerlichem Ton vorbrachte –, sie hätten ja so viele Hausaufgaben!
Der Gedanke daran schnürte ihm die Kehle zu.
Er trank etwas Weißwein, um den Kloß hinunterzuschlucken.
Dann sah er sich um. Nichts zu sehen.
Ihn fröstelte.
Am Himmel versuchte ein Sonnenstrahl, sich an zwei grauen Wolken vorbeizumogeln. Ferdinand schloss die Augen und hielt das Gesicht in die Sonne, um sich wieder aufzuwärmen. Doch die Ruhe war nicht von langer Dauer. Rasche Schritte auf dem Bürgersteig. Klack klack klack klack. Ein junges Mädchen näherte sich im Kostümrock und mit hochhackigen Schuhen. Eine Seltenheit in dieser Gegend. Er überschlug rasch, dass ihm sieben Sekunden blieben, bis sie an ihm vorbeikam … sechs, fünf … schob seinen Stock … vier, drei … nach vorne … zwei, eins. Bingo. Das Mädchen stolperte und verdrehte sich den Knöchel. Aua, schrie sie. Sie wollte gerade dem Mistkerl, der ihr absichtlich seinen Stock in den Weg gestellt hatte, eine entsprechende Bemerkung an den Kopf werfen, als ihr Blick an Ferdinand hängenblieb. Es war ihm gelungen, einen derart besorgten und zutiefst zerknirschten Gesichtsausdruck aufzusetzen, dass sie lächeln musste. Aber sie besann sich rasch, warf ihm mit zusammengezogenen Augenbrauen einen bösen Blick zu und drohte ihm mit dem Zeigefinger, womit sie zum Ausdruck bringen wollte, dass die Masche mit dem armen Unschuldslamm bei ihr nicht zog. Sie kannte die Tricks der Alten in- und auswendig. Schließlich hatte sie vier Großeltern gehabt und ihr Berufspraktikum in der neunten Klasse in einem Altenheim absolviert, also Obacht … In dem Moment senkte er den Kopf. Und Muriel gefiel die Vorstellung, dass ihre Botschaft angekommen war. Zufrieden machte sie sich daran, ihre Kleider wieder zurechtzurücken. Strich sorgfältig den Rock glatt – wobei sie vor allem der Rückseite große Aufmerksamkeit angedeihen ließ, denn Falten am Po haben echt keinen Stil –, klopfte den Staub von ihrer Tasche, indem sie sie mehrmals gegen die Unterschenkel schlug, fing eine Strähne ein, die sich aus der Frisur gelöst hatte, und lief, ohne Ferdinand noch eines Blickes zu würdigen, weiter. Plötzlich hatte sie Angst, zu spät zu kommen (zu ihrem Termin mit dem Immobilienfritzen wegen des Zimmers, das sie mieten wollte, aber was sollte sie ihm erzählen, wo sie weder eine Kaution noch sonst etwas zu bieten hatte, oje …).





























