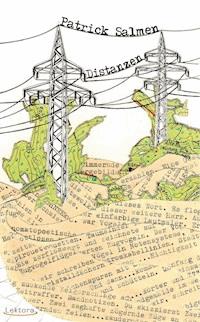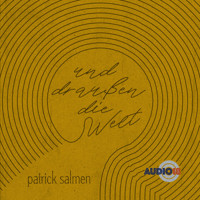Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lektora
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
"Auf einer Zisterne, inmitten eines stillgelegten Industriehofes, sitzt ein Vogel. Von einem abgelegenen Fenster aus beobachtet ihn ein kleiner Junge durch sein Fernglas. Das könnte der Anfang einer sehr schönen Geschichte sein. Solch eine Zisterne, der Industriehof, der Vogel, ein Kindlein am Fenster – das wären doch wahrlich poetische Grundlagen. Doch leider kann der VogeI nicht fliegen. Bedauernswert."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Und draußen die Welt
Patrick Salmen
Kurzgeschichten & Miniaturen
2008–2013
Erste Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
Copyright 2021 by
Lektora GmbH
Schildern 17–19
33098 Paderborn
Tel.: 05251 6886809
Fax: 05251 6886815
www.lektora.de
Covermotiv & -montage: Olivier Kleine, www.olivierkleine.de
Lektorat & Layout Inhalt: Denise Bretz, Lektora GmbH
ISBN: 978-3-9546-117-37
Bei den meisten Texten handelt es sich um neue Fassungen von Texten, die bereits in folgenden Büchern erschienen sind: „Distanzen“, „Tabakblätter und Fallschirmspringer“ und „Das bisschen Schönheit werden wir nicht mehr los“.
BEIM BLICK NACH OBEN
Übliches: Äste, Wolken, Leitungen.
Wolken, langsam,
in sich gekehrt. Als suchten sie
Heimat und fänden
bloß Himmel.
Himmel, der sich öffnet
Und dann schließt.
(Lydia Daher)
„Einer geht jahrelang jeden Tag, bei jedem Wetter auf einen Berg, nach Feierabend, drei Stunden Marsch, und trägt jedesmal einen großen Stein mit sich. Nach vielen Jahren hat er eine riesige Pyramide gebaut. Er äußert sich nicht dazu und möchte nicht darauf angesprochen werden.“
(Peter Bichsel)
Vorwort
Lieber Leser, liebe Leserin,
folgende Miniaturen und Kurzgeschichten stammen aus dem Zeitraum von 2008–2013. Die meisten Texte erschienen bereits in meinen ersten drei Büchern. Für diese Neuauflage habe ich sie überarbeitet und neu zusammengestellt.
Wie wahrscheinlich jeder Autor von sich behaupten würde, hat meine Art, zu schreiben, sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Vielleicht weil das Schreiben damals ein wesentlich unbefangenerer und ungefilterter Prozess war. Weil man beim Versuch, das Leben in eine poetische Sprache zu übersetzen, keine Angst hatte, auch nur ansatzweise ins Verklärende abzugleiten, die Dinge zu überzeichnen oder sich zu sehr in Melancholie zu suhlen. Auch wenn sie mir im Nachhinein ein wenig fremd erscheinen, bin ich wahnsinnig stolz auf diese Geschichten, so schwer es auch fällt, sich das vor lauter Selbstzweifeln manchmal einzugestehen. Ihre Bilder und Leitmotive begleiten mich noch immer.
Für diesen Band habe ich meine persönlichen Lieblingsgeschichten ausgesucht. Dies waren meine ersten Schritte als Autor und der Versuch, eine eigene Sprache zu finden: Geschichten, die sich mit dem Schreiben auseinandersetzen, über das Scheitern, die Faszination von Kränen und Strommasten und die Angst vor dem Vergessen. Geschichten über Väter, die Traurigkeit und den Zauber der Symmetrie. Geschichten über grüne Gießkannen. Vorwiegend über grüne Gießkannen.
Der Bahnhof
Am Rande des Industriegebiets. Horizontkonturen von Fabrikschloten und alten Zechen. Eine verlorene und doch wunderschöne Welt. Es scheint, als liege noch immer ein hauchdünner Film von Kohlenstaub auf den Feldern. Kleingartensiedlungen. Vor lackierten Holzzäunen wachende Gartenzwerge. Lauernde Heckenschützen, schmale Pfade zwischen Holunder und Hibiskus. Doch viele weitere Kilometer entfernt, da gibt es sie nicht mehr: die Gartenzwerge, die Kleingartenlauben, die Menschen. Da gibt es nicht mehr als die Felder. Wenn die gelben und grünen Flächen nicht als Zeichnungen auf den Landkarten existieren würden, dann würde man manchmal glauben, sie seien nur Kulissen, eine Art Fata Morgana, die man nur wahrnimmt, wenn man im Zug sitzt und aus dem Fenster blickt. Verlorene Paradiese. In der Spätsommerseptembersonne glitzernde Roggenfelder. Nur die Gleise und Strommasten erinnern an den Kontakt zu einer fernen Welt, lassen die Illusion von Distanzlosigkeit bestehen. Die Stille ist manchmal nicht mehr als ein Surren.
Die rostigen Gleise der Eisenbahn. Man erzählte den Kindern damals, dass ein einziger Mann die Gleise aus flüssigem Stahl gegossen habe. Er habe sich vorgenommen, alle Städte dieser Welt zu verbinden, denn er fürchtete, sie könnten sich sonst aus den Augen verlieren. Es ist wie bei den Menschen. Manchmal sollte man jemanden an der Hand nehmen, wenn man nicht will, dass er verschwindet.
Dann sei er losgezogen und habe die Schienen gegossen. Ganz alleine, im ganzen Land. Nach vielen langen Jahren sei er wiedergekommen, habe sich auf die alte Holzbank gesetzt, kurz durchgeschnauft und gemurmelt: „Jetzt habe ich mir eine Mütze Schlaf verdient“, so als hätte er soeben nur ein paar Eimer Kohlen geschaufelt oder kurz die Blumen gegossen. Aber er war über fünfundzwanzig Jahre unterwegs. Er soll dann einen halben Tag geschlafen und sich am nächsten Morgen wieder um seinen Bauernhof gekümmert haben. „Und wie hat er den flüssigen Stahl transportiert?“, fragte eines der Kinder.
„Er hatte einen Kupferkessel dabei. Dieser Kupferkessel war sehr groß. So ungefähr.“ Und während sein Vater das sagte, streckte er die Arme so weit, wie es nur eben ging, auseinander.
„Das glaube ich dir nicht. Wie soll der Stahl denn dann hart geworden sein?“
„Na ja, er hat gepustet. Ich erzählte dir bereits, dass er sehr lange unterwegs war. Aber er hatte Begleitung, und zwar vom Landvermesser.“
„Aber vorhin hast du gesagt, er sei alleine gewesen.“
„Nein, habe ich nicht. Der Landvermesser hat jedenfalls die Schritte gezählt, und wenn er gerade nichts zu tun hatte, dann half er ihm beim Pusten. Es war eine lange Reise, denn der Landvermesser hat kurz vorm Ziel plötzlich die Zahl aus seinem Gedächtnis verloren und dann mussten sie wieder zurück und von vorne beginnen. Der Stahlgießer hat dann natürlich auf dem Rückweg auch wieder zwei Schienen verlegt. Das ist auch der Grund, warum es immer zwei Gleise nebeneinander gibt. Wenn der Landvermesser nicht so vergesslich gewesen wäre, dann wäre alles ganz anders gekommen.“
„Ich glaube dir nicht. Landkarten gibt es doch schon viel länger als Eisenbahnschienen. Warum sollte der Landvermesser denn alles nochmal gezählt haben?“
„Nun ja, er glaubte den Karten nicht. Er wollt es selber herausfinden.“
„Und wie viele Schritte waren es?“
„Musst du nicht langsam wieder ins Bett? Das erzähle ich dir morgen.“
Auch anderen Kindern erzählte man diese Geschichte. Und dann überlegten manche Väter nächtelang, wie viele Schritte es wohl gewesen sein könnten. Sie hofften insgeheim, dass die Kinder ihre Fragen vergessen würden, aber das geschah in den seltensten Fällen. Manche Väter sollen die ganze weite Strecke dann abermals zu Fuß abgegangen sein, nur um eine glaubwürdige Antwort zu haben. Natürlich kam immer eine andere Zahl dabei heraus, weil alle diese Männer Schritte unterschiedlichster Größe machten. Es war wirklich kein einfaches Unterfangen mit dem Landvermessen.
Heute sind die Kinder fort. Auch die Väter sind fort. Die meisten zogen in die Stadt, denn als die Eisenbahnen dann einmal fuhren, da war es ihnen ein Leichtes, neue Orte zu entdecken. Übrig blieben nicht mehr viele. Zwischen Betonbauten und Industrieidyllen, da schlummern sie, die Dagebliebenen. Sie sind nicht mehr als eine verzerrt verschwommene Linie aus dem Blickwinkel eines Zugführers, ein kleiner Punkt von oben aus der Perspektive eines Zeppelins. Ein leerer Fleck auf der Landkarte, irgendwo da draußen. Die Dagebliebenen. Die Wahrhaften. Manchmal glaubt man, sie seien nicht mehr als eine Kulisse.
Und er … er ist einer von ihnen. Er sitzt dort auf seinem Rasenmäher, zeichnet feine Linien ins Kornfeld und schaut auf die vorbeifahrenden Züge. Dann und wann winkt er den Kindern zu. Vor einigen Jahren, da hat er sich mit einem Schild an die Gleise gestellt. Amerika stand in schöner Schreibschrift auf der Pappe. Früher, da träumte er von Amerika.
Und irgendwann später, nachdem die Züge immer wieder an ihm vorbeigefahren waren, da kam er auf eine andere Idee. Er ging in die Scheune und suchte etwas Holz zusammen, trug es Stück für Stück an die Gleise und dann … Dann hat er sich einen Bahnhof gebaut. Einen ganz kleinen Bahnhof aus ein paar alten Brettern, Nägeln und ein wenig Dachpappe.
Es war der kleinste Bahnhof der Welt, womöglich aber auch der schönste. Der Zug jedoch hielt hier auch weiterhin nicht. Der Mann blieb ein verzerrter Punkt vor der Kulisse. Aber immer wieder kommt er hierher, hält ein wenig inne und beobachtet die Schienen.
Manchmal sitzt man im Zug und bekommt urplötzlich das Gefühl, anhalten zu müssen. Wenn man diesen Druck auf den Ohren hat. Immer dann, wenn die Landschaft nicht mehr ist als ein einziges verschwommenes Aquarell. Immer dann, wenn man die Felder sieht – die Strommasten, die Vögel. Nur die Vögel, sie kommen noch zu Besuch. Sie setzen sich auf die Hochspannungsleitungen und singen ein leises Lied in Dur. Es gibt sie, diese Paradiese. Fernab von Braunkohlewerken, Gaskesseln und Kraftwerken, fernab der Schrebergärten, fernab der Stadt, da surren sie. Dann ist das Surren die einzige Form von Stille, die geblieben ist.
Da sitzt er nun, der alte Herr auf dem Rasenmäher, direkt neben seinem kleinen Bahnhof. Langsam fängt es an, zu rattern. Die Eisenbahn, ein leises Pfeifen. Ein Junge sitzt im Abteil, presst seine Nase fest an das Fenster und beobachtet die Landschaft. Im Hintergrund: Silos, Heuballen und Traktoren. Eine Schaufel lehnt an der Scheune. Die wohl schönste Form von Reduktion. Nichts als Felder. Plötzlich sieht der Junge den alten Mann auf dem Rasenmäher direkt neben der selbst gebauten Bretterhütte. Der alte Mann sieht den Jungen und winkt ihm zu. Der Junge fragt seinen Vater, warum der Zug denn nicht anhalte. Dort sei schließlich ein Bahnhof gewesen. Ein Mann habe daneben gesessen. Auf einem Rasenmäher. „Bahnhöfe gibt es hier nicht“, sagt sein Vater. „Hier gibt es nur Felder.“
Früher, da wollte er nach Amerika.
Ach, unser Ludwig
Sie sagen, sein Leben wäre stets von einer gewissen Theatralik durchdrungen gewesen. Seine Blicke seien klar, die Gesten bedacht und in seiner Stimme läge immer ein gewisses Pathos. Wenn er spräche, dann klar und betont, jedes Wort wie gedruckt, die Sätze verschachtelt und sorgsam gewählt. Aus ihm wäre ein guter Schauspieler geworden. Ach, hätte er doch bloß nicht so viel getrunken. Und wenn doch die schlimmen Jahre nicht gewesen wären, und wenn doch die Frauen und die Schulden nicht … und wenn doch die Welt an sich eine gerechte gewesen wäre. Dann wäre doch alles ganz anders gekommen. „Ach, unser Ludwig.“ Die Männer am Tresen betrachten das Bild an der Wand. Der Wirt schenkt schweigend aus.
Was die Männer nicht wissen: Vor vielen Jahren sollte Ludwig erstmals in einem Theaterstück mitwirken. Er bekam die tragikomische Nebenrolle eines verwahrlosten Trinkers zugeteilt. Zum Stück selbst ist er damals nicht erschienen. Aber noch heute erzählen sie dort, wie souverän und gewissenhaft er bei den Proben gewesen sei, wie sehr er seine Rolle verinnerlicht und perfektioniert hätte. Und während sie von ihm sprechen, nehmen sie ganz unbewusst seine Haltung und Stimmlage an.
„Ach, unser Ludwig.“
Der Mann aus dem Erdgeschoss
Vor dem Haus steht eine einsame Laterne. Nachts wirft sie ihr zitterndes Licht auf die mattgrüne, von spröden Rissen durchzogene Hausfassade. Vier Fenster mit Rundbögen zur Straßenseite. Geblümte Gardinen, die oberen Fensterbänke sind schlicht, ungeschmückt. Nur am Fenster neben mir schützen drei Porzellanpuppen die Wohnung vor Wärme. Weiße Porzellanpuppen mit rauer Textur und kreisrunden Augen. Ihr Blick Richtung Straße. Sie wachen, horchen. Blassweiße Gesichter im Laternenlicht.
Ich bin der Mann aus dem Erdgeschoss. Wenn ich das Treppenhaus betrete, dann glaube ich oft, alleine am Geruch zu erkennen, dass ich hier zuhause bin. Der dumpfe Geruch meines Hauses. Ich kenne ihn. Seit Jahren. Die einzelnen Düfte verändern sich. Aber es bleibt der Geruch des Hauses. Schon lange wohne ich in diesem Haus. Seit sieben Jahren. Meine Wohnung verlasse ich selten. Ich habe die Bewohner des Hauses noch nie erblickt, geschweige denn jemals mit ihnen gesprochen. Mir fehlt jegliche Vorstellung ihrer Gesichter, ihrer Persönlichkeit, ihrer Erscheinung. Aber ich würde sie erkennen. Draußen auf der Straße würde ich sie erkennen.
Gegenüber wohnt eine alte Dame. Die meiste Zeit sitzt sie vor dem Fenster. Sie sitzt dort und schaut nach draußen, verstellt die Antenne ihres alten Radiogerätes, dreht an dem geriffelten Rädchen und sucht so etwas wie Vertrautheit. Das stelle ich mir zumindest so vor. Dass sie überhaupt existiert, weiß ich nur, weil es im Treppenhaus nach Putzwasser duftet. Weil es dort immer nach Putzwasser duftet. Nach Seifenlauge und nach alter Dame. Im Winter, wenn die nassen Fußsohlenspuren der anderen Bewohner das Treppenhaus zieren, dann lässt sie diese Spuren mit warmem Wasser verschwinden. Dann wirkt es, als seien diese Spuren nie dagewesen. Als würden diese Treppen zum Himmel führen. Ich habe diese Treppen nie betreten.
Wenn ich nach Hause komme, lasse ich die Tür leise ins Schloss fallen. Am Abend wird die Haustüre abgeschlossen. Behutsam öffne ich meinen Briefkasten. Im Flur stehen ein Kinderwagen und eine Schneeschaufel. Mich gibt es nicht. Man weiß, dass ich existiere. Ich habe eine Fußmatte und ein Messingschild neben meiner Türe. Manchmal schimmert warmes Licht durch den Türspalt. Aber es gibt mich nicht. Ich bin nur der Mann aus dem Erdgeschoss. Es zieht. Die Fenster sind verschlossen. Es muss von der Decke kommen. Über mir wohnt ein Dirigent. Das vermute ich zumindest. Er scheint zu üben, probt womöglich seine Inszenierung für das Orchester. Mit wilden Gesten, schwungvoller Dynamik und fiebrigen Armschwüngen scheint er sich auf die Symphonie vorzubereiten. Ja, er muss Dirigent sein. Wenn ich nachts in meinem Bett liege, die Augen schließe, bilde ich mir ein, ich könne die einzelnen Instrumente heraushören, jede Klanganhebung, jedes einzelne Intermezzo. Nur anhand der Luftzüge. Ich habe kein Bild von diesem Herrn. Aber draußen würde ich ihn erkennen. Dann würde ich ihn anschauen und genau wissen, wer er ist. Ich kenne ihn seit Jahren. Und er würde mich ansehen und wüsste von nichts. Aber ich, ich würde ihn erkennen. An seiner Schrittfolge, an seinem Geruch, an seinem Rhythmus. Ich würde wissen, dass er in dem mattgrünen Haus mit der rissigen Fassade wohnt, dass er Brahms mag, dass er jeden Morgen die Zeitung bekommt, dass er jedes Mal nach Verlassen der Wohnung nachsieht, ob die Tür auch richtig verschlossen wurde. Ich würde wissen, dass er sonntags Lederschuhe trägt und in die Kirche geht.
Aus der Wohnung gegenüber dringt ein vertrauter angenehmer Geruch unter dem Türspalt hervor. Es duftet nach Grünkohl und Lavendel. Die Fußspuren sind fort. Ich sollte mal die Treppe hochgehen. Vielleicht führt diese Treppe zum Himmel.
Im Innenhof des Hauses stehen drei Mülltonnen. Daneben, angelehnt an die bemooste Fassade, ein blauer Plastiksack. Aus den kleinen Rissen schauen die Spitzen von Tannenzweigen hervor. Er liegt schon lange dort. Neben der Regentonne eine einzelne Bank. Wenn man dort sitzt, dann können einen alle Bewohner aus ihren Schlafzimmerfenstern heraus beobachten. Ich sollte mich mal dort hinsetzen, auf die Bank. Im Sommer. Noch ist viel Zeit.
Heute Morgen habe ich gehört, wie der Dirigent sich mit der alten Dame unterhielt. Viel habe ich nicht verstehen können, aber ich glaube, es ging um einen Zweitschlüssel. Von mir hat niemand einen Zweitschlüssel. Niemand. Dass ich existiere, wissen diese Menschen nur, weil ich eine Fußmatte habe. Neben meiner Tür klebt ein Messingschild. Manchmal schimmert Licht unter dem Türspalt hervor. In den matschigen Fußspuren im Treppenhaus findet man Rückstände von Streusalz. Sobald die Menschen durch das Haus laufen, hört man die Sohlen knistern. Salzreste in Tauwasserpfützen. Knisternde Sohlen. Aber am nächsten Morgen sind sie fort, die Spuren zum Himmel. Dann duftet es nach Putzwasser. Nach alter Dame und Grünkohl. Ich liege mit geschlossenen Augen auf der Couch und lausche den Windzügen des Dirigenten. Unter mir im Keller surrt die Waschmaschine. Ein blechernes, dumpfes Geräusch. Das Geräusch meines Hauses.
Es zieht. Draußen liegt Schnee. Ich sollte die Hyazinthen gießen. Auf meiner Fensterbank sitzt ein Zinnsoldat. Durch die Gardinen schimmert schwaches Tageslicht. Es riecht nach Putzwasser und Grünkohl, nach kaltem Qualm und nach Leder. Im Winter tragen die Menschen Stiefel. Rauch erkaltet. Im Innenhof steht ein blauer Müllsack. Über mir lebt der Dirigent. Die Waschmaschine rotiert. Eine Treppe führt zum Himmel. Draußen wirft die einsame Laterne ihr zitterndes Licht auf den bröckelnden Putz der Fassade. Ich bin der Mann aus dem Erdgeschoss.
Niemandsort
Er kommt jeden Tag hierher. Er wartet kurz, betrachtet die Straße, raucht eine Zigarette und verschwindet wieder. Eines Tages würde sie ihn besuchen kommen. Dass sie noch etwas Zeit brauche, das schrieb sie ihm. Und dass sie die Dinge bis dahin in Ordnung bringen würde. Er erwiderte, dass das kein Problem für ihn sei. Alleine sei er ohnehin immer gut zurechtkommen. Er habe ein Haus, einen Garten und überhaupt gebe es immer viel zu tun. Etwas abseits von einer kleinen Häusersiedlung, angrenzend an ein weitläufiges Maisfeld, steht eine Bushaltestelle. Hinter der matten Plexiglasscheibe hängt der Fahrplan und zeigt eine einzige eingetragene Verbindung. Ein Niemandsort. Jeden Morgen um halb acht kommt ein Omnibus und fährt zwei Kinder zur städtischen Gesamtschule. Es soll an jedem Tag der einzige Bus bleiben. Wahrscheinlich ist dies die einsamste Haltestelle der Welt. Ein idealer Ort für einen Statistiker für Fahrgastzählungen. Er hätte nicht viel zu tun. Zwei Fahrgäste, jeden Tag zu der stets gleichen Uhrzeit. Am späten Mittag kommen sie auf der anderen Straßenseite wieder an. Sie steigen aus dem Bus, überqueren die Straße, betreten den Feldweg und irgendwann verschwinden ihre Silhouetten. Vielleicht wird eines Tages eine junge Frau aus dem Bus aussteigen, sich auf die Bank setzen und durchschnaufen. Vielleicht wird sie rauchen und die Vögel betrachten. Vielleicht wird sie nach einigen Minuten aufstehen, den Mantelkragen zurechtzupfen, sich kurz umsehen und in Richtung der Häusersiedlung gehen. Vielleicht auch nicht. Er kommt jeden Tag hierher.
Sei still, alter Mann
Stellen Sie sich einen jungen Mann vor. Als er klein war, hatte er in einem Lexikon etwas über Traktoren gelesen. Er wusste, wie sie aussehen, wie schwer sie sind und über wie viele Pferdestärken ihre Motoren verfügen. Er wusste, wie sie heißen, wo sie gebaut und wofür sie genutzt werden. All das war in diesem Lexikon zu lesen. Und in der Nachbarschaft stand solch ein Traktor. Ein großer roter Traktor, etwas rostig und marode, mit Rädern, die viel höher waren als er selbst. In den Reifenprofilen trockene Erde. Er schien lange nicht benutzt worden zu sein. Der Junge fragte seinen Vater einmal, ob sie gemeinsam mit diesem Traktor fahren könnten, und der Vater sagte nur: „Dafür bist du noch zu jung. Nein, das sollten wir ein anderes Mal tun. Später, wenn du groß bist.“
Und immer wieder, Tag für Tag, ging der Junge an diesem Traktor vorbei und sagte sich: „Irgendwann bin ich groß!“
Hartnäckig hielt er an seinem Gedanken fest. Irgendwann würde er mit diesem Traktor fahren.
Als zwei weitere Jahre vergangen waren, ging er erneut zu seinem Vater, nahm all seinen Mut zusammen und fragte, ob sie sich nun den Traktor vom Nachbarn ausleihen wollten, damit er endlich damit fahren könne. „Nein“, sagte der Vater, „dafür bist du doch schon viel zu groß. Kleine Kinder interessieren sich für Traktoren, aber sieh, mein Sohn, du bist zwölf. Du sollst für die Schule lernen. Hier, lies einmal die Zeitung. Verstehst du, was darin steht? Verstehst du etwas von Wirtschaft und Politik? Du solltest mehr Bücher lesen. Ich möchte, dass du später einmal einen vernünftigen Beruf erlernst, Geld verdienst als Händler und Geschäftsmann. Du solltest später einmal eine Frau versorgen können und vor allem solltest du wissen, was in der Welt passiert. Traktoren haben mit dieser Welt nicht mehr viel zu tun.“
„Aber als ich dich gefragt habe …“, sagte der Sohn, ,,da hast du gesagt, ich sei zu klein. Und jetzt bin ich zu groß?“
„Geh in dein Zimmer!“, antwortete der Vater. „Du sollst lesen! Hier, nimm das Buch! Darin steht vieles, was du wissen musst. Ein Buch über die deutsche Geschichte. Lies es, und in ein paar Wochen stelle ich dir Fragen dazu!“
„Ich möchte dieses Buch nicht lesen. Ich möchte auf diesen Traktor klettern.“
Dieses Buch über die deutsche Geschichte hat er nicht angerührt, wie Sie sich denken können. Er nahm sein altes Lexikon und schaute sich erneut das Kapitel über Traktoren an, lernte alles, was es über sie zu wissen gab, stellte sich das Knattern des Motors vor, stellte sich vor, wie er mit den riesigen Reifen über die Felder fahren würde. Alle diese Bilder waren in seinem Kopf. Einen Tag später kaufte er sich auf einem Flohmarkt ein ganzes Buch über Traktoren, lernte auch nun wieder alles, was es zu wissen gab, erforschte die Bilder, die kleinen Tabellen und alle Details, die in diesem Buch standen. Er kannte bald alle Modelle mitsamt Seriennummer und Baujahr und ward zunehmend in seinem Vorhaben bestärkt, irgendwann selbst einen solchen Traktor zu fahren – einen roten.
Irgendwann kam sein Vater herein. „Ich hoffe, du hast das Buch über die deutsche Geschichte gelernt. Hast du?“
„Ja, selbstverständlich.“
„Nun gut, dann wirst du mir doch bestimmt sagen können, wie unser erster Bundeskanzler hieß?“
„Adenauer.“ Das hatte er mal in den Nachrichten im Radio gehört.
„Ja, richtig. Sehr gut.“
Und dann stellte der Vater ihm viele Fragen über Wirtschaftskrisen, Weltkriege, Revolutionen, Aufstände, Parteien. Wie ein Lehrer wartete er auf die Antworten. Aber sie blieben aus. Sein Sohn hatte natürlich keine Ahnung, hatte auch das Buch nicht gelesen. „Aber weißt du, ich kann dir ganz viel über Traktoren erzählen.“
Und dann präsentierte er voller Stolz sein Buch und hielt es dem Vater vor die Nase. „Du Träumer“, sagte dieser. „Du willst doch kein Bauer sein, kein Tagelöhner. Ich habe dich nicht großgezogen, damit du mir mit einem Traktor durch die Felder ratterst.“
Nun, auch ich habe diese Geschichte nur gehört. Ich weiß nicht, ob sie der Wahrheit entspricht. Aber irgendwie hat sie mich eingenommen. Eine Geschichte über einen Jungen, einen Traktor und einen Vater. Was sind denn Väter? Männer, die manchmal bloß Angst haben, Fehler zu machen. Männer, die glauben, Männer schaffen zu müssen. Erfolgreich, wohlhabend und gebildet. Das Wort Stolz ist eines, das den Menschen leicht über die Lippen geht, wenn sie von Nationen reden, von Besitz und von Herkunft. Einmal traf ich einen Mann, der sagte, er sei stolz auf sein Land und auf sein Haus. Ich verstand ihn nicht, hakte nach und er sagte, sein Haus hätte er gebaut und für sein Land hätte er gekämpft. Ich dachte mir, stattdessen sollte er stolz auf sich sein, mit eigenen Händen ein Haus gebaut zu haben. Hingegen sollte jemand, der für ein Land kämpft, das Wort Stolz