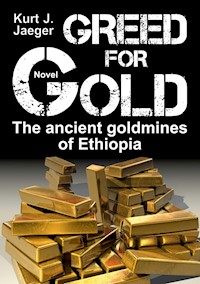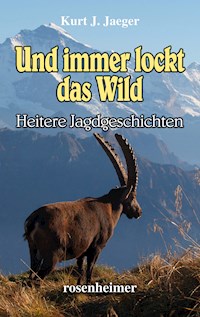
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als langjähriger Revierpächter und Jagdaufseher hat Kurt J. Jaeger viel erlebt in Wald und Wiese. Er erzählt humorvoll von den Tücken des Jägerlebens sowie von lustigen Erlebnissen aus seinem Bekanntenkreis. Ein Geißbock irrt durch die Wälder, vertreibt das Wild und sorgt sogar nach seinem Abschuss für Aufregung. Empörung geht durch eine ländliche Gemeinde, als ein Gast ihren Steinbock erlegt. Besserwisserische Jagdgäste und Leichtsinn unter den Kollegen führen zu kleinen und größeren Pannen. Ebenso erfährt man von den Folgen des Abschusses eines Steinadlers. Kurt J. Jaegers Geschichten sind voller Frohsinn und Witz und vermitteln dennoch die Ernsthaftigkeit der Jagd.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zuVollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2013
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Lektorat: Iris Erber, AistersheimSatz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, BayreuthTitelfoto: © pascalimhof.com – fotolia.comIllustrationen Innenteil: Karin Widmer, Wabern
eISBN 978-3-475-54398-2 (epub)
Worum geht es im Buch?
Kurt J. Jaeger
Und immer lockt das Wild
Als langjähriger Revierpächter und Jagdaufseher hat Kurt J. Jaeger viel erlebt in Wald und Wiese. Er erzählt humorvoll von den Tücken des Jägerlebens sowie von lustigen Erlebnissen aus seinem Bekanntenkreis. Ein Geißbock irrt durch die Wälder, vertreibt das Wild und sorgt sogar nach seinem Abschuss für Aufregung. Empörung geht durch eine ländliche Gemeinde, als ein Gast ihren Steinbock erlegt. Besserwisserische Jagdgäste und Leichtsinn unter den Kollegen führen zu kleinen und größeren Pannen. Ebenso erfährt man von den Folgen des Abschusses eines Steinadlers. Kurt J. Jaegers Geschichten sind voller Frohsinn und Witz und vermitteln dennoch die Ernsthaftigkeit der Jagd.
Inhalt
Anerkennung
Vorwort
Der Jäger Albert
Der Satansbock
Der Adler vom Ried
Der Goppensteiner
S. D. Prinz Hans von und zu Liechtenstein
Die Fuchsjagd
Der Grenzbock
Die Wilddiebe
Der Hochstandbau
Die berüchtigten Wetten vom Pirschwald
Die Pächterversammlung
Die Verschwörung
Der Jägerschlag
Die Murmeljagd
Das perfekte Team
Die Hirschjäger vom Riet
Der Jagdgast und die Geister
Anerkennung
Die folgenden Jagdgeschichten sind zum Teil Erinnerungen aus der Tätigkeit des Autors als Pächter und auch als Jagdaufseher von Tal- und Bergrevieren in Liechtenstein. Die Jahre jugendlichen Übermutes sowie die am offenen Feuer und bei geselligem Aser geschweißten Freundschaften zwischen Jägern taten ein Übriges, um hin und wieder bewusst Situationen zu kreieren, die für Lachsalven sorgten. Schadenfreude ist eine der ältesten Freuden, und so wurden auf der Jagd nicht selten auch Konstellationen geplant, die darauf hinausliefen, den einen oder anderen Waidgenossen in eine eher harmlose Falle tappen zu lassen.
Dem Leser wird auffallen, dass in gewissen Revieren der Frohsinn auf der Jagd regelrecht gepflegt wurde. Das Berufsleben war hart genug, da musste nicht auch noch die Jagd zur stressigen Tätigkeit ausarten. Einzelne Pächter neigten daher dazu, das Waidwerk nicht nur mit tödlichem Ernst zu führen, sondern diese Tätigkeit mit Humor etwas aufzulockern. Nicht zuletzt spielte dabei auch die Situationskomik eine große Rolle. Sie brannte sich für Jahre im Gedächtnis der Beteiligten ein, sorgte im Revier immer wieder für ausgelassene Heiterkeit und für ausgiebige Gelage in den von den Jägern besuchten Gasthäusern. Aufgrund der Tatsache, dass viele Zeitzeugen inzwischen verstorben sind, wurden ein paar Geschichten in diesem Buch so gut wie möglich rekonstruiert.
An dieser Stelle möchte ich den Jagdaufsehern J. Gassner und G. Schurti, einigen Jagdpächtern der Liechtensteiner Jägerschaft sowie dem Landesarchiv in Vaduz für ihre Unterstützung bei der Zusammenstellung einiger skurriler Geschichten herzlich danken. Ohne ihre Hilfe wäre diese Sammlung von Anekdoten über die Jagerei in Liechtenstein nicht zustande gekommen.
Vorwort
Die Jagd in Liechtenstein wurde im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte zum größten Teil stets der Zeit entsprechend von den Herren des Landes ausgeübt. Im Jahre 1792 wurde von der Hochfürstlichen Liechtensteinischen Oberamtskanzlei die Satzung herausgegeben, dass eine im Lande tätige Jäger- und Waidmannsgesellschaft einen Vorstand und einen »Sekretarius« zu wählen habe. Auch damals galten für Übertretungen der Anordnungen strenge Strafen, die bis zu einer Höhe von »einem Pfund Pfennig« gingen. Bei nichtigeren Vergehen wurde dem Sünder »mit dem Waidmesser eines hinauf gemessen«.
Gesetzliche Vorschriften gab es aber erst viel später. Unter Fürst Alois wurde im Jahre 1843 lediglich eine Polizeiverordnung eingeführt, die sich auf das Schießen, Fangen und Ausnisten von Singvögeln belief und dabei auch eine zeitliche Beschränkung für den Verkauf von gefangenen Junghasen erwähnte. Erst im Jahre 1849 wurde die Jagd in Liechtenstein zum Landesregal erhoben. Die Vergabe einer Jagdpacht war dabei jedoch lediglich für Niederwild vorgesehen. Rot-, Gams- und Rehwild waren ausdrücklich davon ausgeschlossen. Mit dem Jagdgesetz von 1921 wurde schließlich das ganze Staatsgebiet in Jagdbezirke, sogenannte Reviere eingeteilt, die von der Regierung in einer öffentlichen Versteigerung auf fünf bis zehn Jahre verpachtet wurden.
Dass die Reviere zu Beginn zum Großteil von finanzstarken Pächtern aus dem benachbarten Ausland übernommen wurden, versteht sich in Anbetracht der zu der Zeit eher knapp bemessenen Mittel der liechtensteinischen Mitbieter von selbst. Nichtsdestotrotz brachte man bei der Neuverpachtung im Jahre 1956 in zum Teil heftigen Debatten eine Bevorzugung liechtensteinischer Pächter sowie eine Mindest- und Höchstzahl an Pächtern pro Revier ein. Die Spannungen ebbten danach wieder ab, und es kehrte die nötige Ruhe in das Jagdgeschehen im Lande ein.
Nebst dem ernsthaften Jagdbetrieb ist seit jenen Tagen in den Liechtensteiner Berg- und auch Talrevieren öfters auch etwas Spaßiges beim Waidwerk passiert. Gar kuriose Begebenheiten wurden zum Teil auch gerne im übertriebenen Jägerlatein an den Stammtischen des Landes weitererzählt. Geschichten, die bei den Betroffenen oft rote Köpfe und bei den gespannt lauschenden Zuhörern so manch heimliches Schmunzeln hervorlockte. Heitere Ereignisse, die oft dem Zufall zuzuschreiben waren, aber manchmal auch bewusst den Köpfen einiger Spaßvögel entsprangen. Auch ein gewichtiges Mitglied des Fürstenhauses trug dabei nicht unwesentlich zu humorvollen und unvergesslichen Episoden bei der Jagd im Lande selbst, aber auch im Ausland, bei. Und da die Jagd außer dem Ansitz, der Pirsch, dem Abschuss und Verwerten des Wildes auch noch aus gemeinsamen, gemütlichen Stunden in der Jagdhütte oder beim Aser am fackelnden Lagerfeuer bestehen sollte, sind solch scherzhafte Jagdgeschichten es wert, erzählt zu werden.
Es sind Zeitzeugen aus einer Jagdkultur, die nebst hartem Waidwerk auch gemütliches Beisammensein und Humor auf dem Banner trugen. In der heutigen rastlosen Zeit hat der moderne Mensch anscheinend immer weniger das Bedürfnis, sich bei der Jagd innerlich wohlzufühlen und den Frohsinn unter Freunden zu pflegen. Neue Gesetze und Verordnungen wie auch die konstante Hetze von fehlgeleiteten sogenannten Freunden der Tiere oder auch sensationsgeilen Medien haben das edle Waidwerk scheinbar immer mehr zu einer Tätigkeit verkommen lassen, die von den der Natur entfremdeten Mitmenschen als grausam und unnötig empfunden wird. Nicht selten scheut sich schon der im grünen Loden gekleidete Jäger, nach dem Waidwerk ein Wirtshaus zu betreten. Verächtliche Blicke oder dumme Bemerkungen vonseiten anwesender Gäste sind nichts Ungewöhnliches.
Es mag vielleicht der Neid oder die Unkenntnis über die Aufgaben und Tätigkeit des Jägers sein, die zu solchen Reaktionen führen. Tatsache ist jedoch, dass heute außer dem Forstamt kaum jemand mehr vom Erlegen des Wildes wissen will. Der moderne Mensch möchte am liebsten sein Wildbret sauber zerlegt, in Vakuum abgepackt und mit einem Verfalldatum versehen im Supermarkt angepriesen sehen. Es fragt sich, ob nicht in absehbarer Zeit bald nur noch ein kleiner Teil der städtischen Bevölkerung wissen wird, wie dieses gesunde Nahrungsmittel überhaupt auf den Tisch kommt.
Die Aussichten für das ursprüngliche, vom Jäger gerne ausgeübte Waidwerk im Lande scheinen so trüb wie die von Regen begleitete Warmfront, die über die Berge vom Westen in die Täler kriecht. Bald einmal und in nicht allzu weiter Ferne könnte damit auch der zum Waidwerk gehörig gepflegte Witz und Humor unter den verbliebenen Jägern im Lande der Vergangenheit angehören.
Der Jäger Albert
Ganz im Süden des Landes und teilweise angrenzend an schweizerisches Hoheitsgebiet liegt versteckt ein von steilen Hängen und Felsen eingeschlossenes Hochtal. Den Ausgang dieses Hochtales bildet die enge Schlucht der Lawena, ein sich über Jahrtausende tief in die Bergflanke einfressender Wildbach, dessen gespenstische Wildheit die nötige Nahrung für allerhand schaurige Sagen darstellt. Noch heute glauben die Älteren im Lande, dass in der finsteren, vom Mahlen und Brausen der wilden Wasser ausgeschlagenen Felsenschlucht die Seelen der für Hexenverbrennungen im Mittelalter verantwortlichen Verleumder im Lande verflucht sind, bis zum Jüngsten Gericht dort ihr Dasein zu fristen.
In früheren Zeiten war es für Vieh und Senn ein mühseliger Gang auf schmalen Pfaden, um die Hochalpe Lawena zu erreichen, denn kein Steg führte damals durch diese grausige Schlucht in die Höhe. Erst nachdem um die Jahrhundertwende und vor dem Ersten Weltkrieg mithilfe italienischer Spezialisten für Straßenbau in mühseliger Arbeit ein Fahrweg durch die Schlucht gesprengt worden war, entstand schließlich ein direkter Zugang zur Lawena-Alp. In der Folge konnte nun auch die in der Lawena vergebene Revierjagd bequem vom Tal aus erreicht und das im dortigen Gebiet erlegte Wild fortan mittels Karren zu Tale befördert werden. Später nutzte man Motorfahrzeuge, um den Höhenunterschied von rund tausend Metern vom Tal bis zur Hochalpe zu überwinden.
Als einer der damaligen Revierinhaber im Jahre 1958 mit seinem Geländewagen auf der schmalen Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und um ein Haar in die tiefe Lawena-Schlucht abgestürzt wäre, ergriff ihn das Grausen und die Angst. Seinem Schutzengel dankend, entschied er sich unverzüglich, die Pacht in diesem gefährlichen Bergrevier abzutreten. Als neuer Pächter übernahm nun der Industrielle Martin vom Unterland die Jagd.
Zu dieser Zeit ergab es sich, dass der Triesner Zimmermann Albert Schurti durch einen schlimmen Arbeitsunfall gezwungen war, nach einer anderen Tätigkeit Ausschau zu halten. Glücklicherweise bot ihm nun der neue Pächter an, die Stelle als Jagdaufseher im steilen Gebirgstal zu übernehmen. Albert packte die Gelegenheit beim Schopf und trauerte danach keinen Tag mehr seinem alten Beruf nach. Er hatte die Aufgabe seines Lebens gefunden. Fortan nutzte er die kurvenreiche und steile Lawena-Straße fleißig, indem er in den schneefreien Monaten mit seinem BSA-Motorrad mit Seitenwagen die tausend Meter Höhenunterschied von seinem Haus bis zur Jagdhütte auf der Hochalp bewältigte.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Jäger Albert, wie man ihn nun landläufig nannte, auf die Idee kam, sein englisches Motorrad auch als Transportgerät für das erlegte Wildbret zu verwenden. Öfters konnte man nun kapitale Gämsen oder Rehböcke als Insassen seines Seitenwagens beobachten, wenn er nach der Jagd noch schnell im vertrauten Landgasthof Linde zu Triesen einen Halt einlegte, um sich etwas gegen seinen fürchterlichen Durst zu genehmigen. Nicht selten aber dekorierten auch gewichtige Vertreter des alpinen Rotwildes das arg strapazierte Motorradgespann. In solchen Fällen wurde manchmal beträchtlich über den Durst getrunken, um auf das Waidmannsheil der Jäger in der Lawena anzustoßen. Zwischenzeitlich erstarrte dann auf dem Seitenwagen vor der Linde nicht selten der stets von einer wachsenden Schar von Jagdgenossen und Dorfbewohnern begutachtete Hirsch zu bocksteifem Wildbret.
Der Seitenwagen diente aber auch dem Jagdherrn Martin selbst, wenn dieser jeweils spät nach der Jagd vom Jäger Albert nach Hause gefahren werden musste. Dass die beiden es dabei vorzogen, geschmückt mit dem Schützenbruch auf dem Hut und für alle gut hör- und sichtbar, fröhlich durch den Hauptort Vaduz zu fahren, funktionierte eine Zeit lang ganz gut, wenigstens bis zu dem Tag, an dem die Gattin des Fabrikanten davon zu hören bekam. Ihr Argument, dass ein Direktor einer großen Firma nicht in einem alten, klapprigen Seitenwagen durch das Land gefahren werden dürfe, veranlasste den Jagdherrn schließlich, für seinen Jagdaufseher einen Land Rover anzuschaffen.
Als vollamtlicher Jagdaufseher im Alpengebiet machte der Jäger Albert nicht nur seinem Berufsstand alle Ehre, er war auch weit herum bekannt als humorvoller Mensch, der es verstand, seinen Schalk an den Mann zu bringen. In solchen Stunden lief Albert zur Hochform auf. Die Treffsicherheit, mit der er seine trockenen Sprüche humorvoll platzierte, wurde von den Gästen am Stammtisch der Linde sehr geschätzt. Schließlich waren es nicht selten auch scharfzüngige Anspielungen auf weniger beliebte Politiker im Lande, die dabei ihr Fett abbekamen. Als Fabrikbesitzer hatte der Jagdherr aber öfters auch Kunden aus dem Ausland zu Besuch. Darunter waren auch solche, die jede Gelegenheit nutzten, einen als Dank angebotenen Pirschgang im Revier Lawena in die Tat umzusetzen. Dazu wurde natürlich der Jäger Albert als Berg- und Pirschführer für den Gast aufgeboten. In den steilen Felsgebieten war nämlich die Jagd nicht ungefährlich und eine kundige Führung daher unerlässlich. Und sollte einmal ein Jagdgast das Glück haben, einen Abschuss zu tätigen, so brauchte er auch die nötige Hilfe, um das Wildbret zu bergen und sicher zu Tal zu bringen.
So kam es, dass ihm eines Tages ein etwas kauziger Eidgenosse vorgestellt wurde, der als guter und langjähriger Kunde beim Jagdherrn ein gewisses Ansehen genoss. Als Dank für dessen Einkäufe und weil dem Fabrikanten bekannt war, dass dieser Kunde in seinem Heimatkanton schon auf Rotwild gejagt hatte, anerbot er ihm den Abschuss eines guten Hirsches in seinem Revier. Der Jäger Albert packte also seine sieben Sachen und den Schweizer in seinen Land Rover und tuckerte mit ihm die steile Straße durch die Lawena-Schlucht hoch zu der auf etwa 1500 Metern gelegenen Jagdhütte. Albert wusste von einem guten Platz im Hochwald, wo ein kapitaler Hirsch seine Fährte zog und wo auch ein brauchbarer Hochsitz stand, von dem aus der Eidgenosse einen sicheren Tellschuss anbringen konnte.
Also schulterte er seinen Rucksack und das Gewehr des Gastes und begann langsam den Aufstieg. Der Schweizer stolperte schwer atmend und innerlich fluchend hinterher. Um zum Hochstand zu gelangen, mussten sie notgedrungen einen Bachlauf überqueren. Der Jäger Albert sprang von einem Stein zum andern, zeigte dem Gast, wie man so etwas macht, und jener eiferte zaghaft nach. Aber anscheinend war dies zu viel verlangt, denn plötzlich verlor dieser, wild in der Luft umherfuchtelnd, das Gleichgewicht und fiel taumelnd ins kalte Wasser. Das anschließende Gejammer des Schweizers über den Mangel an gut ausgebauten Pirschpfaden und Brücken berührte Albert nicht besonders. »Das wird deine hochgestellte Nase etwas hinunterziehen«, dachte er befriedigt über das Missgeschick des Jagdgastes. Er tröstete den klagenden Gast damit, dass es zum Hochstand nun nicht mehr weit wäre. Dem war denn auch so. Kurz darauf standen sie nämlich vor der grob gezimmerten Leiter. Oben angelangt, platzierte Albert den Jagdgast gleich in eine Ecke, wo dieser einen sicheren Halt für die Büchse finden konnte. Dann hieß es nur noch warten.
Inzwischen war die Sonne schon hinter dem Bergkamm der Mittagsspitze versunken, und das Tageslicht schwand langsam, aber stetig. Etwas entfernt sah Albert eine Rehgeiß mit Kitz in die offene Grasfläche austreten. Er richtete sein Glas aber immer wieder auf den ihm bekannten Wechsel, hoffte dabei sehnlichst auf den Hirsch, den er schon öfters ausgemacht und sicher angesprochen hatte. Schließlich musste er dem Jagdgast, der den hiesigen Dialekt als verbales Kommunikationsmittel verschmähte, nicht nur unterhalten, sondern auch eine optimale Jagd bieten. So viel war er dem Jagdherrn schuldig.
Mittlerweile hatte sich der Schweizer in seiner Ecke eingerichtet und bestaunte die im letzten Licht erstrahlenden Bergspitzen auf der anderen Seite des tief unter ihnen liegenden Rheintales. Der sanfte Stoß von Alberts Ellenbogen in seine Seite kam völlig unerwartet. Überrascht drehte er sich um und sah, wie sein Pirschführer den Zeigefinger auf die Lippen drückte und mit dem Kinn nach rechts deutete. Er hatte verstanden, drehte seinen Kopf zurück, blickte in die angegebene Richtung und erstarrte. Keine achtzig Meter entfernt stand, wie eine Statue, ein kapitaler Rothirsch. Der Jäger Albert war erleichtert. Das war ein guter Hirsch, er passte genau. Noch war gutes Schusslicht, um einen sicheren Schuss anzubringen, dachte er. Und so gab er dem Gastjäger mit leuchtenden Augen das Zeichen, sich vorsichtig mit seiner Büchse zu befassen.
Es brauchte eine Weile, und Albert hatte schon Angst, dass der stolze Recke die Bewegungen des Gastes bemerken und sich verdrücken würde. Doch dann schien der Schweizer das Ziel erfasst zu haben. Der Schussknall donnerte über die Hochalp, rollte als vielfaches Echo von den Felswänden und verlor sich ins Tal hinaus. Der Jäger Albert aber hatte deutlich das Zusammenrucken des Hirsches gesehen, dessen Flucht den Hang hinab verfolgt und beobachtet, wie dieser offensichtlich verletzt im angrenzenden Unterholz verschwand.
»Getroffen! Jetzt rauchen wir erst einmal eine Zigarette. Der Hirsch geht jetzt nämlich ins Wundbett, und dort wird er dann verenden«, wies der Jäger Albert seinen Gast an. Dieser aber hatte ganz andere Ideen. Hoch erfreut über den gelungenen Abschuss eines kapitalen Alpenhirsches, packte er seine Sachen zusammen und eröffnete dem Jagdaufseher stolz, dass man bei ihm zuhause nach einem Schuss nicht lange wartet, sondern sofort den Hirsch holt. Schließlich hätte er das Wild mit einem perfekt platzierten Schuss ins Jenseits befördert. Der Jäger Albert war sich da aber nicht so sicher. Mit einem guten Treffer wäre der Hirsch bestimmt kurz nach dem Anschuss zusammengebrochen. Er hielt sich jedoch mit einer entsprechenden Bemerkung zurück. Seine Sorge war jetzt die Nachsuche bei einfallender Nacht.
»Wissen Sie, ich kenne mich bei der Jagd auf Rotwild bestens aus. Wir warten keinesfalls, sondern gehen jetzt gleich los und holen uns den Hirsch!« gab der Eidgenosse im Befehlston zu verstehen. Albert protestierte lauthals, aber der Jagdgast wollte nichts davon wissen. Sein Entschluss war gefasst, denn seiner Ansicht nach war dieser ungehobelte Jagdbegleiter nur zum Aufbrechen und Versorgen des Hirsches zu gebrauchen. Es half alles nichts. Der Schweizer Gast warf alle Warnungen seines Pirschführers in den Wind und drängte nun energisch, mit der Nachsuche zu beginnen. Zerknirscht gab der Jäger Albert schließlich nach. Er ging erst einmal zum Anschuss, um sich über eventuelle Schusszeichen zu informieren. Dort fand er denn auch gleich etwas dunklen Schweiß und Schnitthaare, die möglicherweise auf einen tiefen Blattschuss hindeuteten. Der Gast aber hielt nicht viel von einer langweiligen Theorie über Schweißfärbung und Schusszeichen. Im Gegenteil, er beeilte sich jetzt, die Stelle zu finden, an der seiner Ansicht nach der Hirsch mit letzter Kraft ins Unterholz eingewechselt war.
Der Jäger Albert eilte ihm hinterher, wollte ihn aufhalten, aber es war zu spät. Der Gastjäger drückte bereits lärmend durch die ersten Erlenstauden, als Albert deutlich das laute Rumpeln von wegbrechendem Wild vernahm. »Aus! Es ist passiert. Dieser Idiot hat es tatsächlich fertiggebracht, den Hirsch aus dem Wundbett aufzumüden«, dachte er, sich genervt an den Kopf greifend. Am liebsten hätte er dem Gast an Ort und Stelle gehörig den Kopf gewaschen, ihn zur Schnecke gemacht, aber er dachte an die Worte, die er dabei verwenden würde. Sie wären dem Schweizer wohl kaum geläufig und würden somit nichts bewirken. Und so ließ er es sein und nahm die Verfolgung auf, denn er wusste, die Dunkelheit würde in weniger als einer halben Stunde über das enge Gebirgstal hereinbrechen. Kaum waren sie ein paar Dutzend Schritte in den Hochwald eingedrungen, stießen sie auch schon auf das verlassene Wundbett. Albert besah sich kurz die Schweißlache, ahnte Schlimmes und folgte, so schnell es die Sicht auf Trittsiegel und Schweißspritzer auf dem Waldboden zuließen, der Fährte bergab, der Reihe von Wasserfällen entgegen, die der Lawena-Wildbach in Tausenden von Jahren in das Gestein geschnitten hatte. Hier verlor sich die Fährte plötzlich. Kein Schweiß, keine Fährte, nichts. Wo war der Hirsch geblieben? Vielleicht ins tiefe Tobel abgestürzt? Der Jäger Albert wusste keinen Rat. Die Nacht legte sich langsam über das Gelände und er dachte nur noch daran, seinen Gast im Dunkeln sicher zur Jagdhütte zurückzubringen. Morgen würde er in aller Früh die Nachsuche erneut aufnehmen und die Jagd hoffentlich doch noch zu einem guten Abschluss bringen. Doch auch der Tag danach brachte keine neuen Erkenntnisse. Der Hirsch, oder was von ihm noch übrig war, blieb verschwunden.
Noch tagelang suchte Albert ohne Erfolg. Schließlich gab er es auf und meldete es dem Jagdherrn. Dieser nahm die Sache zwar ernst, aber nicht so tragisch wie sein Jagdaufseher Albert. Schließlich gab es noch mehr gute Hirsche und auch anderes Wild in seinem Revier, und nächstes Jahr konnte er seinem wichtigen Kunden eine Wiederholung der Jagd anbieten.
So kam es, dass der Schweizer im Jahr darauf erneut zur Jagd auf einen kapitalen Hirsch antrat. Der Jäger Albert aber hatte die Sache mit dem verluderten Hirsch nicht so leicht verdaut. Er schwor sich insgeheim, am waidmännisch unehrenhaften Eidgenossen Rache zu nehmen. Und so richtete er es ein, dass er beim Pirschgang den besagten Wildbach mehrmals überqueren musste. Dabei passierte dem Jagdgast jedes Mal das Missgeschick, dass er entweder knietief ins kalte Wasser abrutschte oder zumindest einen Schuh voll davon herauszog. Albert aber hüpfte das Herz vor Schadenfreude, und er plante danach die Pirsch mit kalter Berechnung, sodass dem Gast mit Sicherheit kein passender Abschuss gelingen konnte. Der zog danach verdrießlich wieder ab und reiste am nächsten Tag zurück in die benachbarte Schweiz.
Dies wiederholte sich sieben Jahre lang mit dem gleichen Resultat. Der schweizerische Gast kam, stolperte über das Gelände, fiel in den Bach, lud wahrscheinlich auch immer wieder die gleiche Patrone in den Lauf und reiste nach erfolgloser Pirsch wieder ab. Im achten Jahr hingegen entschied er sich plötzlich, den einen Tag, den er für die Jagd in der Lawena reserviert hatte, auf der Jagdhütte zu verbringen und auf den gefährlichen wie erfolglosen Pirschgang zu verzichten. Dies war dem Jäger Albert nur recht. Er feuerte also den Holzofen an, kredenzte dem Gast seinen obligaten Walliser Pinot Noir und legte zum Aser luftgetrockneten Speck, Brot und Käse auf den Tisch. Nach einer Weile entwickelte sich ein holpriges Gespräch, und der Jagdgast meinte etwas skeptisch:
»Wissen Sie, Albert, ich glaube es hat gar keinen Sinn, mit Ihnen dieses Jahr nochmals jagen zu gehen. Wir werden bestimmt wieder kein schussbares Wild antreffen.«
Der Jagdaufseher ahnte, was ihm der gekränkte Eidgenosse durch die Blume sagen wollte. Sehr wahrscheinlich hatte er endlich erkannt, dass er an der Nase herumgeführt wurde. Albert schob sich langsam eine Zigarette zwischen die Lippen, zündete sie umständlich mit einer Kerzenflamme an und meinte dann, ohne das Gesicht zu verziehen, in seiner eigenen, trockenen Art:
»Das hätte ich Ihnen eigentlich schon vor sieben Jahren sagen können!«
*
Der Jäger Albert hatte auch die Gabe, die Gäste oder auch Pächter im Revier mit ihren eigenen Worten zu schlagen. So geschah es, dass an einem Herbsttag nach der Hirschbrunft vom Jagdherrn eine Drückjagd angesagt wurde, um eine Reduktion von Kahlwild zu erreichen. Die entsprechenden Einladungen gingen raus und Jäger Albert bereitete alles vor, markierte die Standplätze, kaufte Lebensmittel für den Aser am Lagerfeuer ein und organisierte die Treiberwehr. Schließlich war es dann so weit. Gastjäger und Pächter trafen zeitig am Sammelplatz ein. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Jagdherrn und der eindringlichen Ermahnung über die bestehenden Sicherheitsvorschriften während des Treibens wurden die Standplätze zugewiesen. Die Treiber marschierten zu der vom Jäger Albert vorgegebenen Startlinie, um zur abgemachten Zeit langsam mit dem Durchdrücken des steilen Bergwaldes zu beginnen.
Unter den anwesenden Pächtern war dieses Mal auch der allseits bekannte Rechtsanwalt Walter, der beim Jagdherrn eine Dauerstellung für juristische Angelegenheiten innehatte und auch sonst auf politischer Ebene sowie bei der Liechtensteiner Jägerschaft bestens bekannt war. Jäger Albert hatte ihm, wie schon Jahre zuvor, einen Platz oberhalb der Rotwildfütterung bei Schärris zugewiesen. Hier saß er nun, seine Lieblingspfeife schmauchend, abwartend auf seinem einbeinigen Jagdstuhl. Den Stamm einer mächtigen Fichte als Rückenlehne benutzend und die geladene Büchse über den Knien, lauschte er gespannt auf Geräusche, die das Herannahen von Rotwild bedeuten würden.
Seine Nerven wurden auf eine harte Probe gestellt, aber dann zuckte er zusammen. Hatte er da nicht gerade etwas knacken gehört? Er spitzte die Ohren, und seine Augen suchten nervös zwischen den Stämmen nach einer verräterischen Bewegung. Da – was war das? Etwas Dunkelbraunes zog, kaum achtzig Meter unter ihm, durch den Bestand. Längst hatte er die Pfeife in der Jackentasche versenkt, die Büchse hochgenommen und fiebernd versucht das Wild anzusprechen. Jetzt! Zwischen einer Baumlücke fassten seine Augen das Ziel. »Genau richtig! Ein einzelnes Schmaltier«, fuhr es ihm durch den Kopf. Hastig riss er die Büchse in den Anschlag, fasste mit dem Zielstachel das Schulterblatt und zog den Abzug durch. Im Schussknall sah er noch, wie das Wild in sich zusammenklappte und dann zwischen den Stämmen den Hang hinunterrutschte. Adrenalin jagte durch seine Adern, ließ sein Herz heftig schlagen, aber er fühlte sich glücklich über den gelungenen Abschuss. Tief atmend repetierte er eine weitere Patrone in das Patronenlager, versuchte seine Nerven und den Puls auf ein normales Niveau zu bringen.
Jetzt hörte er von Weitem das sachte Klopfen der Treiber, dann ein paar Stimmen, die in der Stille weit trugen. »Das Treiben wird in Kürze zu Ende sein«, überlegte er, mit sich und seiner Leistung zufrieden. Doch da, was war das? Fast an der gleichen Stelle schob sich jetzt von links drüben ein einzelnes Stück Rotwild vorsichtig zwischen den schützenden Stämmen hindurch. Der Rechtsanwalt nahm kurz sein Fernglas vor die Augen: ein Schmaltier! Passt! Blitzschnell nahm er die Büchse hoch, und als das Wild einmal kurz verhoffte und sicherte, fuhr er mit dem Zielfernrohr ins Ziel und drückte ab. Im Donnern des Schusses stürmte das Schmaltier nach vorne, knickte zwanzig Meter weiter neben einer Fichte ein und blieb regungslos liegen. Aufgeregt holte er seine Pfeife wieder aus der Tasche, erneuerte zittrig die Glut und genoss kurz danach die scheinbar erholsame Wirkung des Tabaks. Zehn Minuten später vernahm er das Jagdsignal, das ein Ende des Treibens bedeutete.
Mit sich und der Welt zufrieden packte er seine Utensilien zusammen und stampfte nun guten Mutes in Richtung des Sammelplatzes. Dort berichtete er mit nicht geringem Stolz von seinem erfolgreichen Jagderlebnis. Jäger Albert hatte natürlich die Schüsse gehört und gehofft, dass dem Rechtsanwalt möglicherweise ein Abschuss gelungen war. Dass er anscheinend aber sogar, wie er behauptete, zwei Schmaltiere erlegt hatte, war wesentlich mehr, als er erwartet hatte. Kurzerhand entschied er sich, das Wild sofort zu bergen. Zusammen mit dem Rechtsanwalt und zwei Gehilfen machte er sich daher auf, um an Ort und Stelle die blutige Arbeit zu erledigen. Als Albert mit den Gehilfen, vom Rechtsanwalt geführt, am Ort des Geschehens eintraf, stellte er fest, dass hier tatsächlich und entgegen seiner Erwartung nicht weit voneinander zwei Stück weiblichen Rotwildes lagen. In gewohnter Manier ging er auf das erste zu, hob aus Gewohnheit einen Hinterlauf hoch und bückte sich leicht.
Seine Augenbrauen zogen sich zusammen und mit einem schiefen Blick schaute unter der Krempe seines abgetragenen Jagdhutes hervor auf den danebenstehenden, strahlenden Schützen. Er sagte kein Wort, sondern ging gleich zum zweiten Stück Wild. Dort tat er dasselbe. Schließlich streckte er sich zu seiner vollen Größe, und während er immer noch einen Hinterlauf des weiblichen Stücks hochhielt, wandte er sich mit gerötetem Gesicht an den jetzt etwas unsicher dastehenden Rechtsanwalt.
»Waidmannsheil, du Oberflasche! Jetzt hast du tatsächlich den Vogel abgeschossen. Dies hier sind zwei etwas abgekommene und schmale Tiere, aber bestimmt keine zwei Schmaltiere!«
Nervös in seinen Bocksbart stammelnd bückte sich der Anwalt, um sich von der Aussage des Jagdaufsehers zu überzeugen, und tatsächlich, beim Drücken des Gesäuges spritzte fettige Milch heraus. ,»Führende Tiere«, durchfuhr es ihn heiß. Ungläubig starrte er die längste Zeit auf das leblose Rotwild, unfähig sich eine passende Ausrede zusammenzustellen. Für eine ganze Weile aber hörte man noch den Jäger Albert, als er beim Aufbrechen, wie ein Rohrspatz schimpfend, des Rechtsanwalts unfähiges Ansprechen von Wild an den Pranger stellte.
Es gäbe über die gelegentlichen schlagfertigen Bemerkungen vom Jäger Albert, wenn er sich über irgendeinen Gast ärgerte oder dessen Gehabe ihm in keiner Weise in die Schuhe passte, sicher noch viel zu berichten. Stets überließ er es auch dem Betroffenen, die Bedeutung seiner spitzigen Bemerkungen richtig auszulegen.
So geschah es denn auch einmal während einer herbstlichen Drückjagd im Hochwald der Alp Münz in den Sechzigerjahren. Der Jagdherr hatte nebst dem im Lande sehr bekannten »Scana Toni« aus Schaan noch ein paar andere Gäste eingeladen, und der Jäger Albert bemühte sich in der Folge, die Jagdorganisation auf die Beine zu stellen. Treiber mussten bemüht und Standplätze vorbereitet werden. Auch die Vorbereitungen für den großen Aser in der Jagdhütte verlangten von ihm einen vielseitigen Einsatz. Schließlich kam der große Tag. Das Wetter zeigte sich mit einem stahlblauen Himmel und einer großartigen Fernsicht. Damit waren die Vorbedingungen für einen prächtigen Jagdtag in den Bergen gegeben. Bei bester Laune und begleitet vom Umtrunk eines hausgebrannten Zielwassers, erwartete am Morgen die Jäger- und die Treiberschar die offizielle Begrüßung des Jagdherrn auf der Alm.
Dieser verschaffte sich denn auch bald die nötige Aufmerksamkeit, und nachdem der Jagdherr schließlich auf die Regeln der Sicherheit verwiesen hatte, gab er das Wort an den Jäger Albert weiter, der die einzelnen Standplätze verteilte und den zeitlichen Ablauf der ersten Drückjagd vorgab. Seiner Ansage gemäß war vorgesehen, den Hochwald von unten gegen den Goraspitz und die felsige Plattawand durchzudrücken. Dort oben auf 1000 Meter über Meer musste das Rotwild einen Zwangswechsel einnehmen, um dann nach rechts über die Münz und Platta auszuweichen. Ein Hochsitz an idealer Stelle in der Münz bot ein ideales Schussfeld gegen die Plattawand und das offene Gelände rechts davon. Wild, das hier durchflüchtete, konnte gut angesprochen und relativ sicher beschossen werden.
Der Jäger Albert hatte schon die Jahre zuvor beobachtet, wie der Scana Toni sich stets bemühte, diesen bevorzugten Standplatz für sich zu ergattern. In der Hoffnung, dass ihm endlich ein guter Hirsch vor den Lauf kommen würde, teilte er ihn kurz entschlossen auf diesen Hochsitz ein. Auf einen in Sichtweite und weiter unten sich befindlichen Hochsitz schickte er einen Gast, der als guter und schneller Schütze den Rückwechsel über die Hochalm abdecken sollte. Der Scana Toni war sichtlich erfreut über die Zuteilung, und nachdem er wusste, dass dieser Trieb in etwa eineinhalb Stunden zu Ende sein würde, machte er sich mit einem wohlgemeinten »Waidmannsheil« schnurstracks daran, den steilen Weg zum Hochsitz anzugehen.
Inzwischen hatten auch die anderen Jäger ihre Standplätze zugewiesen bekommen, und der Jäger Albert begab sich mit den Treibern zum unteren Rand des Hochwaldes, den es durchzudrücken galt. Bald ertönte das Hornsignal, das sich schwach als Echo an den Felswänden des Tales brach. Der Trieb hatte begonnen. Langsam und ohne Lärm mühten sich die Treiber den steilen Hochwald aufwärts. Mittlerweile hatte der Scana Toni seinen Platz auf dem Hochsitz auf der Münz eingenommen und genoss die fantastische Aussicht auf den Gonzen und die Bergkette vom Alvier auf der gegenüberliegenden Talseite. Wie schön es doch hier oben, weit weg vom Ärger des Alltags war, überlegte er. Keine Telefonanrufe, keine Problemlösungen, die ihm zu schaffen machten, nur tiefe Ruhe, die lediglich durch das fast monotone Rauschen vom Verkehr im Tal gestört wurde. Und da die Jagd für ihn keine Leidenschaft barg, er eher die erholsamen Stunden und den Anblick beim Ansitz schätzte und das gemütliche Schüsseltreiben danach, war er auch heute nicht so recht bei der Sache. Gedankenverloren schweifte sein Blick über das vor ihm ausgebreitete und von der Sonne hell beleuchtete Alpenpanorama, die frisch überzuckerten Bergspitzen der Glarneralpen und des Säntismassivs.
Tief unter ihm sah er den sich wie eine Schlange durch das Tal ziehenden Verlauf des Rheins und daneben auch deutlich die Landstraße, die von Triesen nach Balzers und über die Festung Luziensteig führte. Fasziniert verfolgte der Scana Toni den Verkehr auf der Straße, der sich seiner Meinung nach in den letzten Jahren beträchtlich vergrößert hatte. Dann schaute er kurz mit dem Fernglas auf den Hochsitz unter ihm, bemerkte, wie dort ein ebensolches Fernglas auf ihn gerichtet war und dann ein Arm ihm zuwinkte. »Aha, der Pauli macht sich mir bemerkbar«, dachte er, dann winkte er freudig zurück. Gleich danach stellte er sein Glas wieder scharf auf die Straße unten im Tal ein. Seine Neugier war geweckt. Eifrig versuchte er, die wie kleine Käfer auf grauem Band sich fortbewegenden Fahrzeuge zu unterscheiden und die Ladungen auf den einzelnen Lastwagen zu identifizieren. Längst hatte er den Ablauf der Drückjagd vergessen, so sehr hielt ihn der Betrieb auf der Straße gefangen. Und dann begann er zu zählen, versuchte Ordnung in die Anzahl der sich dort unten durch das Tal drängenden Fahrzeuge zu bringen. Limousinen, Kleinlaster, Motorräder, Lastwagen und Fahrräder – ein Durcheinander, das er nun zu zählen versuchte. Dabei schnitt er nach jedem zehnten Fahrzeug mit dem Messer eine Kerbe in das Holz der Brüstung, um sicher zu gehen, dass er sich nicht verzählte.
Indessen hatte sich der Jäger Albert mit seinen Treibern langsam bergauf durch den Hochwald gekämpft. Frische Fährten und Ausrisse im Waldboden deuteten darauf hin, dass sich vor ihnen Rotwild langsam gegen die Plattawand davondrückte. Er war nun überzeugt, dass der Scana Toni zum Schuss kommen würde. Das Wild würde ihm unweigerlich und ohne Hast vor die Büchse kommen. Und so lauschte er denn nach jedem Schritt auf den erlösenden Knall eines Schusses vom Hochstand auf der Münz, der seine Annahme bestätigen würde. Nicht weit vor ihm sah er schon durch einzelne Lücken im Wald den dunklen Fels der Plattawand. Er beschloss daher dem rechten Waldrand zuzusteuern, um vielleicht noch einen Blick auf sich trollendes Rotwild zu erhaschen, wenn es sich, durch die Felswand gezwungen, über die offenen Grasflächen der Platta in Richtung Goraspitz davonstehlen würde. Schon erspähte er durch die ersten lichten Baumlücken den grasigen Steilhang zur Platta, trat wenig später aus dem düsteren Hochwald und schaute gleich hoch zum Zwangspass unter den Ausläufern der Plattawand.
Er blieb wie angewurzelt stehen. Sein Puls machte einen Satz bei dem, was er jetzt sah. Fein säuberlich in einer Kolonne zogen acht Stück Rotwild gemächlich vom Hochwald kommend auf die Alpwiesen der Platta. Jäger Albert riss seinen abgegriffenen Feldstecher hoch. Richtig, dort am Ende der Kolonne tauchte ein Geweihter auf. »Ein Eissprosszehner, ein perfekter Abschusshirsch«, dachte er noch und wartete nun angespannt auf den Schuss aus der Kanzel des Hochstandes, wo der Scana Toni saß.
Aber nichts passierte. Kein Schuss zerriss die idyllische Ruhe. Das Rotwild zog ohne Hast über die Alp und drehte dann langsam in Richtung Goraspitz, wo es kurz darauf im angrenzenden Gehölz verschwand. Der Jäger Albert verstand die Welt nicht mehr. Was war passiert? Warum hatte der Scana Toni nicht geschossen? Von dessen Hochstand auf der Münz drüben gab es doch bei Gott keinen einfacheren Schuss.War er vielleicht auf dem Sitz eingeschlafen? Hatte er vielleicht sogar die Munition zum Gewehr vergessen? War damit die ganze Schufterei des Treibens im steilen Bergwald für die Katz gewesen? Alberts Laune rutschte auf einen Tiefpunkt, und als wenig später das Treiben unter der Plattawand ein Ende fand, das Signal aus dem Jagdhorn das Sammeln am Ausgangspunkt anordnete, stampfte er ziemlich unglücklich in Richtung der Alphütte. Er traf dort auf betretenes Schweigen und hilfloses Schulterzucken. Kein Schuss war gefallen. Niemand hatte Anblick gehabt. So etwas war eigentlich noch gar nie vorgekommen, war der allgemeine Standpunkt der Anwesenden. Selbst der Jagdherr war unglücklich über das Ergebnis.
Der Jäger Albert hörte sich die enttäuscht wirkende Diskussion eine Weile an und wollte gerade seine eigene Beobachtung durchgeben, aber in diesem Augenblick meldete sich der Scana Toni zu Wort:
»Was glaubt ihr, wie viele Fahrzeuge in der Zeit des Treibens allein von Triesen nach Balzers gefahren sind?«, fragte er, sich wichtig in Szene setzend, denn er wusste, dass gar niemand eine Ahnung von seiner bedeutsamen Beobachtung haben konnte. Staunende Gesichter und verdutztes Schweigen. Niemand erfasste, was der Scana Toni mit solch einer Frage bei der alljährlichen Treibjagd im Revier Lawena bezweckte. Fragen über das erfolglose Treiben an diesem Morgen wären ja noch berechtigt gewesen, aber die Anzahl der Fahrzeuge im Tal …? Und so schaute man etwas perplex in die Runde, in der Hoffnung, der Jäger Albert würde ihnen vielleicht mit einer lustigen Erklärung zu Hilfe kommen. Dies tat er denn auch mit einem etwas mürrischen Gesichtsausdruck.
»Ich hätte da eine Gegenfrage, Toni! Wie viele Hirsche hast du in der gleichen Zeit bei dir am Hochstand vorbeiziehen sehen?«
Betroffene Mienen und offene Kinnladen ringsum.
»Was soll die Frage?«, erkundigte sich der Jagdherr misstrauisch, denn er wusste aus reichlicher Erfahrung, dass hinter der Bemerkung seines Jagdaufsehers etwas Spezielles stecken musste.
»Ganz einfach«, begann der Jäger Albert, sich bedächtig eine Zigarette zwischen die Lippen schiebend. »In der Zeit, in der unser Scana Toni die Autos auf der Straße gezählt hat, sind nämlich acht Stück Rotwild direkt hinter seinem Hochstand durchgewechselt. Dabei war auch ein guter Eissprosszehner.«
Ein Aufschrei der Empörung ging durch die Gruppe von Jägern und Treibern. Alles starrte auf den langen und hageren Scana Toni, der jetzt mit dummem Gesicht und in großer Verlegenheit sein Gewicht von einem Bein auf das andere verlagerte, dabei stammelnd versuchte, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Verkehrszählung an den Mann zu bringen. Es war vergeblich. Sein Ruf als tauglicher Waidmann war wieder einmal in ein neues Tief geschlittert. Noch lange musste er an diesem Tag das Gespött seiner Jagdgenossen erdulden, die sich seinetwegen um einen erfolgreichen Jagdtag geprellt sahen. Vom Jäger Albert bis in letzte Detail ausgeschmückt, diente die Episode danach am Stammtisch in der Linde zu Triesen noch für Wochen als Anstoß für ausgelassene Stimmung, aber zweifelsfrei auch schadenfrohes Gelächter.
Der Satansbock
Je nach Jahreszeit, Wetter und persönlichem Ehrgeiz läuft eine Jagd im Revier stets etwas anders ab. Aber anlässlich eines in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts durchgeführten Pirschganges in den Steilhängen des Maurerberges spielte zusätzlich das Element der Überraschung eine bedeutende Rolle. Und das kam so: Der Jagdleiter Ossi vom Revier Pirschwald hatte sich im Spätherbst entschieden, zusammen mit dem Pächter Guntram den im steilen Gelände nur selten benutzten Pirschweg alias Kaiserstraße zu benützen, um möglicherweise den im Schutzwald ansässigen Waldgämsen auf die Pelle zu rücken. Kaiserlich an diesem Pirschweg war aber höchstens die Aussicht, wenn hin und wieder eine Baumlücke den Blick ins tief darunter liegende Tal freigab. Verschlungen wand sich nämlich der schmale Pfad durch eng gewachsenen Jungwuchs und durch alte, knorrige Baumbestände, vorbei an steilen Felspartien und durch steinschlaggefährdete Schluchten. An gewissen Stellen musste man auch erst vorsichtig einen sicheren Tritt suchen, bevor man sich weiter vorarbeiten konnte. Die Gefahr, im steilen Gelände den Halt zu verlieren und abzurutschen, war in etlichen Bereichen der Kaiserstraße durchaus gegeben.
Pirschführer Ossi schlich also langsam und mit den Augen stetig das steile Gelände vor ihm absuchend auf der besagten Kaiserstraße voran. Jagdgenosse Guntram folgte, seinen Steyr-Mannlicher durchgeladen und gesichert, knapp dahinter. Es war ein schwieriges Gehen, und immer wieder verhofften sie, um vorsichtig sperrige Äste aus dem Weg zu räumen oder abgerutschte Stellen im Hang zu umgehen. Sie waren schon eine gute halbe Stunde unterwegs und hatten noch immer keinen Anblick gehabt. Pirschführer Ossi schüttelte verzweifelt seinen Kopf. Er konnte es nicht begreifen. Hier war sonst die Aussicht, auf Gämse zu stoßen, immer sehr groß gewesen. Er wollte schon bitter enttäuscht das Signal zum Rückzug geben, als er durch das Rauschen der nahen wasserführenden Rüfe hindurch das feine Klingeln einer Schelle zu hören glaubte. Abrupt blieb er stehen, lauschte mit zur Seite geneigtem Kopf in Richtung der ihm bestens bekannten, mit senkrechten Felsabbrüchen durchsetzten Rüfe. Guntram schloss vorsichtig auf und lauschte ebenfalls, aber außer dem Rauschen der zu Tale stürzenden Wasser konnte er nichts Ungewöhnliches vernehmen. Alles Deuten von Ossi in Richtung der wilden Rüfe nützte nichts. Doch jetzt schien der Pirschführer es wieder zu hören. Das Geläut drang kurzzeitig und deutlich durch.
»Da oben in der Steilwand scheint sich etwas herumzutreiben«, zischte er. »Weiß der Kuckuck, was es ist, aber wir klettern jetzt langsam in Deckung hoch, bis zu dem großen Felsvorsprung. Dort sollten wir einen Überblick haben.«
Guntram schluckte trocken und nickte. Fünf Minuten später hatten sie den Felsen erreicht, und zwei Augenpaare suchten gespannt die vor ihnen sich in die Höhe ziehende Rüfe ab. Aber so sehr sie auch mit den Gläsern das zerklüftete Gelände absuchten, sie konnten nichts Verdächtiges feststellen.
»Ich hätte schwören können, dass hier irgendwo eine kleine Glocke gebimmelt hat«, sagte Ossi, während er ein letztes Mal die obere Kante der gegenüber senkrecht emporragenden Felswand beobachtete. Aber auch dort, zwischen den am Abbruch stehenden Fichten und dem wuchernden Erlengebüsch, war nichts auszumachen. Enttäuscht über den erfolglosen Pirschgang auf der Kaiserstraße traten sie schließlich den Rückweg an.
Doch der Vorfall ließ Ossi keine Ruhe. Er war überzeugt, etwas Merkwürdiges gehört zu haben. Noch war er nicht imstande, den Laut zu definieren, denn das Verhören war zu kurz gewesen, und zudem hatte das Rauschen des Wassers den fremdartigen Klang übertönt. Aber er war fest entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Kurzerhand rief er noch am selbigen Abend den Mitpächter Ludwig in Eschen an und schlug ihm vor, sich für einen zeitigen Pirschgang am nächsten Morgen vorzubereiten. Der Ludwig vom Flux dankte dem Herrgott für die Gelegenheit, sich wieder einmal für ein paar Stunden aus dem Geschäft zu verabschieden, und sagte prompt zu. Im Morgengrauen des nächsten Tages trafen sie sich bei der alten Holzerhütte, und der Ludwig stieg samt Rucksack und Gewehr in Ossis Wagen um.
Es war schon Tageslicht, als sie endlich den Einstieg in die Kaiserstraße erreichten. Drüben auf der anderen Talseite erhellten die ersten Sonnenstrahlen die schwarz in den Himmel ragenden Felstürme der Kreuzberge, während unten im Tal der sanfte Rücken vom Eschnerberg aus einem endlosen grauen Meer von Bodennebel ragte. Die morgendliche Kälte fuhr den beiden Jägern durch die Knochen, während sie, wie Indianer auf dem Kriegspfad, lautlos auf dem schmalen Weg voranpirschten. Immer wieder blieben sie stehen und lauschten auf verräterisches Poltern von Steinen, das im Steilhang von ziehendem Wild losgetreten wurde. Doch es regte sich nichts. Der Schutzwald schien wie ausgestorben.
»Ich kann das nicht verstehen«, raunte Ossi verzweifelt. »Wir sind zur richtigen Zeit hier, und der Wind steht gut. Es ist wie verhext. Wir sollten eigentlich jeden Moment auf Gämse stoßen.«
Ludwig rümpfte seine Nase, hob verzweifelt die Schultern und zuckte im nächsten Augenblick zusammen. Auch Ossi verharrte jetzt angespannt, starrte steil nach oben. Was war das? Genau über ihnen polterten plötzlich Steine durchs Stangenholz, prallten gegen Baumstämme, schwirrten neben ihnen vorbei in die Tiefe. Hastiges, dumpfes Stampfen verlor sich über ihnen seitwärts in die höheren Regionen.
»Rotwild!«, keuchte Ossi.« Die haben uns mitbekommen. Jetzt sind auch die Gämsen vorgewarnt.«
Der Ludwig nickte nur. Die Spannung war ihm anzusehen. Zitternd rieb er sich seine Hände warm und folgte Ossi erneut auf dem schwierigen Pfad. Sie kamen jetzt bereits in die Nähe der großen Rüfe, und der Jagdleiter spitzte seine Ohren. Hier war es gewesen, als er gestern das komische Gebimmel vernommen hatte, überlegte er. Schritt für Schritt kamen sie nun der Felsenschlucht näher. Schon hörte man das Gurgeln und Rauschen des sich darin durch das Gestein stürzenden Wassers. Da, was war das? Ossi verharrte steif auf dem Weg, und der Pächter Ludwig lief beinahe auf ihn auf. Deutlich hatte er jetzt wieder das klare, feine Glockengebimmel in den Ohren, das er schon gestern ausgemacht hatte. Auch Ludwig hatte jetzt das schwache Geläut mitbekommen.
»Verflucht, das ist eine Schelle, und es kommt von da oben in den Felsen«, raunte er skeptisch. »Was kann das sein? Hier ist weit und breit keine Weide, und der Alpabtrieb ist schon seit bald zwei Monaten vorbei.«
Mit dem Kinn vorgeschoben zeigte Ossi hinauf zum Felsvorsprung, der schon gestern als Ausguck gedient hatte. Auf allen Vieren hochkrabbelnd, erreichten sie kurz darauf den Abbruch, und der als Pirschführer agierende Ossi begann sogleich, die über ihm hochragenden Wände der Rüfe mit seinem Zeissglas abzusuchen. Er versuchte krampfhaft den Ursprung des Bimmelns, das in den Felsen widerhallte, zu finden. Aber es war sinnlos, der Ton schien jedes Mal von wo anders herzukommen. Schließlich folgte sein Blick dem fast senkrechten Felsabbruch links über ihm. Und dann verharrte er plötzlich mit vor Staunen halb offenem Mund.
»Ein Geißbock! Es ist ein verdammter Geißbock, und er hat eine Schelle umgebunden«, fauchte Ossi, ungläubig den wuchtig gehörnten und völlig verwilderten Bock durch das Glas betrachtend. Langes, zerzaustes Haar hing von dessen Nacken, und die schwarz gezeichnete Maske mit dem vom Kopf zurückgeschwungenen Gehörn vermittelte einen fast satanischen Anschein.
»Mach dich bereit!«, befahl er dem verdutzten Ludwig. »Dieses Viech ist gehörig verwildert und gehört nicht in diesen Wald. Wir schießen ihn ab, basta!«
»Aber was ist, wenn er nun ausgebrochen ist und der Bauer danach sucht?«, entgegnete Ludwig erschrocken ob Ossis Vorschlag. »Das könnte uns eine Menge Ärger einbringen.«
»Nichts da! Dieser alte, stinkende Geißbock muss weg. Du siehst es ja, er ist ja schon total verkommen und vertreibt mit dem verdammten Gebimmel seiner Schelle auch noch unsere Gämsen.«
»Ja, aber …«
»Nichts mit aber. Mach dich bereit!«
Der Pächter Ludwig ließ sich nun nicht zweimal bitten. Er verdrängte seine Bedenken und platzierte sogleich seinen Rucksack auf dem bemoosten Felsvorsprung. Dann legte er seine abgegriffene Mauser Büchse obendrauf und schob seinen Körper auf dem abfallenden Gelände in eine passable Stellung, bis er die Büchse auf das Ziel ausgerichtet hatte. Noch stand der gehörnte Teufel breitseitig am Rand des Abbruchs und knabberte mit bimmelnder Glocke an einem Strauch.
»Mach schon, schieß!« rief Ossi jetzt ungeduldig, derweil der Ludwig langsam das Absehen seines Zielfernrohres ins Ziel rückte. Dann brach auch schon donnernd der Schuss, schlug mit einem peitschenden Echo von den kahlen Felswänden der Schlucht wider und hallte ins Tal hinaus. Hoch oben auf dem Felsabbruch aber kippte der Geißbock leblos über die Kante und stürzte in die Tiefe, wo er dumpf aufschlug.
»Waidmannsheil, perfekter Blattschuss«, jubelte Pirschführer Ossi triumphierend, und Ludwig meinte lakonisch: »Aus die Maus!«
Dann repetierte er gewohnheitsmäßig und wollte schon den Sicherungsflügel umlegen, als Ossi ihn hastig niederdrückte und aufgeregt nach oben zeigte, dorthin, wo gerade noch der Geißbock gestanden hatte.
»Die Geiß! Zum Teufel auch, er hat eine Geiß bei sich. Leg sie um, bevor sie den Braten riecht!«
Verstört warf sich Ludwig wieder hinter seine Büchse und blickte durchs Zielfernrohr. Tatsächlich, dort oben und beinahe an der gleichen Stelle stand jetzt plötzlich eine abgemagerte Geiß, die unverdrossen über die Felskante in die Tiefe schaute, wo ihr Gefährte leblos zwischen Felsgestein eingeklemmt ausschweißte.
»Blas sie um! Schnell!« ereiferte sich Ossi vor Aufregung zitternd. Ludwigs Büchsenlauf schwenkte auf das Ziel ein, blieb einen Moment stehen und schlug dann im Knall des Schusses hoch. Oben am Abbruch aber sackte die Geiß wie vom Blitz getroffen zusammen, rutschte dann im Zeitlupentempo über die Kante des Felsens und stürzte ebenfalls in die Tiefe.
»Kein Wunder, dass wir in dieser Gegend keine Gämsen mehr antreffen. Das verdammte Gebimmel dieses Geißenpaars hat alles verscheucht«, mutmaßte Ossi.
»Aber wo kommen die denn her?«
»Wahrscheinlich sind sie von einer Alp im Vorarlbergischen ausgerissen und hier in den Bergwäldern in den letzten Monaten dann völlig verwildert«, doppelte Ossi nach und meinte dann verächtlich: »Wir lassen sie liegen, wo sie sind. Es ist ein willkommenes ›Tischlein deck dich‹ für die Kolkraben und die Füchse im Revier.«
»Ich weiß nicht so recht«, konterte Ludwig. »Das Ganze ist mir etwas in die Knochen gefahren. Was ist, wenn jemand den Geißbock sucht? Er scheint ja ein absolutes Prachtstück zu sein.«
»Mein Gott, Ludwig, mach dir nicht die Hosen voll! Das waren völlig verwilderte Tiere, und im Winter wären sie hier im Berg sowieso eingegangen.«
Aber Ludwig hatte Bedenken. Der Pirschführer Ossi hatte gut reden. Schließlich war nicht er derjenige, der den Abzug der Büchse durchgezogen hatte. In ihm machte sich sein schlechtes Gewissen zunehmend breiter und Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Abschusses begannen an ihm zu nagen. Ossi seinerseits aber war äußerst zufrieden über das erreichte Resultat. Er versuchte Ludwig aufmunternd mit allerlei Argumenten zu beruhigen, schien jedoch damit erst einmal wenig Erfolg zu haben. Der Weg zurück verlief denn auch schweigsam. Ein jeder hing seinen Gedanken nach und überlegte das Wie und Woher betreffend der Herkunft des Geißenpaares.
Nicht ahnend, dass dies noch böse Folgen nach sich ziehen würde, erzählte Jagdleiter Ossi einen Tag später seinem damaligen Aufseher Fritz den Vorfall. Dabei erwähnte er auch die unnötigen Sorgen von Ludwig, der, vom Gewissen geplagt, scheinbar keine ruhige Minute mehr genoss. Ab diesem Moment reifte in Fritz ein gar schauerlicher Plan. Unbemerkt von Ossi und den restlichen Pächtern machte er sich sogleich am nächsten Morgen auf den Weg zur Kaiserstraße, wo er denn auch nach kurzer Suche die Überreste des bereits vom Fuchs angeschnittenen Geißenpaars fand. Kurz entschlossen band er dem hässlichsten aller Geißböcke die Glocke samt Lederband vom Hals und schärfte dessen Haupt ab. Den Rest ließ er, wie auch von Ossi vorgesehen, als gefundenes Fressen für Fuchs und fliegendes Raubzeug zurück. Am nächsten Tag brachte er die Trophäe über die Landesgrenze ins nahe Vorarlberg, um dort bei einem professionellen Präparator das Haupt ausstopfen zu lassen. Dies dauerte natürlich seine Zeit, wurde ihm aber hoch und heilig bis Ende Februar des nächsten Jahres versprochen.
Jagdaufseher Fritz war mit dem bisher Erreichten zufrieden und plante nun sorgfältig seinen nächsten Coup. Klammheimlich packte er das inzwischen gesäuberte Halsband samt polierter Glocke in ein kleines Päckchen. Damit fuhr er ein paar Tage später erneut über die Grenze nach Österreich und legte beim Postamt in Frastanz das Paket mit der Empfängeradresse von Pächter Ludwig in Eschen zum Versenden vor. Die Kosten dazu übernahm er gerne, denn er stellte sich bereits dessen überraschtes Gesicht beim Öffnen des Paketes vor.
Jagdleiter Ossi saß gerade beim Frühstück, als drei Tage später das Telefon klingelte. Ahnungslos nahm er den Hörer ab. Noch bevor er sich melden konnte, brach eine laute, verzweifelt klingende Stimme über ihn herein, sodass er den Hörer vom Ohr weghalten musste. Dass es die Stimme Ludwigs war, wurde ihm gleich einmal klar, aber was die Aufregung sollte, konnte er nicht begreifen.
»Du musst sofort zu mir kommen! Es ist etwas Entsetzliches passiert. Ich kann es dir aber am Telefon nicht erklären. Es ist furchtbar, einfach furchtbar.«
Ossi versprach, sich sofort auf den Weg zu machen. Hastig schlang er daher den Rest des Brötchens hinunter, spülte überstürzt mit Kaffee nach und langte dann nach seinem Autoschlüssel. Noch während der rasenden Fahrt versuchte er die verwirrende Meldung geistig zu verarbeiten, vermutete selbst etwas Fürchterliches und nahm sich vor, erst einmal die Ruhe zu bewahren. Zehn Minuten später hielt er seinen Geländewagen vor Ludwigs Haus in Eschen an. Er hatte in seiner Eile noch nicht einmal die Haustür erreicht, als ihm Ludwig bereits käsebleich im Gesicht entgegen kam. Ohne ein Wort zu verlieren, winkte er ihn hastig herein und in sein Büro. Dann schloss er die Tür hinter sich. Ossi wollte schon fragen, was es mit der Heimlichkeit auf sich habe, aber Ludwig zeigte lediglich mit zittrigen Fingern auf eine weit geöffnete Kartonschachtel auf seinem Schreibtisch.
»Da, schau selbst! Du wirst es nicht glauben«, verkündete er mit klagender Stimme.
Ossi beugte sich vor und betrachtete eingehend eine im Karton in Seidenpapier eingebettete, matt glänzende bronzene Schelle und ein dazu passendes ledernes Halsband. Die Zugehörigkeit dieser zwei Artikel hatte er allerdings in Sekundenschnelle erfasst.
»Das Zeug ist heute mit der Post gekommen, und es wurde in Frastanz, drüben im Vorarlbergischen aufgegeben. Demzufolge weiß man dort, wer die beiden Geißen umgelegt hat«, jammerte Ludwig immer noch fassungslos und einen nahen Stuhl als Halt suchend. Derweil hatte Ossi den aufschlussreichen Inhalt dem Karton entnommen, um ihn einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Dies beinhaltete auch ein ausgiebiges Beschnuppern des Lederbandes.
»Ich weiß nicht so recht. Ein Geißbock stinkt normalerweise fürchterlich, aber dieses Band hier scheint geradezu geruchsneutral zu sein«, meinte er nach einer Weile und versuchte dabei Ludwigs Ängste zu vertreiben. »Hier, riech einmal daran!«
Aber Ludwig hatte alles andere im Sinne, als an diesem Corpus Delicti zu schnuppern. Entsetzt lehnte er sich in seinem Stuhl zurück, den Blick verzweifelt gegen die Decke gerichtet.
»Sie wissen es. Sie haben meinen Namen und die Adresse. Mein Gott, das endet noch in einem Drama!«
»Wer weiß was? Mach dich nicht verrückt, Ludwig. Niemand hat uns dort oben im Berg gesehen. Das ist einfach ein übler Scherz, um dich ins Bockshorn zu jagen.«
Aber der Jagdpächter Ludwig wollte sich überhaupt nicht beruhigen. Er war einfach außer sich, dass er anscheinend bei einer möglicherweise illegalen Sache ertappt worden war. Seiner Ansicht nach waren diese Beweisstücke hier im Karton auch nur eine erste Warnung an ihn. Schlimmeres konnte ja noch folgen. Ossi brauchte viel Zeit und Geduld, um Ludwig etwas zu beruhigen und dessen Adrenalin auf einen normalen Stand zurückzubringen. Schließlich aber schien dieser auf die Argumente Ossis einzugehen und die Angelegenheit als einen bösen Bubenstreich abzutun. Weder der Jagdleiter Ossi noch der Pächter Ludwig konnten allerdings verleugnen, dass dort auf dem Tisch ganz gewiss und ohne Zweifel die Schelle und das Lederband des Geißbockes lagen, den Ludwig vor ein paar Tagen ins meckernde Jenseits befördert hatte.
Entgegen Ludwigs Befürchtungen passierte jedoch in den nächsten Wochen gar nichts, was einen Bezug auf die Jagd auf das Geißenpaar gehabt hätte. Weihnachten ging vorüber und bald wurde wieder einmal ein neues Jahr eingeläutet. Die kommenden Wochen nützte Ossi nun, um die jährliche Abrechnung für die Pächter zusammenzustellen. Diese wurden nämlich jeweils im Frühling anlässlich einer eigens einberufenen Pächterversammlung vorgetragen, wobei die angefallenen Kosten des vergangenen Jagdjahres mit den Einnahmen aus dem Wildbretverkauf konfrontiert wurden. Also wurde vom Jagdleiter Ossi die besagte Versammlung auf die erste Woche des Monats März festgesetzt und, wie damals noch üblich, im Wohnzimmer des Hauses von Jagdaufseher Fritz eingeplant.
Punkt sechs Uhr abends begrüßte Fritz seine Gäste mit einem kräftigen Umtrunk, der wohl dazu dienen sollte, die Zahlen besser verdauen zu können. Alsbald wollte Ossi die Versammlung eröffnen und alle Anwesenden bitten, am großen Tisch Platz zu nehmen. Entgegen der sonst üblichen Platzordnung hatte an diesem Abend der Gastgeber jedoch dem Ludwig als ältestem Pächter vom Pirschwald den Ehrenplatz am Kopf des Tisches zugewiesen. Jagdleiter Ossi fand dies zwar etwas abwegig, weil er normalerweise diesen Platz innehatte, wenn er seinen Vortrag über die Jahresabrechnung hielt. Die Anordnung vom Hausherrn war jedoch zu akzeptieren und hatte auch ihren guten Grund. Denn unbemerkt von seinen Gästen, hatte dieser an der gegenüberliegenden Wand, wo sonst sein Lebenshirsch hing, eine gar sonderbare Trophäe aufgehängt.
Äußerst geschmeichelt nahm also Ludwig den Ehrenplatz am Kopf des Tisches ein, und als alle anderen ebenfalls ihre Stühle besetzt hatten, schaute er lächelnd den Tisch entlang in die Runde. Er schien dabei äußerst vergnügt, machte Witze über besondere Vorkommnisse während des vergangenen Jagdjahres und fühlte sich offensichtlich sehr wohl in seiner Haut. Noch hatte er ja keine Ahnung, was auf ihn wartete, bis zu dem Moment, als sein Blick von etwas gefesselt wurde, das direkt von der gegenüberliegenden Wand auf ihn herunterglotzte. Sein Gesicht wurde plötzlich aschfahl. Mit offenem Mund, die Augen weit geöffnet, starrte er wortlos und gebannt auf das Haupt des scheinbar gerade der Hölle entstiegenen Ebenbildes des Beelzebub. Trotz dessen schwarz gezeichneter Gesichtsmaske und des zottigen Nackenfells war diesem jedoch die Ähnlichkeit zu einem gut gehörnten Geißbock nicht abzusprechen. Nach einer Schreckminute kam ihm die Erscheinung zudem auch noch ziemlich bekannt vor.
Den anderen am Tisch war das komische Verhalten Ludwigs natürlich nicht entgangen, und sie alle richteten jetzt ihre Blicke ebenfalls auf das Objekt seines Entsetzens. Für einen Augenblick blieb es im Raume mäuschenstill, dann aber platzte dem Ossi als Erstem der Kragen. Mit einem lauten Brüller zeigte er mit ausgestreckter Hand auf die Trophäe an der Wand. Dann wollte er etwas sagen, aber die Worte blieben in seinem Halse stecken. Und als niemand sonst am Tisch wusste, worum es überhaupt ging, ergriff Fritz die Gelegenheit, eine Erklärung abzugeben.
»Meine Herren, ich dachte mir, dass die Trophäe des Jahres dort an der Wand unbedingt an dieser Pächterversammlung gezeigt werden sollte. Diejenigen, die sich mit dem Hergang des tragischen Abschusses auskennen, sind bestimmt in der Lage, den genauen Verlauf dieser speziellen Jagd näher zu beschreiben.«
Damit zeigte er salopp in Richtung des immer noch in seinen Grundfesten erschütterten Ludwig, der inzwischen zwar seinen Unterkiefer wieder in Normallage gebracht hatte, aber immer noch bleich um seine Nase versuchte, die Lage einzuordnen. Langsam schienen sich bei ihm die einzelnen Stücke des Horrorpuzzles zusammenzufügen. Inzwischen hatte sich Jagdleiter Ossi bereits wieder von der gewaltigen Überraschung erholt. Zu seiner Verteidigung ergriff er natürlich sogleich die Gelegenheit, seine eigene Version des Geschehens vorzutragen, um den Anwesenden klar zu machen, dass alles seine Richtigkeit hatte.
Die tumultartige Szene, die sich danach am Tisch abspielte, war ein Schauspiel der besonderen Art. Fuchtelnd redeten alle durcheinander. Ein jeder wollte noch genauer wissen, was es mit diesem Bock auf sich hatte, wollte Details hören. Und als der Jagdleiter dann auch noch den Vorfall mit dem von Frastanz im Vorarlbergischen an Ludwig zugeschickten Päckchen zum Besten gab, gab es kein Halten mehr. Grölendes Lachen begleitete die einzelnen Ausführungen der Jagd auf den Satansbock vom Pirschwald, während Ludwig wie ein begossener Pudel und mit hochrotem Kopf das eine Ende des Tisches schmückte. Es wurde eine äußerst lange Pächterversammlung, die bis tief in die Nacht dauerte und dazu auch beinahe noch den letzten Tropfen von Fritz’ Mostvorrat im Keller forderte.
Der Adler vom Ried
In den späten Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurde der Steinadler im Lande Liechtenstein von der Regierung als geschützt erklärt. Das war im Prinzip eine feine Sache. Jedoch hatte dies einen kleinen Haken. Im Nachbarland Vorarlberg war nämlich ein solcher Tierschutz nicht der Fall, und ein Vogel kennt wohl kaum die von Menschen gezogenen Grenzen. Probleme waren also vorprogrammiert.
Eines Tages im Spätherbst sichtete der Jagdpächter Jakob Wohlwend, der sich sehr viel in seinem Riedrevier Ruggell herumtrieb, einen aufgebaumten Steinadler auf der Liechtensteiner Seite der Grenze. Niemand wusste, woher er kam und warum der König der Lüfte seinen angestammten Lebensraum in den Alpen hinter sich gelassen hatte. Allerdings sorgte dessen Anwesenheit im Ruggeller Ried, das grenzüberschreitend bis weit ins Vorarlbergische reicht, für eine gewisse Aufregung. Jakob Wohlwend hatte nämlich seit Tagen beobachtet, wie der große Vogel manchmal im flachen Sturzflug über das Riedgras sauste und, mit einem Hasen oder einem Fasan in den Fängen, sich flugs aus dem Staub machte.
In Jakobs Bauch begannen sich vor Ärger über diese Niederwildräuberei durch den Adler langsam seine Gedärme zu verknoten. Wenn das für Wochen so weiterging, würde bald einmal nichts mehr im Riedrevier für die reguläre Jagd seines Jagdleiters Erich Seeger vorhanden sein. Als anspruchsvoller Pächter und Präsident des Staatsgerichtshofes würde dieser über die Entwicklung auf keinen Fall erbaut sein. Und als er dem Jagdleiter das Problem berichtete, schob dieser wohl nachdenklich seine Brille und die Krawatte zurecht, aberLösung hatte er keine zur Hand. In seiner blasierten Art, mit Untergebenen nur in Hochdeutsch zu kommunizieren, wies er Jakob Wohlwend von oben herab an, über eine Lösung nachzudenken.
Jakob nahm sich dies zu Herzen. Still und heimlich, wie es seinem Wesen entsprach, brütete er über einem Plan, den Adler unauffällig in die gefiederten ewigen Jagdgründe zu schießen. Dies war jedoch leichter gesagt als getan, wusste er doch um den von der Regierung erlassenen Bescheid über den Schutz des Steinadlers. Sollte er erwischt werden, so konnte möglicherweise sein Jagdschein eingezogen werden. Die zusätzlich verhängte Buße würde beträchtlich sein. Da jedoch sein Jagdherr fast täglich mit den Herren vom Gericht zu tun hatte, hoffte er insgeheim mit einem blauen Auge davonzukommen.
Die Raubzüge des Adlers gingen indessen ohne Unterlass weiter, und Jakob befürchtete zunehmend, dass das Ende von Niederwild im Ried absehbar war. Eines Tages Anfang Dezember entschied er sich, die Sache ein für alle Mal mit einem heimlichen Abschuss zu regeln. Wieder einmal hatte er nämlich am Morgen hilflos und mit einer Wut im Bauch zusehen müssen, wie der Adler mit einer Fasanenhenne in den Fängen auf den nahen Hügelzug des Eschnerberges zuflog. Mürrisch und auf Rache sinnend fuhr nach seinem Kontrollgang im Revier durchgefroren nach Hause, um sich aufzuwärmen. Seine Frau hatte sich inzwischen bemüht, ein kräftiges Mahl auf den Tisch zu stellen.
Aber Jakobs Sinne waren nicht auf Essen eingestellt. Obwohl der Duft der Speisen in seiner Nase kitzelte, wollte kein Appetit aufkommen. Die Angelegenheit mit dem räuberischen Adler im Ried wurmte ihn gewaltig, ließ ihn nicht los. Also stocherte er abwesend im Teller herum, während in seinem Kopf langsam der Entschluss reifte, der Räuberei des Adlers noch heute ein jähes Ende zu setzen. Dieser Vogel konnte ja wohl nicht richtig im Kopf sein, wenn er unten im Tal nach Hasen und Fasanen jagte, statt gemäß seinem angestammten Wesen in den Bergen herumzufliegen, überlegte er missmutig. Jakob hatte überhaupt kein Problem mit dem Gedanken, dass der große Vogel dort in seiner Not nach Gamskitzen jagen würde.
»Was ist denn los mit dir?«, wollte seine Angetraute wissen. »Schmeckt dir heute das Essen nicht? Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben.«
»Ach, nichts Besonderes«, beruhigte Jakob. »Ich muss nur noch einmal in einer dringenden Angelegenheit weg.«
Damit kürzte Jakob sein Mittagessen entsprechend ab und schob sich alsbald wieder hinter das Steuer seines betagten Opels. Noch einmal vergewisserte er sich, ob er genügend Munition für seine auf dem Rücksitz mitgeführte Büchse bei sich hatte, dann drückte er auf das Gaspedal. Die Fahrt ins Ruggeller Revier dauerte lediglich zehn Minuten. Nachdem er die letzten Häuser des Dorfes hinter sich gelassen hatte und sich auf einem schmalen Schleichweg im Ried der Landesgrenze näherte, hielt er an und spähte um sich. Er wollte sichergehen, dass keine Zeugen in der Nähe waren. Aber die beißende Kälte schien allfällige Spaziergänger davon abzuhalten, das florale Schutzgebiet des Ruggeller Rieds zu durchstreifen. Weit und breit war keine Seele zu sehen.