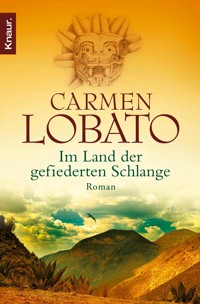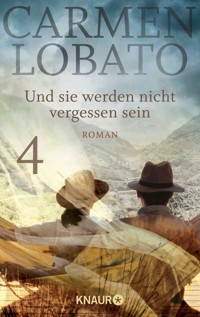
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Teil 4 des sechsteiligen Serials! Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Carmen Lobato
Und sie werden nicht vergessen sein 4
Serial Teil 4
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Inhaltsübersicht
Vierter Teil
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Vierter Teil
Paris, London, Doğubeyazıt, Berlin
»Den eig’nen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andern muss man leben.«
Mascha Kaléko
25
EvaFrühling 1940
Der Krieg war lustig, fanden die Pariser. Drôle de guerre nannten sie ihn, den komischen Krieg. Was daran komisch war, entging Eva. Sie hatte ihren Humor verloren wie ihre Frechheit, wie den Drang, zu malen, und die Lust, einen Mann in den Armen zu halten. Vielleicht war nur komisch daran, dass man vom Krieg nichts spürte, dass die Leute weiter zur Arbeit und wieder nach Hause gingen, Theater und Kinos besuchten, an Tischen, die Gastwirte auf die Straße räumten, Wein tranken und am Flussufer ihre Picknicks abhielten. Es gab Tage, an denen Eva sich wünschte, der Krieg wäre zu spüren, damit den Parisern ihre ewige Lustigkeit verging. Damit das Volk, das um sie herum Tänzchen aufführte, begriff, was in ihrem Innern angerichtet worden war.
Zerstörung und Leere. In ihrem Kopf war ein Bild, obwohl sie nie mehr malen würde, Schluchten aus zerbombten Mauern, die einst zu Häusern gehört hatten, Straßen aus Schotter, in die kein Mensch zurückkehren würde, weiße Knochen, keinem Geschöpf mehr zuzuordnen. Es war ihr einziges Bild, und hätte sie es malen wollen, hätte sie keine Farbe gebraucht. Das hätte sie den mit dem Schicksal flirtenden Parisern in ihre vom Weinlaub umflorten Schädel blasen wollen: Der Krieg, den ihr komisch findet, geht in mir nie zu Ende. Mein Leben hat keine Farbe mehr, und das Einzige, das ihm noch einmal einen Ton verleihen könnte, einen Schatten von Rot oder Blau, ist jenseits des Meeres. Meine eigenen Freunde haben es verscherbelt, und der Krieg, den ihr komisch findet, hindert mich, es zurückzuholen.
Sie hatte den Türken, der sich ihr Kind unter den Nagel gerissen hatte, gesehen, nicht aus der Nähe, weil in die Galerie kein Hineinkommen gewesen war, aber von einer Brücke. Sie hatte hinuntergeblickt ins lauschige Grün, wo das Völkchen bei Brot und Wein turtelte. Der Türke, den sie sich wie einen Vulkan aus wütender Schöpferkraft vorgestellt hatte, war ein handzahmer Musterknabe des Kunstadels, zu dessen Füßen Jungfern in Ohnmacht sanken. Martin Serner in dunkel. Nicht hübsch und golden, sondern düster-exotisch. Seine Frau war eine rotmähnige Liebesgöttin, die den Rock ausbreitete, um sein Haupt in ihren Schoß zu betten und ihm den Schopf zu kraulen.
Eva hätte gern gespuckt. Oder einen Stein genommen und ihn diesen herzigen Götterlieblingen in ihr Idyll geschleudert. Welches Recht hatten die an ihrem Kind? Waren sie bessere Eltern für Chaja, weil sie auf keiner Liste von auszumerzendem Ungeziefer standen, weil sie im distinguierten England lebten, wo Faschismus als unappetitlich im Keim erstickt wurde, weil niemand gewagt hätte, ihren verzärtelten Gliedern ein Leid zuzufügen? Vermutlich bekamen sie obendrein die Schultern geklopft, weil sie so barmherzig waren, ein Waisenkind bei sich aufzunehmen. Aber Chaja war kein Waisenkind, und die beiden waren überhaupt keine Eltern für sie. Chaja war die kleine Königin der Bleibtreustraße, sie hatte Audienzen gewährt und Barmherzigkeit nicht gebraucht.
Hatte dieses malerische Bilderbuchpaar ein Recht auf Chaja, weil ihr Inneres nicht von Krieg verwüstet war? »Wir bieten dem armen Wurm ein Heim«, mochten sie sagen und ohne sardonischen Zug in eine Kamera strahlen. Aber Chaja hatte ein Heim. Ihr Heim war hier, bei Eva, in ihrem verwüsteten Herzen. Von denen da unten mag bleiben was will, doch von mir bleibt nichts als du.
Dem Türken mit seinem Gang wie ein Swingtänzer, der fragte, was die Welt kostete, küsste die Kunstszene die Fußsohlen. Eva dagegen hatte sie ausgespien. Um einen Blick auf eines seiner Werke zu erhaschen, stand halb Paris Schlange, und über seinen albernen leeren Sockel wurde getuschelt wie über die Libido des Papstes. Evas Werke hingegen waren verbrannt und plattgewalzt worden. Seine Wiesenelfe hauchte ihm Küsse in den Nacken, als wollte sie ihn mitten unter seinen Anbetern entkleiden. Eva war auch in den Nacken geküsst und im hohen Gras entkleidet worden, ihr Halbgott hatte über ihrer Schönheit die Fassung verloren, doch das war vorüber. Der Türke hatte alles. Sie hatte nichts, nur einen hölzernen Affen in der Tasche.
Wenn er glaubte, das gebe ihm das Recht, sich ihr Kind einzuverleiben, erkannte sie sein Recht nicht an. Sollte er hundert Haremsdamen die Bäuche mit Kindern füllen, dieses eine war ihres, und sie gab es nicht her.
In ihren schlimmsten Nächten malte sie sich aus, wie sie sich Chaja holte und fortging. Wohin, wusste sie nicht. Wenn sie erst Chaja hatte, war das egal. Nirgendwo wartete jemand auf sie, doch sie würden aufeinander warten. Wenn sie es sich fest genug vorstellte, glaubte sie, in ihrem muffigen Bettzeug den Duft nach Honigmilch und Seife wahrzunehmen. Sie wollte das Geld, das Hagen ihr geschickt hatte, für die Reise nach England sparen, doch von irgendetwas musste sie leben. Ihr Zimmer bezahlen, den Wein, den sie zum Einschlafen brauchte. Also suchte sie sich Arbeit.
Da sie sonst niemanden um Hilfe bitten konnte, half ihr Lucien oder eher dessen Cousin Michel, der alle möglichen Leute kannte. Einer seiner Freunde, ein finster wirkender Kerl mit Narben im Gesicht, den Eva ein paarmal in der Auberge gesehen hatte, war Dreher in der Autofabrik von Citroën, dort wurden Helferinnen für die Betriebskantine gesucht. Sandrine Clermonts Papiere wurden nicht allzu genau überprüft, und zum Kartoffelschälen brauchte man kein Französisch. Von den Frauen, die ihre Schicht teilten, konnte es kaum eine, und Michels Freund, der Dreher, sprach es mit schwerem Akzent.
Es war scheußliche Arbeit. Erniedrigend. Aber um wie viel tiefer konnte eine wie Eva noch sinken? Schlimmer war, dass die Bezahlung jämmerlich war. Ihr blieb nichts übrig, als doch auf das Geld von Hagen zurückzugreifen, und die Fahrt nach England rückte in immer weitere Ferne. Sie hätte ihren Körper verkaufen sollen, aber wer würde für das Wrack auch nur einen Sou bezahlen? Zudem hätte sie den Mann, der nach ihrem Körper griff, womöglich umgebracht.
Sie hatte Wilma geschrieben, dann Paul. Die beiden hatten Chaja gestohlen, sie mussten ihr helfen, sie wiederzubekommen. Aber Wilma und Paul hatten nicht einmal geantwortet. Stattdessen war der Türke nach Paris gekommen. Lucien hatte Eva zugesagt, ihr eine Karte für die Vernissage in der Galerie zu besorgen, doch dann war er bei einem seiner Mädchen hängen geblieben und hatte es vergessen. Sie hätte den Türken am Fluss zur Rede stellen können, aber während sie auf der Brücke stand und auf das Gemälde dieser Sommerfrischler hinuntersah, wurde ihr klar, dass sie sich ins eigene Fleisch schnitt, wenn sie Chaja hier in Paris von ihm zurückforderte.
Er würde wohl kaum postwendend heimfahren, um sie zu holen. Eher würde er ihr wie ein honoriger Seelsorger ins Ohr säuseln, dass sie bei seiner Rotgelockten besser aufgehoben sei, Eva solle an das Wohl des Kindes denken, und er empfehle sich. Wer würde ihr helfen? Sie konnte zu keiner Behörde laufen und melden, ein ausländischer Ehrengast habe ihr Kind gestohlen. Sie war Sandrine Clermont und hatte kein Kind. Nach England zu fahren und sich Chaja zurückzuholen war ihre einzige Chance.
Das war das Härteste: den Mann seiner Wege ziehen zu lassen. Drei Tage später begann der drôle de guerre, der komische Krieg. Der Weg war versperrt.
Sie ging wieder zu Lucien, weil sie noch immer niemanden hatte, an den sie sich wenden konnte. Nur einen Jungen von zwanzig, der von Flüchtlingen Geld stahl und sich mehr oder weniger verkaufte. »Du musst mir helfen«, beschwor sie ihn. »Ich muss nach England.«
Lucien hüstelte und klang nicht länger wie zwanzig. »Dahin müssen wir alle. Aber dahin kommen wir so leicht wie ins Himmelreich.«
Als sie ihn bedrängte, packte er sie hart am Arm. »Hör auf mit dem Quatsch, besinn dich endlich. Du bist nicht erst seit gestern hier, du hättest dir Verbindungen schaffen können. Aber das hast du nicht gemacht, du hast nicht einmal richtig Französisch gelernt. Stattdessen hast du dich auf uns verlassen, und jetzt stehst du da, weil wir dir nicht mehr helfen können. Wir sind froh, wenn wir uns selbst helfen können und nicht im selben Lager landen wie du.«
»In was für einem Lager?«
»Le Vernet«, spuckte er aus. »In den beschissenen Pyrenäen, am beschissenen Ende der Welt.«
»Und wer landet da?«
»Du hast nichts im Kopf als die Soße, in der du schmorst, richtig? Wir sind im Krieg, schon vergessen? Im Krieg mit eurem beschissenen Hitler. Seit Jahren haben wir Leuten geholfen, die der sonst massakriert hätte, wir haben gehofft, es ließe sich hier zusammen etwas aufbauen, vereinter Widerstand, der dieses Monstrum aufhält, aber es gab zu viele wie dich, denen das am Arsch vorbeiging. Und da sind wir jetzt alle. Am Arsch.«
Eva brauchte Wochen, um zu begreifen, wie tief die Falle war, in der sie saß: Deutsche Flüchtlinge wurden fortan als feindliche Ausländer betrachtet und in einem Internierungslager im entlegenen Süden zusammengepfercht. Männer wie Lucien und Michel, die der Kommunistischen Partei angehörten, wurden in Scharen verhaftet und ebenfalls verschleppt. »Wir gelten genauso als Feinde wie die Faschisten«, spie Lucien gallebitter aus. »Am Ende werfen sie uns zu denen in die Zelle – lieber verhungere ich, bevor ich aus deren Blechnapf fresse. Da hat man mal gedacht, man hat ein bisschen Glück, und schon ist alles am Arsch.«
Das bisschen Glück war ein Mädchen aus London. »Nicht hübsch. Dicke Beine, Gesicht wie ein Crêpe. Aber darauf zu achten muss man sich leisten können. Die Leute haben Geld. Wär’ ich zu ihr gegangen, hätten sie mir sicher geholfen, mir was aufzubauen. Dann hätt’ ich dich rüberholen können. Damit ist’s Essig.«
Er musste verschwinden. Der Mann mit dem schweren Akzent, der bei Citroën als Dreher arbeitete, nahm ihn und Michel mit in den Norden, nach Rouen, wo sie untertauchen konnten. Die Auberge vernagelten sie mit Brettern. Eva kam es vor, als würde ihr das Fenster ihres Kerkers zugenagelt. Lucien bedeutete ihr nichts, Michel kannte sie kaum, und in Gegenwart des Drehers war ihr unbehaglich, aber sie hatte einen Ort gehabt, an dem sie ein paar Worte wechseln konnte, wenn ihr das Schweigen über den Kopf wuchs. Zudem gab es jetzt niemanden mehr, den sie um Hilfe bitten konnte.
Aus der Kantinenküche verschwand die Hälfte der Frauen. Der Mann mit den Vögeln wurde verhaftet und schreiend die Treppe hinuntergezerrt. »Étrangers indésirables«, zischte Graindorges Tochter. Unerwünschte Ausländer. »Was machen die alle auf einmal bei uns?« Der Mann war Jude aus Turin, was Eva erst jetzt erfuhr, wo sie ihn nie wiedersehen würde. Für unsere Länder sind wir Feinde, die es hinauszujagen gilt, dachte sie. Und im Ausland sind wir Feinde, weil wir aus diesen Ländern stammen. Sollen wir auf den Mond? Ins Meer? Hat irgendwer sich überlegt, was mit uns geschehen soll? Wohin die Vögel des Italieners verschwanden, blieb ein Rätsel. Tagelang konnte Eva ihre blanquette nicht essen, weil sie fürchtete, Graindorges Tochter hätte die Vögel darin verhackstückt.
Sie selbst hatte vorerst Glück. Sie besaß einen französischen Pass, musste sich jedoch unauffällig verhalten, um keine Kontrolle herauszufordern. Zudem galt der Pass nicht ewig. Was zu tun war, wenn er ablief, wusste sie nicht.
Dafür wusste sie etwas anderes: Sie würde in kein Lager gehen, würde sich nicht noch einmal einsperren lassen. Hätte sie Chaja bei sich gehabt, wäre sie mit ihr geflohen, irgendwohin, wo es keine Menschen, keine Lager, keine Zellen gab. Aber sie hatte Chaja nicht bei sich. Sie musste ausharren und den Kopf einziehen, um niemandes Misstrauen zu erregen. Lucien hatte recht: Warum nur hatte sie in all den Monaten, die sie hier lebte, nicht einmal Französisch gelernt?
In den Monaten, die sie hier lebte? Lebte?
Was sie tat, war kein Leben. Nur Überleben. Warten auf Chaja. Einerseits verging die Zeit nicht, sondern trat endlos auf der Stelle, andererseits war es unglaublich, wie viel schon verstrichen war. Herbst und Winter gingen. Eva zwang sich, täglich Le Temps zu kaufen, ihr Französisch zu verbessern und zu erfassen, was außerhalb ihrer leeren Welt geschah. Hitler hatte Polen überrannt und Stalin einen Streifen davon abgegeben. Dass Großbritannien und Frankreich ihre Beteiligung an diesem Krieg erklärt hatten, schien in Vergessenheit geraten zu sein. Es gab ein Scharmützel im Saarland, das nach wenigen Tagen abgebrochen wurde. Junge Männer, die eingezogen worden waren, kehrten nach Paris zurück.
Als die Kastanien wieder blühten und Eva klarwurde, wie lange sie Chaja nicht gesehen hatte, musste sie mitten auf der Brücke stehen bleiben und sich am Geländer festhalten. Chaja war fünf gewesen und war jetzt fast sieben. Eva hatte nicht einmal ein Bild von ihr, und Chaja hatte kein Bild von Eva. Wusste sie noch, wie ihre Mutter ausgesehen hatte, wenn sie sich über ihr Bett gebeugt hatte? Klang ihr im Ohr noch ihre Stimme, die als Erstes ihren Namen gerufen hatte, von wo auch immer sie heimgekommen war? Evas Leib schmerzte, als platze er wie eine Wunde. Jäh musste sie an die Skulptur auf dem Plakat denken, den aufgetriebenen Bauch, aus dem etwas herausgerissen worden war.
»Frau.« Jemand nahm ihren Arm, eine Französin, wohl im Alter ihrer Mutter. »Kriegen Sie ein Kind, geht es los, brauchen Sie einen Arzt?«
Nein, ich kriege kein Kind. Ich habe nur ein einziges gekriegt, von dem einzigen Mann, und er hat mir versprochen, seine Liebe halte alles aus. Die Nazis haben mir meine Bilder weggenommen und mein Ich kaputt geschlagen, aber mein Kind haben mein Geliebter und meine Freunde an den Türken verkauft. Der hat eine Skulptur davon gemacht: einen Menschen mit zertrümmertem Gesicht und zerrissenem Leib, die Hand, die nach dem Kind greifen wollte, abgehackt.
»Was sagen Sie?«, fragte die Frau. »Sie sind nicht von hier, was? Warten Sie, ich sehe nach, ob ich vorn an der Straße jemanden finde, der den Arzt ruft.«
Eva schüttelte den Kopf, wagte nicht, zu sprechen und sich vollends zu verraten.
»Verstehen kein Französisch?«, fragte die Frau mitfühlend. »Norwegerin?«
Verblüffung betäubte den Schmerz: »Wie kommen Sie denn darauf?«
»Na, da sind die Deutschen doch jetzt auch«, sagte die Frau. »Wo wir die Polen haben, werden wir ja sicher als Nächstes die Norweger kriegen.«
»Ja«, murmelte Eva. »Sicher.«
»Bald tummelt sich hier halb Europa. Die Deutschen kriegen doch den Hals nicht voll, aber zu uns kommen sie nicht rein. Mein Mann sagt: An der Maginot-Linie rennen sie sich die Köpfe ein.«
Eva nickte. »Bien sûr.«
»Geht’s Ihnen besser? Kommt das Kind noch nicht?«
»Nein«, sagte Eva. »Es kommt noch nicht.«
»Dann alles Gute.«
Wie bescheiden man wurde. Früher hätte sie vermutlich mit Wilma über den Topfhut, den die Frau trug, gelästert, heute war sie dankbar für die paar freundlichen Worte. Ihr Kind kam noch nicht. Es würde den Tag feiern, an dem Eva es geboren hatte, und sie würde nicht bei ihm sein.
Die Erinnerung, die sonst zu schnell verblasste, bekam ein flüchtiges Leuchten: An Chajas viertem Geburtstag war Eva mit ihr zu ihrem Händler für Künstlerbedarf gegangen, und sie hatte sich aussuchen dürfen, was sie wollte. »Eine Staffelei, ich will meine eigene Staffelei!« Hinterher hatten sie sich mit Wilma zu Kranzler gesetzt, neben sich die Staffelei, auf die Chaja ihr geliebtes Bild vom traurigen Clown gestellt hatte, und auf ihren Wunsch hin hatten sie »so viel Kuchen gegessen, wie in uns reinpasst«. In Wilma hatte bedeutend mehr Kuchen reingepasst als in Eva und Chaja zusammen.
Später war Martin mit Hagen zu ihnen gestoßen, und sie waren mit Champagner ins Babeurre umgezogen. »Auf meine Prinzessin, das schönste Mädchen, das je geboren worden ist.«
In Martins Augen hatten Tränen geglänzt. Sie hatte ihn dafür geliebt, er war ein Bild von einem Mann, er konnte sich erlauben, wie ein Schlosshund zu heulen. »Danke für das wundervollste Geschenk meines Lebens – ich war nichts, bevor ihr beide kamt, ich weiß nicht, wie ich gelebt habe.« Dann hatte er Eva geküsst.
Bist du jetzt wieder nichts, Martin? Warum hast du es nicht bei dir behalten, das wundervollste Geschenk deines Lebens? Wäre Chaja bei ihrem Vater, ich könnte ertragen, sie nicht bei mir zu haben, ich könnte ertragen, an sie zu denken und mir vorzustellen, wie du ihr von mir erzählst, ihr meinen Namen nennst und ihr mein Gesicht auf Bildern zeigst. Sie würde auf mich warten und nicht vergessen, dass ich ihre Mutter bin.
Ich wäre nicht ausgelöscht, als hätte es mich nie gegeben – im Leben meines Kindes wäre ich noch da.
Die deutsche Wehrmacht besetzte Norwegen und Dänemark, und in London geriet darüber die Regierung ins Wanken. Irgendein früherer Kriegsminister hatte nicht länger still sitzen, sondern Norwegen selbst besetzen und Hitler entgegentreten wollen. Er war nicht gehört worden, und jetzt warf die Opposition Premierminister Chamberlain vor, er habe eine Flutwelle über Europa rollen lassen, ohne zumindest einen Damm zu bauen. Eva betrachtete das körnige Zeitungsfoto. Früher hätte ich ihn malen wollen, dachte sie. Der Mann sah nicht aus wie ein Kriegsminister, sondern wie jedermanns Großonkel, ein verfetteter Bassethund mit Zigarre. Nur die Augen und der schiefgezogene Mund verrieten, welch ein Orkan in ihm auf seinen Ausbruch wartete.
Drei Tage später kannte seinen Namen die ganze Welt. Er hieß Winston Churchill und löste Chamberlain als Premierminister ab, er war der Mann, der die Kartoffeln aus dem Feuer holen sollte. Am selben Tag marschierten deutsche Truppen in die Niederlande, nach Belgien und Luxemburg ein. Eva ging zur Arbeit. In der mit Dampf gefüllten Großküche stand jede Helferin für sich und starrte auf Schälgut und Schälmesser, zu verängstigt, um den Kopf zu heben. Als Eva ins Hotel zurückkehrte, beschlich sie der Eindruck, die Franzosen zögen ihre Köpfe ein wie die fremden Arbeiterinnen.
Rotterdam ergab sich nicht. Warschau hatte sich ebenfalls nicht ergeben. In den Zeitungen waren Bilder von beiden Städten, nachdem deutsche Bomber sie zum Aufgeben gezwungen hatten. Warschau und Rotterdam glichen dem Bild in Evas Kopf. Früher hatte sie einmal zu Martin gesagt: »Vielleicht brauche ich Krieg, um weiterzukommen. Um Gesichter zu schaffen wie dein Türke, muss ich vielleicht einen Schmerz darin sehen, den ich mir ohne Krieg nicht vorstellen kann.«
Jetzt dachte sie: Wenn ich ein Bild vom Krieg malen würde, wäre kein Gesicht mehr darin. Nichts Menschliches. Sie hätte eine Leinwand grau anmalen und sie Warschau und Rotterdam nennen können.
Nur Warschau und Rotterdam?
Zwei Tage später fielen Bomben auf Sedan hinter der belgischen Grenze. Deutsche Panzerdivisionen folgten. Statt sich die Köpfe an der Maginot-Linie einzuschlagen, kamen sie über die Ardennen, die nach Einschätzung der französischen Heerführung unpassierbar waren. Die Stadt wurde eingenommen. Am nächsten Tag flog Churchill nach Paris, um mit dem französischen Ministerpräsidenten Reynaud zu sprechen. Als Eva zur Fabrik kam, wurden sie und die anderen Frauen an den Toren abgewiesen. Es gab keine Arbeit mehr, die Betriebsküche war geschlossen, und ausstehender Lohn verfiel. Zu protestieren wagte keine der Frauen. Sie gingen mit eingezogenen Köpfen ihrer Wege.
Was sollte werden, wenn die Küche sie nicht wieder aufnahm, wo sollte sie Arbeit finden, wie sollte sie leben? In ihrer épicerie, wo sie, um zu sparen, keine Lebensmittel, sondern nur Wein kaufte, blieben die Kunden zum Schwatzen, weil niemand das Alleinsein aushielt. »Jetzt kommen ja die Briten«, dozierte ein selbsternannter Redner. »Die richten’s schon. Der Spuk ist bald vorbei.«
»Ha, die boches nach Hause schicken, das könnten wir selbst«, protestierte das pomadisierte Männchen, das den Laden betrieb. »Dazu braucht’s keine Briten, sondern einen anderen Mann an der Spitze. Reynaud ist ein müdes Füchslein, das nichts vom Krieg versteht, aber wenn wir Pétain die Zügel in die Hand geben, lehrt er die boches das Fürchten, wie er’s schon einmal getan hat.«
Eine Frau, die mit ihren zwei Einkaufstaschen schon an der Tür war, drehte sich um. »Damals sind die boches aber nicht über Sedan hinausgekommen«, sagte sie. »Heute sollen sie schon vorm Kanal sein, und Maréchal Pétain ist kein schneidiger Kriegsheld mehr, sondern ein Greis mit Mitte achtzig. Was für Wunder soll der wirken, er oder der lasche General Weygand, den sie nun plötzlich als Oberkommandanten aus Syrien herbeizitieren?«
»Seit wann verstehen Frauen was vom Militär?«, brummte der Ladenbesitzer. »Habt ihr mit Einkauf und Kindern nicht genug zu tun?«
»Voilà.« Die Frau hob die prallen Taschen. »Mein Einkauf ist gemacht. Und mit den Kindern fahre ich morgen ins Sommerhaus. Wenn die boches hierherkommen, in ihren scheußlichen Uniformen, dann steh ich nicht da und heiße die willkommen.«
»Hierher?« Der Redenschwinger wandte sich ihr zu, und der Ladeninhaber ruckte an seiner Brille. »Ma belle dame, dies hier ist Paris, die Hauptstadt von Frankreich. Wenn die boches hierherkommen wollen, um sich eine Tracht Prügel abzuholen, sollen sie’s nur versuchen. Aber die Prügel beziehen sie schon im Norden, so war’s das erste Mal, und so kommt’s diesmal wieder. Bis es Zeit für die Sommerhäuser wird, ist der Krieg vorbei.«
Vielleicht würde der Krieg vorbei sein, doch mit welchem Ausgang? Die Gespräche in den Straßen wurden stiller, die Kinos schlossen, in der strahlenden Frühlingssonne picknickte kein Mensch mehr am Fluss. Am 4. Juni nahm die deutsche Wehrmacht Dünkirchen ein. Mehr als 300000 Soldaten, Briten wie Franzosen, flohen zu Schiff über den Ärmelkanal nach England.
Eva ging weiterhin jeden Morgen zur Citroën