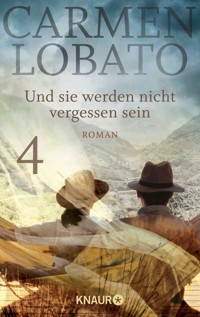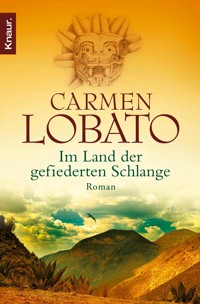1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Teil 5 des sechsteiligen Serials! Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Carmen Lobato
Und sie werden nicht vergessen sein 5
Serial Teil 5
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft unvergessliches Liebespaar: Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe beweisen müssen.
Inhaltsübersicht
Letzter Teil
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Letzter Teil
Sainte-Cécile-les-Vignes, London, Doğubeyazıt, Aghtamar
»Nicht, dass ich weine, Liebster, darf dich wundern.
Nur, dass ich manchmal ohne Träne bin.«
Mascha Kaléko
31
EvaSainte-Cécile-les-Vignes. September 1942
Der Ort lag zwischen Weinbergen, in seine Ebene gebettet wie ein Kind in seine Wiege. Chajas Wiege hatte Eva in den Nächten vor ihrer Geburt bemalt. Mit Menschenfiguren. Etwas anderes malte sie nie. Ob Chaja manchmal von der Wiege träumte?
Das silbrige Glitzern der Olivenbäume, die mittelalterlichen Mauerreste, die in der Sonne schliefen, die Kegel von Mückenschwärmen über schwarzen Teichen, nichts davon hätte die alte Eva je dazu verlockt, zu Pinseln und Palette zu greifen. Jetzt wünschte sie sich zuweilen, sie hätte etwas wie diesen vergessenen Flecken Erde im Département Vaucluse gemalt, etwas, das dem Weltgeschehen gänzlich gleichgültig war und das deshalb eine Art von Frieden ausstrahlte.
Frieden, das hatte Eva gelernt, war die Abwesenheit von Menschen. Die aber gab es nicht einmal hier, so selten auch ein vereinzeltes Menschenwesen den buckligen Pfad hinunter ins Dorf trottete. Hätten nicht Menschen über das verschlafene Nest wie über die wimmelnden Promenaden von Paris geherrscht, so hätten sich andere – solche wie sie – nicht in den dunklen Winkeln von Scheunen verstecken müssen.
In der Scheune lebte Eva, seit der Armenier sie in seinem Wagen hergebracht hatte. Als sie mit den fünf anderen von der Ladefläche getorkelt war, hatte sie geglaubt, sich aufzulösen, in Strömen von Schweiß und schmelzender Lebenskraft zu zerfließen. Sie konnten nicht alle bleiben. Manche mussten zu Fuß bis in den nächsten Ort weiter. »Ich kann nicht mehr«, sagte Eva. Die Worte brachte sie gerade noch heraus, ehe sie zusammenbrach.
Also war ihr in der Scheune ein kleiner Verschlag überlassen worden, in dem Rechen, Forken und Schaufeln aufbewahrt wurden. Dass die Deutschen drei Tage später Paris besetzt hatten, erfuhr sie erst nach etlichen Wochen. Frankreichs Regierung hatte um Waffenstillstand gebettelt, und Hitler hatte sich einen Spaß daraus gemacht, ihre Unterhändler den Vertrag in Compiègne unterzeichnen zu lassen, im selben Eisenbahnwaggon, in dem Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg seine Kapitulation hatte unterzeichnen müssen.
Hitlers Truppen besetzten Frankreichs Norden und seine Mitte, überließen den Süden jedoch den Greisenhänden ihres willfährigen Erfüllungsgehilfen Maréchal Pétain, der seinen Regierungssitz in dem beschaulichen Kurort Vichy errichtet hatte. »Das heißt aber nicht, dass ihr Juden hier im Süden willkommener seid«, hatte der Armenier erklärt. »Manche sagen, die Herren von Vichy, die in den Luxushotels wie in Palästen Hof halten, geben sich alle Mühe, die Deutschen in ihrem Hass zu übertreffen. Wir haben es hier unten nur leichter, weil die Franzosen nicht so wirkungsvoll erfassen und organisieren können wie die Deutschen. Es heißt, so war es auch bei den Osmanen. Viel dünn besiedeltes Land, viel Misswirtschaft und Chaos, daher ein paar mehr Maschen im Netz, durch die einige Glückliche schlüpfen konnten.«
Die Masche im Netz, durch die der Armenier hatte schlüpfen können, war ein Waisenhaus im französischen Protektorat Libanon gewesen, in das eine kurdische Familie ihn und seinen Bruder geschafft hatte, nachdem sein Vater erschlagen worden und seine Mutter verhungert war. »Dort bekamen wir zu essen und mussten keine Angst mehr haben«, sagte er. »Wir waren dankbar.«
Eva wusste, sie hätte ebenfalls dankbar sein sollen. Weder der Armenier noch das Bauernpaar, das ihr seinen Verschlag in der Scheune zur Verfügung stellte, schuldeten ihr etwas. Sie riskierten ihr Leben, aber Eva war nicht fähig, Dankbarkeit zu empfinden. Wer in eigenem Leid fast ertrank, hatte keinen Raum für das von anderen. Sie hörte dem, was der Armenier erzählte, kaum zu und vergaß es gleich wieder.
Einst hatte sie sich aus eigener Kraft ein Leben erkämpft, den Platz in der Welt, der ihr gefiel und an den sie passte, sie hatte Schönheit, Grips und Talent besessen und sich in ihre Arbeit gestürzt, ohne auf jemandes Hilfe angewiesen zu sein. Warum musste ein Mensch wie sie, der keinen Hagen Fidelis gebraucht hatte, sondern seinen Weg allein gegangen war, ein paar Jahre später dankbar für ein paar alte Laken in einem Heuschober sein, für hartes Brot und Wasser, das sie sich nach Sonnenuntergang aus dem Brunnen schöpfen durfte? Was hatte sie getan, dass sie sich jetzt für ein Leben bedanken sollte, in dem sie nicht mehr war als eine Ziege, mit der niemand sprach?
An manchen Tagen wäre sie dankbar für einen Strick gewesen, um ihn am Dachbalken festzuknüpfen und ein Ende zu machen. Dann aber flammte der Chaja-Hunger auf, die Gewissheit, dass sie sich Chaja zurückholen und dafür am Leben bleiben musste. Sie war eine Frau, der alles genommen worden war, sogar ihr eigenes Kind. Sie hatte keinen Grund, irgendeinem Menschen dankbar zu sein.
In Paris war die Zeit zugleich zu langsam und zu schnell vergangen. Hier verging sie gar nicht und war dabei schon um. Ziegen rupften Gras, und über Nacht schien es nachzuwachsen. Regen fiel selten und versickerte gleich wieder. Unvorstellbar war, dass anderswo Zeit eine Bedeutung hatte, dass sie aus einem kleinen Kind ein Schulmädchen machte, das vielleicht eine Zeichenmappe unter dem Arm trug, vielleicht schiefe, entartete Gesichter malte und dafür Schläge auf Herz und Mut bekam. Versuchten der Türke und seine rotgelockte Frau, aus ihrer begabten Tochter eine Spießerin zu machen, die im Faltenröckchen zur Hauswirtschaftsstunde ging?
Ihr Verstand sagte ihr, dass der Türke ein Künstler war, zwar ihr Feind, der Dieb, der ihr vier Jahre mit ihrem Kind geraubt hatte, doch immerhin in der Lage, ein Talent wie das von Chaja zu erkennen und zu fördern. Aber wer sagte ihr das? War der Mann, der sich fraglos für einen Gottbegnadeten hielt, bereit, die Begabung eines andern neben seiner eigenen stehen zu lassen, noch dazu die eines kleinen Mädchens? Und selbst wenn – es war nicht sein Recht, Chaja auf ihrem Weg in die Kunst zu begleiten, das Recht dazu hätte allein Eva zugestanden!
In einer einzigen Nacht träumte sie von Chaja und erwachte mit tränennassem Gesicht. Der Traum war eine Aneinanderreihung von Erinnerungen, die bei Tag allzu schnell verblassten: Chaja, die von Eva den ersten Kasten Farbstifte bekam und jede einzelne Farbe betrachtete, Chaja, die sich in der Kunsthandlung die Staffelei auswählte und Evas Bild daraufstellte, das sie den traurigen Clown nannte, und schließlich Chaja an dem Tag, an dem ihre Welt zerbrochen war, Chaja, die Eva versprach: »Meine Bilder schenke ich dir, Mama. Und morgen male ich dir neue.«
Würde Chaja jetzt ihre neuen Bilder der Frau des Türken schenken?
Eva sehnte sich danach, noch einmal von ihr zu träumen, doch es geschah nie wieder. Oft sprach sie über Wochen mit niemandem ein Wort. Die Tochter des Bauern, die ihr Essen brachte, flüchtete stets hastig wieder, als glaube sie, Eva sei eine Hexe, die in der Besenkammer hauste. Der Bauer ließ sie ab und an bei der Arbeit helfen, Trauben stampfen, Heu bündeln, Wäsche waschen, es war eine Wohltat, aber es geschah nicht oft. Alle paar Monate kamen Michel, der Armenier oder ein anderer Helfer, die Flüchtlinge brachten oder abholten. Auch dabei wurde kaum geredet, oft sprachen die Leute, die eine Zeitlang bei dem Bauern unterschlüpften, nur Polnisch oder sie trauten keinem als einander. Eva fragte sich, wohin die, die abgeholt wurden, wohl kamen. Mit dem Armenier sprach sie nicht darüber, doch als ihr zweiter Herbst in der Scheune anbrach, kam Lucien.
Es war fast, wie einen Freund wiederzusehen, obwohl Lucien ihr gleichgültig war. Er war jemand, der sie kannte, der wusste, dass sie Sandrine hieß, und dass sie nicht so hieß, spielte kaum eine Rolle. Er war heiter, geradezu aufgedreht. »Das mit den boches hat bald ein Ende, du wirst sehen. Wir haben de Gaulle. Wir haben die Engländer, die uns nicht hängenlassen. Aber vor allem haben wir einen Helden wie Jean Moulin. Wir schlagen jetzt erst richtig los.«
Noch etwas anderes begeisterte ihn mindestens so sehr wie der Résistance-Führer, der nach England geflogen war, um mit den Leuten von France libre zu sprechen: »Stell dir vor, ich hab einen Sohn. Mit dem Mädel, von dem ich dir erzählt hab, der dicken Londonerin mit den Eltern, die Geld haben. Wenn wir die boches vertrieben haben, fahr ich dahin. Bau mir was auf. Édouard heißt mein Junge, er kann schon laufen.«
Er zeigte ihr eine Fotografie, auf der ein übergewichtiges, mondgesichtiges Mädchen und ein übergewichtiges, mondgesichtiges Baby in die Kamera grinsten. Evas Herz verkrampfte sich, so heftig wünschte sie sich, sie hätte ein Bild von Chaja besessen oder wenigstens erzählen können, dass es Chaja gab.
»Schau ihn dir an. Kommt mehr nach mir als nach der maman, was?«
Eva schaute, und ihr Herz verkrampfte sich noch stärker. Nicht wegen des Kindes, sondern wegen dessen Mutter. Eva war Malerin gewesen, sie hatte einen Blick für Gesichter und vergaß nie eines. Das wenig attraktive Mädchen auf dem Foto und seine Mutter im silbernen Etuikleid hatten zum Gefolge des Türken gehört.
»Ich hab ihr von mir auch ein Bild geschickt«, sagte Lucien. »Für meinen Jungen. Damit er seinen Vater erkennt, wenn ich komm.«
»Wie hast du ihr das denn geschickt?«
Lucien zuckte die Schultern. »Ich darf dir nichts sagen. Je weniger man weiß, desto weniger kann man verraten. Die Engländer, die euch rausholen, nehmen was mit, wenn sie können. Ist alles nicht sicher und dauert ewig, ist aber besser als nichts.«
»Was für Engländer?«, fragte Eva.
Noch einmal zuckte Lucien die Schultern, sich wohl bewusst, dass er bereits zu viel sagte, und doch nicht in der Lage, zu schweigen. Menschen waren zum Schweigen nicht gemacht, sie waren in dieser Zeit des Schweigens wie Hunde, denen man die Schwänze kupiert hatte und die deshalb mit den Ärschen wackelten. »Die Engländer sind unsere Verbündeten«, versuchte er, sich lapidar herauszuwinden. Dann senkte er die Stimme. »Die schicken Flugzeuge und Fallschirmspringer rüber, Agenten, die uns helfen. Die landen in den Alpilles, und wenn einer von uns rausmuss, nehmen sie den mit. Sonst holen sie nur Juden. Michel, mein Cousin, hängt da groß mit drin. Ein paar von denen sind Freunde von ihm, dieses Kunstvolk von der Galerie.«
»Lucien«, sagte Eva und wünschte, sie hätte ihre Schönheit noch gehabt, ihr Pfund, oder irgendeine andere Waffe. »Sag Michel, die Engländer sollen mich auch rausholen. Es ist dringend, es geht um Leben und Tod, und ich zahle es euch zurück.«
Lucien lachte auf. »Darum geht’s bei allen. Worum denn sonst?«
»Bei mir geht es um mehr.«
»Ich seh, was ich tun kann«, sagte er. »Aber Frauen mit Kindern kommen erst dran. Das musst du verstehen.«
Schweigen tat weh. Bei Menschen nützte kein Arschwackeln.
Die Hoffnung hatte sie über den Winter gebracht. In den Stürmen konnte kein Flugzeug in den Bergen landen, doch wenn der Frühling kam, würde auch Lucien wiederkommen und ihr sagen, wann sie abgeholt wurde.
Sie sah Lucien nicht wieder. Es wurde Juli, bis endlich jemand kam, den sie kannte, Michel, Luciens Cousin, der eine alte polnische Jüdin und zwei Kinder mitbrachte. Eva hielt das Schweigen nicht länger aus.
»Wann kommt Lucien?«
Michel wirkte, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. »Lucien kommt nicht mehr.«
»Wo ist er?«
Als er die Schultern zuckte, wirkte er wie sein Cousin, obwohl er gewiss fünfzehn Jahre älter war. »Das weiß kein Mensch. Wir wissen es von so vielen nicht. Seit Dezember haben sie mehr als fünftausend von uns verhaftet und fortgeschafft. Nach Deutschland wohl. Oder in den Osten. Luciens Mutter hat überall angefragt, ist zu allen Behörden gelaufen, hat gebettelt, aber niemand konnte ihr etwas sagen. Sie ist keine von uns, keine Kommunistin, nur eine französische Mutter. Die hätten ihr schon helfen wollen, aber die wissen selbst nichts. Leute wie Lucien kommen als NN-Gefangene in die Lager, als Gefangene ohne Namen, ohne Papiere, damit niemand je herausfinden kann, was mit ihnen geschehen ist. Damit bestrafen sie uns. Nicht nur indem sie uns umbringen, sondern indem sie sagen, uns hat’s nie gegeben.«
»Aber Lucien wollte mir helfen«, entfuhr es Eva. »Er hat versprochen, er sorgt dafür, dass ich nach England komme, er kann mich doch nicht hängenlassen.«
In Michels Blick las sie dieselbe Verachtung, die sie auch im Blick der Bauerntochter und in dem des Armeniers fand. Sie wusste, wie die Gedanken hinter diesen Blicken lauteten: Was wagt die es, noch Forderungen zu stellen? Die hat doch dankbar zu sein.
»Schämst du dich nicht?«, fragte Michel. »Lucien war erst dreiundzwanzig, und er hatte in London einen kleinen Sohn.«
Ich habe in London eine kleine Tochter. Schämen sich die, die sie mir gestohlen haben? Nein, sie schämte sich nicht. Dass sie sich schämen sollte, hatte ihr Vater von ihr verlangt, und sie hatte es auch damals nicht getan. Wofür sich schämen? Dafür dass ich malen wollte, dafür dass ich leben wollte, dafür dass ich jetzt nichts mehr will als mein eigenes Kind? Schämen sich die, die uns entmenscht haben, schämt sich in dieser gottverfluchten Welt je einer, der Grund dazu hat?
»Dass du auf die Liste zum Ausfliegen sollst, hat er mir gesagt«, murmelte Michel. »Du wärst auch dran gewesen. Aber Hitler kennt jetzt kein Halten mehr. In Paris haben sie dreizehntausend Juden wie Vieh zusammengetrieben und in die Radrennhalle gepfercht. Etliche Kinder sind dabei, die schicken sie in ihre Todeslager. Auschwitz. Hast du den Namen schon gehört?«
Eva schüttelte den Kopf.
»Ein paar haben wir warnen, ein paar verstecken können. Danuta hier hat ihren Mann und ihre Tochter verloren, nur sie und die Enkel sind noch da. Auf dem Platz im Flugzeug, der für dich vorgesehen war, kommen jetzt sie und die Kleinen raus.«
Eva verschlug es die Sprache. Was hätte es auch zu sagen gegeben? Dass sie ihre Tochter seit vier Jahren nicht gesehen hatte, dass sie seit vier Jahren für nichts mehr lebte als für das Wiedersehen mit ihrem Kind? Die polnische Jüdin wirkte halb tot, die Kinder kaum kräftiger. Eva konnte nichts sagen.
»Wer weiß, wie lange wir überhaupt noch jemanden rausbekommen«, sagte Michel. »Es wird wieder gemunkelt, die Faschisten könnten auch die Freie Zone besetzen. Dann wird kein Brite mehr seinen Hals hier riskieren wollen.«
»Verflucht, warum bekommen die Briten und all die anderen diesen Hitler denn nicht endlich klein?«
Wieder zuckte Michel die Schultern wie Lucien. »Ich bin Kommunist, ich glaub nicht an den Teufel. Aber vielleicht war genau das unser Fehler.«
Als er fort war, hatte Eva nichts mehr. Keine Hoffnung, keine Tränen, keine Träume. Sie hätte sich von dem Bauern einen Strick stehlen wollen, aber der Gedanke, dass sie eine NN-Gefangene war, dass ihre Tochter nicht einmal erfahren würde, wo ihre Mutter gestorben war, raubte ihr die Kraft.
Die alte Jüdin mit den Enkeln wurde von einem Mann abgeholt, den Eva nicht kannte. Sie war wieder allein in der Scheune und froh darum, da Alleinsein neben Menschen, die miteinander, aber nicht mit ihr sprechen konnten, noch härter war. Auf den lähmend heißen August folgte ein September, der überraschenderweise Abkühlung, Regen und Stürme brachte. In der zweiten Woche des Monats kam der Armenier und inspizierte die Scheune.
»Ich brauche hier etwas Platz«, sagte er und schob Evas kläglichen Besitz an die Wand. »Ich muss einen Verwundeten herbringen, einen Piloten, der sich bei der Landung verletzt hat und ein paar Wochen Erholung braucht, ehe er wieder abfliegen kann.«
»Einen Engländer?« Evas Herz schlug in raschen Sätzen.
Der Armenier, dessen düsteres, vernarbtes Gesicht kaum je eine Regung zeigte, blickte verwundert. »Einen Landsmann«, sagte er. Und nach einer Pause: »Einen Freund.«
Die Enttäuschung war kaum zu ertragen. Eva taumelte in dem kleinen Raum bis an die Wand zurück. Wie sollte sie diese Enge mit einem Mann teilen? Bisher waren Frauen, Kinder und Greise mit ihr hier gewesen, aber keine Männer wie der Armenier, dessen Fremdheit die Kammer zu sprengen drohte.
»Er kommt aus England«, sagte der Armenier. »Wenn es ihm bessergeht, fliegt er zurück.«
Von den Umschwüngen wurde Eva schwindelig. Verzweiflung. Hoffnung, Verzweiflung, Hoffnung. Sie stützte sich an der Wand ab. Das Pendel stand wieder auf Hoffnung. Sie würde sie diesmal festhalten.
»Wenn er zurückfliegt«, begann sie zögernd, »nimmt er Passagiere mit?«