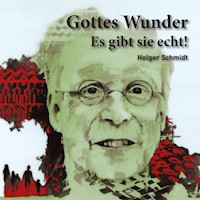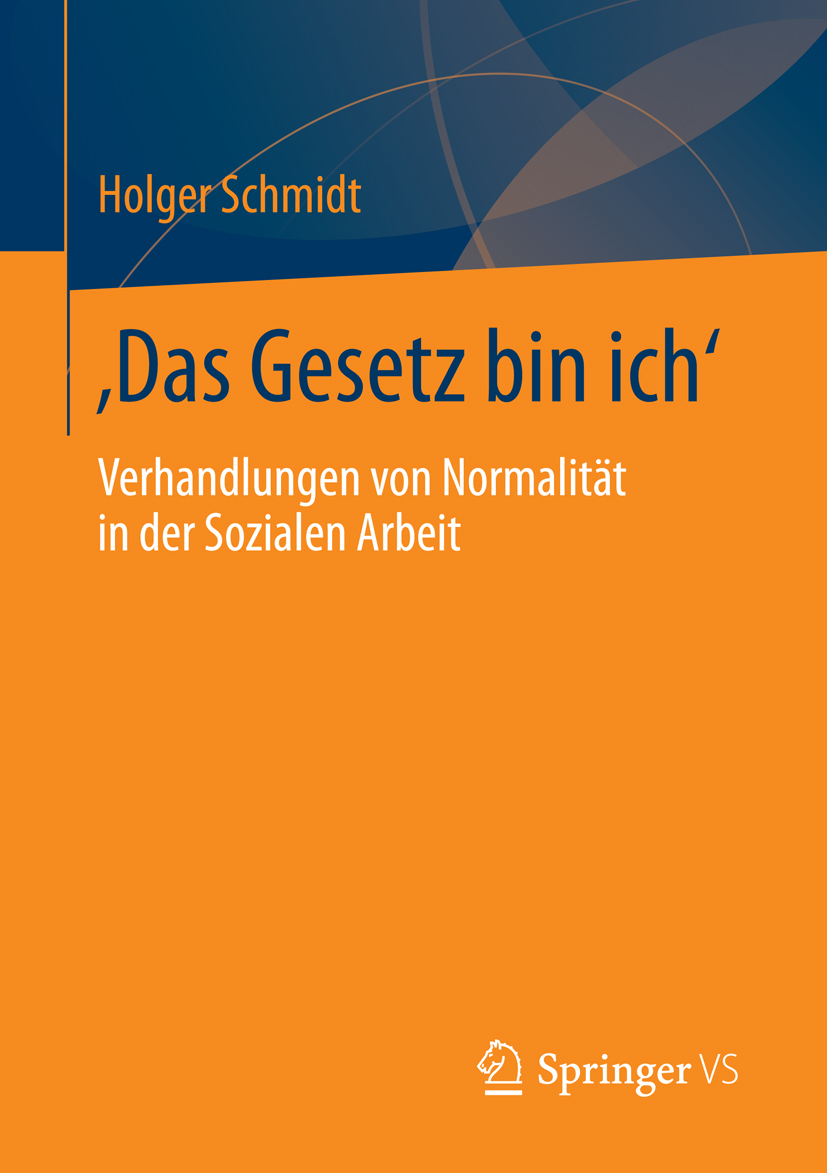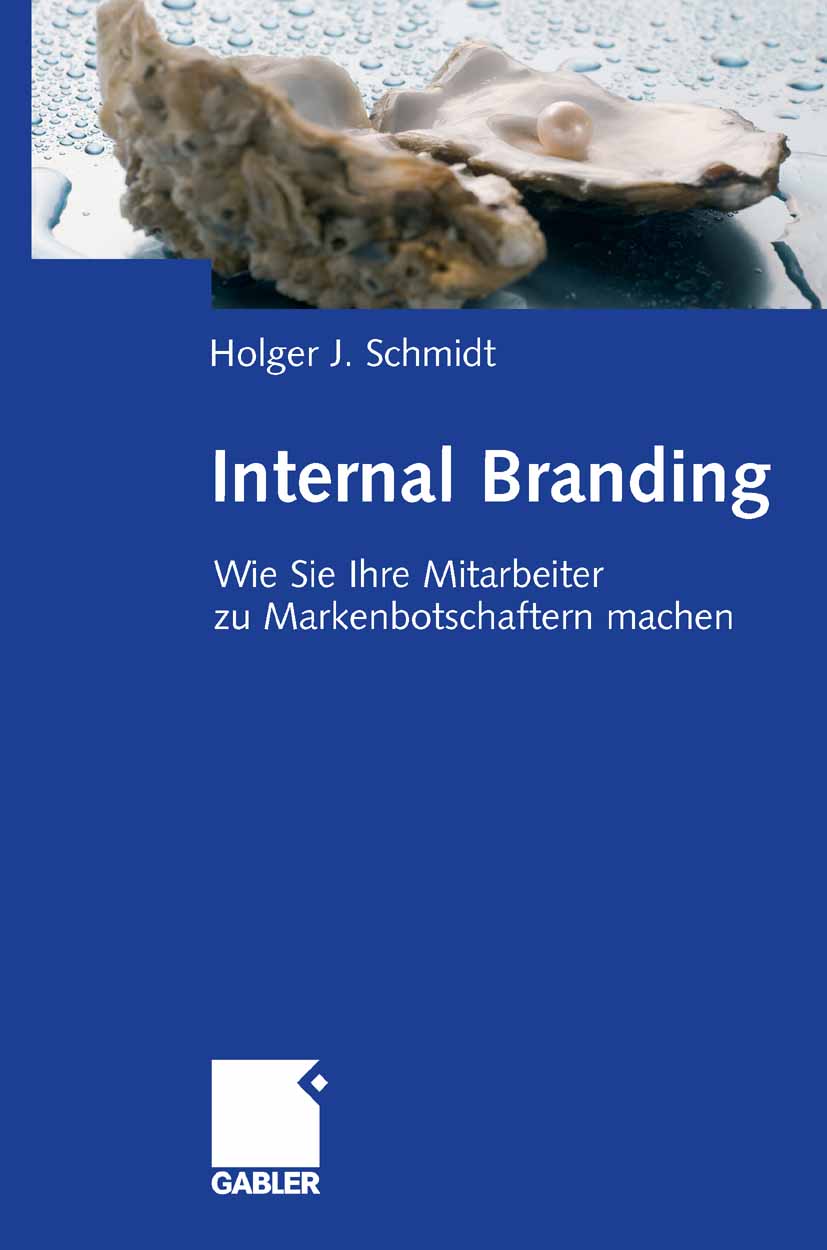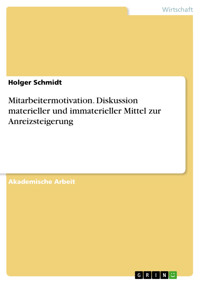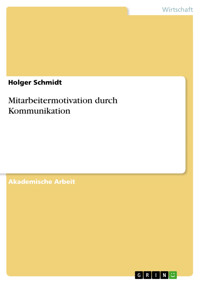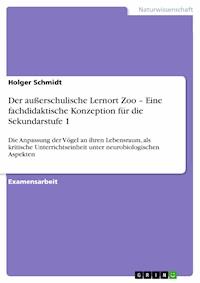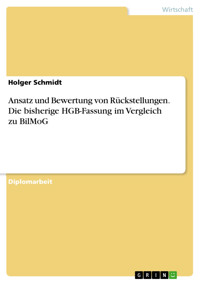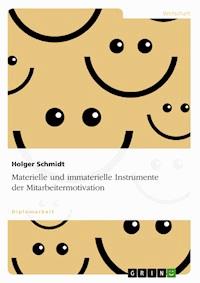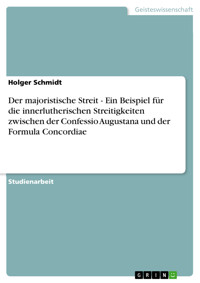Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der 49jährige Robert Döner und seine Frau Claudia beschließen, ihr altes Leben an den Nagel zu hängen und bar jeglicher Segelerfahrung zu einer zweijährigen Weltumseglung zu starten. Hin- und hergeworfen zwischen boshafter Ironie und philosophischer Selbsterkenntnis begreifen die beiden im Lauf der Reise, dass nicht Sturmgefahren auf hoher See oder feindlich gesinnte Eingeborene, sondern sonnenverbrannte Kreuzfahrt-Touristen-Horden, und das ständig nach Zuwendung gierende Boot die wahren Herausforderungen darstellen. Zwischen Erlebnissen mit Aussteigern auf Tonga, dem Kampf gegen die geistigen Hinterlassenschaften von segelnden Reichsbürgern in Vanuatu und Mormonen auf einem aktiven Vulkan bleibt jedoch immer genug Zeit für die eine oder andere Tasse Kaffee.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
"... und wie geht's Ernst-August?"
Holger Schmidt
Der 49jährige Robert Döner und seine Frau Claudia beschließen, ihr altes Leben an den Nagel zu hängen und bar jeglicher Segelerfahrung zu einer zweijährigen Weltumseglung zu starten. Hin- und hergeworfen zwischen boshafter Ironie und philosophischer Selbsterkenntnis begreifen die beiden im Lauf der Reise, dass nicht Sturmgefahren auf hoher See oder feindlich gesinnte Eingeborene, sondern sonnenverbrannte Kreuzfahrt-Touristen-Horden, und das ständig nach Zuwendung gierende Boot die wahren Herausforderungen darstellen. Zwischen Erlebnissen mit Aussteigern auf Tonga, dem Kampf gegen die geistigen Hinterlassenschaften von segelnden Reichsbürgern in Vanuatu und Mormonen auf einem aktiven Vulkan bleibt jedoch immer genug Zeit für die eine oder andere Tasse Kaffee.
Holger Schmidt, 1957 in Bad Kreuznach geboren und aufgewachsen, eröffnete nach jeweils mehrjährigen Zwischenstationen bei der Bundeswehr, am Steuer eines Taxis und Lenkrad eines LKWs mit seiner Frau 1993 ein Interior-Design-Studio. Im Jahr 2007 versetzten sich die beiden in den Ruhestand und starteten in der Türkei zu ihrer Weltreise auf einem Hochseekatamaran. Aus den ursprünglich geplanten zwei Segeljahren sind mittlerweile siebzehn geworden und ein Ende ist nicht abzusehen.
Handlung und Figuren sind frei erfunden, beruhen aber, wie so oft, auf selbst Erlebtem.
"... und wie geht's Ernst-August?"
Eine Halbweltreise
Holger Schmidt
Roman
1. Auflage, 2024
Texte: © 2024 Holger Schmidt
Umschlaggestaltung: © Holger Schmidt
Skulptur auf dem Umschlag:
»Ernst-August von Vanuatu« von Marion Freund
Foto Skulptur: Daniel Hass
Hintergrundfoto: Marion Freund
Verantwortlich für den Inhalt:
Holger Schmidt
C/o Block Services Stuttgarter Str. 106 70736 Fellbach
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Prolog
Wenn Vladimir Putin sich doch entschließen sollte, Panzer Richtung Potsdamer Platz in Marsch zu setzen, könnte Donald von Amerika, ganz im Sinne der Nato-Strategie »Prophylaktische Vorwärtsverteidigung« (oder so ähnlich) vorher ein paar Atomraketen auf Russland abfeuern lassen. Vladimir Putin wird sich daraufhin vielleicht entscheiden, die langsamen russischen Panzer lieber in den Kasernen zu lassen und anstatt dessen lieber die schnelleren russischen Atomraketen gen Amerika und/oder Europa loszuschicken.
Explodierende Atomraketen erzeugen, wie die Menschheit heute aus leidvoller Erfahrung weiß, einen so starken elektromagnetischen Impuls, dass alle elektronischen Geräte ihr Lebenslicht aushauchen. Als da wären zu aller erst Handys zu nennen, des Weiteren Fernsehgeräte, Kühlschränke, Mikrowellengeräte, der Gasbrennwertkessel im Keller, sowie die Solaranlage auf dem Dach. Die Haustür des Smart Homes öffnet sich nicht mehr, die LED-Beleuchtung bleibt dunkel. Auf den Autobahnraststätten bricht das schiere Chaos aus, weil die Lavazza Kaffeemaschine keinen Espresso mehr herausrückt, und wenn du dich denn im Untergeschoss dazu entschließt, das sich nicht mehr öffnende Drehkreuz zu den Sanifair-Toiletten mit einem beherzten Sprung zu überwinden, da die Blase noch funktioniert, wird dich die bepinkelte Toilettenbrille erschüttern, die sich nicht mehr drehen und selbst reinigen will. Der Kampf um noch halb leere Kloschüsseln wird erst im Laufe der nächsten Stunden eskalieren, wenn nämlich die Besatzungen der auf freier Strecke liegengebliebenen, mit vielfältiger Elektronik vollgestopften Kraftfahrzeuge, nach ermüdendem Fußmarsch eintreffen. Der VW-Käfer – bar jeder Elektronik - läuft zwar noch (wie die Werbung ja damals versprach), steht aber auch im Stau.
1. Motorprobleme
»JETZT …! STARTEN!«, brülle ich, breitbeinig über dem Yanmar Schiffsdiesel thronend, durch die geöffnete Motorraumklappe zu Claudia nach oben. Mit der rechten Hand jage ich gleichzeitig eine halbe Dose Startpilot in das Luftfilterrohr und starre ängstlich auf den gefährlich geringen Abstand meiner Testikel zur sich gleich drehenden Keilriemenscheibe.
»WAS IS DENN?! STAAARTEN …!«
»Ich starte doch!«, blafft sie entnervt zurück.
»Mist …, das kann doch nicht sein! Die Batterie kann doch nicht SO! leer sein, dass der Anlasser noch nicht mal klackt.«
»WAAAS!?«
Anstatt zu antworten, steige ich auf den Motor und ziehe mich von dort durch die Motorraumöffnung zurück an Deck.
Claudia steht am Steuerstand, den Finger noch am Starterknopf und sieht mich erwartungsvoll an.
»Da rührt sich nix! Die Batterien sind beide geladen. Selbst wenn sie durch die lange Standzeit kaputt sind, müsste der Anlasser wenigstens mal klack machen.«
»Kolbenstecker?«
»Vom stehen …? Glaub ich nicht! Aber das lässt sich ja einfach überprüfen.« Vorsichtig lasse ich mich wieder ins Motorraumverlies herunter und versuche, an der Keilriemenscheibe der Wasserpumpe zu drehen. »Tatsächlich, die sitzt fest!«
»Wie kann das denn passieren?«, Claudia lugt über den Rand nach unten.
»Vielleicht vom Spülen.«
Wenn wir VEGA für längere Zeit an Land stellen, um nach Deutschland zu fliegen, spülen wir die Kanäle des Kühlsystems, durch die normalerweise Salzwasser fließt, mit Süßwasser. Früher hievte ich dazu immer einen vollen 10-Liter-Eimer Wasser neben den Motor und hängte den Ansaugschlauch rein. In meinem Effektivierungswahn koppelte ich vor unserer letzten Abreise den Druckwasserschlauch der neukaledonischen Werft mit dem Ansaugschlauch des Motors. Auf mir unbekannten, verschlungenen Wegen müsste das Wasser in den Brennraum gelangt sein und hätte dort drei Monate Zeit gehabt, Kolben und Zylinderwände zusammenrosten zu lassen.
Dass nach dem Abstellen des Motors Wasser aus dem Luftfilter-Ansaugrohr schoss, hätte mich unbedingt stutzig machen sollen. Tat es aber nicht.
Drei Tage, eine Dose WD 40 und einen ruinierten Drehmomentschlüssel später bewegt sich der inzwischen als Übeltäter identifizierte vordere Kolben des Dreizylinders immer noch nicht.
Philippe, der stets hilfsbereite Werftmanager telefoniert den Werftmechaniker herbei. Keine fünf Minuten später wackelt Patrice, ein kleiner rotgesichtiger Waldschrat mit siffiger Baskenmütze auf dem und glimmendem Gauloisesstummel im Kopf, wohl schon angeschickert von der morgendlichen Pastis-Jause, unsicher die steile Leiter nach oben. Wenn der jetzt von der obersten Sprosse abrutscht und sich auf dem Boden an irgendeiner, der überall hervorstehenden rostigen Stahlplatten, die Birne halbiert, kassiert seine Frau wenigstens eine anständige Witwenrente. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendeine Frau auf seine Hygienestandards eingelassen haben sollte.
Nach kurzer Inaugenscheinnahme des Schlachtfeldes am Yanmar taucht der Schrat mit finsterem Der-ist-tot-Blick aus dem Motorraum auf. Philippe übersetzt unnötigerweise seine Diagnose vom Französischen ins Englische.
Nach dem Todesurteil diskutieren wir eine Weile, immer mit Philippes Übersetzungshilfe, welche Möglichkeiten uns bleiben. Für einen neuen Motor würden wir inklusive Einbau 10.500 Euro auf den Büroschreibtisch blättern müssen. Vom Austausch nur eines Motors rät Patrice selbstredend ab. Er bringt das so locker, wie wir uns früher in der Disco gegenseitig zum Saufen animiert haben: »Komm Mensch, auf einem Bein kann man nicht stehen! Eins geht noch!« »Komm Mensch, ein Motor ist kein Motor! Nimm doch gleich zwei!« Angesichts der Horrornachrichten und in Ehrfurcht vor Patrice erstarrt, nicken wir erstmal zu allem, wollen aber nochmal drüber schlafen.
20000 Euro – ja eigentlich schon die Hälfte – ist uns definitiv zu viel Geld. Schließlich überlegen wir in der letzten Zeit immer wieder, wie lange wir dieses Leben auf dem Boot noch führen wollen oder können. Kurzum - wir sind am Boden zerstört.
Mehrere Stunden erörtern wir, im Salon sitzend, unsere Möglichkeiten. Zusätzlich zu dem Motor-Fiasko stehen wir auch unter Zeitdruck. Im Dezember beginnt die Zyklonsaison, und wenn wir uns zu lange hier an Land verdödeln, brauchen wir gar nicht mehr zurück ins Wasser zu gehen.
Plötzlich klopft es an der Bordwand: »Robert?« Es ist Philippe.
»I would try to repair it«, überrascht er uns. »I get the engine out and put it next to the boat. Then you can try to fix it.«
Ungläubig schauen Claudia und ich uns an.
»I would try it!«, bekräftigt er.
Also gut, lass es uns versuchen.
Die nächsten drei Wochen verbringe ich damit, mit Philippes Hilfe den Motor aus dem Boot zu heben, komplett zu zerlegen und den Zylinderkopf in Ducos, dem Industriegebiet Noumeas, ausschleifen zu lassen. Neue Zylinderkopfdichtungen und Kolbenringe stöbere ich bei einem Händler in Australien auf, der sich freundlicherweise bereit erklärt, sie mir zum nur doppelten Preis nach Neukaledonien zu schicken.
Unser Motordrama hat sich natürlich bis in die hinterste Gammelecke der, von uns intern Schrottplatz gerufenen Bootswerft, herumgesprochen.
Vielleicht sollte ich erklären, was eine Bootswerft im Südpazifik von einer Schiffswerft in Deutschland unterscheidet. Auf letzterer arbeiten, berufsgenossen- und gewerkschaftlich betreute Gesellen und Meister in ihrem 8-bis-17-Uhr-Job auf TÜV-geprüften Leitern stehend, in den Händen CE-zertifizierte Werkzeuge und bauen neue, beziehungsweise reparieren alte Schiffe.
Eine Schiffswerft auf einer südpazifischen Insel fungiert hingegen als Wohnort, Hobbykeller, Auffangstation für Wohnsitzlose, soziale Begegnungsstätte und Spielplatz für Kinder und Hunde, für Letztere auch als Toilette.
Viele der Jachten hier werden von ihren Besitzern bewohnt. Dafür bezahlen diese eine »Liveaboard fee« für Strom Wasser und Benutzung der einzigen Werfttoilette/Dusche, deren purer Anblick bei sensiblen Gemütern schon Hepatitis hervorruft. Da wir das Duschklo nicht nur mit allen hier arbeitenden und wohnenden Menschen, sondern auch mit zehntausend Malaria- und Chikungunya-verseuchten Moskitos teilen müssten, verzichten wir gerne und benutzen unser in Neuseeland gekauftes Porta Potti. Alle drei bis vier Tage steige ich nach Sonnenuntergang - in einer Hand den Fäkalientank - die steile Leiter vorsichtig vom Schiffsheck auf den Boden herunter, ängstlich darauf bedacht, nicht zu stolpern und von einem halben Zentner Scheiße in die Tiefe gerissen zu werden, um den Inhalt im Meer zu verklappen. Hört sich eklig an, ist es auch, aber das Rohr des Werftklos macht das Gleiche direkt nebenan.
Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, sieben Tage die Woche, arbeiten alle (bis auf die, die hier wohnen) wie besessen, um den Aufenthalt auf dieser Schrottplatz-Schiffsfriedhof-Kombination so kurz wie möglich zu halten. Nach ein paar Wochen kennt hier jeder jeden, und oft stehen andere Yachties bei mir, um zu sehen und klug zu kommentieren, was ich da treibe. Zusätzlich landen jeden Morgen die einsamen Wölfe an, die vor der Werft Anker geschmissen haben und sich, mangels Kohle, seit Jahren nicht mehr fortbewegen. Rasta-Matte steht bei den Jungs hoch im Kurs. Ist ja auch praktisch, wenn das Geld für die horrenden Frisörpreise und die Lust zur täglichen Haarpflege fehlt. An Bord trägt Mann Haut und an Land nach polynesischer Sitte ein um die Hüfte geschlungenes Tuch.
Auch eine ledrige, anorektische Rothaarige, an deren fleckige Haut sich nicht mal mehr ein Melanom rantraut, vermutlich etwas älter als wir, lebt mit ihrem Mischlingshund auf ihrem gepflegten alten Holzschiff vor Anker. Sie verdient ihren Lebensunterhalt durch Sattlerarbeiten für andere Jachten. Von ihr haben wir schonmal einen neuen Reißverschluss in unsere Windschutzscheibe einnähen lassen. Täglich chauffiert sie ihre Schäferhund-große Mischlingsdame mit dem Dingi an Land, die es, auf dem Rand balancierend, kaum erwarten kann, sich ins sehnsüchtig auf sie lauernde Hunderudel-Getümmel zu stürzen. Neben den beiden Bisamratten-großen Köternvon Philippe treffen sich hier der reinrassige deutsche Rauhaardackel des Franzosen, der in einer der Blechbaracken Holzarbeiten anbietet, zwei halbhohe, kurzhaarige Schäferhund- und Dobermannmischlinge, die morgens aus dem Steilhang von den Kanak-Baracken zu uns herunterklettern und Philippes dritter Hund – vermutlich verwandt mit dem Dobermannmix. Jeder Tag vergeht mit herumtollen, fressen, schlafen, sich bei den Schiffsbesatzungen durchschnorren und, vorzugsweise im Schatten zwischen den Rümpfen eines Katamarans, hinscheißen.
Anfangs wunderten wir uns über die auf dem Boden scheinbar sinnlos herumliegenden Holzbretter, über dunkle Löcher und hervorstehende Rohre, bis ich eines Tages entdeckte, dass die uferseitige Schiffsabstellfläche aus alten amerikanischen Landungsbooten besteht, die während des 2. Weltkrieges hier im Pazifik Dienst taten. Am Ufer hintereinander festgebunden, goss man sie mit Beton aus, und fertig war das Werftgelände. Natürlich nagt der Salzwasserzahn der Zeit an Stahl und Beton. Ab und an bricht mal das eine oder andere Teil ab und fällt ins Wasser. Oder ein Loch klafft plötzlich im Boden – daher die vermeintlich planlos herumliegenden Holzbretter.
Die einstmalige Betonfläche bedeckt längst eine zentimeterdicke Dreck-Sand-Erdschicht. Den Gras- und Gestrüppbewuchs hält Philippes Assistent Louis mehr oder weniger erfolgreich mit der chinesischen Motorsense in Schach. Die allgegenwärtigen Hundehaufen schreddert er kompostierfreundlich gleich mit und verteilt sie im gesamten Umfeld. Auch das eine oder andere, der überall im hohen Gras verborgenen Stromkabel, muss mal dran glauben. Die mit Isolierband umwickelten Flickstellen sorgen bei jedem stärkeren Regen für Stromausfall auf dem gesamten Werftgelände.
An der Palme neben VEGA lehnt ein vergammelter, mattschwarzer Peugeot-Motorroller, inzwischen bis zum Lenker zugewachsen.
Nach einem Monat ist der große Tag gekommen. Unter dem tosenden Applaus der Umstehenden gelingt es Claudia, mir und einem gehörigen Schuss Startpilot, den wieder eingebauten Motor zum Laufen zu bringen.
Sofort bequatschen wir Philippe, dass er unser Schiff gleich morgen während des Tidenhöchststandes ins Wasser setzt. Ein letztes Mal schrubbe ich die rote, Erz-versetzte Erde des gegenüberliegenden Nickelwerkes vom Deck und fülle die Wassertanks. Was wirklich alles mit dem Dreck in der Luft zu uns herüberweht, wollen wir gar nicht so genau wissen. Jedenfalls überzieht nach drei Monaten Abwesenheit eine dicke Salz-Rostschmiere-Schicht alle Edelstahlteile.
2. Der segelnde Thermomix
Welch ein fantastisches Gefühl, wieder die luxuriöse Handpump-Toilette an Bord benutzen zu dürfen. Kein Gehämmer sonntagmorgens um sieben, keine Flexarbeiten, kein Farbsprühnebel, der sich auf unsere Scheiben legt. Kurzum, das Paradies!
Zurück in Noumea legen wir uns an unsere Boje. Nach unserer Ankunft haben wir sie unserem französischen Freund Manua abgekauft. Ihn und seine spanische Frau Sabrina nebst 13-jähriger Tochter Sola lernten wir vor 3 Jahren in einer Ankerbucht auf den Cookinseln kennen. Ihr Schiff tauften sie UN BARCO VENDRÁ, was laut Sabrina bedeutet: Ein Schiff wird kommen. Leider hatten Sabrina und Manua nicht bedacht, dass der Name ihres Schiffes in englisch- oder französischsprachigen Ländern öfter mal per Funk übermittelt werden muss. Diese Versuche endeten immer mit der entnervten Anweisung, den Namen jetzt zu buchstabieren.
Nach ein paar Wochen des zusammen Segelns trennten sich – wie so oft bei Yachties – unsere Wege wieder. 2017 war die Wiedersehensfreude groß, als wir UN BARCO VENDRÁ im Ankerfeld entdeckten.
Manua kauft in der Hafenbucht von Noumea schrottreife Segel- oder Motorboote und vermietet sie an junge Leute, die sich die exorbitanten Mieten hier nicht leisten können. Französische Staatsangestellte dürfen in den diversen Überseegebieten Frankreichs zwei Jahre arbeiten – zu annähernd doppeltem Gehalt. Das treibt die Lebenshaltungskosten in abstruse Höhen.
In der letzten Zeit schwächelt der Mietmarkt, was ihn auf die Idee brachte, auf Airbnb umzustellen. Das beschert ihm zwar mehr Arbeit, da viele Kunden nur für einen Tag mieten, aber seine Auslastung liegt bei fast 100%.
Inzwischen hatten sich Manua und Sabrina getrennt. Manua lebt jetzt auf einem seiner schwimmenden Wracks ohne Motor, aber mit viel Zufriedenheit keine hundert Meter entfernt von UN BARCO VENDRÁ, und Sola, sowohl im Spanischen als auch Französischen muttersprachlich perfekt, pendelt - manchmal mehrmals am Tag - hin und her. Auf beiden Booten bewohnt sie eine Kajüte.
Sabrina unterrichtet als Spanischlehrerin an einer Schule in Noumea.
Die Hafenbucht weist zwar in der offiziellen Seekarte drei riesige Ankerfelder aus, nur leider versenkten, um dem erwähnten Mietwucher zu entgehen, hunderte von Franzosen mehr oder weniger sichere Grundgewichte im Hafenwasser, an die sie eine Boje und daran ihre Schiffe banden. Als Neuankömmling bleibt einem keine andere Wahl, als in der Fahrrinne zu ankern. Das wiederum ruft spätestens nach ein paar Tagen den Hafenmeister, der für die sichere An- und Abfahrt der Kreuzfahrtschiffe verantwortlich ist, auf den Plan. Nachdem wir dreimal vertrieben wurden, griffen wir bei Manua zu und kauften eine seiner Bojen.
Erstmal mit dem Schlauchboot in die Stadt. Unsere Staubänke sind leer. Wir brauchen etwas zu essen.
Wüssten wir es nicht besser, könnten wir Noumea für eine x-beliebige Stadt an der Côte d’Azur halten. Viel Geld investiert der französische Staat in Straßen, Parks, städtische Busse und Grünanlagen. Die Zahl der Verkehrsampeln lässt auch keine Wünsche offen. Casino, Carrefour, Giant und Johnston Supermärkte erfüllen die ausgefallensten Wünsche. Inzwischen wissen wir, wo es die günstigsten Haferflocken gibt, halbwegs bezahlbaren Wein, die Zutaten für unser Millionärsmüsli (taufte Segelfreund Maik so im Hinblick auf die schweineteuren, nur im Bioladen erhältlichen Zutaten), Obst und Gemüse, Brot, - das seinen Namen verdient – kurzum alles, von dem sich der verwöhnte Westler so ernährt. Frisches Obst und Gemüse kaufen wir in den drei Wochenmarkt-Hallen direkt am Hafen.
In einer der Hallen besorgen wir uns an einer kreisrunden Bistrotheke, hinter der mindestens 8 Frauen in atemberaubendem Akkordtempo alle Arten von unter Franzosen beliebten Kaffeevariationen zubereiten, unsere ersten Café allongé. Damit setzen wir uns unter eine zwischen Gemüse- und Fischhalle gespannte Plane und beobachten das Treiben.
An zwei zusammengeschobenen Tischen sitzt schon die uns inzwischen bekannte Gruppe älterer polynesischer Männer und unterhält sich in einer der vielen polynesischen Sprachen. Sie sitzen auch noch da, wenn wir gehen. Sie sitzen überhaupt immer da.
Die vollschlanke, französische Mittvierzigerin, mit starker Abneigung gegen Haarpflegeprodukte, bindet gerade ihre dreibeinige Mischlingshündin an eine Laterne und verschwindet unter deren Protestgebell in der Fischhalle. Manchmal schafft sie es, einzukaufen. Oft, wenn die Warteschlangen an den Fischtheken zu lang sind, muss sie zwischenzeitlich rauskommen, um ihren Hund zu beruhigen.
Liegt ein Kreuzfahrer im Hafen, baut ein großer, junger, passabel englischsprechender Franzose seinen Stand aus übereinandergestapelten Plastikboxen, voll mit einer Art überdimensionalem Federball, auf. Nähert sich eine Horde Kreuzfahrttouristen, leicht zu erkennen am bunten Brachialoutfit, den Rotweiß-Schattierungen der verbrannten Haut, dem Dreifachen des gesunden Normalgewichtes und den bei australischen Teenies dieses Jahr en vogue scheinenden, angetackerten Flechtzöpfen, versucht er sie zum Mitspielen zu animieren, indem er den Sandsackfederball mit der flachen Hand in ihre Richtung spielt. Ab und zu begeistert er seine Mitspieler so, dass sie ein Set bei ihm kaufen.
Keine zwanzig Meter von ihm entfernt sitzt ein junges Paar unter seinem Schatten spendenden Pavillon. Er, ein gutaussehender muskulöser Polynesier, verwandelt meterlange Holzbalken, nur mit Stechbeitel, Holzhammer und Säge, in Tikis, Trommeln oder Waffen. Hochkonzentriert in seine Arbeit vertieft, scheint er die Touri-Trauben um sich herum nicht wahrzunehmen. Seine französische Freundin, schlank, langhaarig, blond, beantwortet in französisch gefärbtem Englisch geduldig die vielen Fragen.
Während ich weiterhin soziologische Feldstudien betreibe, dreht Claudia ihre Runden zwischen den Ständen und liefert zwischendurch immer wieder ihre Obst- und Gemüsebeute ab. Hat sie alles zusammen, bringe ich die erste volle Tasche zurück zum Schlauchboot.
Als Nächstes geht’s zum Champion. Der kleine Supermarkt liegt mitten im Stadtzentrum, und wenn er gerade anbietet, was wir suchen, ist es meistens dort am billigsten. Was wir hier nicht bekommen, kaufen wir im einen Kilometer entfernten Carrefour. Dort gönnen wir uns auch zwei casse-croûte, mit allerlei Leckerem belegte kleine Baguette, mit denen wir uns in den nahen Park des Place de Cocotiers setzen, dem zentralen Platz von Noumea. Als meistens einzige Weißen ignorieren uns die Kanak auf den Bänken erst mal. Setzen wir uns einfach zu ihnen, kommt - zumindest von älteren Frauen - ein zögerliches: »Bon Appétit!«
Leider verwechseln uns Kanak wegen unserer Hautfarbe entweder mit australischen Touristen, oder noch schlimmer, mit Franzosen. Da Frankreich quasi seit Anbeginn der Besetzung immer wieder die Unabhängigkeitsbestrebungen der einheimischen Bevölkerung mit Truppen niedergeschlagen hat, zum letzten Mal 1988, lebt man, sich tapfer gegenseitig ignorierend, nebeneinander her.
Hatten wir im gesamten Südpazifik die Einheimischen als sehr kontaktfreudig, hilfsbereit, freundlich und neugierig kennengelernt, erfahren wir hier in Neukaledonien das andere Extrem. Sei es in Französisch-Polynesien, auf den Cookinseln, in Tonga, Fidschi oder Vanuatu, überall stellen Weiße eine kleine, wenn auch privilegierte Minderheit dar. Nicht so hier. Durch Zuzugserleichterungen für Franzosen aus dem Mutterland und allerlei andere gewitzte Tricks sind die Kanak inzwischen zu einer Minderheit im eigenen Land geworden. Das erzeugt, vor allem bei vielen jungen Ureinwohnern, Frust und Aggressionen.
Claudia und ich wenden einen kleinen Trick an, um als Nichtfranzosen aufzufallen. Wir sprechen Deutsch. Ganz unpatriotisch konstatiere ich mal: Die Deutschen sind das beliebteste Volk auf den südpazifischen Inseln. Ursache hierfür: die während des Ersten Weltkrieges verlorenen Kolonien, aber auch der deutsche Fußball trägt seinen kleinen Teil zur Beliebtheit bei. Bundesligaergebnisse findest du in Vanuatus größter Tageszeitung auf der ersten Seite.
Während wir unsere Thunfischbaguette futtern, parliert Claudia mit den beiden Kanak-Damen neben uns. Es sind eh immer die gleichen Fragen: »Wie alt seid ihr, wie viele Kinder habt ihr? Was keine …???!« Dass wir uns bewusst gegen Kinder entschieden haben, stößt zwar auf absolutes Unverständnis, wird aber sofort akzeptiert. Das Baguette im Bauch tragen wir unsere schwer gewordenen Einkaufstaschen zum mitten im Park gelegenen Café L’Annexe. Die nächste Feldstudie und der nächste Allongé sind angesagt.
Was den 68ern ihr Che Guevara, ist den jungen Kanak heute Bob Marley. Seinen Schattenriss auf dem T-Shirt, die Baggys in der Kniekehle, träumen sie, nicht selten Dope-unterstützt, von der großen Revolution gegen ihre Besatzer. Nun hat Frankreich im Laufe der Jahrzehnte, freiwillig oder durch die UN gezwungen, im Umgang mit seinen ehemaligen Kolonien dazugelernt. Gesetze wurden erlassen, die die starken sozialen Unterschiede in der heterogenen Bevölkerung mildern und langfristig beseitigen sollen. Dass da einige Jahrzehnte nicht reichen, ist einerseits Fakt, andererseits gibt sich die junge Generation bei einer Jugendarbeitslosenquote, die im 40% Bereich pendelt, nicht zufrieden.
Auf dem Weg zurück zum Hafen laufen wir einen kleinen Umweg durch das Quartier Latin. Eine Bäckerei hier verkauft Pain rustique. Es erinnert an deutsches Brot, ist gehaltvoller und nicht schon nach einem Tag knüppelhart, wie sein französisches Pendant in knuspriger Stangenform. Nicht etwa, dass wir kein Baguette mögen – ganz im Gegenteil. Leider nur ist es bei wochenlangen Segeltouren, wegen seiner begrenzten Haltbarkeit, für uns nicht zu gebrauchen. Um das Brotbacken komme ich sowieso nicht herum, aber da der Gasverbrauch für zwei Brote etwa dem einer Woche täglichen Kochens entspricht, gehen wir den Mittelweg, kaufen ein leckeres Pain rustique, und ich backe, wenn das aufgegessen, oder, was auch schon mal vorkommt, verschimmelt ist.
So eine ausgedehnte Einkaufstour kostet uns immer einen halben Tag. Mit den schweren Einkaufstaschen kilometerlange Märsche von Markt zu Supermarkt, das Ganze in der Stadt-verstärkten Tropenhitze.
Nach zehnminütiger Rückfahrt zur VEGA fällt uns schon von weitem das tischtuchgroße Schwarz-Rot-Gold einer schnieken 19 Meter langen Amel (der Mercedes S-Klasse unter den Fahrtenseglerschiffen) auf, deren Neupreis, wie ich eine Stunde später bei Google sehe, irgendwo zwischen 1,5 und 1,9 Millionen Euro pendelt.
Unsere Boje liegt gegenüber eines der drei großen Jachthäfen Noumeas. Die Amel muss während unserer Abwesenheit angekommen sein – vermutlich aus Fidschi. In der Takelage hängt die gelbe Flagge »Q« und signalisiert, dass das Schiff von den Behörden noch nicht abgefertigt wurde (oder der Skipper vergessen hat, sie einzuholen), also unter (Q)uarantäne steht. So dicht neben uns, quasi Nachbarn, da gebietet es des Seglers Höflichkeit, seine Aufwartung zu machen. Obwohl schon reichlich mittagsschläfrig, fahren wir kurz rüber und hängen uns, wie in solchen Fällen üblich, an die Bordwand. In der Takelage weht die nicht minder große Flagge der World ARC. Als Heimathafen prangt Stuttgart auf dem breiten Heck.
Im Cockpit sitzt eine blond ondulierte, mittelgroße Frau in unserem Alter, Typ Hannelore Kohl, und stürzt, als sie uns kommen sieht, gleich zur Reling: »Hallöle, i bin die Rosi aus Sturgard!«, schwäbelt sie uns an.
»Robert und Claudia … Kommt ihr gerade aus Fidschi?«, sage ich, um was zu sagen. Anscheinend sieht man uns schon von Weitem die deutsche Herkunft an. Oder sie zählte eins und eins zusammen, als sie uns neben der VEGA sah. Rechnen können sie ja, die Schwaben.
Bis gestern blies ein strammer Westwind, was bei einem Westkurs, also von Fidschi nach Neukaledonien, jeden halbwegs erfahrenen Segler davon abhalten würde, diese Strecke zu segeln.
»Jo, mir kommed direkt vo Deane... Dengs do oder so!« Sie meint wohl Denarau.
»Und, gutes Wetter gehabt?«, frage ich scheinheilig.
»Noa, ned so guad. Dr Wend isch ons emmer endgega komma. Mir hen hald emmer greiz on quer fahra miassa. Des hod mr an saumäßiga Schbass gmacht. Woasch, in han a Thermomixle uff´m Schiff, domid mach i emmer Breschdlengssorbee. Des mag dr Peder so arg.«
Glück für sie, dass ihr Peter wohl noch nicht an Bord ist. Der hätte natürlich sofort den Zusammenhang zwischen dem Erdbeersorbet und seiner mangelhaften Wetterplanung hergestellt. Dazu musst du wissen, dass du auf der Strecke von Fidschi nach Neukaledonien im September den Wind fast immer von hinten hast. Chance auf Westwind – gleichsam gegen 0! Außerdem - wenn der Wetterbericht Südost-Passat prognostiziert, bläst es nie, nie, nie aus West! Also irgendeinen groben Schnitzer muss er sich geleistet haben - der Peder.
Da federt er auch schon vom Steg auf die Heckplattform. Ebenfalls etwa in unserem Alter, groß, braungebrannt, breitschultrig. Silbergraues, dichtes Haar, wie Horst Seehofer in der Sixt-Werbung. Weiße, lange Hose, weißes Sweatshirt mit (vermutlich) dem Wappen des Stuttgarter Jachtclubs, am strumpflosen, braungebrannten Fuß den Helly Hansen Ahiga V3 Hydropower für Herren!
»Komm Peder, mir hen Bsuach aus Deidschland!«, kräht Hannelore ihm entgegen.
Peter kann Hochdeutsch. Vermutlich ahnt er, dass wir schon über das Wetter gesprochen haben – ist ja schließlich Thema Nummer eins bei Überfahrten.
»Ja, wir haben das falsche Wetterfenster erwischt…«, knirscht er. »Das Schiff war aber auch so langsam. Obwohl ich in Fidschi schonmal einen Taucher runtergeschickt habe. Der sollte unten sauber machen.«
»Na ja, jetzt seid ihr ja hier. Direkt hier vor Noumea findet ihr jede Menge schöner Inselchen, da liegt ihr meistens alleine oder höchstens mal mit zwei anderen Booten«, wechsele ich das Thema.
»A woasch, mir sen ned so dia Angerer. Mir miassad ned jedan Schdoa omdrea. Dia zeh Dag dia mir do sen, bleibad mir en dr Marina. Do hen mr au Schdrom fir onser Klimaalag,« klärt uns Hannelore auf.
Während ich mich schon langsam in die innere Immigration zurückziehe, quatscht Claudia noch ein paar Minuten munter weiter.
Irgendwann lasse ich einfach mit den Worten: »Wir müssen dringend unsere Lebensmittel in den Kühlschrank schaffen«, die Bordwand los.
Ein paar Sätze zur WORLD ARC-Flagge. Die WORLD ARC ist die logische Erweiterung der ARC. Mitte der 80er Jahre rief ein ambitionierter Fahrtensegler die Atlantik-Rally-for-Cruisers ins Leben, um unerfahrenen oder unsicheren Seglern die Atlantiküberquerung zu erleichtern. Sie startet traditionell auf Gran Canaria und endet im Hafen von St. Lucia. Inzwischen lockt der zum Millionengeschäft avancierte Event jährlich hunderte von Schiffen auf die Kanarischen Inseln. Ein noch größeres Geschäft verspricht (wenn es das nicht schon ist) die WORLD ARC zu werden, ermöglicht sie doch jedem mit rudimentären Segelkenntnissen, sich nach 15 Monaten Hetzjagd um die Welt im heimatlichen Jachtklub als Weltumsegler feiern zu lassen. Egal, wann und wo eine Besatzung einläuft, immer steht das Rallye-Empfangskomitee am Steg, um die Leinen anzunehmen und den ganzen Papierkram des Einklarierens zu erledigen. Scheißegal, wie die ganzen Regionen heißen, scheißegal, wer die Menschen sind, durch deren Gewässer man gerade brettert. In den Sammelhäfen suggerieren – den Programmen für Kreuzfahrttouristen nicht unähnlich – alkoholgeschwängerte Veranstaltungen dem Weltumsegler in spe, wie er sich das Eingeborenenleben vorzustellen hat.
Zwei Sachen musst du allerdings haben: viel viel Geld und einen Stellvertreter, der während deiner Abwesenheit auf deine Firma aufpasst.
Uns zieht es raus aus der Hafenbucht zur 900 Meter langen und 100 Meter breiten Îlot Maître. Sind zwar nur 7 Kilometer, aber du fühlst dich in einer anderen Welt.
Der Hotelkonzern Escapade belegt mit in den Flachwasserbereich auf Stelzen gebauten Überwasserbungalows und den dazugehörigen Einrichtungen einen Großteil der Fläche.
Aus uns nicht ersichtlichen Gründen haben japanische Hochzeitspaare die Insel für sich entdeckt. Ein Standesbeamter traut – wenn gewünscht - in der eigens errichteten Inselkapelle, einer dominanten Mischung aus Führerbunker und Scientologykirche oder auf der zwischen den Bungalows aufgeschütteten Trauungsinsel.
Während sich ein japanisches Paar im Heimatland gelegentlich bis ins Rentenalter verschuldet, um die traditionell geforderte Hochzeitsfeier auszurichten, kommt es hier, weit weg von der Heimat, trotz der aus unserer Sicht sehr hohen Hotelpreise, vergleichsweise billig davon. Da bleiben noch viele Yen übrig für Jet-Ski, Kitesurfen oder sich auf einem Segelkatamaran in den Sonnenuntergang fahren zu lassen.
Japanische Paare auf Jet-Skis erkennen wir inzwischen aus beliebiger Entfernung. Er fährt, und zwar vorwiegend im Standgas, sie klammert sich an ihm fest, giggelt hysterisch vor sich hin und stoppt jeden seiner verwegenen Versuche mit schrill-panischem Lustgeschrei, das 120 km/h schnelle Wassermotorrad auf mehr als Schrittgeschwindigkeit zu beschleunigen. So geht das die ganze bezahlte Stunde lang: Gas geben, stoppen, schreien, lachen ..., Gas geben, stoppen, schreien, lachen ....
Da bei dieser Fahrtechnik glücklicherweise kaum Welle entsteht, ertragen wir die Vorführungen halbwegs amüsiert. Außerdem müssten europäische Hotels bei dem hier zu verzeichnenden hauptsaisonalen Besucherandrang wegen zu geringer Auslastung schließen. Ist halt nix los im Pazifik.
Rund um die Insel ist durch das neukaledonische Umweltministerium eine Schutzzone ausgewiesen, die auch – französischer Bürokratie sei Dank – überwacht wird. Um die wunderschönen Korallenblöcke vor uns Ankerern zu schützen, liegen kostenlose Bojen aus. Meistens findet man eine freie. Dauernd streckt um uns herum eine Schildkröte den Kopf aus dem Wasser, stößt laut röchelnd die verbrauchte Luft aus, und taucht ganz gelassen wieder ab. Ein einzelner Dugong wohnt auch hier. Dem zu begegnen, erfordert allerdings Glück oder einen langen Atem.
Mit Badekappe auf dem Kopf, um meine empfindliche Kopfhaut vor Sonnenbrand zu schützen, und Taucherbrille auf der Nase, lasse ich mich für mein allmorgendliches Rund-ums-Boot-Schwimmtraining ins kristallklare Wasser gleiten.
Heute kommt es mir so milchig vor. Allerdings ziehe ich zum Lesen eine Brille mit 2,5 Dioptrien an. Die Taucherbrille dagegen ist nicht geschliffen.
Sofort starre ich elektrisiert in die Richtung, in die gerade die ein Meter lange Schildkröte davon gepaddelt ist. Das muss Schildkrötensperma sein!, schießt es mir durch den Kopf. Und heute Morgen sind besonders viele Tiere ums Boot herum zu sehen. Sie wirken auch irgendwie total aufgeregt.
»Werf mal schnell die Kamera runter!«, rufe ich zu Claudia hoch. Kopulierende Wasserschildkröten zu fotografieren – das wär’s doch! Hat meines Wissens bis jetzt noch nie jemand beobachtet.
Überall um mich herum riesige milchige Schwaden. Wohl so eine Art Swingerparty unter Wasser. Während ich dem potenten Männchen hinterher schwimme, überfallen mich erste Zweifel an meiner Sperma-Theorie. Als es auf Armen und Beinen stärker zu jucken und zu brennen anfängt, dämmert mir: Den Biologie-Nobelpreis kann ich abschreiben. Seit mehreren Minuten schwimme ich durch Schwärme von Kleinstquallen.
Jetzt aber nix wie zurück an Bord.
»SCHNELL DEN ESSIG!«, brülle ich schon wieder Richtung Claudia.
Die Heckleiter hochhechtend, reiße ich ihr die Plastikflasche aus der Hand. Der Essig neutralisiert nach und nach das Nesselgift.
Nach der Fotosafari heute Morgen wäre jetzt eigentlich arbeiten angesagt. Auf meiner To-do-Liste springt mich nichts so wirklich an. Manche Reparaturen lassen sich auch nur im sicheren Hafen durchführen; alles, wozu einer der Motoren für länger, als ein paar Stunden stillgelegt werden muss. Dazu gehört jedenfalls unser dringendstes Problem: Läuft der reparierte Motor, blubbert’s im Kühlwasser. Leider war mir nicht bewusst, dass ich nach Demontage des Zylinderkopfes diesen hätte planschleifen müssen. Jetzt drücken sich Abgase von der Verbrennung an der Zylinderkopfdichtung vorbei in den Kühlkreislauf.
»Vesper ist fertig!«, ruft Claudia.
Kommt mir gelegen, und ich schiebe die Frustrationsliste wieder an ihren Platz auf dem Bücherbord.
Nach der Vesper folgt der kleine Mittagsschlaf, nach dem Mittagsschlaf die Tasse Kaffee im Cockpit. Mittags um vier will ich nichts Neues mehr anfangen. Irgendwie ist heute nicht mein Tag.
Während des Cockpitkaffees trudelt eine E-Mail der Stadtmarina ein, die uns überraschend für fünf Tage einen Liegeplatz im Hafen offeriert. Wir greifen sofort zu und erledigten ruckzuck das leidige Zylinderkopfdichtungsthema.
3. Rückblick – die Entscheidung
Irgendwann im Frühjahr 2011 …
Ich wollte jetzt endlich weg, Claudia wollte inzwischen gar nicht mehr weg.
Der mit Hilfe von Excel-Tabellen, Diskussionen, Streits, Trennungsdrohungen und von mir, wie ich hoffte, geschickt lancierten Farbreportagen über Sonne, Sand und Palmen, gefundene Kompromiss, lautete: Einmal um die Welt, in der kürzest möglichen Zeit.
Nach jahrzehntelangem Konsum der kompletten deutschsprachigen Fahrtenseglerliteratur entschied ich: kürzest möglich hieß: Zwei Jahre. Claudia biss die Zähne zusammen und nickte. Die Entscheidung war gefallen.
Als Vorbereitungszeit, also Einweihen meiner Mutter und der Lebensgefährtin von Claudias verstorbenem Vater, schließen unseres Geschäftes nach angemessen frühzeitiger Information unserer Kunden, finden von Mietern für unser Haus, die unseren Garten und unsere zwei Katzen Max und Luise betreuen sollten und dafür keine Miete zu zahlen brauchten, ausrüsten des zehn Jahre alten Fahrtenkatamarans, den wir einer Charteragentur in der Türkei abgekauft hatten, Grobplanung der Route, Ersteigern von gebrauchten Seekarten über Ebay, wöchentlichen Besuchen auf dem Gesundheitsamt, um sich von einer nicht sprechenden, kurz vor der Pensionierung stehenden, winzigen Amtsärztin unzählige Impfinjektionen in die Arme jagen zu lassen, einem halbjährigen Fernkurs zur Erlangung des Amateurfunkzeugnisses, hatte ich aus dem hohlen Bauch heraus anderthalb Jahre kalkuliert.
Größtes Problem in dieser unvollständigen Liste blieb bis zum Schluss: Mieter für unser kleines Häuschen finden. Eine Zeitungsannonce für Haus und Garten aufzugeben, mit dem Titel: Haus mietfrei zu bewohnen, entfiel aus naheliegenden Gründen. Deswegen suchten wir im Bekannten- und sehr stark erweiterten Bekanntenkreis. Schließlich lagen uns das Wohl von Max und Luise und der Zustand des Gartens, in den wir mehr Zeit und Geld, als in unser Haus gesteckt hatten, wirklich am Herzen. Anfänglich meldeten sich gleich mehrere Kandidaten. Leider litt einer unter starker Katzenallergie, der nächste hasste Gartenarbeit, ein junges Paar konnte die neu erstandene Einbauküche nicht unterbringen, und einer Berufspendlerin schien der Weg von acht Kilometern zur Autobahnauffahrt zu lang. Letztendlich blieb eine Freundin übrig, die sich von ihrem Mann getrennt hatte, Katzen ebenso wie Gartenarbeit liebte und unser 100-Quadratmeter-Häuschen super gerne gegen ihre 40-Quadratmeter-Mietwohnung tauschen wollte. Ein Jahr vor unserer Abreise zog sie um in ein anderes Haus, und wir strichen auch sie von unserer Liste.
Es reifte die Erkenntnis der Notwendigkeit, eine andere Lösung zu finden.
Max mit aufs Boot zu nehmen, würde ihn in tiefste Depressionen stürzen, warnte uns sein Hausarzt. Um Luise machten wir uns inzwischen weniger Gedanken. Drei Häuser weiter in unserer Straße hatte ein Rentnerpaar Gefallen an ihr gefunden und sie seit Monaten täglich mittels Trockenfutter in ihr Haus gelockt. Wir merkten es daran, dass ihr Fell stank, wie ein voller Kneipenaschenbecher. Außerdem zickte sie Max an, wenn der mal mit ihr schmusen wollte. Um ihn sorgten wir uns mehr. Obwohl leidenschaftlicher Freigänger, durchaus erfolgreich im Jagdgeschäft, suchte er jeden Abend, wenn wir von der Arbeit nach Hause kamen, das intensive Gespräch mit uns. Die Fernsehabende verbrachten wir ausschließlich gemeinsam. Brach für Claudia und mich die Schlafenszeit an, verabschiedete er sich zur Nachtschicht.
Beide Katzen bewohnten inzwischen ihre Einliegerwohnung im Keller mit separatem Eingang. Bei ihrem Einzug hatte ich für kalte Wintertage einen Zentralheizkörper montiert.
Nach all den frustrierenden Absagen verfolgten wir jetzt die Idee, einen tierlieben Nachbarn innerhalb des Revieres der Tiere zu finden, der zumindest Max adoptieren, sprich füttern würde. Ihren Raum bei uns im Keller sollten die Katzen weiterhin sozusagen als Zweitwohnung nutzen können.
Die Bevölkerung auf dem Land teilt sich traditionell in Katzenhasser und Katzenfreunde. Die Freunde besuchten wir in den folgenden Wochen nacheinander, erzählten von unseren Aussteigerplänen und baten um Asyl für Max; leider ohne Erfolg. Eine alleinstehende, ältere Frau hätte ihn sogar genommen, züchtete jedoch in ihrem Garten weiße Zwergkaninchen, die sie mir stolz präsentierte. Ein Drahtgitterdach schützte das mitten auf dem Rasen stehende Gehege gegen Angriffe von oben.
»Stelle si sich mo vor, eener von dene Wanderfalge«, sie deutete auf den roten Sandsteinfelsen hinter ihrem Haus, »hot sich nachts eens vun meene Karnickel gehol. Desswee muscht das Dach druff!«
Jetzt erinnerte ich mich wieder an den weißen, kugeligen Stummelschwanz, den uns Max zwei Wochen zuvor, Sonntagmorgens, als Trophäe seiner Nachtarbeit, unter Absingen des üblichen Triumphgeheuls, auf die oberste Stufe des Hauseinganges gelegt hatte.
Ich verfluchte solidarisch die blutrünstigen Wanderfalken und machte mich vom Acker.
Die Lösung unseres Asylproblems kam von gänzlich unerwarteter Seite.
Beate und Kurt, im Haus gegenüber, gehörten zur Katzenfreunde-Fraktion und vermieteten seit jeher an mindestens 2 Tiere. Leider hasste ihr Kater Moritz unseren Max abgrundtief, was in gelegentliche nächtliche, lautstarke Schlägereien und morgendliche Antibiotikagaben mündete. Bisswunden bei Katzen führen oft zu schlimmen Entzündungen.
Trotz dieser durch Moritz einseitig ausgesprochenen Kriegserklärung (unser Max liebte alle anderen Lebewesen, es sei denn, sie passten in sein Beuteschema) schaffte es unser Kater irgendwie immer wieder auf das steile Dach des zweigeschossigen Hauses, schlüpfte durch das meistens offen stehende Schlafzimmerfenster, um in Kurts und Beates Ehebett einen geruhsamen Nachmittag zu verpennen - wenn Moritz ihn nicht vorher erwischte.
Genau das passierte eines Tages. Vom Kampflärm alarmiert, stürmte Kurt in sein Schlafzimmer und verhinderte gerade noch rechtzeitig schlimmeres Blutvergießen. Max stand aufrecht mit dem Rücken zur Wand und erwartete Moritz Attacke.
Beate und Kurt erkannten unsere prekäre Situation und unterbreiteten uns eines Tages den Vorschlag, es trotzdem mit den beiden zu probieren. Trotz geringer Hoffnung, aber mangels Alternativen, stimmten wir zu und entwarfen eine Strategie, um den Konflikt auf diplomatischem Wege zu entschärfen und den Kriegsparteien ein, wenn schon nicht freundschaftliches, so doch gesichtswahrendes Miteinander zu ermöglichen. Ab sofort trugen wir morgens und abends unseren Kater ins Nachbarhaus, wo er fortan seine Mahlzeiten völlig gelassen einnahm. Moritz und Pinta erhielten während dieser Zeit Hausverbot.
Zwei Wochen später schöpften wir Hoffnung. Im Haus herrschte ein von Beate und Kurt überwachter Burgfriede. Max lümmelte sich sogar schon das ein oder andere Mal zum Fernsehgucken auf dem Sofa. Moritz ignorierte er einfach. Dem blieb keine Wahl, als sich dem neuen Diktat zu beugen.
Einen bezahlbaren Gärtner zu finden, baute sich als nächste Hürde vor uns auf. Garten-Service-Betriebe wucherten zwar inzwischen wie Unkraut auf dem BUND-Acker, aber in denjenigen, die unser Budget nicht sprengten, schnitten Ein-Euro-Jobber im Akkord mit der Kettensäge(!) die Rosen auf den Verkehrsinseln der Stadt. Für uns keine Option.
Wenige Wochen vor unserer Abreise fanden wir durch Empfehlung der Freunde von Freunden einen Ein-Mann-Betrieb aus unserem Nachbardorf. Wir luden ihn zum Probeschneiden unserer 100 Meter langen Eibenhecke ein. Er schaffte es in der vorgegebenen Zeit. Die Gewissensprüfung bestand er ebenfalls mit Bravour. Unsere für Dorfverhältnisse etwas individuellen Ansichten in puncto Gartengestaltung teilte er glücklicherweise.
Schwer erleichtert gaben wir ihm den Zuschlag und den Hoftorschlüssel. Leider ein Kardinalfehler, wie wir ein halbes Jahr später merkten, als wir wegen Problemen mit Mietern von Madeira aus 14 Tage nach Hause fliegen mussten. Der erste Probetag, den der neue Gartenprofi bei uns verbracht hatte, war gleichzeitig auch sein Letzter gewesen. Aus Gründen, die uns für immer verborgen bleiben sollten, ließ er sich nie mehr bei uns blicken. Auch hier entpuppte sich Kurt als Retter in der Not und erklärte sich bereit, wenigstens ab und zu mal den Rasen zu mähen und die Hecke zu schneiden.
Zwei befreundete Paare wollten während unserer Abwesenheit im Wochenwechsel unser Haus besuchen, um nach dem Rechten zu sehen. Geschäftspost reduzierten wir, indem wir jeden unserer Lieferanten persönlich anschrieben oder anriefen. Bei zweien funktionierte das trotz E-Mails, Briefen, Faxen und mal freundlichen, mal drohenden Anrufen nicht. Einen davon, die Messegesellschaft Frankfurt stoppten wir erst vor zwei Jahren durch Zuschrauben unseres Briefkastens vor unserem ehemaligen und jetzt anderweitig vermieteten Ladengeschäft. Den privaten Briefkasten an unserem Haus tapezierten wir mit dezidierten Anweisungen für die Post, alle Paketdienste, Austräger des Amtsblattes, der kostenlosen Wochenzeitungen und von Werbeprospekten.
Einfach »KEINE WERBUNG BITTE!« nützte hier gar nichts. Jeder wollte persönlich angesprochen werden.
Mit diesen Maßnahmen reduzierten wir den Papieranfall auf zehn ignorante Prozent, die Kurt regelmäßig im Altpapier entsorgte.
Für unser Ladenlokal fanden wir ein polnisch-deutsches Geschäftsmann-Duo, das seine bis dahin erfolgreich über eBay vertickerten Waren rund ums Kind, vom Schnuller bis zur High-End-Kinderwagenlimousine in unseren Schaufenstern präsentieren wollte. Da kinderlos, war das Thema Kinderwagen ziemlich an uns vorbeigezogen, und wir hörten staunend von den beiden Fachleuten, dass junge Eltern heutzutage ohne Skrupel eine Summe auf den Kassentresen blätterten, für deren Hälfte wir uns im Alter von 18 Jahren unseren ersten VW Käfer geleistet hatten. Die Käfer liefen immer noch, wenn wir sie nicht, wie damals allgemein üblich, nach dem letzten Dorfdiskothekenbesuch nachts aufs Dach gelegt hatten. Nächtliche Polizeipräsenz in der Hinterpfalz – damals Fehlanzeige.
Im Gegensatz dazu verloren nach anderthalb Jahren die sauteuren Säuglings-Mercedes ihre Daseinsberechtigung.
Für den Geldnachschub während unserer Reise war also durch die Mieteinnahmen gesorgt. So sorgfältig, wie es die von mir konsumierte Segler-Literatur zuließ, kalkulierten wir die auf uns zu kommenden monatlichen Kosten. Dass wir für unseren Lebensunterhalt wesentlich weniger ausgeben würden, erschien uns sicher. Versicherung und Steuer für 2 Autos, sämtliche Nebenkosten für das Haus (sehr geringe Heizkosten für überschlagene Temperaturen im Katzenzimmer ausgenommen) und vor allem die Krankenversicherung entfielen. Die Statuten von Claudias gesetzlicher und meiner privaten Versicherung sahen eine Weltumseglung nicht vor. Also schlossen wir für zwei Jahre eine Auslandslangzeitreisekrankenversicherung ab, die uns in den kommenden zwei Jahren runde 10.000 Euro Beiträge sparen sollte. Das durch die Versicherungsmathematiker errechnete Krankheitsrisiko von Fahrtenseglern lag offensichtlich so niedrig (Segler werden nicht krank, die saufen höchstens ab), dass wir den angesichts unserer früheren Beiträge lächerlichen Monatsbeitrag von weniger als 38 Euro pro Nase bezahlten – allerdings im Voraus – wohl wegen der Gefahr besagten Absaufens.
Marinas, also Häfen für Jachten, würden wir nur im Mittelmeer anlaufen müssen, danach nicht mehr. In der Karibik wird geankert, im Pazifik ebenso. Darüber, welche Eurosummen unser Schiff für Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Diesel für sich beanspruchen würde, herrschte große Unklarheit. Meine Bücher verdrängten das Thema kollektiv (oder taten das die Lektoren der Verlage?).
Da unser Häuschen im alteingesessenen Ortskern und in einer Sackgasse liegt, in die es kein Fremder ungesehen hineinschafft, und tritt er zu lange unschlüssig auf der Stelle, sofort nach dem Woher und Wohin und Wie heißen Sie eigentlich? gefragt wird, hatten wir beschlossen, es während unserer Abwesenheit leer stehen zu lassen. Alles auch ideell Wertvolle verteilten wir auf Freunde und Familie. Zur letzten Sicherheit, um potentielle Einbrecher abzuschrecken, die dann vielleicht aus lauter Frust, weil bei uns nichts zu holen war, unseren schönen Marcel Breuer-Couchtisch mit ihren Stoffwechselendprodukten krönten, kauften wir bei Aldi die gerade angebotenen, elektrischen, programmierbaren Rollladen-Gurtwickler, zehn Schaltuhren und Plastikorchideen, um Bewohntheit zu simulieren.
Die Menschen reagierten höchst unterschiedlich auf unsere Ankündigung. Eine Kundin nahm es uns persönlich übel und wollte uns so etwas wie einen gesellschaftlichen Auftrag, unsere Heimatgemeinde mit Designermöbeln zu versorgen, unterjubeln. Während der letzten Jahre hatten sich ihre Käufe auf Flaschenöffner und Mobiles beschränkt. Kaum senkten wir die Möbel zum Abverkauf im Preis, fuhr sie mit einem riesigen Pferdeanhänger vor und stopfte alles hinein, was ging.
Meistens fielen die Reaktionen jedoch positiv bis euphorisch aus. Schlummerte doch in so manchem Kopf der Traum einer Weltumseglung. Der Einzige, dem es langsam mulmig wurde, war ich selbst. Den Unterschied, in einem Buch, in dem vielleicht die ganz schlimmen Katastrophen der Zensur zum Opfer gefallen waren, zu lesen, oder sich wirklich, wahrhaftig darauf vorzubereiten, wochenlang diverse Ozeane, ohne Aussicht auf Hilfe, zu überqueren, diesen Unterschied erkannte ich natürlich erst jetzt, da ich mich entschlossen hatte, das zu tun, was ich jetzt tat, nämlich Claudias und mein Leben radikal und unumkehrbar neu auszurichten – und vielleicht vorzeitig zu beenden. Ich sollte den etwas bizarren Aspekt nicht unerwähnt lassen, dass meine maritimen Kenntnisse zur Zeit unserer Entscheidung lediglich die 40 Jahre zurückliegenden Erfahrungen als achtjähriger Knirps auf einer Luftmatratze in Jugoslawien beinhalteten. Daran änderte auch der Sportbootführerschein nichts, den ich auf einem kleinen, dieselmotorgetriebenen Seelenverkäufer auf dem Rhein bei Wiesbaden machte. Immerhin wusste ich jetzt, was die roten und grünen Tonnen zu bedeuten hatten, legte souverän am Steg des ADAC in Wiesbaden Biebrich an und überquerte angstfrei und staatlich legitimiert die Fahrrinne des Rheins an jeder mir genehmen Stelle.
Angstfrei zu bleiben fiel uns »Kapitänsanwärtern« während der Ausbildung nicht immer ganz leicht, angesichts des technischen Zustandes unseres schon mindestens einmal gesunkenen 6 Meter langen Schrotthaufens aus Stahl, der uns, mit einem Auto-Mercedes-Diesel heillos überladen und übermotorisiert, die Praxis einer guten, deutschen Seemannschaft vermitteln sollte. Rost im Dieseltank fand seinen Weg immer wieder in den Filter des Motors, der sofort abstarb, vorzugsweise dann, wenn wir gerade mitten im schnell fließenden Fahrwasser ein Manöver fuhren. Während unser erfahrener Lehrer bis zur Achsel im Dieseltank nach dem verstopften Filter angelte, beobachteten wir derweil auf unserem mit 6 Knoten rheinabwärts treibenden, manövrierunfähigen (dafür gäbe es dann ein Flaggensignal, wie wir lernten) Wrack die entgegenkommenden Frachtschiffe. Albert (Name aus Angst geändert) schaffte es immer wieder, kurz bevor wir über Bord springen wollten, den Mercedesdiesel zu starten. Gerne begrüßte er uns morgens um zehn mit: »Wer will ein Bier?!«, da er ungern alleine trank.
Mit dem Sportbootführerschein in der Tasche sollte es dann aber auch gut sein, fand ich. Schließlich stand selbst Bobby Schenk, das große Vorbild der deutschen Weltumsegler-Anwärter-Szene, Segelscheinen eher skeptisch gegenüber. Stattdessen entwickelte ich die geniale Idee, das Weltumsegler-Handwerk während einer Weltumseglung zu lernen. Authentischer ging’s schließlich nicht.
Nachdem wir uns vor Mallorca eine Woche in dem baugleichen Katamaran, den wir favorisierten, hatten rumschippern lassen, kauften wir bei einer Charteragentur in der Türkei die 10 Jahre alte, damit für den Charterbetrieb zu alte, VEGA. Dem Vorbesitzer nötigte ich – ziemlich clever, wie ich fand – einen zweistündigen Einführungskurs in die verwirrende Vielfalt der Seile, Winschen, Klemmen und Segel ab.
Im Frühjahr 2012 flog ich alleine - Claudia lag mit schlimmer Bronchitis im Bett - nach Marmaris, um unser neues Schiff offiziell zu übernehmen.